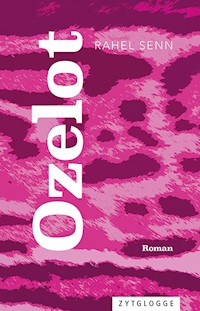
23,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 1958. Victoria ist elf Jahre alt und verbringt viele Nachmittage im Zürcher Frauensekretariat, für das ihre Mutter arbeitet. So erlebt sie, wie sich Frauen in der Schweiz zu Verbänden zusammenschliessen, um sich gegen die fehlenden Rechte der Frau einzusetzen. Zum ersten Mal hört sie den Namen Iris von Roten.Der «Bund Schweizerischer Frauenvereine» baut auf Konsens – die Basler Juristin und Journalistin auf Konfrontation. Am 1. Februar 1959 soll eine erste Abstimmung zum Frauenstimmrecht auf Bundesebene stattfi nden. Kurz davor veröffentlicht Iris von Roten ein ebenso provokantes wie radikales Manifest mit dem Titel «Frauen im Laufgitter» und macht sich damit zur meistgehassten Person der Schweiz. Man gibt ihr die Schuld an der verlorenen Abstimmung von 1959.Immer wieder wird sich Victorias Leben fortan mit dem ihres grossen und geheimnisvollen Vorbilds verweben. Als 21-Jährige schliesst sie sich mit anderen Studentinnen zur Frauenbefreiungsbewegung (FBB) zusammen. Die 68er-Generation setzt – wie Iris von Roten – auf Konfrontation. Das Stimmrecht wird zum Teil eines grossen Freiheitskampfes: der Revolution der Frau.Bei der Abstimmung vom 7. Februar 1971 wird das Frauenstimmrecht mit 621 109 Ja- zu 323 882 Nein-Stimmen angenommen. Autorin und Verlag danken für die grosszügige Unterstützung:walter haefner stiftung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Titel
Vorwort
Motto
Prolog
TEIL I 1955–1959
Teil I
Historische Notiz I
Teil II 1967–1991
Teil II
Historische Notiz II
Dank
Quellen
Über das Buch
Rahel Senn
Ozelot
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2021–2024 unterstützt.
© 2021 Zytglogge Verlag, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Alle Rechte vorbehaltenLektorat: Thomas GierlUmschlaggestaltung: Kathrin Strohschnieder
Dies ist ein Roman. Er orientiert sich an den Eckdaten des Lebens von Iris von Roten, ist aber in den Szenen und Gesprächen, in denen Iris von Roten und ihr privates Umfeld vorkommen, von der Autorin im Rahmen der Spielhandlung frei und fiktional gestaltet.
Für nichtfiktionale biografische Informationen über Iris und Peter von Roten weisen wir auf folgende Publikationen hin, denen die Autorin wertvolle Anregungen für die Ausarbeitung ihrer Romanfiguren verdankt:– Wilfried Meichtry: Verliebte Feinde. Iris und Peter von Roten. Nagel & Kimche, 2012.– Eleonora Bonacossa: Der weibliche Sinn in der Welt: Iris von Roten. Ulrike Helmer Verlag, 2003.– Yvonne-Denise Köchli: Eine Frau kommt zu früh. Weltwoche-ABC-Verlag, 1992.
Für Leon, ohne dich ich nicht wäre. Für Sibylla,
Rahel Senn
Ozelot
Mit einem Vorwort von Ruth Metzler-Arnold
Roman
Vorwort
Iris von Roten-Meyer, geboren 1917 in Basel, war eine Schweizer Juristin, Journalistin und Frauenrechtlerin. Sie studierte als eine von wenigen Frauen der damaligen Zeit Jurisprudenz und promovierte auch. Zusammen mit ihrem Ehemann Peter von Roten führte sie eine Anwaltskanzlei. Mich beeindruckt, dass sie schon damals die volle wirtschaftliche Unabhängigkeit für Frauen forderte, damit diese auch wirklich frei über ihr Leben bestimmen können. Eine Forderung, die uns heute immer noch beschäftigt, und für die ich mich engagiere.
Iris von Roten starb 1990 – zumindest hatte sie noch die Einführung des neuen Eherechtes erlebt, welches von rechtsbürgerlicher Seite stark bekämpft wurde. Der Grundsatz der Gleichstellung in der Ehe ist erst seit 1988 in unserer Gesetzgebung verankert.
In den Diskussionen betreffend 50 Jahre Frauenstimmrecht ging es meistens darum, dass Frauen abstimmen und wählen dürfen. Ich habe jedoch die hohe Bedeutung vermisst, welche dem passiven Wahlrecht zukommt – dem Recht, dass Frauen auch wählbar sind. Und ich habe bedauert, dass die Einführung des neuen Eherechtes 1988 nicht stärker thematisiert wurde. Ich war Mitte der 80er-Jahre an der Uni und war damals konsterniert, mit welchen Argumenten die Gegner die Gleichstellung in der Ehe bekämpft hatten.
Seit der Einführung des Frauenstimmrechts auf Bundesebene und dem neuen Eherecht hat sich sehr viel getan. Dank mutigen Frauen, die den Schritt aufs politische Parkett gewagt hatten, ist es heute eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen mitbestimmen und selber an die Schalthebel der Macht wollen, um sich für die Menschen in unserem Land zu engagieren. Sie können ihre Erfahrungen bei den verschiedensten Themen einbringen und ihre Ideen umsetzen. Endlich ist es auch selbstverständlich, dass Frauen ebenso vielfältig und unterschiedlich politisieren wie die Männer. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass möglichst viele Frauen in der Politik vertreten sind.
Die Autorin Rahel Senn schildert in ihrem Roman den Kampf der Frauen um Gleichberechtigung. Die Geschichte um «Ozelot» nimmt ihren Anfang in den späten Fünfzigerjahren. Die Leserinnen und Leser begleiten die Protagonistin, welche den Namen «Iris von Roten» trägt, und erhalten durch die Augen eines elfjährigen Mädchens – Victoria – Einblicke in einen Teil unserer Geschichte in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Beim vorliegenden Buch handelt es sich jedoch weder um Geschichtsschreibung noch um eine Biografie, sondern um eine fiktionale Darstellung der sozialen und politischen Verhältnisse in den späten Fünfzigerjahren.
Ruth Metzler-Arnold
Hier ist das Buch ...über ein Buch:«Frauen im Laufgitter». Hier ist das Buch ...über einen Kampf.Schier unglaublich ist,dass Frauen in der Schweizbis vor fünfzig Jahren nicht abstimmen und wählen durften.
Hier ist das Buch ...von Heldinnen und Helden.
Prolog
Wir trugen den Ozelot mit Stolz. Mit Stolz, eine Frau zu sein.
Als wir vom Bundesplatz in Richtung Bahnhof eilten, waren die Trillerpfeifen längst verstummt. Die Trams standen seit Stunden still. An diesem 1. März 1969 waren wir drei von fünftausend pfeifenden und lärmenden Frauen, die sich vor dem Bundeshaus versammelt hatten, um für ihr Recht einzustehen. Wir hatten uns von denjenigen Studentinnen verabschiedet, die eine Übernachtungsmöglichkeit bei Freunden oder Verwandten in der Bundeshauptstadt gefunden hatten. Es gab auch einige, die sich während der Demonstration einen Studenten angelacht hatten und für ein erotisches Abenteuer in Bern blieben. Die, die während des Nachmittages auf den Straßen gesessen und die Tramschienen blockiert hatten, waren verschwunden.
«Beeilt euch! Der Zug fährt in zwanzig Minuten!» Miriam streckte das Banner in die Luft. «Stimmrecht für die Schweizer Frauen!» Ihr Ausruf hallte von den Wänden wider. Verärgerte Menschen schielten durch halb geöffnete Fenster. Wir lachten. Die Nacht gehörte uns. Wir – das waren Miriam, Ruth und ich. Wir waren drei Freundinnen aus Zürich und nannten uns Ozelot. Warum Ozelot? Ich muss von vorne anfangen, mit einer Frau, die den Mut hatte, einen Ozelot zu tragen, als alle noch Schiss hatten: Iris von Roten.
Die pure Lebenslust machte mich feministisch. Alles, was das Herz begehrte: wilde Abenteuer, lockende Fernen, tolle Kraftproben, Unabhängigkeit, Freiheit – das schäumende Leben schlechthin – schien in Tat, Wort und Schrift den Männern vorbehalten zu sein.
Iris von Roten (1917–1990)
Woher kam sie?
Wer war sie?
Wohin ging sie?
Immer wieder kam und verschwand sie.
TEIL I1955–1959
Am 6. Dezember 1955, kurz nach zwei Uhr nachts, wurde in Zürich eine Frau verhaftet, die behauptete, aus Basel zu kommen und Anwältin zu sein. Sie trug eine grüne Cordhose und einen Ozelotmantel, dazu roten Lippenstift, aber keinen Hut. Ihre Handtasche hing von der linken Schulter herunter. Auffällig war, dass sie weder Eile noch Angst hatte. Den Blick hatte sie auch nicht gesenkt. Wie war so etwas möglich? Eine Frau mitten in der Nacht ganz allein? Für die zwei patrouillierenden Polizisten war klar: «E Trottoiramsle.»
Man ging auf sie zu und stellte sich ihr in den Weg: «Ahalte!» Woher sie komme, wollte man wissen, wer sie sei und wohin sie gehe. Woher sie sich das Recht nähmen, ihr solche Fragen zu stellen, entgegnete die Angesprochene. Auf die Forderung nach ihrem Ausweis reagierte sie kühl: «Wieso? Ich bin nicht verpflichtet, einen Ausweis mit mir zu führen. Übrigens habe ich keinen bei mir.»
Die Beamten fühlten sich durch ein solches Verhalten – und dies noch von einer Frau – provoziert. Ob sie das Gefühl habe, in diesem Staat tun und lassen zu können, was ihr beliebe. «Wie heißen Sie? Wo wohnen Sie?»
Um die Sache kurz zu machen, gab die Frau Namen und Adresse an:
Iris von Roten
Oberer Heuberg 12
Basel
Als sie weitergehen wollte, wurde ihr abermals der Weg versperrt. «Halt!» Man wolle noch allerlei von ihr wissen. Wohin sie gehe, zum Beispiel, in welches Hotel.
«In keines.»
«Sie werden wohl irgendwo übernachten, also wo?»
«Wie kommen Sie dazu, mich zu fragen, wo ich übernachten werde? Übrigens steht es mir frei, überhaupt nicht zu übernachten, immer zu gehen, beispielsweise bis nach Ziegelbrücke.»
«Von wo kommen Sie überhaupt?»
«Von Basel.»
«Aha, vielleicht sucht man Sie in Basel. Sind Sie heute von Basel gekommen?»
«Ja.»
«Wann?»
«Soeben.»
«Um diese Zeit kommen gar keine Züge an.»
«Polizisten, die im Umkreis des Bahnhofs patrouillieren, sollten die Ankunftszeiten der letzten Züge kennen.»
«Nein, das brauchen wir nicht zu wissen. Haben Sie ein Billett? Zeigen Sie es!»
Die Frau zeigte ihr Billett, doch selbst dieser exakte Nachweis genügte nicht.
«Sagen Sie jetzt, wohin Sie gehen.»
«Nein! Sie haben kein Recht, das zu wissen.»
«Dann nehmen wir Sie auf den Polizeiposten.»
«Das ist geradezu absurd.»
«Soso, vielleicht, Fräulein, sagen Sie uns, was Sie von Beruf sind.»
Als sie sagte, dass sie Journalistin und Anwalt sei, brachen die uniformierten Beamten in lautes Gelächter aus. «Man wird es dann auf dem Polizeiposten schon sehen, ob Sie Journalistin und Anwalt sind. Kommen Sie!» Worauf die aufmüpfige Frau in den schwarzen Dienstwagen verfrachtet wurde. «Es ist unsere Pflicht, Sie zum Schutze der Öffentlichkeit auf den Polizeiposten zu bringen; Sie sind eine Gefahr für die Öffentlichkeit, Sie haben provoziert.»
Nach einem Anruf an die Basler Kollegen war klar: Die Festgenommene hieß Iris von Roten und war tatsächlich Anwalt, verheiratet mit dem ehemaligen Nationalrat Peter von Roten – ebenfalls Anwalt und Inhaber diverser politischer Ämter im Kanton Wallis –, Mutter einer zweijährigen Tochter und nebenberuflich Journalistin.
Nun, da man wisse, wer sie sei, stelle sich allerdings die Frage, wer sich um ihr Kind kümmere, während sie hier so frei herumspaziere. «Hat Ihr Mann diesem nächtlichen Ausflug überhaupt zugestimmt?»
Die Frau, die sich weigerte, auch nur eine einzige dieser Fragen zu beantworten, wurde geradezu jähzornig. Was ihnen eigentlich einfalle, ihr solch private Fragen zu stellen. Eine Beamtenuniform mache sie noch lange nicht zu besseren Menschen. Einen solchen Ton anzuschlagen hatte noch niemand gewagt.
Obwohl Iris nicht einverstanden war, rief ein Polizist um 2.45 Uhr am Heuberg an, um sich von der Hausangestellten bestätigen zu lassen, dass Frau von Roten nach Zürich gefahren sei. Die Angerufene verriet außerdem, dass Iris’ Schlaflosigkeit der Grund sei, warum sie mitten in der Nacht Zugreisen nach Zürich unternehme. Ihre Hausherrin erhoffe sich Aufschluss über die Ursachen ihres Leidens durch nächtliche Gespräche mit einer befreundeten Psychoanalytikerin, deren Namen sie auch gleich angab: Anna Huggler-Guggenbühl.
In den frühen Morgenstunden wurde die Festgenommene aus der Untersuchungshaft entlassen. Im polizeilichen Rechtfertigungsbericht stand, dass Benehmen und Aufmachung der verhafteten Person auffällig gewesen seien. Die Vermutung habe nahe gelegen, sie wäre aus einer Heilanstalt entwichen. Was für eine Frechheit! Stehen die öffentlichen Verkehrswege nachts den Frauen weniger voraussetzungslos offen als den Männern?
Zwölf Tage später schrieb Iris einen vierzehnseitigen Beschwerdebrief an den Polizeivorstand. In dem schockierenden Erlebnis mit den Beamten sah die Feministin nämlich auch die Möglichkeit, Grundsatzfragen über die Ungleichbehandlung der Geschlechter in ihrem Land aufzuwerfen. Und da fragt man noch, für was die Schweizerinnen das Stimmrecht brauchen. Es gab ja so viele Frauenvereine, die schon seit über fünfzig Jahren Gleichberechtigung von Mann und Frau forderten und nie auf einen grünen Zweig kamen. Eine Schweizer Frau war von Gesetzes wegen ihrem Vater, Ehemann oder Bruder unterstellt. Insofern war sie politisch etwa gleichberechtigt wie ihre Kinder, Katzen oder Hunde. Wie war so etwas möglich in einer über hundertjährigen Demokratie? Iris musste erfahren, dass Frauen in diesem Land zwar studieren durften, aber mit ihren Universitätsabschlüssen kaum Berufschancen hatten. Die interessanten Posten waren Männern vorbehalten. Jahrelange Berufserfahrung nützte einer Frau ebenso wenig wie gute Referenzen. Als Teilzeit-Redaktorin bei einigen Zeitungen und Magazinen lebte sie mit dem ständigen Frust darüber, dass die Entscheidung immer bei den – ja, männlichen – Chefredaktoren lag, ob und wie ein Artikel publiziert wurde. In anderen Berufsfeldern sah es nicht anders aus. Die wenigen Frauen, die ihr Leben nicht der Mutterschaft und dem Haushalt widmeten, waren den Männern in jeder Hinsicht untergeben. Vielleicht lag es an der Tatsache, dass niemand den Mut hatte, die Wahrheit auszusprechen.
Obwohl die von den Medien als Panthermantel-Affäre bezeichnete Verhaftung einer nächtlichen Spaziergängerin auf großes öffentliches Interesse stieß, musste Iris die Hoffnung schon bald aufgeben, dass dadurch eine öffentliche Debatte über die gesellschaftliche und politische Stellung der Frau entfacht würde. Wenn sie etwas ändern wollte – so viel war klar –, musste sie die Sache selbst in die Hand nehmen. Die stärkste Waffe war die der Schrift, und diese lag in ihrer Hand.
*
Zum ersten Mal bin ich ihr in Basel begegnet. Das heißt: Die richtige Person war es nicht, aber ein Abbild von ihr. Hunderte Abbilder. Zu diesem Zeitpunkt war Iris von Roten ein berühmter Mensch. So berühmt, dass sie der Kopf der Basler Fasnacht wurde. Wenige Wochen zuvor, im Frühjahr 1959, hatte die erste Eidgenössische Abstimmung zum Frauenstimm- und Wahlrecht stattgefunden. Die Vorlage war vom Stimmvolk abgelehnt worden. Warum eine so ernst zu nehmende Person wie Iris von Roten zu einer Fasnachtsfigur wurde? Um das zu verstehen, muss man verstehen, in was für einer Zeit wir lebten. Die Schweiz vor sechzig Jahren – das war ein Moloch von ...
Was haben uns unsere Eltern gelehrt?
Die Frau gehört an den häuslichen Herd.
Der Mann ists, der die Frau ernährt.
*
«Iris! Iris!» Peters Stimme hallte von den Wänden wider. Natürlich würde er sie arbeitend in ihrem Büro antreffen. Er eilte die Treppe hinauf. Das Arbeitszimmer seiner Frau lag in der obersten Etage eines vierstöckigen Wohnhauses inmitten der Basler Altstadt. Während sich im Erdgeschoss Büros befanden, hatte sich das Paar in den oberen drei Etagen zum Wohnen eingemietet.
«Was ist los, Peter, du kriegst ja kaum Luft.»
«Was los ist – ha!» Er wedelte mit der Post in der Luft. «Du wirst es nicht glauben, wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst.»
«Ist etwas für mich dabei?» Iris’ Herz klopfte. Das frühere Leben konnte einen ganz unerwartet einholen.
«Ob etwas für dich dabei ist?» Peter streckte ein graues Couvert in die Luft.
Sie erkannte es sofort. «Dein Stimmcouvert?»
Er schüttelte den Kopf und zog ein weiteres Stimmcouvert hervor. «Meines ist das hier.»
Zwei Stimmcouverts in einem Haushalt? Hatte der Briefträger fälschlicherweise das Stimmcouvert des Nachbarn in ihren Briefkasten geworfen? Das wäre ja geradezu fahrlässig ...
«Lies doch!», drängte Peter und zeigte auf den Brief.
Herr Doktor Iris von RotenOberer Heuberg 12Basel
Beide prusteten los. «Das ist ja unglaublich!» Dann wurde Peter ernst. «Ich finde, wir sollten zusammen ins Stimmlokal fahren, du solltest die Frauen und Hunde anlächeln, die draußen vor dem Haus warten, wir sollten zusammen hineingehen, du solltest deinen Stimmzettel in die Urne werfen, und wir sollten darauf anstoßen, dass du als erste Schweizer Frau abgestimmt hast.» – «Nein!», erwiderte Iris schnell. Eine Frau im Stimmlokal ... «Das wäre ein Skandal!»
Für den leeren Skandal war sie nicht zu haben, nicht sie. Nicht Frau Doktor Iris von Roten.
Woher kam sie?
Wer war sie?
Wohin ging sie?
Immer wieder kam und verschwand sie.
*
Ich besuchte die sechste Klasse in Hottingen und verbrachte die meisten Mittwochnachmittage im Zürcher Frauensekretariat. Natürlich nicht freiwillig, denn welches elfjährige Mädchen verbringt seine Zeit gerne mit Warten? Das Sekretariat, für das meine Mutter arbeitete, war kein gewöhnliches Sekretariat, sondern eines nur für Frauen. Es gehörte dem Bund Schweizerischer Frauenvereine an. Dieser war im Jahr 1900 von der Berner Patriziertochter Helene von Mülinen gegründet worden und vereinigte fast alle Frauenvereine des Landes. Nur die großen Verbände, die sich selbst als Dachorganisation sahen, oder jene, die aus religiösen Gründen unabhängig bleiben wollten, hielten an ihrer Eigenständigkeit fest. Helene von Mülinen hätte gerne an einer Universität studiert, aber von einer Tochter erwartete man anderes. So gehörte sie zu den ersten, die sich gegen die Ungleichbehandlung der Geschlechter auflehnten. Um die Sache gemeinsam anzugehen, gründete sie eben den Bund Schweizerischer Frauenvereine, kurz BSF. Ich saß im Wartezimmer und schlug die Zeit mit Hausaufgaben und Mimi tot. Mimi – das war mein Tagebuch.
Liebe Mimi, immer, wenn ich ein Geräusch aus dem Treppenhaus höre, denke ich, es sei Mama. Wenn ich zur Tür schaue, bleibt sie zu. Warten ist schlimm. Mama sagt, ich solle die Zeit sinnvoll nützen. Es wäre wichtig, dass ich in der Schule gute Noten schreibe.
Ihre Arbeit nahm kein Ende. Zuerst sagte Mama, es gehe ums Frauenstimm- und Wahlrecht, doch dann kamen immer mehr Dinge dazu. Am Schluss war sogar die Bundesverfassung das Problem. «Die erste Bundesverfassung», erklärte sie, «wurde vor hundertzehn Jahren – also im Jahr 1848 – besiegelt. Denn: Ohne Verfassung – kein Gesetz. Und: Ohne Gesetz – keine Demokratie.»
Sechsundzwanzig Jahre nach ihrer Besiegelung, also im Jahr 1874, wurde sie totalrevidiert.
R-E-V-I-S-I-O-N
Eine Sache wird neu bestimmt.
«Wenn eine Abteilung der Bundesversammlung die Revision beschließt und die andere nicht zustimmt, oder wenn fünfzigtausend stimmberechtigte Schweizerbürger die Revision der Bundesverfassung verlangen, so muss im einen wie im andern Fall die Frage, ob eine Revision stattfinden soll oder nicht, dem Schweizerischen Volk zur Abstimmung vorgelegt werden.» Die Frauen im Sekretariat wussten alles. «Nach Artikel 112 geschieht die Revision auf dem Wege der Bundesgesetzgebung. Die revidierte Bundesverfassung tritt in Kraft, wenn sie von der Mehrheit der stimmenden Schweizerbürger und von der Mehrheit der Kantone angenommen wird.»
Mit «Schweizerbürger» wären sowohl Frauen als auch Männer gemeint. Aber in unserem Land dürfen nur die Männer abstimmen. Das ist ein Fehler oder ...
«Eine Falschinterpretation!» Fräulein Cartier war für die Briefe zuständig. Sie war auch die Chefin des Sekretariats. «Eine Demokratie», sagte sie, «ist keine Demokratie, wenn die Hälfte ihrer Bürger nichts zu sagen hat.» In Artikel 74 stand, dass jeder Schweizer, der das 20. Altersjahr vollendet hatte, stimmberechtigt war. «In Artikel 4 steht, dass alle Schweizer vor dem Gesetz gleich sind.»
Es gibt in der Schweiz keine Untertanenverhältnisse, keine Vorrechte des Orts, der Geburt, der Familien oder Personen. In der Wirklichkeit ist es eher so: Es gibt in der Schweiz ein Untertanenverhältnis – nämlich das der Frau – und ein Vorrecht – jenes des Mannes. Das französische Wort «homme» hat zwei Bedeutungen: «Mann» und «Mensch».
Alles, was ich lernte, teilte ich mit Mimi.
GENERISCHES MASKULINUM
Schon vor fünfzig Jahren, als Frauen an der Universität studieren und Juristinnen werden konnten, begann der Kampf um Rechtsgleichheit zwischen Frau und Mann. Auf dem juristischen Weg hatten es schon andere versucht. Emilie Kempin-Spyri zum Beispiel, die im Juli 1887 als erste Frau Europas zur Doktorin der Rechte promoviert worden war. Da die Zürcherin kein Wahlrecht besaß, konnte sie kein Anwaltspatent erwerben. Was nützte ihr der Doktortitel in diesem Fall? Emilie Kempin-Spyri sah das Problem im vierten Artikel der Bundesverfassung. Mit «Schweizer» wären sowohl Männer als auch Frauen gemeint. Sie forderte eine Neubewertung des Artikels und scheiterte schließlich vor Bundesgericht.
«Uns bleibt nur noch der Weg über den Souverän.»
Mimi gab zwar nie eine Antwort, aber ihr Dasein tröstete mich.
Wenn ich eine gute Schülerin bin, werde ich nach der sechsten Klasse die «Höhere Töchterschule Hohe Promenade» beim Bahnhof Stadelhofen besuchen. Später darf ich an einer Universität studieren. Das Gehirn der Frau ist kleiner als jenes des Mannes. Manchmal stelle ich mir vor, mein Gehirn wäre so winzig wie eine Erbse.
Von meinem Platz aus konnte ich das Bücherregal sehen. Wenn ich Glück hätte, legte jemand ein neues Buch hinein. Das Bücherregal war aber nicht das Einzige, von dem ich mich ablenken ließ. Auch das Schneckenbild war interessant. Warum hängte jemand ein Bild von einer Schnecke ins Wartezimmer? Ich schob einen Stuhl zur Seite. Die Schnecke war so groß, dass sie von einem Dutzend Frauen gezogen werden musste. Keine echte, selbstkriechende Schnecke, nein. Warum war eine große, falsche Schnecke so wichtig? Ich kniff die Augen zusammen und las:
LA MARCHE DU SUFF...
Der Satz war auf Französisch. Mit einem Stuhl könnte ich ... «Victoria!» Meine Mutter kam gar nicht. Mit elf weiß man aber selbst, was erlaubt ist und was nicht. Ich schob den Stuhl zurück und setzte mich wieder auf den Boden. Nur durch Besuch wurde meine Langeweile unterbrochen.
Frau d’Agostini zum Beispiel, die mit ihren Kindern und ohne Mann in einem Dorf am Zürichsee wohnte. Wenn sie keinen Italiener geheiratet hätte, wäre Frau d’Agostini eine Schweizerin. Ihre Kinder auch. Heiratsstrafe nannte sich das. Während die meisten Länder um uns herum diese Regel vor mehr als dreißig Jahren abgeschafft hatten, wurde sie in unserem Land sogar noch verschärft. «Im Jahr 1941 – kurz nach Kriegsausbruch – erließ der Bundesrat ein Notgesetz, wonach eine Schweizerin, die einen Ausländer heiratet, ihr Bürgerrecht verliert», erklärte Mama. Für die Sicherheit der Schweiz seien solche Maßnahmen eben wichtig gewesen.
Nun, da der Krieg vorbei und ihr Mann für immer nach Italien zurückgereist war, wollte Frau d’Agostini, dass sie und ihre Kinder wieder Schweizer würden. So einfach sei das nicht, hatte man ihr mitgeteilt. Da sie ja jetzt Italienerin sei, müssten sich die Italiener darum kümmern. Das war aber nicht das Problem. Herr Grob, der in der untersten Wohnung ihres Wohnhauses lebte, hatte nämlich auch eine Italienerin geheiratet. Bei denen waren jetzt alle Schweizer, auch die Kinder. Schließlich galt die Heiratsstrafe nur für Frauen. Eine Frechheit sei das, schimpfte Frau d’Agostini. Bevor sie von Mama hereingebeten wurde, saß sie auf dem Stuhl unter der Schnecke und schaute mir beim Tagebuchschreiben zu.
Mein Blick fiel zuerst auf die Fremde und dann auf das Bild. Suff... Eine Fliege surrte vorbei und landete auf dem linken Auge der Schnecke. War es überhaupt ein Auge? Vier Augen? Zwei winzige Punkte befanden sich am Ende der langen Stiele, die sich aus dem Schneckenkopf gen Himmel reckten. Die anderen beiden Stiele waren vielleicht Ohren. Oder Fühler. Wie beim Schmetterling. Hatten alle Tiere Fühler statt Ohren? Ich stand auf. «Können Sie mir das einmal vorlesen?»
«Natürlich. Da steht DIE FORTSCHRITTE DES FRAUENSTIMMRECHTS IN DER SCHWEIZ.»
«Und auf Fr...?» Mama kam immer im falschen Moment. Für den Rest des Nachmittags saß ich wieder auf dem Boden und langweilte mich. LA MARCHE DU SUFF...
SUFF...
S...
Das Wort war zu schwierig. Neben dem Schneckenbild gab es ein zweites Bild von einer Blume. War es eine Blume? Wenn ich den Kopf zur Seite neigte schon. Keine echte Blume – ein grauer Kreis und zwei graue Striche. Oder ein o und ein t. L-A-B-E-L, stand darunter. Der Rest war zu klein zum Entziffern. Als Fräulein Kuhn hereinkam, nutzte ich die Gelegenheit: «Können Sie mir das vorlesen?»
«Label ist das Zeichen recht entlöhnter Arbeit. Das Label-Zeichen bietet der Frau die Möglichkeit, auch als Käuferin für die Sache des sozialen Fortschritts zu wirken. Der Bund Schweizerischer Frauenvereine ist Mitglied der Konsumenten-Sektion der Schweizerischen Label-Organisation.»
«Was für Enten?»
Fräulein Kuhn lachte und erklärte, dass Konsumenten keine Tiere, sondern Menschen wären. «Die Konsumgesellschaft zwingt die Frau an den ...»
Was haben uns unsere Eltern gelehrt?
Als ich nachhaken wollte, entschuldigte sie sich. Sie war nur gekommen, um die Zeitung zu holen. Fräulein Kuhn arbeitete nämlich gar nicht fürs Sekretariat. Sie und ein paar Freundinnen vom Akademikerinnen-Verein waren Mitglieder einer neu gegründeten Kommission – der Saffa-Kommission. Ihre Sitzung fand nur einmal im Monat statt. Ich hörte Gelächter aus dem Nebenraum und stellte mir vor, ich hätte eines Tages meinen eigenen Verein und würde wichtige Traktanden behandeln.
Schritte auf der Treppe. Vom Fenster aus konnte ich Frau d’Agostinis roten Hut erkennen. So viele Frauen im Sitzungszimmer! Ich kletterte auf einen Stuhl und drückte mein Ohr gegen die Wand. Zwischen dem Schneckenbild und dem Fenster gab es eine Stelle, die sich besonders gut eignete. Aus den Gesprächen schloss ich, dass es sich bei der Saffa um eine Ausstellung handelte. Wieder die Fliege. Jetzt landete sie auf meiner Tasche. Zwei Fliegen. Ich sprang vom Stuhl herunter. Die Sitzung dauerte länger als gewöhnlich. Für die Saffa hätten sich alle Frauenvereine des Landes zusammengetan. Ob meine Mutter auch in der Saffa-Kommission saß? Lautlos verließ ich das Wartezimmer und schlich mich durch den Flur. Durch den Türspalt konnte ich nur ihre Hände erkennen – Mamas wundervolle, flinke Hände auf der Tastatur der Schreibmaschine. Wenn ich groß wäre, wäre auch ich eine Sekretärin – eine Frauensekretärin.
«Victoria?» Es dauerte nicht lange, bis sie meine Anwesenheit bemerkte. «Bist du fertig mit den Hausaufgaben?»
«Ja.»
«Komm rein.» Der Briefstapel reichte bis zum oberen Rand des Postfachs. Wenn ich Glück hätte, ließe sie mich ...
Geschäftsstelle Bund Schweizerischer Frauenvereine
Schweizerisches Frauensekretariat
Merkurstraße 45
Zürich 7/32
Die Adresse kannte ich in- und auswendig. Kalt und schwer fühlten sich die Tasten der Schreibmaschine unter meinen Fingern an.
Bundesrat Th. Holenstein
Bundeshaus
Bundesplatz 3
Bern
Mama überließ mir sogar ihren Stuhl. Sie war anders als die meisten Mütter, die nicht arbeiteten. Ihr Gehirn war größer als eine Erbse. Sie war genauso intelligent wie ein Mann und hatte einen richtigen Beruf, mit dem sie Geld verdiente. In der Schule glaubte niemand, dass meine Mutter Briefe an Bundesräte schrieb.
Sehr geehrter Herr Bundesrat HolensteinIm Namen der Schweizerischen Frauenverbände, des Schweizerischen Frauenstimmrechts-Verbandes, des Akademikerinnen-Vereins sowie des Christlichen Frauenvereins wenden wir uns mit dem Ausdruck tiefster Dankbarkeit an Sie. Das von Bund und Kanton bewilligte Projekt trägt den Namen SAFFA (Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit). In unserem Organisations-Komitee sitzen Mitglieder aus sämtlichen nationalen Frauenvereinen. Die im Sommer bis Herbst dieses Jahres stattfindende Ausstellung soll eine Plattform bieten, um die Konkordanz zwischen den Geschlechtern – beziehungsweise das harmonische Zusammenleben von Mann und Frau – darzustellen. Im Hinblick auf das erwartete nationale Medienecho und als Zeichen der Relevanz unserer Arbeit erachten wir die Eröffnung durch einen Bundesrat als sinnvoll. Würden Sie sich zur Verfügung stellen?
«Beeil dich, Victoria!» Sobald die Sitzung beendet war, ging alles ganz schnell. Mit einem Briefstapel erwartete mich meine Mutter bei der Treppe. «Wir haben noch zwanzig Minuten!»
Ich schnappte meine Schultasche und folgte ihr. Als ich fragen wollte, warum Bundesräte Bundesräte waren, zog sie mich zum Ausgang.
«Pass auf, Victoria!» Bei der Kreuzung musste man sich beeilen. Es gäbe zwar einen Fußgängerstreifen, aber viel weiter vorne. Die Post wäre dann schon zu, und unsere Briefe kämen zu spät an.
«Warte, Mama!»
Im Tram hatte sie Zeit. «Wenn du Sekretärin werden willst, musst du in allen Fächern gute Noten schreiben.» Schlechte Schülerinnen würden nämlich nicht zu Bewerbungsgesprächen eingeladen. Als ich wissen wollte, warum Knaben intelligenter waren als Mädchen, schüttelte sie den Kopf. «Das sind böse Zungen, die so etwas behaupten.» Aber das Gegenteil konnte sie mir auch nicht beweisen.
Außer Mama gab es noch Kathrins Mutter, die als Krankenschwester im Universitätsspital arbeitete. Aber das war nur, weil ihr Vater als Schuster nicht genug Geld verdiente. Wie weit kämen Kathrin und ihre fünf Geschwister mit seinem Hungerlohn? Die Frau, die bei uns im obersten Stock wohnte, musste arbeiten, weil ihr der Mann verstorben war. Meine Mutter sagte, dass alle Witwen früher oder später eine Arbeit aufnehmen müssten. Eine verheiratete Frau besaß nämlich nichts. Wenn sie vor der Ehe reich war, wurde alles auf den Ehemann übertragen. «Ihm gehören auch ihre Kleider und sogar die eigenen Kinder.»
«Heißt das, ich gehöre Papa?»
«Ja, eigentlich gehörst du Papa.»
*
Sie [die Frau] hat schon froh zu sein, wenn sie nicht vollständig übergangen wird. [...] Sie [die Männer] machen mit und aus ihm [dem Kind], was sie wollen. Nur eines wollen sie dabei nicht: persönlich mit seiner Pflege und Obhut zu tun haben.
Beide Absätze des Artikels Nummer 274 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches kannte sie auswendig:
1. Während der Ehe üben die Eltern die elterliche Gewalt gemeinsam aus.
2. Sind sich die Eltern nicht einig, so entscheidet der Wille des Vaters.
Iris ging zwischen ihrem Schreibtisch und dem Fenster hin und her. Trotz geschlossener Tür konnte sie die Geräusche aus der Küche hören. Die Studentin aus Wettingen war ein Fehlgriff. Meistens war das Geschirr noch dreckig, wenn man es aus den Schränken holte. Zum Glück war da noch Judith.
Iris fragte sich, ob ihre Idee, die Mansarden auf der zweiten Etage an Studentinnen zu vermieten, sinnvoll war. Wie sollte jemand, der wenig oder gar keine Erfahrung mit Haus- und Küchenarbeit hatte, in der Lage sein, zu helfen? Andererseits hatte sie sich nach Berthas Kündigung monatelang vergebens nach einer neuen Hausangestellten umgesehen. Sie zündete sich eine Zigarette an und ärgerte sich, dass sie sich ständig von Unnötigem und Alltäglichem ablenken ließ. Das Licht der Mittagssonne reflektierte auf dem dünnen Eis. Auf der Wiese lag noch Schnee. Iris stand vor dem Fenster und rauchte ihre Zigarette. Passend zur weißen Hose trug sie eine graumelierte Bluse und die cremefarbene Strickjacke, welche ihr Sylvia zum vierzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Sie nahm sich vor, ihrer jüngeren Schwester einen Brief zu schreiben, wenn sie mit dem Manuskript fertig wäre. Sylvia hatte sich in Paris einen Namen als Designerin gemacht und führte mit ihrem Ehemann einen Antiquitätenladen. Die Tatsache, dass sie es als Ausländerin geschafft hatte, sich eine eigene Existenz in der französischen Metropole aufzubauen, beeindruckte Iris.
Das Manuskript ... Diese elende Unkonzentriertheit! Noch achtzig Seiten ... Danach hätte sie mehr als die Hälfte geschafft – sofern sie sich nicht noch einmal umentschied und das Kapitel über Mode in ihr Buch einschließen wollte. Das dritte Kapitel über die Mutterschaft war das zweitlängste nach jenem über die Frau in der Berufswelt. Iris nahm sich vor, zehn Seiten ihres handgeschriebenen Manuskriptes zu korrigieren, bevor sie in die Küche hinunterging, um sich etwas Kleines zu Essen zuzubereiten.
Als der Schöpferin kämen ausschließlich der Mutter die «Identifikationskompetenzen» gegenüber dem Kind zu. Sie nämlich hätte dem Kind Namen, Bürgerrecht, Religion und Vermögen «weiterzugeben», sie allein dürfte in den Kindern «weiterleben». Eine Erbfolge von Generation zu Generation wäre nur in weiblicher Linie möglich, sofern man davon ausgeht, dass Gut dem Blut folgen soll, eine Grundlage, die von zahlreichen Kulturen anerkannt wird. Selbstverständlich soll mit dem Verweis auf ein natürliches «Recht» der Mutter über Leben und Tod der Kinder keineswegs der Freiheit der Mutter, ihre Kinder zu töten, das Wort geredet werden. Aber es geht nicht an, beim Abwägen der physiologischen Machtfaktoren der Geschlechter [...] vor den natürlichen Gegebenheiten und den Folgerungen, die sich aus ihnen ziehen lassen, einfach die Augen zu schließen.
Ein Vorwort fehlte noch. Bis zum Ende des Winters wollte Iris einen Verlag für Frauen im Laufgitter finden. Nach zehn Jahren Arbeit wäre es an der Zeit. Bisher hatte sie nur Absagen erhalten. Hatte sie etwas anderes erwartet? Wieso sollte ein Deutscher Verlag ein Buch auf den Markt bringen, das sich hauptsächlich auf die Schweiz bezog? Bei den Schweizer Verlagen gab es ein anderes Problem: Diese sahen in der Publikation ihres 564 Seiten starken Wälzers ein pures Verlustgeschäft. Vier Verlage standen noch auf ihrer Liste. Jeden einzelnen würde Iris anschreiben. Wenn sich niemand für ihr Buch interessierte, würde sie selbst einen Verlag gründen.
*
«Zehn Jahre!» Mama hatte kein Verständnis für meine Ungeduld. Als wir wieder im Tram saßen, streichelte sie mir über den Kopf. «Geduld ist wichtig, meine Prinzessin. Wer keine Geduld hat, kommt im Leben nirgends hin.» Immer kam sie mit demselben Beispiel: «Zehn Jahre lang hat der Bund Schweizerischer Frauenvereine erfolglos Resolutionen verabschiedet und Eingaben an den Bundesrat gemacht.» Am 29. September 1952 wurde das Bundesgesetz schließlich revidiert. Seitdem darf eine Schweizer Frau ihren Pass behalten, wenn sie einen Ausländer heiratet.
«Dann hätte Frau d’Agostini später heiraten sollen.»
Mama lachte: «Ja, sie hätte später heiraten sollen.»
Am Central standen Frauen mit Listen. Mama erkannte sie sofort: «Das sind Mitglieder vom Zürcher Frauenstimmrechtsverein.» Meine Mutter erklärte, dass sie Umfragen machten. «Wenn wir dem Bundesrat beweisen können, dass die Mehrheit der Frauen das Stimm- und Wahlrecht wünscht, muss er handeln.» Bisherige Abstimmungen in den Kantonen hatten ergeben, dass die Mehrheit der Bevölkerung gegen das Frauenstimmrecht war. «Man unterscheidet zwischen eidgenössischen und kantonalen Verfassungsänderungen. Wenn ein Kanton ein neues Gesetz einführt, muss es nicht für das ganze Land gelten. Und umgekehrt.» Man nennt dieses Prinzip Föderalismus. Im Zentrum steht immer Bundesbern. «Bundesräte sind die höchsten politischen Amtsträger in unserem Land. Sie können Gesetze umschreiben oder neue machen, die dann für das ganze Land gelten. Wenn ein Bundesrat will, kann er den Linksverkehr einführen. Aber ...», fügte Mama schnell hinzu, «es gibt noch sechs andere Bundesräte und das Parlament.»
Es hat 246 Mitglieder – 200 Nationalräte und 46 Ständeräte. Jeder Vollkanton darf zwei Ständeräte nach Bern schicken, jeder Halbkanton einen. Die Schweiz hat 26 Kantone, davon zwanzig Vollkantone und sechs Halbkantone. Die Halbkantone heißen «Obwalden» (war ich noch nie), «Nidwalden» (war ich noch nie), «Appenzell Innerrhoden» (war ich noch nie), «Appenzell Ausserrhoden» (war ich noch nie), «Basel-Land» (war ich noch nie) und «Basel-Stadt» (war ich schon!).
Mimi sollte alles wissen.
Als das Tram vom Central in Richtung Kunsthaus fuhr, erklärte mir meine Mutter, was eine direkte Demokratie sei. «Alle müssen einverstanden sein. Andernfalls wird abgestimmt. In fast keinem Land hat das Volk so viel zu sagen wie bei uns.» Aber eben nur das halbe Volk. Im Übrigen sei der Linksverkehr nicht das, was sie wollten. «Wir wollen nur das Stimmrecht».
Die Bäckerei befand sich direkt neben der Haltestelle gegenüber von unserem Wohnhaus. Ich rannte, denn es war kalt. Am Straßenrand sammelte sich der letzte Schnee des Winters.
«Beeil dich, Mama!» Als ich die Tür aufstieß, stand Frau Schmid bereits hinterm Tresen. Sie war immer nett, außer zu ihrem Sohn.
«Gustav!» Er kam aus dem Hinterraum gerannt. «Geh und hole ein Gipfeli für Victoria!» Während ich auf mein Gipfeli wartete, schaute ich zu, wie die Bäckersfrau das Brot in ein Tuch wickelte und Geld in der Kasse scheppern ließ. Mama und Frau Schmid unterhielten sich über gemeinsame Bekannte. Die Bäckersfrau erzählte von einer Gewerkschaft, der ihr Mann nun beigetreten sei. Gewerkschaften seien wichtig, um die Rechte des Einzelnen zu vertreten. Als meine Mutter einhakte, kam Gustav und streckte mir das Gipfeli durch den Spalt zwischen der Theke und der Vitrine entgegen.
«Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht?», flüsterte ich.
Gustav nickte.
«Kannst du mir morgen wieder dein Französischheft ausleihen?»
Wieder nickte er.
«Was stehst du so blöd herum! Geh jetzt sofort das Mehl auffüllen!»
Warum war Frau Schmid so gemein zu ihrem Sohn?
Die Familie hatte drei Kinder: Kaspar, Gustav und das Lisi. Kaspar war viel älter als sein Bruder und studierte etwas Anspruchsvolles in Bern. Eines Tages wäre er ein wichtiger Mann im Parlament. «Politik», flüsterte Frau Schmid. Die Partei ihres Mannes favorisiere ja den jungen Herrn Schmid bereits.
P-O-L-I-T-I-K
Deswegen sei Kaspar das Geld wert, das die Eltern in ihn investierten. Im Vergleich zu seinem Bruder sei Gustav geradezu ein hoffnungsloser Fall. Von Herrn Welti kämen ständig Reklamationen, sodass sich ihr Mann überlege, ihn nach der Primarschule abzumelden und stattdessen in der Bäckerei zu beschäftigen. Früher oder später würde er sie so oder so übernehmen. Jeden Morgen musste Gustav um fünf aufstehen und seinem Vater bei der Auslieferung von Bestellungen helfen. Von unserem Wohnzimmer aus sah ich manchmal, wie er des Nachts von seiner Mutter über die Straße zum grauen Lieferwagen gezogen wurde. Die Familie wohnte auf der anderen Seite des Sees, in Wollishofen. Da er aber mehr Zeit in der Bäckerei verbrachte als zu Hause, besuchte Gustav dieselbe Klasse wie ich. «Das Lisi», verkündete Frau Schmid, und ihre Miene erhellte sich, «ist ja seit vergangener Woche einem Bankierssohn aus dem Zürcher Oberland versprochen.» Um ihre Tochter müsse man sich deshalb keine Sorgen machen. Einzig Gustav ... «Wenn er so weitermacht, wird er nie eine Familie ernähren können!»
Als ich mich umdrehte, stand Mama bereits an der Tür. Auf dem Weg zu unserer Wohnung ließ sie ihrem Unmut freien Lauf: «Die Schweiz ist voll von solchen Erzkonservativen wie Frau Schmid».
Was heißt ...?
*
Im Namen Gottes des Allmächtigen.
Jeder, der die Bundesverfassung kannte, wusste, dass sie mit diesem Leitsatz begann.
Der Respekt der Frauen vor den Männern hat etwas von jenem des Kindes vor dem Erwachsenen, des Schülers vor dem Lehrer, des Arbeitnehmers vor dem Arbeitgeber und vielleicht auch des Tieres vor dem Menschen, solange es glaubt, dieser sei der Mächtigere.
Erst 155 Jahre nach der Französischen Revolution, also 1944, wurde in Frankreich das Frauenstimmrecht eingeführt. Zwei Jahre später folgte Italien, nach vier Jahren Belgien. In Deutschland durften die Frauen schon seit vierzig Jahren abstimmen.
In den meisten Staaten hat man sich inzwischen des monströsen Mangels an Folgerichtigkeit geschämt und die Frauen an der Volkssouveränität teilhaben lassen. Nicht so in der Schweiz. Nach wie vor bedeutet das Schweizerkreuz im roten Feld, im Firnenglanz oder Alpenrosenkranz, wo immer es an Augustfeiern, auf Diplomen und Banknoten erscheint, nebenbei auch einen Verrat an der Idee der Demokratie.
Natürlich, das Fremde ist es, das den Menschen Angst macht. Nach dem Krieg sowieso. War es nicht selbstverständlich, dass alle lieber an der Tradition festhielten, als die neu gewonnene Sicherheit aufs Spiel zu setzen? Dabei wäre jetzt der Zeitpunkt, etwas zu ändern. Frankreich, Italien und Belgien hatten es vorgemacht. In Jugoslawien wurden hohe Kommandostellen in der Armee von Frauen besetzt, Ärztinnen und Chefärztinnen kamen zum Einsatz, und die Redaktionen der Tageszeitungen lagen in weiblicher Hand. Offenbar brauchte es Kriege, um das patriarchalische System zu sprengen. Und hier? Wie viele Frauen hatten dem Vaterland ihren Dienst erwiesen? Wie viele Söhne hatten sie auf dem Schlachtfeld verloren?
«Es wäre möglich», sagte Iris, «dass Frauen Kinder bekommen und Karriere machen. Gerade jetzt, da es uns wirtschaftlich so gut geht, sollte man nach neuen Wegen für das gesellschaftliche Miteinander suchen.» Wenn sie von einer Idee gepackt wurde, glänzten ihre wachen blauen Augen.
Judith liebte es, ihr zuzuhören. Immerhin mietete die Studentin schon seit mehr als einem Jahr ein Mansardenzimmer bei den von Rotens. Sie wusste, wie der Alltag der Familie organisiert und wie die Hausherrin gestrickt war. Selten erlebte man sie so gesprächig wie an diesem Tag.
«Dies bedingt allerdings, dass Männer die Hälfte der Kinderbetreuung und der Haushaltsarbeit übernehmen. Betreuungsplätze für Kinder müssten geschaffen werden, und Haushaltsarbeit müsste wie jede andere Arbeit entlöhnt werden. Jede zweite Hausfrau wäre ein Hausmann.» Während Iris mit einer Hand ihre brennende Zigarette hielt, kritzelte sie mit der anderen Notizen in ein Heft. «Um Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu erlangen, müsste ein völlig neues Konzept entworfen werden. Ein Konzept, das es der Frau ermöglicht, gleich nach der Geburt wieder berufstätig zu sein.»
Judiths Gesicht erhellte sich. «Sie sind mein Vorbild, Frau von Roten!»
Iris’ Ideen gingen noch weiter: «Paare und Kinder wären am besten in Kommunen aufgehoben. Die Hausarbeit müsste unter allen Familienangehörigen aufgeteilt werden – damit meine ich auch die Kinder. Kinderhüten müsste als elterliche Freizeitbeschäftigung verstanden werden.»
Plötzlich war sie verschwunden – mit ihr das Notizheft. Die Gespräche der Hausherrin waren wie Selbstgespräche.
Wie Perlen in Peters Leben. Genauso, wie er seiner Frau über die Gerichtsfälle und Mandate berichtete, wollte er, dass sie ihm alles über ihr Buch erzählte. Schließlich wäre er selbst gerne Schriftsteller geworden. Wie Montaigne wollte er sich mit einer großen Bibliothek in einen einsamen Turm zurückziehen, um ein Buch zu schreiben. Zwei Gründe hinderten ihn daran: Erstens war er nicht ehrgeizig genug, und zweitens erwartete man anderes von einem von Roten. Peter bewunderte Iris’ Willen zur Perfektion, ihren Fleiß und die Fähigkeit zur Selbstkritik. Kein Mensch könnte ihr jemals das Wasser reichen. Für ihn war sie die schönste und klügste Frau der Schweiz, vielleicht auch Europas oder gar der Welt. Mit keiner anderen könnte er Nietzsche, Homer und Proust lesen.
Und de Beauvoir.
Als ihr Buch erschien, war Iris gerade aus Amerika zurückgekehrt. Es war klar, dass sie ein bisschen neidisch war, denn die Französin hatte in ihrem zweibändigen Werk viele ihrer Ideen vorweggenommen. Dennoch: Die Lektüre von Das andere Geschlecht motivierte sie, an ihrem eigenen Manuskript weiterzuarbeiten. Während es überall rumorte und Frauen auf der ganzen Welt ihre Rechte einzufordern begannen, blieb es still in der Schweiz.
Obwohl ...
Nie würde Peter das amüsante Erlebnis im Parlament vergessen. Im Winter 1948, wenige Monate nach seiner Wahl in den Nationalrat, hatte sich eine Delegation von Frauen zum Besuch angemeldet. Mitglieder von mehreren Frauenvereinen waren gekommen, um dem Bundesrat zum hundertjährigen Jubiläum der Bundesverfassung ein Geschenk zu übergeben: Eine Europakarte mit einem schwarzen Punkt in der Mitte. «Die Schweiz – das einzige Land ohne Frauenstimmrecht», spottete Iris. Außer der Schweiz gab es noch das diktatorisch regierte Portugal und die kleinen Fürstentümer Liechtenstein und Monaco. «Wie kann etwas so offensichtlich Falsches so offensichtlich übergangen werden?» Peter amüsierte sich über Iris’ Empörung. Er war es gewohnt, mit dem Wolf im Schafspelz zu leben. In seinem Heimatdorf Raron wäre jeder gern ein von Roten. Beide Großväter, drei von vier Urgroßvätern und sein Vater hatten Jura studiert und erfolgreiche politische Karrieren vorzuweisen. Natürlich erwartete man dasselbe von ihm. Nach seiner Ausbildung sollte er sich für die Rechte von Kirche, Dorf und Partei einsetzen. Die Rollenzuteilung war klar: Peter von Roten sollte der nächste Heinrich von Roten werden. Dabei wäre ihm alles lieber als Politik und Jurisprudenz. Wie sehr hasste Peter dieses Aristokraten-Dasein! Als jüngstes von sechs Kindern war er es gewohnt, von der Mutter mit strengeren Blicken kontrolliert zu werden. Schon während der Zeit am Kollegium Spiritus Sanctus hätte sie ihn gern mit jedem anständigen Mädchen aus gutem Haus verkuppelt. Peter versuchte, Distanz zu schaffen, indem er Teile seines Studiums in Italien und Frankreich absolvierte. Im Gewirr der Großstadt fühlte er sich wohl. Seltsamerweise empfand er große Sympathie für den italienischen Duce. Im italienischen Faschistenstaat sah er eine Art Versuchsstation der autoritären Demokratie. Als es nach dem Hitler-Franco-Pakt zu innenpolitischen Grabenkämpfen zwischen Konservativen, Kommunisten und Nationalisten kam, sympathisierte er mit dem Front populaire und nahm an Demonstrationen teil. Für Peter war klar: Niemals würde er eine Frau heiraten, die er nicht leidenschaftlich liebte.
Im Oberwallis schimpften sie, er habe mit seiner Meyerin den Feminismus geehelicht. Seine Familie ging noch weiter: Mit Iris habe er sich dem Unglück verschrieben. Peter war solches Geschwätz egal. Im Gegenteil fand er gerade in dieser Provokation eine Art von Genugtuung. Wenn er wählen könnte, wäre er lieber Revolutionär oder Anarchist anstatt Anwalt und Politiker. Schon als Kind hatte ihn das Spiel mit dem Risiko oft in ein Dilemma gestürzt, zum Beispiel, wenn er mitten im Gottesdienst Lust hatte, aufzustehen, sich die Kleider vom Leib zu reißen und nackt zum Altar zu rennen. Wie oft war er sich selbst als Wolf im Schafspelz vorgekommen!
*
«Tot – toter – am totesten.»
Wenn Herr Welti mit hinter dem Rücken verschränkten Armen durch die Bankreihen ging, herrschte Schweigen. Sogar Robi und Thomas, die sonst immer mit ihren Bleistiften herumhantierten, saßen still. So waren alle ein bisschen erschrocken, als der Lehrer zu lachen begann. «Tot – toter – am totesten.» Hörte denn keiner zu? «Lasst euch nicht jeden Quatsch diktieren! Tot, tot, tot – mehr gibt es nicht.»





























