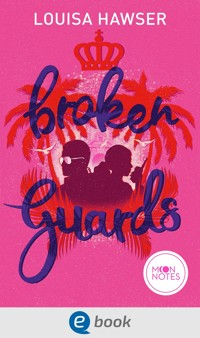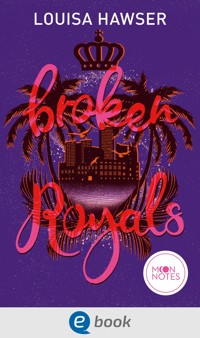
9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von glamourösen Partys und Luxus kann Billie nur träumen: Um ihre demenzkranke Mutter und ihre Schwester in Monaco über Wasser zu halten, jongliert die Medizinstudentin drei Jobs. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie von einem geheimnisvollen Mann geküsst wird. Plötzlich findet Billie sich inmitten eines royalen Skandals wieder – denn der Fremde ist niemand geringeres als Prinz Charles von Monaco. Dessen Familie hat die Eskapaden ihres Sprösslings satt und macht Billie ein Angebot: Sie soll sich als die Freundin des Prinzen ausgeben, um dessen Ruf wiederherzustellen. Als Billie sich auf das Angebot einlässt, ahnt sie nicht, dass am Ende nicht nur eine fürstliche Summe Geld, sondern auch ihr Herz auf dem Spiel stehen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch
Von glamourösen Partys und Luxus kann Billie nur träumen: Um ihre demenzkranke Mutter und ihre Schwester in Monaco über Wasser zu halten, jongliert die Medizinstudentin drei Jobs. Doch ihr Leben ändert sich schlagartig, als sie von einem geheimnisvollen Mann geküsst wird. Plötzlich findet Billie sich inmitten eines royalen Skandals wieder – denn der Fremde ist niemand geringeres als Prinz Charles von Monaco. Dessen Familie hat die Eskapaden ihres Sprösslings satt und macht Billie ein Angebot: Sie soll sich als die Freundin des Prinzen ausgeben, um dessen Ruf wiederherzustellen. Als Billie sich auf das Angebot einlässt, ahnt sie nicht, dass am Ende nicht nur eine fürstliche Summe Geld, sondern auch ihr Herz auf dem Spiel stehen wird.
»Louisa hat es geschafft, eine wunderbare Mischung aus Witz, Schmerz und großen Gefühlen in einer richtig schönen story zu vereinen. Ein sehr starkes Debüt.«
– Tabea Grunert @tabeajoanna
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de
Schau gern hinten nach, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Themen in diesem Buch. (Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern, steht der Hinweis hinten im Buch.)
Für meine Schwester
Playlist
Fake Blood – I Think I Like It
Ray Charles – Hit the Road Jack
James Brown & the Famous Flames – It’s A Man’s, Man’s World
Lana Del Rey – Young and Beautiful – DHOrchestral Version
ABBA – Money, Money, Money
Frank Sinatra – That’s Life
Clinton Kane – MERRY GO ROUND
Jon Bellion – Overwhelming
Lana Del Rey – Chemtrails Over The Country Club
Niall Horan – You Could Start A Cult (with Lizzie McAlpine)
Matt Hansen – LET EM GO
Taylor Swift – I Hate It Here
Gang of Youths – Achilles Come Down
Patrick Watson – Ode to Vivian (Rework)
Asaf Avid – My Tunnels Are Long And Dark These Days
The Kid LAROI – HEAVEN
Bobby Darin – Call Me Irresponsible (2001 Remaster)
Ariana Grande – safety net (feat. Ty Dolla $ign)
Nina Simone – I Put A Spell On You
Taylor Swift – Dress
Jon Bellion – Blu
Dermot Kennedy – Without Fear
Stephan Sanchez – High
Billianne – Simply The Best
Kapitel 1
Charles
Das Leben ist nicht immer fair.
Diesen beschissenen Satz sagen andauernd Menschen, die vor allem eins haben: keinen verdammten Plan vom Leben. Erst recht nicht von meinem.
Was soll das überhaupt bedeuten, dass das Leben nicht immer fair ist? Soll das heißen, dass man es einfach zu akzeptieren hat, wenn man unfair behandelt wird? Dass man es hinnehmen und sich nicht dagegen wehren soll?
Einen Scheiß werde ich akzeptieren. So viel ist sicher.
Mürrisch mahle ich meine Kiefer aufeinander und verschränke meine Arme vor der Brust. Das Leder des Stuhls ist kühl und drückt unangenehm in meinen Rücken. Kalter Schweiß klebt mir an der Stirn von all dem Alkohol, den mein Körper gerade händeringend abzubauen versucht. Recht erfolglos würde ich sagen. Dafür mit reichlich Nebenwirkungen wie dröhnenden Kopfschmerzen und einer Übelkeit, bei der ich befürchte, mich gleich auf den Glastisch vor mir zu übergeben.
Die stickige Luft in diesem Besprechungsraum macht es auch nicht besser. Aus Sicherheitsgründen befindet er sich im Keller des Palastes und besitzt keine Fenster, die man öffnen könnte. Dafür hat er eine Klimaanlage, die das Zimmer auf Sibirien-ähnliche Temperaturen herunterkühlt. Ich kann nicht sagen, ob man mich damit bestrafen will oder ob Papas Hofstaat es braucht, um einen kühlen Kopf zu bewahren.
Um mich herum herrscht nämlich das reinste Chaos.
Alle reden durcheinander.
Reden über mich.
Aber keiner von ihnen redet mit mir.
Normalerweise würde ich das gut finden, aber gerade macht mich jede weitere Sekunde, die ich stumm an diesem Tisch sitzen soll, unruhiger.
Das gesamte Kabinett ist einberufen worden, gleich nachdem der Leak vor ein paar Stunden von den Medien veröffentlicht worden ist.
Mittlerweile ist es halb vier Uhr morgens, und ich werde erst jetzt so langsam wieder nüchtern.
Leider.
»Wir müssen umgehend eine Pressemitteilung rausschicken«, schlägt François, der mir gegenübersitzt, vor.
Er ist Papas Aide de Camp, der militärische Assistent, darüber hinaus sein engster Berater und die wahrscheinlich nervigste Person unter der Sonne. Direkt neben ihm sitzt Benoît, ebenfalls ein Berater meines Vaters, der unangefochten den Titel als zweitnervigste Person innehat.
Und ich armes Schwein habe das Pech, gleich mit beiden in einem Raum ausharren zu müssen.
Schon oft habe ich gedacht, dass François mit seinem gehetzten Blick einer Ratte ähnlich sieht. Er hat das gleiche spitze Gesicht und graue, in alle Richtungen abstehende Haare. Doch selbst wenn er nicht so aussehen würde wie eine Ratte, verhält er sich oft genug wie eine. Seit ein paar Monaten spioniert er mir hinterher und lässt keine Möglichkeit aus, mir mein Leben zur Hölle zu machen.
Natürlich revanchiere ich mich ab und an bei ihm.
Erst letzte Woche habe ich – ein gestandener vierundzwanzigjähriger Mann – ein Foto der ehemaligen britischen Boyband One Direction auf den Rücken des Jacketts seiner Dienstkleidung drucken lassen. Es war vielleicht mein schönster Moment in diesem Jahr, als er begriffen hat, dass da gleich fünf junge, gut aussehende Briten auf seiner Arbeitskleidung um die Wette grinsen, ehe er sich sein Sakko mit hochrotem Kopf von den Schultern gerissen hat. Kindisch war es allemal, aber dafür mindestens genauso unterhaltsam. Immer, wenn er so richtig wütend ist, zuckt sein rechtes Auge – quasi mein Erfolgsmaßstab.
»Ich bin dafür, dass wir noch ein paar Tage warten«, widerspricht Benoît, der wie die Standuhr aus dem Disneyfilm Die Schöne und das Biest aussieht: klein, rundlich und mit einem feinen Bart über der Oberlippe, der mich an die Schnurrhaare einer Katze erinnert.
»Der Leak ist schon draußen. Alles, was wir jetzt tun können, ist, Schadensbegrenzung zu betreiben, und damit sollten wir so früh wie möglich anfangen.« Der Tonfall von François ist scharf.
Er und Benoît können sich bis auf den Tod nicht ausstehen. Da haben wir drei wenigstens eine Sache gemeinsam.
»Außerdem«, fährt er unbeirrt fort, »gibt es ja noch ein weiteres Problem, das wir adressieren müssen. Wir sollten uns auf einige kommende Schlagzeilen vorbereiten.«
François sieht mit zusammengekniffenen Augen zu mir herüber. Er hätte auch gleich mit dem Finger auf mich zeigen und sagen können: Seinetwegen gibt es an einem Tag gleich zwei große Skandale im Fürstentum Monaco!
Leider war ich nur für einen der beiden selbst verantwortlich.
Wieder bricht ein Tumult bei den zwölf Beratern aus.
»Wissen wir, wie der Leak an die Öffentlichkeit gekommen ist?«, fragt Papa, der in den Raum gerauscht kommt und sämtliche Diskussionen am Tisch verstummen lässt.
Stühle kratzen über den grauen Teppichboden, alle erheben sich, und ein dumpfer Ton erklingt, als Benoîts Knie beim Aufstehen gegen die gläserne Tischkante knallt.
Alle neigen ehrfürchtig den Kopf vor Papa.
Alle außer mir.
»Fürst Philippe«, krächzt François und verbeugt sich leicht. »Bisher konnten wir noch nicht genau feststellen, wo die Sicherheitslücke ist. Aber wir arbeiten auf Hochtouren daran und sind zuversichtlich, den Ursprung bald zu lokalisieren.«
Schleimer.
»Bien«, antwortet Papa, der am Kopfende des Tisches Platz nimmt. Er sieht erschöpft aus, aber seine grauen Augen sind so klar und fokussiert wie immer.
Große Ähnlichkeit habe ich nicht mit ihm. Ich fühle mich ihm auch nicht ähnlich.
Die braunen Augen und die markante Knochenstruktur habe ich von Maman. Nur die Größe, die Türrahmen in den letzten Jahren zu meinen größten Feinden gemacht hat, habe ich von Papa geerbt. Sie und die braunen Locken, die bei ihm inzwischen ins Graue verblasst sind. Nun haben sie die gleiche Farbe wie seine Augen.
Ich mache den Fehler und sehe auf, wobei mich sein durchdringender Blick trifft. Es fällt mir schwer, diesen Blick zu ertragen, und ich habe mich oft gefragt, ob man ihn von Geburt an besitzt oder ob die Rolle des Monarchen ihn lehrt. Seine filigrane Nase hat er kaum merklich krausgezogen und seine Lippen zusammengepresst.
»Oder hast du etwas mit diesem Leak zu tun?«, fragt er dann an mich gewandt.
Es ist so still am Tisch, dass ich nur noch das Brummen der Klimaanlage hören kann.
Ich schnaube, ein verächtliches Geräusch, das sich in meinen Ohren verbittert anhört. »Das meinst du hoffentlich nicht ernst.«
Er hält meinem Blick stand, und nichts an seiner Miene lässt darauf schließen, dass ihm gerade nach Scherzen zumute ist. Aber das ist in letzter Zeit ohnehin selten der Fall. »Die Information ist kurz nach unserer Unterhaltung heute Morgen an die Öffentlichkeit gelangt, Charles.«
Der Ton in seiner Stimme ist bedrohlich ruhig. Das Leder meines Stuhls schmatzt, als ich mich langsam vorlehne, den Blick immer noch fest mit seinem verschränkt, wobei ich mir Mühe geben muss, dem richtigen der drei schwankenden Väter in die Augen zu sehen.
Ich brauche dringend ein Wasser. Oder noch einen Tequila-Shot.
»Du hast recht. Natürlich bin ich sofort zur Presse gelaufen, nachdem ich erfahren habe, dass mein Bruder zu krank ist, um den Thron zu besteigen. Ich musste den Journalisten ja stolz von meinem neuen Amt erzählen. Das ergibt total Sinn, angesichts der Tatsache, dass ich mir lieber mit einer Gabel die Augen ausstechen würde, als Fürst von Monaco zu werden.«
Wenn es überhaupt möglich ist, ist es noch ruhiger im Raum geworden. Als habe man ihn in ein Vakuum verpackt und ihm sämtlichen Sauerstoff entzogen. Unter dem Tisch ballt Papa seine Hände zu Fäusten zusammen.
»Hüte deine Zunge, Charles«, sagt er drohend und lehnt sich ebenfalls in seinem Stuhl vor. »Außerdem überrascht mich deine starke Ablehnung bei dem Thema. Hast du dich nicht, gleich nachdem die Meldung rausgegangen ist, auf einem Boot dafür feiern lassen?«
»Jachten«, korrigiere ich ihn fast automatisch.
»Wie bitte?«
»Jachten«, wiederhole ich und muss mich konzentrieren, ein Schmunzeln zu unterdrücken, was mir jedoch nicht wirklich gelingen will. Das liegt vermutlich daran, dass ich es nicht genug versuche. »Es war kein Boot, auf dem ich mich habe feiern lassen, sondern eine Jacht, und wenn du es genau nehmen willst, dann waren es Jachten, Plural.«
Für einen Moment sieht Papa mich nur an. In dem gleißenden Licht der Leuchtstoffröhren zeichnen sich die dunklen Schatten unter seinen Augen deutlich ab. Schlaflose Nächte sind nur eine von vielen Nebenwirkungen, die sein Amt mit sich bringen.
»Ich wollte das nur richtigstellen«, fahre ich unbeirrt fort. »Immerhin ist es die größte Jachtparty gewesen, die in Monaco jemals gefeiert wurde. Es ist nur ein Graus, dass ich sie frühzeitig verlassen musste. Man hat ja nicht oft die Chance, seinen letzten Tag in Freiheit zu feiern, nicht wahr?« Ich werfe einen Blick über die Schulter zu Papas Bodyguard, der mich auf die unsanfte Art von der Jacht heruntergezerrt hat.
Hoffentlich haben die Paparazzi genug Fotos davon gemacht. Ein Gedanke, der mich in den vergangenen Monaten bei jedem Schritt begleitet hat. Eigentlich sind Paparazzi in Monaco strengstens verboten. Aber es gibt immer Mittel und Wege, sie trotzdem in die Stadt zu holen. Oder aber man verlagert das, was sie fotografieren sollen, auf internationale Gewässer.
Ich sehe zu Papa, der mich anschweigt und schließlich seufzend den Blick von mir abwendet. »Wie auch immer. Wir müssen eine offizielle Pressemitteilung rausgeben, in der wir von den Änderungen der Thronfolge berichten.« Papa sieht in die Runde der zwölf Berater, die rings um den wuchtigen Glastisch sitzen. »Dabei werden wir keine Details über Raphaëls Gesundheitszustand nennen. Wir sollten uns darauf beschränken, dass kein Grund zur Sorge besteht. Wir müssen sichergehen, dass die Berichterstattung sauber verläuft. Sie darf keine Fragen offen- und keine Spekulationen zulassen.«
Wieder schnaube ich.
»Charles, deine Meinung wird in dieser Angelegenheit nicht länger benötigt«, kommentiert mein Papa das Geräusch.
Ich zwinge mich dazu, den Blick zu senken und nicht wieder zu ihm aufzusehen. Die Wahrscheinlichkeit ist zu hoch, dass ich sonst über den Tisch steige und Dinge tue, die ich später bereuen würde.
»Du formulierst es so, als bestünde die Hoffnung, dass es wieder gut wird«, sage ich. »Dass Raphaël wieder gesund wird. Aber das wird er nicht.«
Diese Worte auszusprechen, macht die Wahrheit plötzlich sehr real. Zu gern wäre ich jetzt aufgesprungen und losgelaufen, die Treppenstufen vom Keller hinauf bis in den vierten Stock. Natürlich würde ich dabei gleich zwei Stufen auf einmal nehmen, so wie damals. Ich würde an der Galerie vorbeilaufen, wo die Familiengemälde der Grimaldis hängen. An ihrem Ende würde ich links abbiegen und dem Gang bis zu der hölzernen Flügeltür folgen. Ich würde nicht klopfen und Raphaël sofort wissen, dass ich es bin, der hereinkommt. Sein kleiner Bruder, der ihn mal wieder all seine Nerven kostet.
Aber all das würde ich nie wieder tun können.
Ich würde nie wieder in sein Zimmer stürmen und Raphaëls wissendes Lächeln auf seinen Lippen sehen. Weder heute noch sonst irgendwann. Die Erinnerung an ihn verblasst jeden Tag ein bisschen mehr, während mein schlechtes Gewissen größer wird.
Ich presse den Kiefer zusammen, so fest, dass es schmerzt.
»Du bist bei dieser Sache emotional zu involviert. Wir möchten lediglich eine lückenlose Erklärung dafür geben, warum du der neue Thronerbe wirst. Ohne dabei zu viele Fragen aufzuwerfen.«
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie Papa die von einem grauen Sakko bedeckten Ellenbogen auf dem Glastisch absetzt und das Kinn auf seine Hände abstützt. Für die einen muss der Ausdruck in seinem Gesicht väterlich besorgt wirken. Aber väterlich ist keines der Adjektive, mit denen ich Fürst Philippe in den letzten Monaten beschrieben hätte. Manchmal, sei es auch nur für einen Wimpernschlag, fand ich einen Hauch Fürsorge irgendwo hinter dem Grau seiner Augen verborgen. Am liebsten hätte ich ihn angebrüllt. Hätte ihm gesagt, wie wenig er mich versteht, wie wenig er alles versteht.
»Natürlich bin ich emotional involviert, er ist mein Bru–«
»Lacroix, da sind Sie ja endlich«, unterbricht Papa mich und schaut über meinen Kopf hinweg.
Ich rieche Yves, bevor ich ihn sehe. Dieses Gemisch aus seinem Aftershave, Leder und Zigarettenrauch. Er hat mir schon zigmal versprochen, dass er mit dem Rauchen aufhören wird. Wobei ich ihm nicht wirklich eine Unterstützung gewesen bin. Ich drehe mich zu ihm um und sehe in ein vertrautes Paar graublauer Augen. Blau sind sie an den Tagen, an denen ich mich stundenlang mit unserem Koch Guillaume in der Küche verschanze und er weiß, dass ich nichts anstellen kann. Grau sind sie hingegen an Tagen wie heute.
Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen steht Yves neben der Tür, genau wie Papas Bodyguard.
Obwohl beide den gleichen schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd darunter tragen, sehen sie komplett unterschiedlich aus. Nicht zuletzt, weil Yves mit seinen sechsundzwanzig Jahren deutlich jünger ist als Papas Bodyguard. An Yves’ Oberarmen spannt das Sakko und lässt nur erahnen, dass er die geringe Zeit, die er nicht als mein Bodyguard im Dienst ist, mit Krafttraining und Kampfsport verbringt. Seine aschblonden Haare sind zu einem Buzzcut geschoren, und sein getrimmter Bart sieht wie immer sehr gepflegt aus.
Abgesehen von dem obligatorischen Anzug verbindet die beiden Bodyguards nur der schwarze Knopf im Ohr. Das Teil ist so klein und unscheinbar, dass ich seine Existenz immer wieder vergesse. Nur wenn Yves sich von mir abwendet und in das Mikrofon an seiner Manschette spricht, erinnert es mich daran, dass er weit mehr als mein guter Freund ist. Dass er immer auf der Hut ist und es mindestens ein Dutzend Menschen gibt, die jederzeit genau wissen, wo ich bin, und eingreifen können, sollte ich in Schwierigkeiten geraten. Dabei bin ich in den vergangenen Monaten selbst zu meiner größten Gefahrenquelle geworden.
Yves’ Blick wandert zu mir, nur ganz kurz.
Sein Gesicht ist wie versteinert, eine ausdruckslose Maske, doch seine Augen verraten ihn, und ich erkenne die Wut, die wie Flammen in dem Graublau auflodern. Seine Brust hebt und senkt sich schnell, und ich vermute, dass er keine Zeit verloren hat, nachdem er erfahren hat, dass man mich hergebracht hat. Wieder nagt das schlechte Gewissen an mir, und wieder ersticke ich es mit denselben Worten wie immer: Es hat alles einen Grund, und ich werde nicht aufhören, bis auch der Letzte es verstanden hat.
»Danke, Charles, deine Anwesenheit wird hier nicht länger gebraucht«, sagt Papa nun und faltet die Hände auf der Oberfläche des Glastisches zusammen.
Keine Frage, ein Befehl.
François und Benoît tauschen einen vielsagenden Blick miteinander.
»Ich dachte, hier geht es um mich«, presse ich hervor, und Papa verengt die grauen Augen.
»Es geht um das Fürstentum. Und um den Palast. Du wirst früh genug von unserer Entscheidung unterrichtet werden, und bis dahin hoffe ich, dass du endlich gelernt hast, Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn mich deine Taten in den letzten Monaten stark daran zweifeln lassen.« Papa seufzt, ein Geräusch, das sofort unter die Ärmel meines Longsleeves kriecht. »Früher hast du dein Zuhause geliebt. Früher hast du es nicht mit Füßen getreten.«
Ich schweige, klammere mich fester an die Lehnen des Stuhls und senke schließlich den Blick.
»Lacroix, wären Sie so freundlich und würden Charles auf sein Zimmer begleiten? Es erscheint mir nur vernünftig, wenn er seinen Rausch ausschläft.« Die Stimme meines Vaters lässt keinen Widerspruch zu.
Ich rümpfe die Nase, und Yves macht einen Schritt auf mich zu.
Alle sehen mich an.
Starren mich an.
Als sei ich hier fehl am Platz. Der Blick meines Vaters signalisiert mir deutlich, dass, wenn ich nicht freiwillig gehe, trotzdem dafür gesorgt wird, dass ich gehe. Das hier ist nicht die erste Besprechung, aus der ich fliege. Ich erhebe mich von meinem Stuhl und sehe niemanden an, als ich gehe. Nicht Papa, nicht François oder Benoît und auch nicht Yves, der mir zweifellos wie ein Schatten aus dem Raum folgt. Es ist auch Yves, der die Tür schließt, als ich durch den totenstillen Gang in Richtung der Aufzüge laufe.
Thronfolger.
Das Wort klingt falsch in meinen Gedanken. Wie ein böses Omen, das schon lange wie eine dunkle Wolke über mir schwebt.
Ich soll Thronfolger werden.
Zum wiederholten Mal in den letzten Stunden wird mir schlecht. Mein Magen dreht sich um, meine Sicht wird plötzlich unscharf, und schwarze Flecken säumen mein Sichtfeld. Für einen Moment muss ich mich an der Wand abstützen, während mein Herz so laut gegen meine Brust hämmert, dass Yves es sicher hören kann.
»Charles?«
Ich nehme seine Stimme irgendwo weiter weg wahr, doch ich schüttle nur den Kopf, drücke mich von der Wand ab und laufe weiter. Wie ferngesteuert hebe ich die Hand zum Knopf, um den Aufzug zu holen, und stolpere hinein, als sich die dicken Stahltüren öffnen. Kurz zucke ich zusammen, als ich mich selbst im Spiegel des Fahrstuhls entdecke.
Tiefblaue Augenringe auf blasser Haut. Meine braunen Haarspitzen kleben an meiner Stirn, und meine Lippen sind spröde und aufgeplatzt.
»Du siehst ziemlich beschissen aus«, kommentiert Yves mein Erscheinungsbild, als er zu mir in den Fahrstuhl tritt. Er drückt den Knopf, der uns in die zweite Etage der Grands Appartements bringt. Die schweren Stahltüren schließen sich.
»So redet man aber nicht mit seinem neuen Thronfolger«, erwidere ich sarkastisch mit erhobenem Zeigefinger.
Yves schnaubt. Nicht belustigt, sondern eher ungläubig.
Wütend.
In dem grellen Licht des Fahrstuhls sieht man deutlich die wulstige Narbe, die sich durch Yves’ rechte Augenbraue zieht. Als er vor knapp drei Jahren mein Bodyguard wurde, habe ich ihn nach ihrem Ursprung gefragt. Er hat nur geantwortet, dass die Geschichte nicht der Rede wert sei.
So ist das eben mit Yves.
Man stellt ihm viele Fragen, aber bekommt nur auf die wenigsten eine Antwort.
Er steht kerzengerade da und würdigt mich keines Blickes.
»Yves«, sage ich, lehne mich mit dem Rücken gegen die Fahrstuhlwand und beobachte ihn. »Ich werde das Gefühl nicht los, dass du ein bisschen sauer auf mich bist.«
Er hebt das Kinn und nimmt einen tiefen Atemzug, ehe er mir antwortet. »Du bist betrunken, Charles.«
»Ja, zum Glück. Anders wäre diese Krisensitzung da gerade auch nicht zu ertragen gewesen.«
Yves dreht den Kopf zu mir, ein Blitzen in dem graublauen Sturm seiner Augen.
»Ich hätte heute deinetwegen fast meinen Job verloren, ist dir das klar?«
Ich zucke unbeeindruckt mit den Schultern, obwohl seine Worte einen wunden Punkt auf der Höhe meiner Brust treffen. Aber die Wut, die sich darüberschiebt, ist lauter. »Solange es nur fast war, ist doch alles gut, oder? Außerdem wäre dein Rausschmiss auch ein bisschen verdient. Wer sich so leicht von mir abhängen lässt, macht seinen Job als Bodyguard offenbar nicht gut.« Ich klopfe ihm spielerisch auf die Schulter, aber Yves bleibt standhaft wie ein Baum.
»Du hast jedenfalls einiges verpasst«, füge ich noch hinzu.
Yves’ Nasenflügel blasen sich kaum merklich auf. Aber er erwidert nichts.
Ich weiß, dass ich ihm gegenüber nicht so ein Arschloch sein sollte. Dass er eigentlich nur das Beste für mich will. Aber auch wenn er mein Freund ist, stehen seine Pflichten für das Fürstentum immer zwischen uns.
Die Aufzugtüren öffnen sich, und ich blicke in den Gang. Das gelbe Licht der Wandleuchten spiegelt sich auf dem polierten Marmorboden wider. Als wir schweigend zu meinem Zimmer laufen, lege ich den Kopf in den Nacken. Trotz der hohen Decken fühle ich mich schrecklich eingeengt. Yves sagt nichts, als er die Tür zu meinem Zimmer öffnet. Zu dem Ort, der sich wie zu Hause anfühlen sollte.
Aber das tut er schon lange nicht mehr.
Kapitel 2
Billie
Drei Wochen später
Vorstellungskraft ist etwas Faszinierendes.
Der Mensch ist in der Lage, geschriebene oder gesagte Worte bildlich im Kopf zu sehen. Wenn man in ein gutes Buch vertieft ist, läuft ein ganzer Film vor dem inneren Auge ab. Dabei lösen die Worte bei jedem Menschen etwas anderes aus. Zeigen ihnen ein anderes Bild.
Heute Morgen habe ich mich gefragt, wie Hoffnungslosigkeit für mich aussieht.
Jetzt bin ich mir sicher, dass ich es ganz genau weiß.
Für mich wäre es ein Raum mit flackernden Neonröhren, vergilbten Lamellenvorhängen und einem groben grauen Teppichboden, auf dem die Schritte dumpf klingen. Ein Holztisch würde in der Mitte des Raums stehen, verstreute Akten darauf und daneben eine Tasse, bei der das Motiv schon längst abgeblättert ist.
Hoffnungslosigkeit sieht für mich aus wie das Büro, in dem ich sitze.
»Ich brauche nur noch eine einzige Verlängerung, dann kann ich die erste Rate zahlen. Bitte, Monsieur Dellaire«, flehe ich den Mann an, der in einem etwas zu engen taubengrauen Anzug auf der anderen Seite des Holztisches sitzt.
Sein von Falten gezeichnetes Gesicht nimmt einen Ausdruck an, der auch den letzten Funken Hoffnung im Keim erstickt.
»Das haben Sie schon den letzten Monat und den Monat davor gesagt, Mademoiselle Davis«, antwortet er auf Englisch, wobei ich mir Mühe geben muss, seine Worte trotz seines starken französischen Akzents zu verstehen. Der Lederstuhl ächzt unter seinem Gewicht, als er sich zu mir vorlehnt und die Ellenbogen auf dem Tisch abstützt. Er reibt sich die matten Augen und seufzt schließlich tief.
»Hören Sie, Mademoiselle Davis, ich weiß, dass es gerade in Ihrer Situation nicht einfach ist, und wenn ich könnte, würde ich Ihre Zahlung noch mal um dreißig weitere Tage nach hinten verschieben. Aber die Bank hat entschieden, dass Sie nicht mehr verlängern dürfen.«
Benommen sinke ich in das durchgesessene Polster des Stuhls zurück.
»Verstehen Sie das, Mademoiselle Davis? Dieses Mal kann ich leider nichts mehr für Sie tun.«
Dieses Mal.
Ich habe im vergangenen Jahr oft in diesem Büro gesessen, um Monsieur Dellaire darum zu bitten, die erste Ratenzahlung meines Kredits zu verschieben. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich jetzt vermutlich auf der Straße sitzen.
Wir würden auf der Straße sitzen.
»Okay«, sage ich leise, und das Brennen in meinen Augen kehrt zurück. Gar nichts ist okay, aber weder er noch ich können etwas dafür.
Betäubt stehe ich auf und mache Anstalten, nach meiner Jacke und Tasche zu greifen, doch Monsieur Dellaire kommt mir zuvor. Er hält mir beides mit einem mitleidigen Ausdruck entgegen. »Es tut mir sehr leid, Mademoiselle Davis. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.«
»Merci pour tout«, sage ich zu ihm, und er nickt.
Danke für alles.
Mein Französisch ist nicht das schlechteste, aber in meiner Muttersprache Englisch fühle ich mich deutlich sicherer.
Ein paar Minuten später finde ich mich nach Luft schnappend vor dem Bankgebäude wieder. Zwischen den anderen Bauten der kleinen französischen Gemeinde Beausoleil, unweit der monegassischen Grenze, ragt es wie ein Betonklotz ins wolkenlose Blau des Himmels.
Die Luft riecht nach dem Salz des Meeres und der Wärme des bevorstehenden Sommers, der sich an der Côte d’Azur wie immer früh im Jahr blicken lässt. Trotzdem ist mir eiskalt. Selbst als ich meine Arme um mich schlinge, will mir nicht warm werden.
Einen Monat habe ich Zeit, um die dreitausend Euro für die erste Rate des Kredits aufzutreiben. Ich wusste, dass der Tag kommen würde, an dem ich mich dieser Verantwortung stellen muss. Trotzdem trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag in die Magengrube.
Das Vibrieren meines Smartphones holt mich aus meinen Gedanken. Auf dem Display sehe ich den Namen meiner besten Freundin aufblinken.
Ich starre auf die angezeigte Telefonnummer, und meine Sicht verschwimmt, ehe die Nummer der Spiegelung meines Gesichts weicht.
Dunkle Haarsträhnen fallen mir in die Stirn. Die Schatten unter meinen Augen sind von einer ähnlichen Farbe. Selbst meine Sommersprossen wirken blass, als hätte meine ganz persönliche Sonne aufgehört zu strahlen.
Ich nehme einen tiefen Atemzug und drücke auf den grünen Hörer.
»Hey, Sophie, kann ich dich später zurück–«
»Isabelle Grace Davis«, unterbricht sie mich. »Du glaubst niemals, was ich gerade auf dem Gang mitbekommen habe.«
Der aufgeregte Unterton in ihrer Stimme ist trotz Verzerrung durch die Lautsprecher laut und deutlich zu hören. Auch wenn mir gerade alles andere als zum Lächeln zumute ist, tue ich es dennoch. Als ich nichts antworte, räuspert sie sich am anderen Ende der Leitung. »Billie, ist alles okay bei dir?«
Ein kleiner Teil von mir denkt darüber nach, ihr von dem Banktermin zu erzählen. Doch das Letzte, was ich will, ist, dass sie sich Sorgen um mich macht. »Ja, alles okay«, erwidere ich also stattdessen. »Tut mir leid, erzähl. Was habe ich verpasst?«
»Shayla Hariri hat erzählt, dass sie heute Abend auf der Party in der Villa La Vigie eingeladen ist. Kannst du das glauben?«
Im Hintergrund höre ich ein Stimmenwirrwarr. Vermutlich sitzt Sophie bereits in dem Hörsaal, in dem gleich der Vortrag über Alzheimer stattfinden wird.
Da, wo ich eigentlich auch sein sollte, sagt eine Stimme in meinem Kopf. Seit Wochen habe ich mich auf diesen Termin gefreut, weil Professor Contianni, eine Koryphäe in der Alzheimer-Forschung, den Vortrag hält. Aber wie so oft macht mein Leben mir einen Strich durch die Rechnung.
»Wenn jemand auf so eine Party eingeladen wird, dann Shayla. Umso besser, dass wir nicht da sein werden, weil wir nicht für das Catering in der Villa eingeteilt wurden«, erwidere ich pragmatisch. Seit Wochen reden alle in der Uni von der Party in der Villa La Vigie, einer exklusiven Villa in der Nähe von Monaco, direkt an der französischen Riviera. Dabei ist die Gästeliste kurz und besteht fast ausschließlich aus Hollywoodgrößen, Millionären und anderen einflussreichen Persönlichkeiten.
Unsereins, die dank eines Stipendiums an der Université de Monaco studieren, können nur davon träumen, auf so eine Party eingeladen zu werden.
Nicht dass ich das je gewollt hätte.
»Ich wäre gern eingeteilt worden. Dann hätte ich zwar arbeiten müssen, aber ich wäre zumindest in der Villa La Vigie gewesen! Jetzt wird Shayla uns wochenlang damit in den Ohren liegen.« Sophies theatralisches Seufzen lässt mich schmunzeln.
»Wovon du nichts mitbekommen wirst, weil in einer Woche dein Auslandssemester beginnt«, erinnere ich sie. »Wir machen uns stattdessen einen guten Abend im Le Poisson.«
Sophies Seufzen wird zu einem Stöhnen. »Ja, besonders mit Renault, der uns wieder durch das ganze Restaurant scheuchen wird. Das Universum hat das Glück nicht fair verteilt.«
Wenn man an so was glaubt, dann hat sie nicht ganz unrecht.
Sophies und meine Lebensrealität unterscheidet sich deutlich von der der meisten Bewohner in Monaco. Während unsere Mitstudierenden, unter anderem Shayla und ihre Freundesgruppe, ihre Wochenenden auf High-Society-Partys und glamourösen Veranstaltungen verbringen, jobben Sophie und ich im Le Poisson, einem luxuriösen Fischrestaurant in Monaco-Ville. Das Geld vom Stipendium reicht kaum aus, um sich den Lebensunterhalt in Monaco leisten zu können. Geschweige denn, um dort eine Wohnung zu unterhalten. Deshalb wohnen wir beide in Beausoleil, der Nachbarstadt, die direkt an Monaco angrenzt und zu Frankreich gehört.
»Sag mal, kommst du noch zum Vortrag?«, fragt Sophie und kann den besorgten Unterton selbst durch das Telefon nicht verbergen.
Ich werfe einen Blick auf meine Armbanduhr und verziehe den Mund. »Ich hatte gerade einen Termin, der etwas länger gedauert hat. Bis ich am Campus bin, ist wahrscheinlich schon alles vorbei.«
»Okay, alles klar. Ich habe mir so was schon gedacht. Geht es um deine Maman?«
»Ja«, antworte ich, weil ich weiß, dass sie dann nicht weiter fragen wird. Ich lüge sie nicht gern an, aber wenn es bedeutet, dass sie sich weniger Sorgen um mich macht, kann ich mit dem schlechten Gewissen leben.
»Billie, ist wirklich alles okay? Du hast dich so auf diesen Vortrag gefreut. Es ist schön, dass du für deine Maman da sein willst, aber du musst nicht immer alles allein schaffen, weißt du?«
Ich kneife die Augen zusammen, um die Tränen zu unterdrücken. »Ja, alles okay. Es ging jetzt einfach nicht anders.«
»Okay«, erwidert sie. »Ich bringe dir meine Mitschriften nachher mit ins Le Poisson.«
Ich nicke, auch wenn mir klar ist, dass sie es nicht sehen kann. »Danke, Sophie. Ich wüsste nicht, wie ich ohne dich klarkommen würde.«
»Dafür bin ich doch da«, sagt sie, und kurz danach legen wir auf.
Ich stecke mein Smartphone zurück in die Tasche. Es stimmt, dass ich mein Leben ohne Sophie kaum auf die Reihe bekommen würde. Sophie hat einen nie endenden Speicher an Energie. Sie ist zu gleichen Teilen schlau, ehrgeizig und gutmütig. Deshalb ist es kaum überraschend, dass sie nicht nur die Jahrgangsbeste ist, sondern sich auch für die weniger unterstützten Studierenden an der Université de Monaco einsetzt. Sie weiß genau, wie vollgepackt meine Wochen sind mit meinem Job im Restaurant und meiner Mum und Schwester. Und mit meinem zweiten und dritten Job, in einem Café in Monte Carlo und als Hilfswissenschaftlerin an der Uni.
Gleich für drei Menschen aufzukommen und nebenbei in Vollzeit ein Medizinstudium zu stemmen, erfordert Unmengen an Durchhaltevermögen und fehlerfreier Logistik. Sophie hat das immer verstanden und nie hinterfragt. Wenn ich krank war, hat sie mir angeboten, im Le Poisson für mich einzuspringen. Ich habe das meist ausgeschlagen, auch wenn ich weiß, dass sie es gut gemeint hat. Dabei hat sie mich in der Vergangenheit ausnahmslos unterstützt und mir ungefragt ihre Zusammenfassungen geschickt, wenn ich die Vorlesungen mal wieder verpasst habe.
Nicht zuletzt wegen der sich häufenden Arzttermine von Mum, zu denen ich sie begleitet habe.
Bei dem Gedanken an Mum spüre ich einen Druck auf meiner Brust, der sich gleich darauf als dicke schwarze Decke über meine Gedanken schiebt.
Ich erinnere mich noch genau daran, wann ich dieses Gefühl das erste Mal empfunden habe. Ich war gerade sechzehn geworden, als Mum die Diagnose bekam. Der erste Schock hat schwer gewogen, auch wenn er nach und nach mehr verblasst ist. Diese Art von Diagnose zwingt einen genau dazu: zur Resilienz und zur Akzeptanz. Immer wieder aufs Neue, Tag für Tag.
Auch bei der Busfahrt nach Hause kann ich meinem Gedankenkarussell nicht entkommen. Zu sehr kreist es um alle Eventualitäten, um einen Rettungsring, der mich aus dieser Misere herausholen könnte.
Wahrscheinlich wäre alles anders, wenn Dad noch hier wäre. Zu gern hätte ich diesen Gedanken abgebremst. Doch wie immer, wenn ich an Dad denke, überfährt er mich so schnell, dass ich keine Chance habe, mich dagegen zu wehren.
Sechzehn Jahre war ich alt, als Mum die Diagnose bekommen hat, achtzehn, als mein Dad uns von heute auf Morgen verlassen hat.
Er hat alles mitgenommen, seine Sachen, seine Kleidung.
Nur einen Berg an Schulden hat er hinterlassen.
Einen verdammt riesigen Berg.
Als Immobilienmakler hat er immer gut verdient, ebenso wie meine Mum. Nie hätten wir auch nur geahnt, dass er ein komplettes zweites Leben vor uns verborgen gehalten hat. Bis zu der Nacht kurz nach meinem achtzehnten Geburtstag, in der er mich aus dem Bett geholt hat. Ich erinnere mich lebhaft daran, wie er mich aus himmelblauen Augen, die meine eigenen hätten sein können, angesehen hat. Er hat mir ein Dokument hingehalten, das ich unterschreiben sollte. Als ich ihn gefragt habe, was das ist, hat er mir versichert, dass es keine große Sache sei.
Wenn ich dem Wort Schmerz ein Bild geben müsste, hätte ich eine ganz genaue Vorstellung. Ich würde mich selbst auf dem Fußboden sehen, in der Hand das Dokument von Dad. Durch dieses hat er all seine Probleme und Geheimnisse mit einer einzigen Unterschrift auf mich abgewälzt.
Ich habe ihm vertraut, habe darauf vertraut, dass er mich immer beschützen würde.
Natürlich habe ich das.
Er ist mein Dad, derselbe Mann, der Kissenburgen mit mir gebaut hat und stundenlang mit mir am Schreibtisch saß, bis ich auch die letzte Mathehausaufgabe gelöst hatte.
Rechtlich war da nichts zu machen, egal, wie viele Rechtsbeistände wir konsultierten. Für das Herz gab es keinen Anwalt.
Ganz automatisch lege ich meine Finger an die kühlen Glieder des silbernen Armbands. Das Letzte von meinem Vater, was mir geblieben ist. Vielleicht hätte ich es wegwerfen sollen, als ein Zeichen, dass er nicht länger Platz in meinem Leben hat. Aber die beiden funkelnden Anhänger, die mich an meine Schwester und meine Mum erinnern, halten mich davon ab.
Ich sehe unser Haus schon, als ich aus dem Bus aussteige. Wie ein Außenseiter hebt es sich von den anderen Häusern in der Straße ab. Auch wenn das hier nicht Monaco ist, sind die Mieten rund um das Fürstentum in den letzten Jahren auf eine schwindelerregende Höhe geklettert. Deshalb bin ich umso dankbarer, dass wir überhaupt etwas so nah an der Grenze gefunden haben.
Die einst lebendige Farbe der Fassade ist von der sengenden Hitze der langen Sommer verblasst, und dicke Risse ziehen sich durch den Putz. Die hölzernen Fensterläden hängen schief und lassen nur erahnen, dass das Haus vor vielen Jahren einmal prunkvoll ausgesehen haben muss.
Heute ist davon nicht mehr viel übrig.
Als ich den Hausflur betrete, riecht es moderig. Die Luft ist so stickig, dass man sie mit einem Messer schneiden könnte.
Wie immer klemmt der Schlüssel im Schloss der Wohnungstür, deren rote Farbe an einigen Stellen abgeplatzt ist. Erst als ich mich mit aller Kraft gegen sie stemme, bekomme ich die Tür auf.
Farblose Tapeten, zerfurchte Holzdielen und Kabel, die sich an Wänden entlangschlängeln – genau so sieht das Wort zu Hause für mich aus. Auch wenn die Wohnung dringend eine Renovierung nötig hätte, könnte sie mir kaum vertrauter sein.
Der Geruch im Flur nach frisch gewaschener Wäsche und Vergissmeinnicht steigt mir in die Nase. Doch kurz darauf weicht er einem anderen, mir leider bekannten Gestank.
»Das darf doch jetzt nicht wahr sein …«, murmle ich, werfe meine Jacke und Tasche auf die Bank neben der Tür, und laufe in die Küche.
Mum sitzt friedlich mit übereinandergeschlagenen Beinen am Esstisch und blättert durch einen Supermarktprospekt. Direkt hinter ihr quillt dicker schwarzer Rauch unter dem Deckel eines gusseisernen Kochtopfs hervor.
»Mum!«, rufe ich, und sie zuckt zusammen. Fieberhaft suche ich nach einem Backhandschuh, streife ihn mir hastig über, nehme den Topf vom Gasherd und lasse ihn mit einem lauten Knall in die Spüle fallen. Der verkohlte Inhalt des Topfes zischt und ächzt, während ich Wasser hineinlaufen lasse. Ich huste in meine Armbeuge und stoße das Fenster samt den hölzernen Fensterläden auf.
Dann wirble ich zu meiner Mum herum.
Diese sitzt immer noch auf ihrem Stuhl und blinzelt perplex.
Langsam wandert ihr Blick von dem rauchenden Topf zu mir.
»Oh«, sagt sie leise. »Was ist denn da passiert?«
Ich seufze, tief, mit rasselndem Atem. »Bist du okay, Mum?«
»Ja, mir geht es gut.« Sie antwortet in einer Seelenruhe, die nicht erahnen lässt, dass sie gerade noch neben einem brennenden Topf gesessen hat. »Warum riecht es hier so?«, fragt sie, die Stimme dünn und den Blick aus braunen Augen auf mich gerichtet.
Optisch hat sie sich die letzten Jahre kaum verändert. Ihre dunklen, zu einem Knoten hochgebundenen Haare sind mit mehr grauen Strähnen durchzogen, und die Lachfältchen um die Augen sind etwas tiefer. Der Schwung ihrer filigranen Nase ist gleich, genauso wie die Kerben ihrer Grübchen. Den schmalen Körper hat sie in eine weiße Schürze gehüllt, ein Überbleibsel aus der Zeit, als sie als Köchin im Le Louis XV, einem französischen Drei-Sterne-Restaurant in Monaco, gearbeitet hat.
»Wegen des Kochtopfes«, erwidere ich und deute auf den Übeltäter, dessen verkohlter Inhalt immer noch schwelt. »Hast du vorhin gekocht?«
Sie legt ihren Finger an den Mund und überlegt. Mein Blick wandert zu ihrem goldenen Ehering, und ich muss den Drang unterdrücken, erneut nach meinem Armband zu tasten.
Mum schaut suchend in meine Augen, als wäre meine Frage eine Prüfung. So fühlt es sich für sie wahrscheinlich auch an.
Jede Frage, die man ihr stellt, muss ihr vorkommen wie ein Test. Wie eine Klausur, für die sie mühevoll den Stoff auswendig gelernt hat, nur um ihn mit einem Mal wie bei einem Blackout zu vergessen.
Dabei gibt es Tage, an denen der Nebel in ihrem Kopf nicht so dicht ist, an anderen dafür umso mehr.
»Davon weiß ich nichts«, antwortet sie schließlich.
Ich presse die Lippen aufeinander und ergreife ihre Hand. »Hör mal, Mum. Ich weiß, dass du gern kochst, aber wir haben eine Abmachung getroffen. Dafür habe ich diesen Zettel dahin geklebt.« Ich deute auf den gelben Post-it, der auf der Abzugshaube über dem Gasherd klebt.
Wenn ich kochen möchte, rufe ich laut nach Billie, steht auf Französisch darauf geschrieben. Auch wenn Mums Englisch sehr gut ist und sie den Großteil meines Lebens fast ausschließlich Englisch mit mir geredet hat, spricht sie seit ihrer Diagnose wieder vermehrt in ihrer Muttersprache Französisch.
»Du hast mir versprochen, dass du dich daran halten wirst«, erinnere ich sie, auch wenn ich weiß, dass sie sich wahrscheinlich nicht daran erinnern kann. Als würde sie nach etwas greifen wollen, das direkt vor ihr ist, aber es einfach nicht zu fassen bekommen. Trotzdem ist es mir wichtig, mit ihr darüber zu sprechen. Ihr die Chance zu geben, in den Nebel hineinzugreifen, ohne ihr dabei etwas von ihrer Selbstständigkeit zu nehmen.
Der Ausdruck im Gesicht meiner Mum verändert sich von einer Sekunde auf die andere. Sie entzieht mir ihre Hand, als hätte sie sich an meinen Fingern verbrannt.
»Ich weiß nicht, was du von mir willst.« Wie ein bockiger Teenager, widmet sie sich wieder ihrem Prospekt, während der Rauch langsam durch das geöffnete Fenster nach draußen abzieht.
Ihre Stimmungsschwankungen haben seit ihrer Alzheimererkrankung deutlich zugenommen. Eigentlich ist sie ständig wütend, wird ausfallend und unfair. Auch früher war sie emotional und aufbrausend, in beide Richtungen. Aber mittlerweile bleibt oftmals nur die Wut übrig.
Es muss furchtbar sein, sich erinnern zu wollen, aber es nicht zu können. Dabei ist Alzheimer genauso individuell wie die Menschen, die diese Krankheit haben. Es gibt keinen Fahrplan, keine Liste, keine Vorbereitung darauf, wie sich ein Mensch unter dem Einfluss der Krankheit verändert. Dabei ist das mit dem Kurzzeitgedächtnis eine Sache, aber was tut man, wenn Geräusche, wie das Singen der Vögel oder das Öffnen einer Tür vergessen werden und immer wieder dafür sorgen, dass man in Panik verfällt? Vor ein paar Monaten haben wir alle Schranktüren in der Küche abmontiert, weil alles, was Mum nicht sofort sehen kann, in ihrem Kopf im Nichts verschwindet. Das Gleiche gilt für ihre Freunde. Je länger sie sie nicht sieht, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie sie zuordnen kann. Das sind alles Dinge, die ich in den letzten Jahren lernen musste, damit ich sie besser verstehen kann. Doch genau wie Mums Erinnerungen verpufft unser Fortschritt mit einem Mal, wenn die Symptome schlimmer werden und ich wieder ganz am Anfang stehe.
Rational gesehen weiß ich, dass ich zu wenig Zeit habe, um mich richtig um sie zu kümmern. Dass sie eigentlich einen Pflegeplatz bräuchte, den wir uns nicht leisten können. Bis ich mein Studium beenden kann, sind es noch knapp drei Jahre. Bis dahin muss ich darauf hoffen, dass ihr Zustand nicht schlimmer wird. Aber wenn Alzheimer eines ist, dann unberechenbar.
Ich stehe auf und werfe ihr noch einen letzten Blick zu, ehe ich die Küche verlasse. Im Flur sind die Wände nahezu an jeder Stelle mit Zetteln in verschiedenen Farben tapeziert.
Ich bleibe zu Hause, hier fühle ich mich sicher.
Ich bin Sylvie Davis, zweifache Mutter.
Ich spreche mit meiner Tochter Billie ab, wenn ich das Haus verlassen will.
Ich ziehe mir gerade die Schuhe aus, als ich meine kleine Schwester Lucy im Türrahmen ihres Zimmers entdecke.
»Oh, hi, Billie«, sagt sie mit ihrer hohen Stimme.
»Lucy, du bist ja schon wieder zurück aus der Schule«, sage ich.
Sie verlagert ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen und gräbt die Finger in den Stoff ihres blauen Kleides mit Blümchenprint. »Ich, äh …«, beginnt sie und schiebt sich ihre Brille mit den dicken runden Gläsern zurück auf die Nase. »Ich war nicht da.« Sie zupft an einer ihrer langen, dunkelblonden Locken und weicht meinem Blick aus. »Beziehungsweise ich war da und bin dann gegangen.«
Ich mache einen Schritt auf sie zu und gehe in die Hocke.
»Lucy«, sage ich ruhig und greife nach ihrer Hand. »Was ist los? Ist etwas vorgefallen?«
Jetzt, wo ich ihr so nah bin, sehe ich, dass sich Tränen in ihren Augen sammeln.
»Die Mädchen in der Schule waren wieder fies zu mir«, schluchzt sie und wischt sich mit dem Stoff des Kleides über das runde, gerötete Gesicht.
Es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Lucy ist großartig, das Großartigste, was mir in meinem Leben jemals passiert ist. Und das denke ich nicht nur, weil sie meine kleine Schwester ist, sondern weil sie der vermutlich enthusiastischste Mensch ist, der mir je begegnet ist. Wenn sie sich für etwas begeistert, dann steckt sie jeden damit an.
»Oh, Lucy, das tut mir so leid«, sage ich und drücke ihre Hand.
»Das wäre bestimmt nicht so, wenn ich auf ein Internat gehen könnte«, sagt sie leise.
Ich presse die Lippen aufeinander. »Du weißt, wie gern ich dir das ermöglichen würde, aber …«
»Aber das Geld reicht nicht aus, ich weiß.« Ihre Stimme klingt auf eine Art resigniert, die die Splitter meines Herzens noch tiefer in meine Brust bohren.
Lucy ist mit ihren zwölf Jahren schon fast beängstigend klug. Sie hat nur Bestnoten in der Schule, weshalb die anderen Kinder es ihr oft schwer machen. Seit Jahren wünscht sie sich, auf ein Internat zu gehen, so wie Dad früher. Stundenlang hat er uns Geschichten von Roxford Hall erzählt, einer Schule inmitten der ländlich gelegenen Yorkshire Dales in England, unweit von seiner Heimat. Aber weil die Semesterpreise so hoch sind, wird es für Lucy leider nie mehr als ein Traum sein.
»Was hältst du davon, wenn du dir etwas aus meinem Kleiderschrank aussuchst?«, schlage ich stattdessen vor. »Meinst du, das könnte dich ein bisschen aufmuntern?«
Binnen Sekunden leuchten ihre rehbraunen Augen auf. »Wirklich?«
Mein Mund verzieht sich zu einem Schmunzeln. »Ja, wirklich.«
»Auch das rote Sommerkleid?«
»Ja, auch das.«
Statt einer Antwort fällt sie mir in die Arme und bringt mich damit fast aus dem Gleichgewicht.
»Du bist die allerbeste Schwester der Welt.«
»Ja, ja. Und am Montag gehst du wieder in die Schule, okay? Auch wenn es nicht leicht ist, darfst du nicht darauf hören, was die anderen sagen. Du bist gut so, wie du bist.«
Als sie sich wieder von mir löst, sieht sie verstohlen zu meiner geschlossenen Zimmertür. »Ja und, äh, ich hole mir das Kleid später.«
Ich rapple mich auf und hebe eine Braue.
»Warum?«, frage ich, doch sie zuckt nur mit den Schultern. Dann fängt sie plötzlich an, in ihrem Rucksack zu kramen, der, soweit ich es beurteilen kann, leer ist.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich ein bisschen Zeit habe, bis ich zu meiner Schicht im Le Poisson erscheinen muss. In dieser kann ich noch einen Blick in meine Lernzettel werfen. Ich öffne meine Zimmertür und bleibe wie angewurzelt stehen.
Wider Erwarten ist der Raum nicht leer.
Auf meinem Bett sitzt ein Mann.
Und zwar nicht irgendeiner.
Ich starre in das Gesicht, das mir vertrauter kaum sein könnte. Der Blick aus seinen meerblauen Augen findet mich. Dieselben Augen, in die ich vor ein paar Wochen geschaut habe, als ich mich von ihm getrennt habe.
Kapitel 3
Billie
Blaise sitzt auf meiner Bettkante, in der Hand ein monströser Strauß roter Rosen, durch den ich sein vorsichtiges Lächeln nur erahnen kann.
Binnen Sekunden wird mir übel.
»Lucy hat mich reingelassen«, sagt er statt einer Begrüßung. Seine Stimme klingt kratzig, so als hätte er schon länger nichts gesagt.
Ich werfe einen Blick über die Schulter in den Flur zu meiner Schwester und entscheide instinktiv, dass es besser ist, wenn sie nichts von dem Gespräch mitbekommt. Entschlossen trete ich in mein Zimmer. Als die Tür hinter mir ins Schloss fällt, lässt das Klicken des Schließmechanismus mich zusammenzucken.
Blaise ist hier.
Hier bei mir zu Hause, in meinem Zimmer.
Einen Herzschlag lang kann ich ihn nur sprachlos anstarren. Sein Gesicht ist schmaler als vor ein paar Wochen. Der Dreitagebart ist ungepflegt, und auch seine dunkelblonden Haare wollen nicht so recht eine Frisur formen. Ziemlich untypisch für Blaise, der sehr eitel ist.
Man muss immer vorbereitet sein, hat er zu mir gesagt. Damit meinte er primär, man muss schick genug aussehen, um sich auf exklusive Events und Partys zu schleichen. Dort sammelt er Informationen für die nächste Titelstory der The Whisper – ein Klatschblatt, für das er als Journalist arbeitet. Aber wie soll man bereit dafür sein, dass der Ex-Freund auf einmal im Schlafzimmer sitzt?
»Was machst du hier?«, krächze ich.
Blaise rappelt sich auf und hält mir den Strauß Rosen entgegen. »Hier«, sagt er und ignoriert meine Frage. »Die sind für dich.«
Ich rühre keinen Finger.
Nicht einen einzigen Muskel.
»Was machst du hier, Blaise?«, frage ich erneut, diesmal mit Nachdruck.
Er senkt den Arm mit dem Strauß, als wäre dieser plötzlich um ein Vielfaches schwerer geworden. »Ich wollte mich bei dir entschuldigen.«
Es klingt mehr nach einer Frage als nach einer Aussage.
Mir wird heiß und kalt zugleich, und wieder sage ich nichts, warte ab und drücke meinen Rücken gegen die geschlossene Tür hinter mir, als könne ich mich durch die Fasern des Holzes hindurchpressen. Weg von ihm.
»Es tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe, und ich bereue es sehr. Ich habe es verbockt und will es wiedergutmachen.«
Ich verschränke die Arme vor der Brust, ein kläglicher Versuch, wenigstens gefühlt Abstand zwischen ihn und mich zu bringen.
»Also hast du aufgehört, dem Prinzen nachzustellen?«, frage ich, und Blaises Kiefermuskel zuckt. Er schweigt, was Antwort genug für mich ist.
Ein Schnauben verlässt meine Kehle. Der Ton ist bissig und zeichnet ihm eine tiefe Falte in die Stirn.
»Du weißt, dass das mein Job ist, Billie«, sagt er gepresst. »Seitdem die Gerüchte im Umlauf sind, dass Charles Thronfolger werden soll, ist er untergetaucht. Die ganze Stadt ist seit Wochen auf der Jagd nach ihm.«
»Das heißt nicht, dass du es ihnen gleichtun musst.«
Er fährt sich mit einer Hand durch die Haare. »Ich dachte, du hast ohnehin nicht viel für ihn übrig.«
»Meine Sympathien halten sich in Grenzen, aber es ist falsch, so in das Privatleben eines Menschen einzudringen. Apropos Privatsphäre: Du kannst nicht einfach in unserer Wohnung auftauchen und meine kleine Schwester dafür benutzen, dich hier einzuschleusen.«
Blaise wirft die Hände in die Luft, wobei die Rosen rascheln und sich einzelne Blütenblätter auf dem Boden verteilen. »Ich wollte dich sehen«, erklärt er aufgebracht. »Und was den Prinzen angeht: Er hat die Schlagzeilen in den letzten Monaten bewusst provoziert. Er will doch als Prince du scandale bekannt sein.«
»Ich kann nicht glauben, dass du immer noch der Meinung bist, dein Verhalten wäre okay. Du bist fast im Gefängnis gelandet, weil du in den Palast eingestiegen bist! Und das nur, weil du Prinz Charles auflauern wolltest!«
Blaise schweigt.
»Außerdem kannst du nicht hier aufkreuzen und glauben, dass eine Entschuldigung alles wieder wettmacht«, setze ich nach. »Du hast mich verletzt, du hast –« Mein Atem stockt, und ich balle die Hände zu Fäusten. »Du warst nicht da.«
»Ich weiß, Billie.« Er macht einen Schritt auf mich zu, und ich würde am liebsten zurückweichen. Doch die Tür versperrt mir den Weg. »Es tut mir wirklich leid. Ich will es wiedergutmachen.«
»Und ich will, dass du gehst«, sage ich mit fester Stimme. »Lucy soll nichts von diesem Gespräch mitbekommen. Außerdem habe ich dir deutlich genug gesagt, dass ich dich nicht sehen will.«
»Billie«, krächzt er.
Ich grabe meine Fingernägel in die Handballen. Für einen Moment stehen wir da, der Strauß Rosen zwischen uns, ehe Blaise die Schultern sinken lässt.
»Okay«, sagt er zu meiner Überraschung und legt den Strauß behutsam auf die Tagesdecke.
Ich mache ihm Platz, als er zur Tür geht. Seine Hand berührt bereits die Klinke, als er sich erneut zu mir umdreht.
»Da wäre noch eine Sache …« Sein Brustkorb hebt sich, als er einen tiefen Atemzug nimmt. »Auf einer Party im letzten Semester habe ich Shayla kennengelernt, deine Kommilitonin. Ich habe gehört, dass sie heute Abend auf der Party in der Villa La Vigie eingeladen ist. Vielleicht könntest du sie fragen, ob sie mich auf die Gästeliste setzt.«
In meinen Ohren hallt ein lautes Knacken wider. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, dass das Geräusch von meinem Kiefer kommt.
Natürlich. Wie um Himmels willen konnte ich glauben, dass Blaise Dupont tatsächlich hergekommen ist, um sich zu entschuldigen? Er gehört zu der Sorte Mann, bei der es immer etwas Kleingedrucktes gibt. Nach all den Jahren sollte ich das besser wissen.
»Das kannst du nicht ernst meinen«, presse ich hervor.
»Na ja, ein gutes Wort könntest du schon für mich einlegen, oder? Du weißt doch, wie lange ich bereits versuche, auf die Gästeliste zu kommen.«
»Und warum willst du hingehen? Weil du Lust auf Feiern hast oder weil die geringe Möglichkeit besteht, dass Prinz Charles auch da sein wird?«
Dieser Satz veranlasst Blaise dazu, die Türklinke loszulassen und sich ganz zu mir umzudrehen.
Mein Magen rutscht ein paar Etagen tiefer. Als ich mich von Blaise getrennt habe, habe ich gehofft, ihn nie wieder sehen zu müssen. Aber genauso, wie er das mit Prinz Charles nicht ruhen lassen kann, tut er das bei mir auch nicht. Immer wieder hat er mir geschrieben, als wäre nichts gewesen. Als hätte ich ihm nicht unter Tränen gesagt, dass er mir Angst macht mit seinem Verhalten.
»Diese Party ist meine Chance, um Redakteur bei The Whisper zu werden, Billie. Es geht für mich dabei um mehr als ein bisschen Champagner trinken.«
Ich schnaube, ungläubig darüber, wie wenig er sich selbst in den vergangenen Wochen reflektiert hat. Er ist immer noch genau derselbe skrupellose Kerl. Bereit, alles zu tun, was ihm dabei hilft, die Karriereleiter zu erklimmen.
»Lass mich raten. Diese Beförderung bekommst du nur, wenn du ihnen eine gute Story auftischst.«
»Richtig«, erwidert Blaise. »Nach Prinz Charles’ Skandalfrühling, der Jachtparty und seinem Verschwinden ist das meine Chance, die erste Story nach seinem Comeback in die High Society zu liefern. Dann ist mir der neue Job sicher.«
Seine Augen leuchten auf, als er das sagt. Gleichzeitig überrollt mich eine Welle von Wut, die so heftig ist, dass meine Hände zittern.
»Geh jetzt, Blaise«, höre ich mich mit bebender Stimme sagen.
»Ich habe Shaylas Nummer nicht mehr. Du kannst sie mir auch geben, und ich frage sie selbst –«
»Blaise«, sage ich wieder, mein Herzschlag schnell und hämmernd.
Der Ausdruck in Blaises Gesicht wird zu einer stählernen Maske, ehe er nickt.
»Ich würde mich freuen, wenn du das möglich machen könntest, und wünsche dir eine ruhige Schicht später.« Sein Blick zuckt kurz zu der gefalteten Arbeitskleidung auf meinem Bett. »Wenn du etwas brauchst, melde dich bei mir.«
Auch typisch für Blaise. Er verhält sich absolut daneben und tut danach so, als sei er der liebste Mensch auf der Welt. Aber ich weiß es mittlerweile besser.
Ich geleite ihn bis zur Haustür. Nicht, weil ich so gute Manieren habe, sondern um sicher zu sein, dass er wirklich geht. Und am besten nicht mehr wiederkommt.
»Ich dachte, dieses Mal hättest du es mit deiner Entschuldigung ernst gemeint«, sage ich, als er bereits die Treppen im Hausflur herunterläuft.
Er hält auf einer der Stufen inne. »Das tue ich, Billie. Ich hoffe, du kannst mir eines Tages verzeihen.«
Ich schnaube und schüttle den Kopf. Alles an dieser Aussage ist manipulativ, ein Sinnbild für das, was Blaise lange genug mit mir gemacht hat.
Ein letztes Mal sieht er zu mir hoch, doch sein Gesicht verschwimmt hinter aufsteigenden Tränen. Seine Worte schweben noch ein paar Sekunden in der Luft, ehe die Haustür ins Schloss fällt.
»Hoffentlich hast du nicht vergessen, wie lieb du mich hast.« Lucy taucht neben mir im Flur auf und lächelt vorsichtig.
»Wieso hast du ihn reingelassen?«
»Na ja, er hatte den Strauß dabei. Ich dachte, du freust dich darüber.«
Ich schüttle langsam mit dem Kopf. »Ich habe dir doch gesagt, dass du ihn wegschicken sollst, wenn er herkommt.«
»Also hat er sich nicht entschuldigt?«, fragt sie neugierig.
»Doch, hat er. Und dann wollte er, dass ich Shayla aus der Uni frage, ob sie ihn auf die Gästeliste für die Party in der Villa La Vigie setzen kann.«
Lucys Augen werden immer größer. »O mein Gott! Die Mädchen in der Schule reden seit Wochen über nichts anderes als diese Party. Angeblich wird auch Prinz Charles da sein!«
Wenn ich noch einmal Prinz Charles höre, springe ich aus dem Fenster. Warum sind alle so fanatisch, wenn es um diesen Typen geht, der nichts anderes als Partys, Alkohol und Frauen im Kopf hat?
»Warte mal, gehst du auch auf diese Party?«
Ich schnaube etwas überrumpelt von ihrer Frage. »Nein, aber das Le Poisson macht das Catering.« Diese Nachricht hat schon vor Wochen zu Mord und Totschlag bei der Belegschaft geführt. Fast alle haben sich freiwillig gemeldet, um dabei sein zu können.
Alle außer mir.
Ich verstehe, warum die anderen hingehen wollen – einen Blick in die Welt der Reichen und Schönen zu werfen, klingt verlockend. Aber ich muss pragmatischer denken. Caterings sind immer deutlich anstrengender, dafür habe ich aktuell nicht die nötige Kraft. Außerdem ist das Trinkgeld schlechter.
»O mein Gott!«, ruft Lucy wieder und verdreht theatralisch die Augen. Sie legt eine Hand an die Stirn, ehe sie vor meinen Füßen auf den Boden sinkt.
»Billie«, jammert sie und schlingt die Arme um meine Füße. »Du musst dich dafür einteilen lassen. Und wenn du nicht hinwillst, dann gehe ich für dich.«
Ich lache leise und schüttle den Kopf. »Du bist zwölf, Lucy. Auf keinen Fall gehst du auf eine Party.«
»Dann musst du hin«, erwidert sie.
»Ich habe mich nicht für das Catering gemeldet und werde brav im Restaurant arbeiten.«
Lucy vergräbt ihr Gesicht in ihren Händen und stöhnt. »Wieso bin ich erst zwölf und darf keine eigenen Entscheidungen treffen? Wieso ist das Leben so unfair?«
Die Sonne blendet mich durch das Fenster, als ich den letzten Knopf schließe. Eigentlich sollte die schwarze Bluse tailliert sitzen, bei mir geht sie jedoch gerade in einem runter. So ist das nun mal, wenn man sowohl eine schmächtige Oberweite als auch schmale Hüften hat.
Mein Smartphone klingelt. Ich gehe so schnell dran, dass ich die Nummer auf dem Display nicht sofort zuordnen kann. Aber das ist auch nicht nötig, weil ich die laute Stimme sofort erkenne.
»Wo zur Hölle ist sie?«, brüllt Renault, der Manager des Le Poisson, auf Französisch.
»Ich rufe sie gerade an.« Sophies Worte klingen gedämpft, so als würde sie etwas über das Mikrofon des Telefons halten. Ein Knistern ertönt, gefolgt von einem Räuspern.
»Billie? Bist du da?«
»Ja«, erwidere ich und höre im Hintergrund eine Reihe französischer Flüche.
»Wo steckst du?«, zischt sie.
Panisch stürme ich in den Flur zu der Korkpinnwand, an der meine Dienstpläne hängen. »Noch zu Hause. Ich fange doch erst um achtzehn Uhr an«, erkläre ich, während mein Blick nach dem richtigen Zettel sucht.
»Nein, du fängst heute um sechzehn Uhr an. Beziehungsweise du hättest um sechzehn Uhr anfangen müssen«, erwidert Sophie in der Sekunde, in der ich den Dienstplan entdecke.
Scheiße.
Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich damit schon eineinhalb Stunden zu spät bin.
»O verdammt, ich mache mich sofort auf den Weg«, sage ich gehetzt. Das Smartphone zwischen Schulter und Ohr geklemmt, versuche ich, auf einem Bein hüpfend meine Schuhe anzuziehen.
»Beeil dich«, raunt Sophie. »Renault ist außer sich vor Wut und –«
Ihr Satz wird abgeschnitten, ein Rauschen erklingt, dann herrscht Stille. Allerdings nur kurz.
»Allô? Isabelle?« Renaults Stimme donnert so laut aus dem Lautsprecher zu mir, dass ich das Smartphone ein Stück von meinem Ohr wegnehmen muss.
»Was fällt dir ein, bei dieser wichtigen Veranstaltung zu spät zu kommen? Die Hälfte des Essens ist noch nicht fertig, die zugehörigen Chafing Dishes sind noch nicht abgeholt worden und – Hey! Du da! Wir brauchen noch mehr Chardonnay für die Bar. Ja, jetzt! Es ist unglaublich. Putain, ist denn kein Mensch mehr in der Lage, richtig zu arbeiten?«
Renault ist einer dieser Männer, deren Stimmen grundsätzlich so klingen, als würden sie rund um die Uhr schreien. Was daran liegen könnte, dass er genau das tut. »Und nun zu dir. Ich habe weder die Zeit noch die Geduld, um auf dich oder sonst irgendwen zu warten. Es gibt genug Menschen, die mir die Schuhe küssen würden, damit ich sie im Le Poisson einstelle.«
»Ich weiß, Renault, es tut mir leid. Ich habe mich im Tag verguckt und –«
»Non«, unterbricht er mich. »Deine Ausreden interessieren mich nicht. Es kommt dich jetzt jemand abholen, und dann fahrt ihr auf direktem Weg in die Villa.«
Ich blinzle. »Villa?«