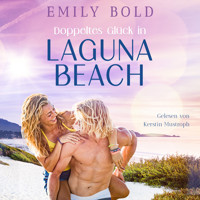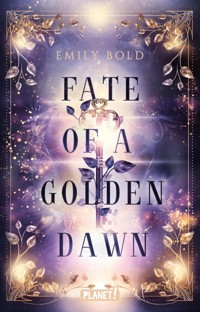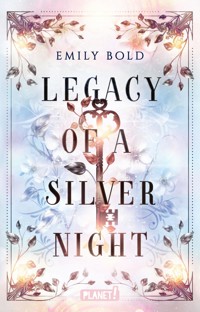12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Emily Bolds knisternde Zeitreise-Dilogie – voller Liebe, Lügen und Intrigen!
Statt in der Vergangenheit steckt Sophie nun in der Gegenwart fest – und das ohne ihren Bruder Elian und ihre große Liebe Valentin, die nach wie vor im Paris von 1688 gefangen sind. Nur eine Sache ist dabei absolut sicher: Der Teufel von Paris führt nichts Gutes im Schilde! Er will Valentin noch weiter in der Zeit zurückschicken, um die Ermordung seiner Familie ungeschehen zu machen. Sophie versucht mit aller Kraft, ihre zwei liebsten Menschen zu retten, bevor sie sie auf ewig verliert ...
Hinter schillernden Palastmauern und prunkvollen Gärten erwarten dich im mitreißenden Finale vielschichtige, interessante Charaktere und eine nervenaufreibende Liebesgeschichte – nur merke dir: Es ist nicht alles Gold, was glänzt!
//Dies ist der zweite Band der »Palast der Lügen«-Serie. Alle Romane der spannenden Liebesgeschichte im Planet!-Verlag:
-- Band 1: Vergangen ist nicht vorbei
-- Band 2: Ewig ist nicht unendlich
Die Serie ist abgeschlossen.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Das Buch
Wie weit würdest du gehen, um jene, die du liebst, zu retten?
»Ich bin abgelenkt, wenn ich meine Gefühle zulasse, Sophie«, erklärte Valentin und wollte mir seine Hände entziehen. »Ich werde Fehler machen, wenn ... und am Ende stößt dir etwas zu.
Das würde ich mir nie verzeihen.«
»Aber wir leben doch jetzt!«, versuchte ich ihm meinen Standpunkt klarzumachen. »Wir wissen nicht, was passieren wird. Es kann etwas schiefgehen, oder nicht. Das Risiko besteht doch immer.«
»Das Risiko ist größer, wenn ich nicht zu hundert Prozent bei der Sache bin!«
»Und dennoch!« Ich packte sein Gesicht und zwang ihn, mich anzusehen. »Wenn alles gut geht, dann was ...? Dann zerstören wir am Ende die Schuldscheine. Dann zerstören wir die Chronographen. Dann kehren wir in unsere Zeit zurück und ...? Was dann?
Dann sehen wir uns nie wieder?«
Die Autorin
© Privat
Emily Bold, Jahrgang 1980, schreibt Romane für Jugendliche und Erwachsene. Ob historisch, zeitgenössisch oder fantastisch: In den Büchern der fränkischen Autorin ist Liebe das bestimmende Thema. Nach diversen englischen Übersetzungen sind Emily Bolds Romane mittlerweile auch ins Türkische, Ungarische und Tschechische übersetzt worden, etliche ihrer Bücher gibt es außerdem als Hörbuch. Wenn sie mal nicht am Schreibtisch an neuen Buchideen feilt, reist sie am liebsten mit ihrer Familie in der Welt umher, um neue Sehnsuchtsorte zu entdecken.
Mehr über Emily Bold: www.emilybold.de
Emily Bold auf Twitter: @emily_bold
Emily Bold auf Facebook: www.facebook.com/emilybold
Emily Bold auf Instagram: www.instagram.com/emily.bold/
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren:www.thienemann-esslinger.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Be·trug
Substantiv, maskulin [der]
Das Täuschen, Irreführen, Hintergehen eines andern. »Ein raffiniert angelegter, ausgeführter Betrug.«
Mehr als eine Lüge
Kindern wird immer gesagt, sie sollen nicht lügen. Sie sollen vermutlich auch nicht betrügen.
Ich bin Sophie. Und ich habe gelogen. Immer. Doch zu lügen, reicht mir jetzt nicht mehr. Warum? Weil meine größten Lügen nicht verhindern konnten, dass in meinem Leben nichts mehr war, wie es sein sollte. Meine Welt war aus den Angeln gehoben. Mein Bruder Elian stand noch immer in der Schuld des Teufels von Paris. Ich stand nun ebenfalls in dessen Schuld. Und Valentin, der Junge, in den ich mich verliebt hatte, der die Rückkehr in seine eigene Zeit für mich geopfert hatte, war über 350 Jahre von mir entfernt.
Ich war nur seinetwegen wieder hier, in meiner Zeit. Weil wir den Chronographen der Zeit manipuliert hatten. Weil wir uns nicht geschlagen gaben. Weil wir bereit waren, nicht mehr nur zu lügen. Wir würden kämpfen. Wir würden uns aus der Schuld des Teufels befreien. Wir würden ihn betrügen und hintergehen, ihn täuschen und belügen. So lange, bis er die Wahrheit nicht mehr von dem unterscheiden konnte, was wir ihm als solche verkaufen würden.
Das war der Plan.
Unsere ewige Schuld würde nicht unendlich sein!
Wir würden den Teufel von Paris enttarnen, ihm seine Macht über uns nehmen und uns unser Leben zurückholen. Ich würde Valentin wiedersehen. Meinen Bruder wieder in die Arme schließen. Und für die Sicherheit meines Vaters und meiner Blutlinie sorgen.
Das war der Plan.
Es würde nicht leicht werden.
Aber hoffentlich machbar.
Es musste machbar sein.
Weil die einzige Alternative war, abzuwarten, bis der Teufel von Paris merkte, dass ich an Valentins Stelle das Paris des Jahres 1688 verlassen hatte. Abzuwarten, was er tun würde, wenn er herausfand, dass Elian den neuen und gefährlichen Auftrag, von dem ich noch überhaupt nicht wusste, worum es ging, nicht mit mir, sondern mit Valentin antrat. Welche Folgen das haben würde, war nicht zu sagen. Sicher keine guten!
Die Alternative war also, sich einfach dem Willen dieses Teufels zu überlassen und weiterhin zu tun, was immer er auf dem Pergament der Schuld einforderte.
Und mal im Ernst. Ihr kennt mich doch inzwischen ein wenig. Glaubt ihr wirklich, ich würde diese Alternative auch nur eine Sekunde in Betracht ziehen?
Natürlich nicht.
Darum duckte ich mich in den Schatten der Bäume und wartete, bis der Wachmann, der stündlich seine Runde hier drehte, an mir vorbeigegangen war. Hätte er mich hineingelassen, wenn ich ihm irgendeine Lüge aufgetischt hätte? Nein.
Und damit waren wir wieder am Anfang angelangt: Lügen reichte nicht länger aus. Ich würde härtere Geschütze auffahren müssen. Doch auch für das, was ich vorhatte zu tun, gab es einige Regeln:
Regel Nummer 1:
Niemals zweifeln.
Ich zückte den Dietrich und knackte das Schloss, so, wie ich es seit meiner Rückkehr aus der Vergangenheit unentwegt geübt hatte.
Als der Widerstand des Schließzylinders nachgab, hätte ich am liebsten laut gejubelt. Doch das sollte ich lieber lassen.
Regel Nummer 2:
Emotionen unterdrücken.
Die Freude, die ich empfand, als ich durch die Tür schlüpfte und meine Taschenlampe auf den glänzenden Marmorboden richtete, war tatsächlich hinderlich. Denn sie lenkte mich ab. Fast hätte ich die Schritte des zweiten Nachtwächters überhört, der im Inneren des Schlosses von Versailles seine Runden drehte. Ich hastete auf Zehenspitzen in eine Nische und schaltete die Taschenlampe aus. Denn ich hatte unbedingt vor, die dritte Regel zu beachten.
Regel Nummer 3:
Keine Fehler machen.
Der Wachmann ging an mir vorbei und ich wartete eine ganze Weile, bis ich sicher war, dass er auch wirklich verschwunden war. Dann huschte ich wie ein Geist durch die Flure und suchte die Ausstellungsräume ab, in denen sich die Dinge befanden, die aus der Zeit des Sonnenkönigs stammten. Ich brauchte Gewissheit. Ich brauchte einen Beweis. Und vielleicht, mit etwas Glück …
»He!« Eine Männerstimme ließ mich in der Bewegung erstarren. »Stehen bleiben! Und Hände hoch!«
Verdammt! Das mit dem Glück war mir offenbar nicht vergönnt. So hatte ich das jedenfalls nicht geplant. Doch wenn Regel Nummer drei versagte, dann galt die letzte und wichtigste Regel:
Regel Nummer 4:
Lass dich nicht erwischen.
Also rannte ich los.
Das Sterben des Feuerwerks
Versailles, 1688
Valentins leerer Blick ging in den nächtlichen Himmel. Die roten und goldenen Explosionen des Feuerwerks registrierte er kaum. Er war umgeben von Menschen. Von Höflingen und schönen Frauen. Und doch war er allein. Er ließ die Arme sinken, in denen er noch vor einem Augenblick Sophie Dubois gehalten hatte. Sie war fort. Einfach aus dieser Zeit gerissen – und niemand hatte es bemerkt. Die staunenden Ahs und Ohs um ihn herum galten nicht der Tatsache, dass seine Begleiterin sich inmitten eines rauschenden Festes in Luft aufgelöst hatte, sondern den sterbenden Farben am Himmel über Versailles.
Es war eine Minute nach Mitternacht. In einer Zeit, die nicht seine eigene war. Er hätte nach Hause in sein echtes Leben zurückkehren können. Hatte so lange darauf gewartet, endlich herauszufinden, ob … Er schüttelte den Kopf, denn sich darüber jetzt Gedanken zu machen, war absurd. Er war nicht zurückgekehrt. Er war noch immer hier. Vielleicht war es besser so.
Sich Mut machend atmete er durch und straffte die Schultern. Er fuhr sich durchs Haar und strich die Rüschen an seiner Brust glatt. Dann wandte er sich um, kehrte dem Feuerwerk den Rücken zu und verließ den Spiegelsaal. Der Blick zum Kopf des Saals zeigte, dass er nicht der Erste war, der das Fest verließ. Der König war ebenfalls gegangen.
Valentin zog nachdenklich die Augenbrauen zusammen. Vor fünf Minuten hatten er und Sophie herausgefunden, dass der König von Frankreich, Ludwig der XIV., der legendäre Sonnenkönig, ebenfalls eine Marionette des Teufels von Paris war. Sie hatten ihn ein Pergament unterzeichnen sehen, das sehr viel Ähnlichkeit mit dem Pergament der Schuld aufwies, das Valentin selbst zum Schuldner des Teufels machte. Und er hatte mit eigenen Augen den kupfernen Chronographen unter dem Umhang des Königs hervorspitzen sehen. Sophie hatte gesagt, dass eine Nachricht, die sie im einundzwanzigsten Jahrhundert auf dem Küchentisch ihrer Familie gefunden hatte, die Handschrift des Königs trug.
Valentins Schritte hallten auf dem Marmor, als er die breite Treppe hinab und aus dem Palast ging. Die Kronen der Bäume, die den Weg säumten, wurden mal rot, mal grün, dann wieder golden von den Farben des Feuerwerks beleuchtet. Doch die Schatten darunter blieben undurchdringlich. Valentin verließ den Weg und trat in einen dieser Schatten. Er verschmolz damit und wartete ab, bis das Feuerwerk erstarb. Ein letzter lauter Knall, ein letzter Funkenregen. Dann der Applaus. Valentin schloss die Augen. Er würde nicht in die Hände klatschen. Er wartete in aller Stille. Von seinem verborgenen Platz hinter dem Stamm einer Eiche aus hatte er freie Sicht auf alle, die aus dem Palast traten. Doch nicht jeder, der ging, interessierte ihn. Er wartete auf eine bestimmte Person. Und er musste nicht lange warten.
Elian Dubois war einer der Ersten, die das Lichterfest nach dem Ende des Feuerwerks verließen. Er war in Begleitung einer jungen Frau, von der Valentin wusste, dass sie noch keinem hier am Hofe je vorgestellt worden war. Ein Schmunzeln stahl sich auf seine Lippen, als er sich ausmalte, wie die Leute wohl reagieren würden, wüssten sie, dass die rothaarige Schönheit an Elians Arm in Wahrheit eine einfache Zofe war und im Dienste des Comte Dubois stand. Sie wären schockiert. Ebenso wie die Frau, die Elian und seiner Begleiterin in kurzem Abstand folgte. Estelle Dubois, Elians Tante – zumindest war sie das für den Rest der Welt. Denn niemand, abgesehen von Valentin, würde verstehen, dass Estelle in Wahrheit eine Vorfahrin von Elian war.
Gerade wirkte Estelle überfordert. Zu sehen, dass ihre Zofe ein Fest des Königs von Frankreich aufsuchte, war für sie erschütternder, als dass ihre Nichte verschwunden war, weil ein Chronograph sie aus dieser Zeit gerissen und in die Zukunft befördert hatte.
Zumindest nahm er das an, denn als er Estelle zuhörte, wurde ihm klar, dass sie das ja noch gar nicht mitbekommen hatte.
»Elian? Wo ist eigentlich Sophie? Ich habe sie aus den Augen verloren«, hakte sie nach und machte einige schnelle Trippelschritte, um zu Elian aufzuschließen.
Valentin straffte die Schultern und trat hinter der Eiche hervor. Mit einer angedeuteten Verbeugung gesellte er sich zu den dreien und vergewisserte sich mit einem knappen Blick über die Schulter, dass sie von niemandem beobachtet wurden.
»Was machst du denn noch hier?«, wunderte sich Elian und sein Blick verfinsterte sich. »Der Teufel von Paris hat dir doch gegeben, was du so dringend wolltest. Dein Ticket nach Hause. Mitternacht ist vorüber. Solltest du nicht …?«
Valentin erwartete nicht, dass Elian mit dem Verlauf des Abends zufrieden sein würde. Doch immerhin hatte er dafür gesorgt, dass Sophies Bruder nicht aufgeflogen war. Ein klein bisschen Dankbarkeit wäre das Mindeste.
»Ich weiß, dass es nicht so gelaufen ist, wie geplant«, gab er zu. »Aber wichtig ist nur, dass Sophie vorerst sicher ist. Sie ist zu Hause. Und der Teufel von Paris hat nicht bemerkt, dass wir gemeinsam gegen ihn gearbeitet haben. Es ist also auch nicht schlecht gelaufen.«
»Wie ist sie denn nach Haus gekommen?«, hakte Estelle verwundert nach. »Hat Rémi sie etwa gefahren?«
Valentin räusperte sich. Er hatte sich wohl unklar ausgedrückt. »Zu Hause in ihrer Zeit«, räumte er das Missverständnis aus.
»Wie das?« Elian ließ Lucilles Arm los und kam auf ihn zu. »Der Teufel hat unseren Chronographen der Zeit. Also, wie …?«
»Sie war so in Sorge, dass euer Vater nicht weiß, was aus euch geworden ist, dass ich ihr meinen Chronographen überlassen habe.« Valentin nahm das filigrane Bauteil in Form eines Tigers aus seiner Brusttasche. »Wir haben es durch Sophies Schlangenzeiger ersetzt und …«
»Ihr habt was?!« Elian versetzte ihm einen Stoß gegen die Brust. »Habt ihr den Verstand verloren?«, brüllte er und kniff die Augen gefährlich zu Schlitzen. »Weißt du, wie ein Chronograph funktioniert? Weißt du etwa, wie er zusammengebaut sein muss, um jemanden sicher durch die Zeit zu bringen? Oder gar in die richtige Zeit?« Elian rieb sich über den Kopf, sodass sich das Samtband, das seine schulterlangen Haare zusammenhielt, löste und auf den Boden fiel. »Merde!«, fluchte Elian und boxte Valentin erneut gegen die Schulter. »Ich dachte, du passt auf sie auf!«, schimpfte er. »Ich schwöre, ich bringe dich um, wenn ihr etwas zugestoßen ist!«
»Elian«, flüsterte Lucille und blickte scheu zurück zum Palast. »Da kommen Leute. Sollten wir nicht besser …«
»Das Mädchen hat recht«, stimmte Estelle energisch zu und reckte ihr Kinn in die Höhe. »Dies ist kein Gespräch für fremde Ohren. Besser, wir setzen es bei uns zu Hause fort. Ich denke, Albert wird hören wollen, was geschehen ist«, erklärte sie bestimmt.
Valentin wartete, denn trotz der eindringlichen Ansprache der Comtesse, starrte Elian ihn noch immer unverhohlen feindselig an. Erst, als Lucille ihn am Ellbogen berührte, wurde sein Blick milder.
»Schön. Fahren wir in die Maison de Dubois.«
»Ich kann nicht«, widersprach Valentin und atmete tief durch. »Ich komme morgen zu euch, um alles zu besprechen, aber …«
Sofort wurde der Ausdruck in Elians Zügen wieder ernst. »Was soll das bedeuten?«, verlangte er zu erfahren. »Was hast du vor? Warum kommst du nicht gleich mit uns?«
»Das geht dich nichts an.«
»Und wie mich das was angeht!« Elian baute sich drohend vor ihm auf. »Du sagst mir auf der Stelle, was …«
»Ich sage dir überhaupt nichts. Was ich tue, geht nur mich etwas an.«
»Ich traue dir nicht!«, presste Elian wütend heraus. »Du hast dich an meine Schwester rangemacht und paktierst irgendwie mit dem Teufel von Paris.«
Valentin biss die Zähne zusammen. Seine Geduld war am Ende. »Ich paktiere nicht mit dem Teufel! Und ich habe mich nicht an deine Schwester rangemacht! Ich habe sie beschützt – nachdem du sie in Gefahr gebracht hast. Dass sie sich in mich verliebt, war nie geplant.« Valentin ballte die Fäuste. »Und glaub mir, es war alles leichter, als ich keine Gefühle für sie hatte!« Damit wandte Valentin sich um und ließ die Dubois stehen. Er konnte jetzt nicht mit ihnen gehen. Er musste allein sein. Brauchte etwas Zeit, um zu verstehen, welche Folgen die Entscheidungen des heutigen Abends für ihn haben würden.
Er drängte den Schmerz zurück, der bei dem Gedanken an seine Familie in seiner Brust aufwallte. Er wollte nicht an zu Hause denken. Nicht an seine eigene Zeit. Nicht an den Kummer, den seine Familie womöglich durchlebte, weil sie nicht wusste, wo er war, oder wie es ihm ging. Ob sie nach vier Jahren überhaupt noch mit seiner Rückkehr rechneten? Ob sie ihn nicht längst für tot erklärt hatten?
Mehrfach schluckte er, um die Enge in seiner Kehle zu lösen. Sich diese Fragen zu stellen war schmerzhaft. Und dabei konnte es durchaus noch viel schlimmer sein. Was, wenn seine schlimmsten Befürchtungen sich bei seiner Rückkehr bewahrheiten würden? Er verbot sich diesen Gedanken. Er war zu schrecklich, als dass er ihn auch nur in Betracht ziehen konnte. Lieber würde er sterben, als sich diese furchtbare Möglichkeit auch nur im hintersten Winkel seines Herzens auszumalen.
Niemand war tot. Er war nicht tot. Und auch sonst niemand. Er war hier. Und er war allein. Einsamer als vor dem Tag, an dem er Sophie Dubois am Brunnen des Apollo zum ersten Mal gesehen hatte. Einsamer, weil er sie nicht mehr berühren konnte. Nicht mehr küssen konnte.
Valentin biss sich auf die zitternde Lippe. Er unterdrückte jedes Gefühl von Verlorenheit, auch wenn die Kälte in seinem Herz mit jedem Atemzug zunahm. Für Sophie hatte er die Rückkehr in seine Zeit aufgegeben. Und nun war sie fort. Natürlich hatte er das gewusst, doch richtig bewusst geworden war es ihm erst, als der Chronograph sie ihm regelrecht aus den Händen gerissen hatte.
Valentin blieb stehen und streckte die Hände aus, als würde er sie noch immer berühren. Die weißen bauschigen Ärmel seines Hemdes fielen ihm wie Glocken über die Finger und verbargen, dass seine Hände leer waren. Doch das musste er gar nicht sehen, um es zu wissen. Seine Hände waren leer. Sein Herz war leer. Und er wusste nicht, woher er die Kraft nehmen sollte, gegen diese Leere anzukämpfen.
Er berührte seine Lippe und dachte an ihren ersten Kuss. Ein Kuss, um die Leute zu täuschen. Ein Kuss, um zu verheimlichen, was sie in den dunklen Fluren von Versailles getan hatten. Ein Kuss, der eigentlich eine Lüge gewesen war – der aber die ganze Wahrheit seines Herzens enthalten hatte. All seine Sehnsucht nach Sophie hatte in diesem Kuss gelegen. Unverblümt. Ehrlich. Und von so trauriger Wahrheit, dass er sich nicht vorstellen konnte, in Zukunft ohne Sophie weiterzumachen. Warum nur hatte er sie gehen lassen? Warum hatte er ihr seinen Chronographen gegeben? Aus Liebe?
Valentins Kehle entrang sich ein heiseres Schluchzen. Aus Liebe – wie rührselig. Er biss die Zähne so fest zusammen, dass sein Kiefer knackte. War er ein rührseliger Narr? Er schüttelte den Kopf und verbot sich seine Gefühle. Seine Trauer. Seinen Schmerz.
Nein, nicht aus Liebe. Es war dumm, sich etwas vorlügen zu wollen. Es gab andere Gründe. Schwerwiegendere.
Er straffte die Schultern und kehrte ins Schloss zurück. Es gab gute Gründe, noch hier zu sein. Gute Gründe, diese Zeit noch nicht zu verlassen. Gute Gründe, nicht nach Hause zurückzukehren.
Die Zeit der Schlange
Maison de Dubois, heute
»Wo zum Teufel warst du die ganze Nacht?«
Ich zuckte zusammen und die Haustür fiel mit einem lauten Rumms ins Schloss, dabei hatte ich vorgehabt, diese lautlos zu schließen. Als ich mich umdrehte, stand mein Vater im dämmrigen Morgenlicht vor mir und wartete vorwurfsvoll auf eine Erklärung.
Zitternd holte ich Atem, doch Clément hob mahnend den Finger. »Und wage es nicht, mich anzulügen!«
»Gott, Papa!« Ich seufzte und rollte mit den Augen. »Das wirst du mir jetzt ewig vorhalten, richtig?«
»Natürlich! Du hast mich schließlich schon einmal angelogen. Mich getäuscht und mit Schlaftabletten betäubt. Denkst du, so was vergisst man einfach?«
Ich schlüpfte aus meiner schwarzen Lederjacke und nahm die Baseballkappe ab, die ich mir übergezogen hatte, um unerkannt zu bleiben. »Ich habe nicht erwartet, dass du es vergisst. Aber du weißt ganz genau, dass ich keine andere Wahl hatte. Ich musste verhindern, dass du dich in Gefahr begibst«, versuchte ich mein Handeln erneut zu rechtfertigen. Seit ich aus 1688 zurück war, machte ich das jeden Tag. Immer wieder musste ich mir Vaters Vorwürfe anhören, wie leichtfertig ich unser aller Leben riskiert hatte und wie sehr ich ihn mit meiner Lüge enttäuscht hatte.
»Ich war auch in Gefahr, obwohl du diese Dummheit gemacht hast!«, schimpfte Clément weiter.
»Das ist ziemlich unfair von dir«, wehrte ich mich und fuhr mir durch die blonden Haare. Ich kämmte sie mit den Fingern durch, bis sie mir in sanften Wellen bis über die Schulter fielen. »Niemand hätte ahnen können, dass es mehr als einen Chronographen der Zeit und mehr als eine Familie gibt, die in der Schuld des Teufels steht.« Ich wollte die Treppe hinauf, weil ich wusste, dass mein Vater mir wegen der alten Kopfverletzung, die er sich vor Jahren bei der Erfüllung eines Auftrags für den Teufel von Paris geholt hatte, kaum folgen würde. Mit der Hand am Treppengeländer stieg ich die ersten Stufen hinauf. »Niemand hat damit gerechnet, dass man den legendären Sonnenkönig hierherschicken würde, um dich zu fesseln und dort vorne ins Torhäuschen zu sperren!« Ich beugte mich übers Geländer, um Papa in die Augen sehen zu können. »Du sagst, du hättest Elian retten wollen – doch du konntest dich nicht mal dagegen wehren, in deinem eigenen Haus überwältigt zu werden. Von Ludwig dem XIV.! Und ich habe den persönlich gesehen – er ist eindrucksvoll, aber ganz sicher nicht der stärkste Kämpfer!« Ich versuchte, meine Wut nicht zu sehr mitklingen zu lassen, auch wenn das schwer war. Entschlossen straffte ich die Schultern. »Ich denke also, dass ich alles richtig gemacht habe!«
Papa schnaubte. Ihm stand der Schweiß auf der Stirn und ich unterdrückte den Impuls, zu ihm zu gehen und seine Stirn zu fühlen. Ihm ein Glas Wasser zu reichen, damit er sich beruhigte. Ich war viel zu wütend dafür. Ich wollte, dass er mir endlich mal etwas zutraute. Dass er aufhörte, mir ständig Vorhaltungen wegen meiner Reise durch die Zeit zu machen. Ich hatte Elian retten wollen. Und im Grunde war ich sogar erfolgreich damit gewesen. Ich hatte ihn gefunden. Hatte verhindert, dass der Teufel von Paris herausfand, was Elians eigentliche Absicht gewesen war. Und ich hatte – zumindest teilweise – die Schuld meiner Familie beglichen, indem ich die Goldene Libelle von Lyon gefunden hatte – wenn auch nur eine Fälschung davon. Und zudem hatten Valentin und ich herausgefunden, dass der Sonnenkönig ebenfalls in der Schuld des Teufels stand.
»Hör zu, Papa«, setzte ich sanfter nach, denn der Gedanke an Valentin machte mich traurig. Wann immer ich an ihn dachte, fühlte ich mich allein. Ich zwang mich, Papa anzulächeln, denn immerhin hatte ich eine Familie. Im Gegensatz zu Valentin, der die Rückkehr zu seiner Familie aufgegeben hatte, damit ich hierher zu Vater kommen konnte. Da war ich es ihm zumindest schuldig, nicht mit meinem Vater zu streiten. »Du musst mir vertrauen. Ich bin nicht so hilflos, wie du denkst. Ich … hab einen Plan«, versicherte ich ihm und suchte in seinen Gesichtszügen nach Verständnis.
Clément hielt sich am Treppenpfosten fest und sah zu mir hinauf. Verständnis erkannte ich jedoch nicht in seinem Gesicht. »Du hast mich angelogen, Sophie – es fällt mir schwer, dir wieder zu vertrauen.«
Vaters Worte hallten schmerzlich in meinem Innersten wider, als ich mich in meinem Zimmer aufs Bett fallen ließ. Wie ein Baby rollte ich mich auf der Seite zusammen und ließ meinen Blick zum Chronographen auf meinem Nachttisch schweifen. Das goldene Uhrwerk mit den vielen Zahnrädern und dem Schlangenzeiger lag reglos da. Kein Ticken war zu hören, keines der Rädchen war in Bewegung. Es war, als würde die Zeit stillstehen. Und genauso fühlte es sich an. Ein weiterer Tag war vergangen und ich hatte kaum etwas erreicht. Ich hatte sämtliche Porträts von Ludwig dem XIV. studiert, war drei Tage hintereinander nach Versailles gefahren, um dort das Schloss und die Überbleibsel aus der damaligen Zeit zu studieren, und da den Besuchern nicht alle Räume zugänglich waren, hatte ich mir heute Nacht dort Zutritt verschafft.
Mir hämmerte noch immer das Herz, wenn ich daran dachte, wie knapp ich dem Wachmann entkommen war. Ich hatte mich in Ludwigs ehemaligem Schlafgemach versteckt und war dann durch die Räume der Königin ungesehen entkommen. Doch zufrieden war ich mit meinem Einbruch nicht. Ich hatte gehofft, den Chronographen irgendwo unter den Hinterlassenschaften des Sonnenkönigs zu finden, um mit seiner Hilfe entweder Valentin in dessen Zeit zurückkehren zu lassen, oder Elian die Möglichkeit zu geben, zurück nach Hause zu kommen. Ein zusätzlicher Chronograph wäre auf jeden Fall hilfreich. Doch so langsam hatte ich keine Idee mehr, wo ich noch danach suchen sollte.
Allerdings war mir etwas anderes ins Auge gestochen. Etwas, das mir Rätsel aufgab und das ich nicht so ganz verstand. Es war Teil eines Gemäldes, das nicht der Öffentlichkeit zugänglich war. Es war unvollendet und womöglich ergab das, was ich darin zu sehen glaubte, auch deshalb keinen Sinn. Ich zog mein Handy heraus und betrachtete das Foto auf dem Display, das ich von dem Gemälde gemacht hatte.
Doch je länger ich es betrachtete, umso weniger Sinn ergab es. Frustriert schob ich das Handy auf den Nachttisch und zog mir die Bettdecke bis ans Kinn. Ich war echt übermüdet. So müde, dass meine Augen mir Streiche spielten? Ich blinzelte und sowohl mein Smartphone als auch der Chronograph verschwammen vor meinen Augen. Ich musste morgen deutlich mehr erreichen. Etwas herausfinden, oder etwas unternehmen. Sonst würde ich vollends den Glauben daran verlieren, dass ich Valentin und Elian noch einmal wiedersehen würde. Ich wollte zu ihnen zurückkehren. Und ich musste darauf vorbereitet sein, das zu tun.
Ich ballte die Fäuste unter der Decke und schluchzte in mein Kissen. Stunden und Tage waren seit meiner Rückkehr vergangen. Endlose Tage, an denen der Chronograph keinen Mucks von sich gegeben hatte und kein einziges Wort auf dem dämlichen Pergament der Schuld erschienen war. Es war, als hätten mich Elian und Valentin einfach vergessen. Genau wie der Teufel von Paris. Ich war raus aus der Zeit. Raus aus der Nummer. Und das gefiel mir überhaupt nicht!
Nicht, dass ich die Gefahren vermisste, denen ich in der Vergangenheit ausgesetzt gewesen war. Mich schauderte noch immer, wenn ich an den Überfall in Paris dachte, an die hungrigen Kinder, die mir in ihrer Not und Verzweiflung selbst die Stiefel gestohlen hatten. Das hätte übel für mich ausgehen können, hätte mich nicht Valentin Delacroix gerettet. Ich schloss die Augen, doch sein Bild sah ich dennoch deutlich vor mir. Eine Hose aus dunklem Leder, ein ebensolcher Umhang, der ihm über eine Schulter bis gegen die Waden fiel. Metallene Schnallen, die das Wams an seiner Brust verschlossen und die Konturen seines Körpers betonten. Dazu die Stiefel und der Degen an seinem Gürtel. Er hatte vor mir gestanden wie ein Musketier. Ein dunkler Retter in den letzten Stunden der Nacht. Das Graublau seiner Augen, das mich regelrecht durchbohrt hatte, und dann seine schützenden Arme, als ich vor ihm auf dem Pferd gesessen hatte. Noch immer spürte ich seinen Atem auf meiner Haut, das Prickeln, das mich bei jeder unserer Berührungen durchlaufen hatte. Das Knistern, als er mich beim Tanz an der Taille gefasst und hochgehoben hatte, oder als er in der Kutsche seine Hand in mein Haar hatte gleiten lassen und mich geküsst hatte. Sein Lächeln, das er nie zu verlieren schien …
Nein, die Gefahren der Vergangenheit vermisste ich nicht. Doch ich starb vor Sehnsucht nach diesem Lächeln. Vor Sehnsucht nach meinem Begleiter und Beschützer. Nach Valentin Delacroix.
Seufzend entwich mir ein müder Atemzug und wie immer, seit ich zurück war, geleitete die Erinnerung an Valentin mich in den Schlaf. Er war Teil all meiner Träume und ich wünschte, nie wieder aus diesen zu erwachen.
Was ist eigentlich geschehen?
Maison de Dubois, 1688
Angespanntes Schweigen lag über dem Salon und obwohl die Fenster geöffnet waren, konnte man nicht einmal das Zwitschern der Vögel hören. Nur das Ticken der Standuhr hallte wie Donnerschläge durch die ansonsten ohrenbetäubende Stille.
Valentin strich sich übers Revers und tippte sich ungeduldig mit dem Finger gegen den Oberschenkel. Dann endlich öffnete sich die Tür und Albert Dubois vervollständigte, auf seinen Gehstock gestützt, die Zusammenkunft.
»Da sind wir nun«, stellte Albert fest und nickte jedem einzeln zu. Seiner Frau Estelle, danach Elian und schließlich Lucille.
Valentin bemerkte Alberts leichtes Zögern, als dessen Blick die Zofe streifte, die – anders als beim königlichen Lichterfest am Vortag – wieder in ihre übliche Hausmädchentracht geschlüpft war. Das weiße Kopftuch bedeckte ihre rostroten Locken und das Schultertuch verhüllte einen Großteil ihrer Figur. Sie saß in einem der vier gepolsterten marineblauen Sessel und hielt den Blick höflich gesenkt. Valentin ahnte, dass sie sich nicht gerade wohlfühlte.
Albert hinkte zu einem freien Sessel, ließ sich mit einem kaum vernehmbaren Stöhnen nieder und fasste sich dann an den Kopf, als wollte er den Sitz seiner Perücke prüfen.
»Ich wäre dankbar zu erfahren, was sich in den letzten Stunden ereignet hat«, setzte er an und musterte Elian. »Was ist in Versailles geschehen? Wo warst du zuletzt und wo ist deine Schwester abgeblieben?«
Elians kantiger Kiefer zuckte. »Ich entschuldige mich bei dir, Albert«, erwiderte Elian ohne echte Reue in der Stimme. »Ich musste meine Entführung vortäuschen und mir Zeit verschaffen. Ich habe versucht, die Identität des Teufels von Paris herauszufinden, um unsere Familie aus dieser niemals endenden Blutschuld zu erlösen.«
Alberts Miene verfinsterte sich. »Ich habe diese Blutschuld geleistet. Du hast kein Recht, das Wort, das ich diesem Mann gegeben habe, zu brechen. Weißt du, was uns droht, wenn der Teufel von Paris von deinen Ränken erfährt?«
»Natürlich weiß ich das. Und mir ist bewusst, dass du ihm dein Wort gegeben hast. Doch weder mein Vater noch ich haben dem zugestimmt. Wir sind dazu verdammt, zu tun, was immer dieser Teufel fordert – weil du es so gewollt hast.« Elian stieß sich vom Kaminsims ab, an dem er gelehnt hatte, und trat an Lucilles Seite. Er berührte ihre Schulter und schenkte ihr ein aufmunterndes Lächeln. »Ich will mich nicht beschweren, Albert. Versteh mich nicht falsch. Ich bin froh, dass mich der Chronograph hierhergebracht hat. Ich bin glücklich, Lucille dadurch begegnet zu sein. Doch mir reichen die drei Tage nicht länger, die mir der Teufel je Auftrag zur Verfügung stellt. Ich kann nicht akzeptieren, dass dieser Mann die Macht besitzt zu bestimmen, wann und in welcher Zeit ich mit welchen Menschen mein Leben teile.«
Alberts Gesichtsfarbe hatte einen ungesunden Rotton angenommen. »Dann riskierst du die Existenz deiner Blutlinie für eine Zofe?« Albert schüttelte den Kopf. »Das ist inakzeptabel!«
Valentin räusperte sich. Das Gespräch entfernte sich immer weiter von dem, weshalb er eigentlich hergekommen war. »Ich denke, dass Elian auf eigene Faust gehandelt hat, weil er diese Reaktion erwartet hat«, mischte er sich kritisch ein. »Und ich kann nicht sagen, dass ich sein Handeln gutheiße, doch darüber zu streiten scheint mir sinnlos in Anbetracht der Tatsache, dass es nun nicht mehr zu ändern ist.« Valentin trat ans geöffnete Fenster und atmete die milde Nachmittagsluft ein. »Ich würde lieber darüber reden, was wir auf dem Lichterfest erfahren haben – und wie es nun weitergehen soll.«
Elian schnaubte laut. »Wir haben erfahren, dass man dir nicht trauen kann!«
»Du verstehst noch immer nicht, was sich in Wahrheit zugetragen hat. Ich habe dir das Leben gerettet«, wehrte sich Valentin gelassen. »Der Teufel von Paris war sich sicher, dass du ihn hintergehst. Ich habe ihn davon überzeugt, dass weder du noch Sophie in ein Komplott gegen ihn verwickelt seid. Deine Schwester kannte den Plan und hat überzeugend gelogen. Du solltest uns dankbar sein.«
»Dankbar?« Elian schüttelte den Kopf. »Wofür? Du hast deinen Auftrag erfüllt, oder? Du hast deinen Chronographen zurückerhalten und das Vertrauen des Teufels von Paris zurückerlangt. Nicht wir. Im Gegenteil. Nun steht auch noch Sophie in der Schuld dieses Bastards!«
»Sophie ist in Sicherheit. Dafür habe ich gesorgt«, erklärte Valentin, auch wenn er das Misstrauen aller anderen im Raum ihm gegenüber spürte. »Ich werde an ihrer Stelle den Auftrag erfüllen, den der Teufel ihr erteilt.« Er zog das Pergament aus der Tasche seines Justaucorps und hielt es hoch. »Was immer er von ihr verlangt, ich werde es tun.«
»Was könnte er verlangen?«, wollte Estelle wissen. Die Comtesse umklammerte das kleine Riechsalzfläschchen, das sie an einer Kette um den Hals trug, jederzeit bereit, einer drohenden Ohnmacht entgegenzuwirken.
»Er hat gesagt, es wird der wichtigste Auftrag, den er je erteilt hat«, antwortete Elian nachdenklich. »Ich schätze, wir müssen uns auf einiges gefasst machen.«
»Du meiner Treu!« Estelle legte sich die Hand an die Stirn. »Was mag das bedeuten?«
»Was immer es heißt – Elian muss sich dem nicht allein stellen. Ich werde ihm helfen. Und zugleich werden wir herausfinden, wie wir uns von unserer Schuld befreien«, meinte Valentin und sah Lucille an. »Einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir beim Lichterfest unternommen.« Er nickte auffordernd. »Sagt, Mademoiselle: Konntet Ihr erkennen, wer der Teufel von Paris ist?«
»Mademoiselle? Ich?« Lucille war verwirrt, weil er sie so formell ansprach. »Ich …«
»Ihr wart bei Hofe«, erklärte er, warum er das tat. »Ihr habt Euch tapfer geschlagen und ich denke, es kann durchaus sein, dass wir Eure Hilfe noch öfter benötigen werden. Außerdem …« Er zwinkerte Elian zu. »Wenn der Neffe des Comte Dubois um Euch wirbt, dann solltet Ihr auch von anderer Seite Höflichkeit erfahren.«
Ein Schnauben aus Alberts Richtung zeigte Valentin, dass der seine Anspielung durchaus verstanden hatte.
»Du meiner Treu!«, japste auch Estelle und schnüffelte nun tatsächlich an ihrem Riechsalz. »Jetzt wissen schon die Diener Bescheid. Das ist eine Katastrophe.«
»Sie ist weit mehr als eine Zofe«, widersprach Elian und legte Lucille die Hand auf die Schulter. »Ich liebe sie und wenn das alles hier vorüber ist, werde ich mit ihr zusammen sein.«
Albert riss die Augen auf. Er tupfte sich den Nacken mit einem Taschentuch ab und wischte sich dabei auch gleich über die Stirn. »Das besprechen wir besser zu gegebener Zeit«, meinte er streng und sein missbilligender Blick heftete sich auf das Hausmädchen. Dann auf Elian und Valentin. »Ihr könnt nicht einfach eine Zofe aus meinem Haushalt bei Hofe einführen, als wäre sie eine Adelige. Was, wenn jemand Lucille erkennt?«
»Kein feiner Herr schenkt je einem aus der Dienerschaft Beachtung, Monsieur«, informierte ihn Lucille.
»Elian offenbar schon«, brummte Albert verstimmt.
»Ich denke, Lucille hat recht«, ergriff Valentin erneut das Wort. »Niemandem wird die Ähnlichkeit auffallen. Und wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können.«
»Aber doch nicht schon wieder die Hilfe einer Frau! Habt ihr aus dem Dilemma mit Sophie denn nichts gelernt?«
Valentins Mundwinkel zuckten. Albert Dubios hatte offenbar ein echtes Problem mit der Emanzipation. »Konntet Ihr denn nun sehen, wie uns der Teufel von Paris gefolgt ist?«, kehrte Valentin zu seiner eigentlichen Frage an Lucille zurück und überging damit Alberts Beschwerde.
Lucilles Wangen röteten sich und sie knetete ihre Hände. »Ich habe einen Mann gesehen, der nach euch die Bibliothek betreten hat«, sagte sie und nickte. »Er war groß. Dunkelhaarig.« Sie deutete auf Valentin. »Er trug das Haar ganz ähnlich wie Ihr das Eure. Ohne es mit einer modischen Perücke zu bedecken.«
»Kanntest du den Mann?« Estelle starrte die Zofe mit großen Augen aufgeregt an. »Kennen wir ihn?«
Lucille schüttelte den Kopf. »Nein, Comtesse. Leider kenne ich nicht seinen Namen. Er war noch nie hier zu Gast, soweit ich das sagen kann.«
Albert lüpfte seine Perücke an der Stirn etwas und kratzte seinen Haaransatz. »Dann ist es keiner, mit dem wir regelmäßig verkehren«, schlussfolgerte er. »Womöglich kein Mann von Rang und Namen.«
Lucille nickte. »Das denke ich auch, Monsieur.« Sie knetete den Stoff ihrer Schürze zwischen den Fingern und warf Elian einen Blick über die Schulter zu. »Nachdem er die Bibliothek wieder verlassen hat, ist er nicht in den Spiegelsaal gegangen. Und hat auch mit keinem der Anwesenden gesprochen, lediglich zugenickt hat er einigen, als würde er sie flüchtig kennen, doch keiner der anderen Gäste schien erpicht, ein Gespräch mit ihm zu beginnen.« Sie runzelte nachdenklich die Stirn. »Ich würde fast sagen … er ist tatsächlich kein Höfling.«
»Wer ist er dann?« Estelles Finger waren so fest um ihr Riechsalzfläschchen geballt, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Wer käme sonst an so einem Tag in den Palast?«
»Er ist kein Höfling, meint Lucille«, überlegte Valentin laut. »Aber er kennt sich in Versailles aus. Er lässt seine Lieferung aus dem Hafen dort abgeben und er hat Zugang zur Palastküche, denn unser Wein wurde mit etwas versetzt, das unsere Sinne betäubt hat.«
»Er geht dort ein und aus«, stieg Elian in Valentins Überlegungen mit ein.
»Und er hat den König in der Hand.« Valentin strich sich über die Knopfleiste des Justaucorps. »Sophie und ich haben gesehen, dass er ein Pergament der Schuld gelesen hat, ehe er sich urplötzlich erhob und den Saal verließ. Dabei fiel uns ein Gegenstand unter seinem Mantel auf. Der König trug einen Chronographen der Zeit bei sich. Daran gibt es keinen Zweifel.«
Laut schnaufend hielt Estelle sich das Riechsalz unter die Nase. Tränen stiegen ihr in die Augen und sie wankte leicht. »Du meiner Treu!«, japste sie wie üblich und fasste sich dann theatralisch ans Herz.
»Der König? Ein Schuldner des Teufels von Paris?«, horchte Albert auf.
»Oder er ist der Teufel in Person«, überlegte Elian stirnrunzelnd.
Valentin schüttelte den Kopf. »Das glaube ich nicht. Denk an die Giftaffäre, die einst mein Auftrag war. Ich lehnte es ab, falsche Beweise im Umfeld des Königs zu streuen, woraufhin ich das Vertrauen des Teufels verlor«, erinnerte er Elian. »Wäre der König selbst der Teufel – was hätte das dann für einen Sinn gehabt? Außerdem bin ich am Abend des Lichterfestes nach dem Feuerwerk zurück in den Palast. Ich habe nach dem König gefragt und mir wurde gesagt, dass er sich nicht wohlfühle und sich einige Tage zurückziehen würde.« Valentin hob vielsagend die Augenbrauen. »Einige Tage – vielleicht drei Tage, um einen Auftrag für den Teufel zu erfüllen?«, stellte er eine Vermutung auf.
Lucille fuhr ruckartig in die Höhe. »Was, wenn die Giftaffäre dazu diente, den König in die Schuld des Teufels zu treiben? Was, wenn er die Giftanschläge und Beweise fälschte, um den König dazu zu bringen, sich Schutz suchend dem Teufel anzuvertrauen, um einem Giftanschlag zu entgehen?«
»Das wäre eine gute Erklärung – aber es sagt uns immer noch nicht, wer der Teufel ist, richtig?«
Lucille ließ die Schultern wieder hängen. »Nein. Das nicht.«
Valentin hatte die Zofe nicht entmutigen wollen. Darum schenkte er ihr ein Lächeln. »Das ist nicht schlimm. Immerhin wisst Ihr nun, wie der Teufel aussieht. Und wir wissen, dass er sich regelmäßig im Palast aufhalten muss. Das heißt, wir werden ihn finden.«
»Und dann?« Albert klang nicht begeistert. »Was dann?«
»Dann holen wir uns unser Leben zurück!« Elian ballte die Fäuste. »Wir zerstören die Pergamente der Schuld und zwingen ihn, uns aus seinem Dienst zu entlassen!« Elian zog Lucille aus dem Sessel und legte ihr die Hand an die Taille. »Aber vorher finden wir heraus, wie er die Zeit steuert, denn ich habe nicht vor, mein Leben in einer Zeit zu verbringen, in der du nicht sein kannst.« Sein Blick wurde zärtlich und Valentin verspürte einen Stich der Eifersucht. Nicht dass er neidisch auf Elian und Lucille war. Nur schmerzte es ihn sehr, dass Sophie nicht mehr da war. Er wünschte sich ebenfalls einen Menschen, der an seiner Seite kämpfte. Einen Menschen, der seine Zukunft war. Er sehnte sich nach Sophie.
Sie waren in der Ausarbeitung eines Plans noch nicht weiter, als Elian erstarrte. Das leise Surren, das sein Chronograph erzeugte, als sich die filigranen Zahnrädchen in seinem Innersten in Bewegung setzten, elektrisierte die Luft. Die Goldene Libelle von Lyon, die dem Chronographen als Zeiger diente, drehte sich einmal um sich selbst, ehe sie sich in den rhythmischen Tanz der Gewinde einfügte.
»Himmel hilf, es geht wieder los«, wisperte Estelle und atmete den stechenden Ammoniakgeist aus ihrem Fläschchen tief ein.
Einen Moment herrschte Stille. Alle Augen hefteten sich auf Elian und den Chronographen. Die Spannung war greifbar und auch Valentin verspürte die altbekannte Beklemmung, die ihn immer dann überkam, wenn der Teufel von Paris nach ihm rief. Nur rief er diesmal nicht nach ihm persönlich. Sondern eigentlich nach Sophie Dubois. Mit angehaltenem Atem griff er in seine Innentasche und holte das Pergament hervor, auf dem Sophie ihre immerwährende Schuld unterzeichnet hatte.
»Gehen wir ins verbotene Zimmer«, meinte Elian und nickte Valentin zu. »Sehen wir, was uns erwartet.«
Verbunden mit der ewigen Zeit
Paris, 1688
Das Nachmittagslicht fiel in warmen Bahnen durchs Fenster. Der Hund blinzelte gähnend und vergrub seine Augen unter der haarigen Pfote.
Auch der Teufel von Paris war müde. Er fühlte sich erschöpft, erschlagen und entmutigt. Er war gescheitert. Sein Blick wanderte über die Bauteile vor sich auf dem Arbeitstisch. Zahnräder, Gewinde, Schräubchen und Federn. Daneben das Gehäuse des Chronographen, den er der Familie Dubois abgenommen hatte.
Seufzend raufte er sich die nachtschwarzen Haare und ließ seinen Kopf in die Hände sinken. Dieses erneute Scheitern – es machte ihn wahnsinnig! All seine Hoffnungen waren zerplatzt. Die Goldene Libelle von Lyon hatte sich als Irrtum erwiesen. Sie hatte versagt. Nur knapp, aber dennoch …
Er drückte sich die Handballen auf die Augen, als könnte er damit die Bilder vertreiben, die ihm durch den Kopf geisterten und ihn quälten. Diese furchtbaren Bilder …
»Da hat der Teufel gewütet!«, hörte er aus seinem Versteck die Passanten auf dem Platz hinter vorgehaltener Hand tuscheln. In ihren Stimmen schwangen Entsetzen und eine perverse Neugier mit, die ihm Übelkeit bereitete. Die Menschentraube um die Werkstatt seines Vaters war dicht gedrängt und er konnte über all die Köpfe und Schultern hinweg kaum etwas erkennen. Vielleicht war das gut so, denn in diesem Moment wurden die leblosen Körper seiner Schwestern aus dem Laden getragen und auf den Karren des Bestatters geladen. Das Geräusch, als der Hinterkopf seiner kleinen Schwester gegen das Holz des Karrens schlug, trieb ihm die Galle in den Mund und er schluckte mehrmals, in dem verzweifelten Versuch, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten. Ihre Augen waren noch im Tod vor Angst geweitet und die blutige Wunde an ihrem Kittel glänzte noch feucht. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er wandte sich ab. Erbrach sich in den Rinnstein. Tränen trübten seine Sicht und er atmete flach durch den Mund, denn er glaubte, den Tod seiner Familie regelrecht riechen zu können. Dann sah er sein trübes Spiegelbild im Fenster des Hauses, gegen das er sich stützte. Das Haar klebte ihm blutig an der Wange, der Kopf hing kraftlos bis fast auf seine Brust, als wäre er ebenfalls tot. Doch seine Haut war nicht wächsern bleich, wie die seiner Schwestern. Er war am Leben – gerade so. Denn in seiner Brust klaffte ein Loch. Ein blutiges Loch. Und etwas Metallisches ragte aus der Wunde hervor.
Er atmete ein, um die furchtbare Erinnerung zu vertreiben. Umfasste den Chronographen mit der Libelle so fest, dass er fürchtete, ihn zu beschädigen, doch die Erinnerung an sein eigenes Leiden war kaum zu ertragen. Er spürte noch den unsäglichen Schmerz in seiner Brust. Den Schmerz, den das tickende Uhrwerk anrichtete, das sich ihm ins Herz gebohrt hatte. Es tickte und tickte und hielt ihn so am Leben – auch wenn das Leben nie mehr ein echtes Leben sein sollte.
»Herr?« Fleurs zarte Stimme durchdrang den Schleier der grausamen Erinnerungen. Ihre Kinderhand berührte seine Schulter. »Herr? Wollt Ihr nicht eine Kleinigkeit essen?« Er wusste, sie hatte etwas zubereitet, denn ihrem Kittel entstieg der Geruch von gebratenen Zwiebeln. Allerdings verspürte er keinen Appetit.
»Lass mich allein«, wisperte er und zog seine Schulter unter ihrer Hand hervor. »Ich brauche nichts.«
»Herr, ich mache mir Sorgen. Ihr solltet …«
»Ich brauche kein Kind, das mir sagt, was ich tun soll.«
Fleur straffte die Schultern. »Jemand muss es euch aber sagen!«, protestierte sie und kniff die Lippen zusammen. Sie trat ins Licht und ihr Schatten fiel auf die Bauteile des Chronographen. »Ich finde, Ihr solltet nicht hier sitzen und wehleiden!«, nahm sie ihren Mut zusammen, auch wenn sie dabei unsicher ihre Hände rang. »Ihr wart Eurem Ziel so nah. Bestimmt gelingt es Euch beim nächsten Mal!«
Er wusste nicht, ob er böse oder gerührt sein sollte. Dass Fleur so mit ihm sprach, ging zu weit, doch insgeheim tat ihre Fürsorge gut.
»Es gibt kein nächstes Mal!«, brummte er und raufte sich erneut die Haare. Diesmal strich er sie danach aber wieder glatt. »Ich gebe auf. Ich gebe mich meinem Schicksal geschlagen.«
»Ihr wollt aufgeben? Was ist mit Euren Schwestern? Mit der Rache? Wollt Ihr die Mörder nun doch davonkommen lassen?« In ihren Augen spiegelte sich Ungläubigkeit.
»Natürlich nicht.« Er schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Aber ich weiß nicht weiter, kleine Fleur«, gestand er und zog die Neunjährige spielerisch an einem ihrer blonden Zöpfe. »Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.«
Fleur machte ein nachdenkliches Gesicht und rieb sich das Kinn. »Ich denke, Herr, Ihr solltet erstmal meinen Eintopf kosten und Euch danach gestärkt wieder ans Werk machen«, schlug sie vor und ging ihm voran in die Küche. »Ihr habt gesagt, die Libelle bringt Euch an den Tag nach dem Überfall auf die Uhrmacherwerkstatt«, redete sie weiter und nahm eine Suppenschale aus dem Regal. Dann schöpfte sie dampfenden Eintopf hinein und legte eine dicke Scheibe Brot dazu.
Der Teufel beobachtete, wie fleißig sie all diese Dinge tat. Fleur war wirklich ein Segen. Und obwohl sie noch ein Kind war, war ihr Geist hellwach und sie brachte ihn oftmals zum Nachdenken. »Richtig. Die Libelle bringt mich einfach nicht weit genug. Und es gibt keine Möglichkeit, das zu ändern.«
Er zog sich einen einfachen Schemel heran und nahm Fleur die Schüssel ab. Er wartete, bis sie sich ebenfalls Eintopf genommen hatte. Dann kostete er das würzige Gemüse. »Ist das Kaninchen?«, fragte er, als er ein Stück Fleisch mit Soße auf seinem Löffel hatte.
Fleur nickte. »Ich hatte Glück. Ich habe das letzte ergattern können.« Sie kicherte. »Die Küchengehilfin des Comte de Gréve hat geschimpft wie ein Hafenarbeiter, weil ich ihr das Kaninchen vor der Nase weggeschnappt habe.« Sie kaute mit offenem Mund und schleckte sich Soße aus dem Mundwinkel. »Da hätte sie einfach früher aufstehen sollen.«
»Das hätte sie wohl«, stimmte er zu und schmunzelte. »Ich habe zwar keine Macht über mein Schicksal, aber wenigstens habe ich ein Kaninchen im Eintopf – ich bin ein Glücks-pilz.«
Fleur rollte mit den Augen. »Ich denke, Ihr überseht die Möglichkeiten, die Euch die Libelle bietet. Vielleicht werdet Ihr nie diese furchtbare Tat ungeschehen machen können, doch wenn Euch die Libelle den Mördern näher bringt, dann werdet Ihr zumindest in der Lage sein, Rache zu üben. Und wer weiß?« Fleur lächelte sanftmütig. »Vielleicht ist Euch Rache ja irgendwann genug.«
Der Teufel von Paris nickte nachdenklich. Fleur hatte nicht ganz unrecht. Seit jenem Tag hatte er nur zwei Ziele. Den Überfall auf das Geschäft seines Vaters zu verhindern – doch dazu war die Libelle nicht zu gebrauchen. Und: die Mörder seiner Familie ausfindig zu machen und bittere Rache an ihnen zu üben. Er konnte den Mord nicht verhindern – noch nicht. Aber er konnte womöglich mithilfe der Libelle die Mörder ausfindig machen.
»Du hast recht«, überlegte er und kratzte die nach Bier und Zwiebeln schmeckende Soße zusammen. »Fangen wir damit an, diejenigen zu jagen, die kein Erbarmen meinen Schwestern gegenüber gezeigt haben.« Er stellte die leere Schüssel ab und verließ mit schnellen Schritten und neuem Mut die Küche. Sein Weg führte ihn direkt zurück an den Arbeitstisch, wo er sich der Fälschung der Libelle zuwandte. Sie war, ebenso wie das Original, nicht in der Lage, jemanden in die Zeit vor dem Mord zu bringen. Doch sie war gut genug, den Tag nach dem Mord zu erreichen.
Mit geschickten Fingern baute er den Chronographen zusammen, setzte die Rädchen in Betrieb und platzierte die Libelle als Zeiger obendrauf. Als alles zu seiner Zufriedenheit zusammengebaut war, lehnte er sich zurück und betrachtete sein Werk.
»Ein schönes Stück«, meinte Fleur von ihrem Platz im Sessel am Kamin aus. Er war so vertieft in seine Arbeit gewesen, dass er nicht bemerkt hatte, dass sie sich zu ihm gesellt hatte. »Wer soll es bekommen?«
»Sophie Dubois«, weihte er sie ein. »Ich schicke sie und ihren Bruder zusammen los.«
»Dann vertraut Ihr den beiden nun wieder?« Fleur löste einen ihrer Zöpfe und flocht ihn neu.
»Denkst du, ich sollte ihnen trauen?«
Fleur verzog das Gesicht. »Ich weiß nicht, Herr«, überlegte sie laut. »Ich habe gehört, was sie auf dem Fest gesagt hat. Sie war offenbar in Valentin Delacroix verliebt.« Fleur knotete ein Samtband um das Zopfende und sah dann auf. »Er hat sie hereingelegt, richtig? Hat mit ihren Gefühlen gespielt, um für Euch die Wahrheit herauszufinden, war es nicht so?« Sie zuckte mit den Schultern. »Falls sie Euch die Schuld daran gibt, könnte sie böse auf Euch sein.«
»Dann trauen wir ihr besser nicht?« Er war so stolz auf die komplexen Gedankengänge, die Fleur zustande brachte. Sie war ihm dabei so ähnlich, dass ihm wohl das Herz vor Freude schneller schlagen würde – würde sein Herz aus freien Stücken schlagen …
»Nein. Besser nicht, Herr. Ich fürchte, ein gebrochenes Herz ist eine gefährliche Waffe, oui?«
Der Teufel von Paris lachte. »Da hast du recht, Fleur. Aber ein Herz, das liebt – gibt uns auch ein Druckmittel in die Hand, richtig?« Er stand auf und trat an den Tisch, auf dem sämtliche Pergamente der Schuld aufgereiht bereit-lagen. Er streckte die Hand aus und wartete geduldig, bis Fleur ihm den Federkiel reichte. Dann nahm er den Korken vom Tintenfass und tauchte die Spitze in die magische Flüssigkeit.
»Was habt Ihr vor, Herr?«, flüsterte Fleur mit angehaltenem Atem.
Der Teufel streifte die überschüssige Tinte von der Federspitze und setzte sie auf das vor ihm liegende Pergament der Schuld. Seine Entschlossenheit wuchs, als er in Fleurs kindliche Augen blickte. Neuer Mut durchströmte ihn. »Was ich immer tue, kleine Fleur. Ich fordere meine Schuld ein.«
Eine neue Schuld
Maison de Dubois, 1688
– Drei Tage verbleibend –
Valentin stand neben Elian vor dem Schreibtisch im verbotenen Zimmer, wie die Dubois den Raum unter dem Dach nannten. Hier befand sich das Pergament der Schuld, das die Familie durch Alberts Unterschrift an den Teufel von Paris band. Und nun breitete Valentin direkt daneben das Pergament aus, das Sophie im Palast unterzeichnet hatte. Eine weitere Blutschuld.
»Du hast unserer Familie keinen Dienst erwiesen«, murrte Elian und warf Valentin einen bösen Blick zu. »Jetzt steht auch noch Sophie in der Schuld dieses Kerls!«
»Die Alternative wäre gewesen, dich als Verräter zu überführen, was sowohl dich als allen anderen hier das Leben gekostet hätte.« Valentin verspürte kein Mitleid mit Elian – wohl aber mit Sophie. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Teufel auch eine Frau verpflichten würde. Nicht, nachdem der Teufel zuvor um Sophies Sicherheit besorgt gewesen war. Welchen Auftrag er Elians Schwester nun auch immer übertragen würde – sie würde zwangsweise in Gefahr geraten. Darum musste er Elian auch unterstützen und eiligst herausfinden, wer der Teufel war, um die Schuldscheine zu zerstören. Nur so konnte Sophie je wieder sicher sein. Und das war es, was er wollte.
»Was steht denn nun da geschrieben?«, drängelte Estelle neugierig und reckte den Kopf zur Tür herein. »Was soll Elian diesmal tun?«
Auch Valentin war gespannt. Er hielt, wie alle anderen auch, den Atem an, als Elian seine Fingerspitze sachte über das vor ihm liegende Pergament gleiten ließ.
»Es ist ein merkwürdiges Gefühl, dieses noch beinahe unversehrte Pergament zu berühren«, meinte Elian und sah Albert an. »Immerhin habe ich bisher meine Aufträge im einundzwanzigsten Jahrhundert erhalten. In meiner Zeit. Und da ist das Pergament an manchen Stellen schon etwas abgenutzt.« Elian rieb sich den Nacken und blickte kurz zu Lucille. »Ich muss mich wohl doch erst noch daran gewöhnen, dass diese Zeit … meine ist.«
»Das ist nicht deine Zeit. Der Teufel hält dich nur hier gefangen«, meinte Albert pragmatisch und räusperte sich. Er stützte sich schwer auf seinen Gehstock und bedeutete Elian weiterzumachen. »Du bist noch lange nicht geboren, also hör auf, dir hier eine Zukunft auszumalen. Denk lieber an die nächsten drei Tage, denn der Sand in der Uhr verrinnt bereits.« Er deutete auf die große Sanduhr an der Wand, deren weißer Sand in einem stetigen Rinnsal vom oberen in den unteren gläsernen Bauch rieselte. »Du verlierst kostbare Zeit.«
»Das sage ich ja«, stimmte Estelle nickend zu. »Also, was verlangt der Teufel von Paris? Was gilt es zu erledigen?«