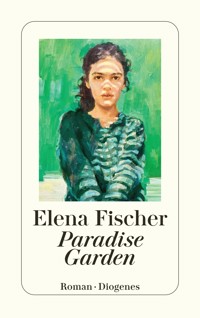
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die 14-jährige Billie verbringt die meiste Zeit in ihrer Hochhaussiedlung. Am Monatsende reicht das Geld nur für Nudeln mit Ketchup, doch ihre Mutter Marika bringt mit Fantasie und einem großen Herzen Billies Welt zum Leuchten. Dann reist unerwünscht die Großmutter aus Ungarn an, und Billie verliert viel mehr als nur den bunten Alltag mit ihrer Mutter. Als sie Marika keine Fragen mehr stellen kann, fährt Billie im alten Nissan allein los – sie muss den ihr unbekannten Vater finden und herausbekommen, warum sie so oft vom Meer träumt, obwohl sie noch nie da war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Elena Fischer
Paradise Garden
roman
Diogenes
1
Meine Mutter starb diesen Sommer.
Ein Lied im Radio war nur noch Geräusch und keine Einladung mehr mitzusingen, obwohl keine von uns den Text kannte. Ein Regenguss war nur noch Wetter und keine Gelegenheit mehr, nach draußen zu laufen und barfuß in einer Pfütze zu tanzen.
Das klingt vielleicht poetisch, aber das ist es nur auf dem Papier. Vierzehn ist ein beschissenes Alter, um seine Mutter zu verlieren. Die Trauer kommt und geht wie Ebbe und Flut, aber da ist sie immer.
Meine Mutter wurde am heißesten Tag des Jahres beerdigt. Die Vögel strauchelten am weißen Himmel, und die Eidechsen zogen sich in die Schatten der Grabsteine zurück. Am Wegesrand blühten Rosenbüsche, und der Wind wehte ihren süßen Duft bis ans Grab. Die Hitze dehnte die Zeit und verlangsamte alle Bewegungen.
Ich wischte meine schweißnassen Hände an meinem Kleid ab und starrte in das Loch zu meinen Füßen. Da unten lag der Sarg, darauf lagen Sonnenblumen, und darin lag meine Mutter. Die dunklen Locken umrahmten ihr Gesicht, die roten Lippen lächelten spöttisch, die Füße steckten in ihren weißen Cowboystiefeln, so stellte ich mir das vor.
Außerdem stellte ich mir vor, dass meine Mutter plötzlich neben mir auftauchte und mich rettete. Sie zog ihren Rock glatt und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Dann sagte sie so etwas wie »Zieht nicht solche Gesichter, das ist ja nicht auszuhalten!« Meine Mutter küsste mich auf den Scheitel, nahm meine Hand und lief mit mir davon, wie so oft.
Meine Mutter kam natürlich nicht.
Stattdessen kam meine erste Periode.
Der Priester warf Erde auf den Sarg. »Von der Erde bist du genommen, zur Erde kehrst du zurück, der Herr aber wird dich auferwecken«, sagte er in einem merkwürdigen Singsang, und das Blut sickerte, warm und lebendig, aus meinem Körper. Eine Sekunde lang dachte ich, dass ich jetzt auch sterben würde, und am liebsten hätte ich mich zu meiner Mutter gelegt. Es erschien mir wie ein Verrat meines Körpers, dass meine Periode ausgerechnet jetzt kam. Ich rührte mich nicht. Ich schloss die Augen und hoffte, dadurch unsichtbar zu sein. Ich hoffte, dass niemand bemerken würde, dass ich gerade zur Frau geworden war.
Ich wollte mein Blut dazu bringen, in meinen Körper zurückzufließen, aber ich konnte die Schwerkraft nicht aufhalten. Mein Blut lief träge an meinem Bein hinab. Alles trieb nach unten, in Richtung Erde. Ich presste die Oberschenkel zusammen und versaute mein gelbes Sommerkleid.
Wäre meine Großmutter hier gewesen, dann hätte sie die Lippen aufeinandergepresst, zwei dünne Striche, die an den Enden nach unten zeigten. Sie hätte unaufhörlich geweint. Meine Großmutter schien einen geheimen Wassertank in ihrem Körper zu haben. Aus ihm speisten sich ihre Tränenbäche. Vielleicht war ihr Gesicht so faltig, weil das ganze Wasser unkontrolliert herausfloss und nichts zurückließ außer Trockenheit.
Am Tag, als meine Mutter starb, fiel ich auseinander. Übrig blieb eine Buchstabenfolge, die einmal mein Name gewesen war.
Meine Mutter nannte mich Billie. B-i-l-l-i-e.
Dabei berührten sich ihre Lippen kurz und sacht. Meinen richtigen Namen hörte ich zum ersten Mal, als ich sieben war. Am ersten Schultag rief die Klassenlehrerin alle Kinder einzeln auf. Ich blieb übrig, gemeinsam mit einem Namen, der mir fremd war.
»Billie ist eine Abkürzung für Erzsébet«, sagte meine Mutter. Ihre Aussprache war perfekt. Ich verstand zwar Ungarisch, aber alles, was ich hörte, war Ärschebett.
»Warum wurde ich nicht gleich Billie getauft?«
»Deine Großmutter war dagegen«, seufzte meine Mutter. Ich kannte meine Großmutter nicht, aber dass sie nichts gut fand, was meine Mutter mochte, hatte ich schon herausgefunden.
»Warum war sie dagegen?«, wollte ich wissen.
»Der Name Billie kommt nicht in der Bibel vor«, sagte meine Mutter.
»Kommt Marika denn in der Bibel vor?«
Meine Mutter schüttelte den Kopf. Dann sagte sie: »Nicht direkt. Aber Marika bedeutet Gottesgeschenk. Das ist jedenfalls eine Bedeutung.«
»Das heißt, es gibt noch eine andere?«
Meine Mutter grinste so breit, dass ich ihren goldenen Backenzahn sehen konnte.
»Die Widerspenstige. Aber daran hat deine Großmutter nicht gedacht.«
2
Aber jetzt: zurück zum Anfang.
Der Anfang war der letzte Tag vor den Sommerferien.
Der Anfang war ein Song im Radio.
Der Anfang waren große Pläne.
Vielleicht war der Anfang alles zusammen.
Jedenfalls kam ich gerade rechtzeitig von der Schule zurück, um mitraten zu können. Meine Mutter und ich waren verrückt nach diesem einen Gewinnspiel.
»Mach mal leiser«, sagte ich, als ich ins Wohnzimmer kam.
Ich hatte den Moderator schon im Laubengang gehört, und wahrscheinlich hatten ihn auch alle unsere Nachbarn gehört.
»Sch«, sagte meine Mutter und legte einen Finger auf ihre Lippen. In der anderen Hand hielt sie das Telefon. Ich wusste, dass sie die Nummer schon eingetippt hatte. Wir hatten schon tausendmal mitgemacht.
Meine Mutter saß auf unserem Sofa. Ihr linkes Bein tanzte, und auf ihrer Stirn glänzten Schweißperlen. Es war ein drückend heißer Nachmittag. Meine Mutter hatte alle Fenster in der Wohnung geöffnet, aber im Wohnzimmer stand die Luft trotzdem.
Kaum hatte ich mich neben meine Mutter gesetzt, ging es auch schon los.
»Drei, zwei, eins«, sagte der Moderator, und dann ertönten die ersten Klänge.
»Wicked Game!«, rief meine Mutter.
»Nie im Leben«, sagte ich. Ich hatte den Song sofort erkannt. »Es ist All My Tears!«
»Bist du sicher?«, fragte meine Mutter.
»Los, ruf an!«, sagte ich.
Den Song zu erkennen war das eine, durchzukommen das andere. Am ärgerlichsten war es, wenn man durchkam, aber falschlag. Meine Mutter drückte auf den grünen Knopf und hielt den Telefonhörer ans Ohr.
Geld zu gewinnen war eine verdammt große Sache für uns.
Da, wo wir wohnten, hatten die meisten Leute das Wort ›gewinnen‹ längst aus ihrem Wortschatz gestrichen.
Niemand wohnte freiwillig hier, am Stadtrand. Unser Block war der höchste von fünf Wohnblöcken, die im Halbkreis angeordnet eine eigene kleine bunte Stadt bildeten. Jedes Haus war in einer anderen Farbe gestrichen, unseres in einem kraftlosen Gelb.
Wenn man diese Adresse angab, bei einer Bewerbung zum Beispiel, dann wussten die Leute sofort Bescheid. Vielen Dank für Ihr Interesse, der Nächste bitte. Meine Mutter konnte ein Lied davon singen.
Ich hielt die Luft an und zählte vier Freizeichen. Es klingelte viermal, und dann waren wir plötzlich im Radio.
Meine Mutter und ich waren so aufgeregt, dass wir uns ständig gegenseitig ins Wort fielen. Meine Mutter wechselte dauernd vom Deutschen ins Ungarische und wieder zurück, wie immer, wenn sie aufgeregt war. Aber der Radio-Mann verstand uns trotzdem. Am Ende sagte er, dass wir in der Leitung warten sollten. Wir konnten unser Glück kaum fassen.
»Hoffentlich frisst die Warteschleife nichts von unserem Gewinn«, sagte meine Mutter. Sie machte den Lautsprecher an und rieb sich ihr rechtes Ohr. Es glühte.
Wir hingen nur fünf Minuten in der Warteschleife. Dann gratulierte uns eine Frau und fragte meine Mutter nach ihrer Kontonummer. Meine Mutter las die Zahlen von ihrer Karte ab. Es war, als würde sie ein Gebet sprechen, von dem sie schon vorher wusste, dass es erhört werden würde.
Als meine Mutter aufgelegt hatte, sagte sie: »Diesen Sommer fahren wir in den Urlaub!«
»In einen richtigen Urlaub?«, fragte ich. Ich sah Palmen, die sich im Wind wiegten, ich sah einen Sandstrand, und natürlich sah ich das Meer.
»In einen richtigen Urlaub«, sagte meine Mutter. Dann stand sie auf, um sich für die Arbeit fertig zu machen.
Ich legte mich auf das Sofa. Die Hitze machte mich ganz dösig. Ich schloss die Augen und hörte, wie das Wasser in der Dusche rauschte. Irgendwann kam meine Mutter in ihrem Ich-kann-alles-sein-Outfit zurück ins Wohnzimmer. Das Paillettenoberteil schimmerte im Sonnenlicht, die Jeans saßen knalleng. Dazu trug sie ihre weißen Cowboystiefel, die mit Kirschen verziert waren. Sie küsste mich zum Abschied und fuhr mit dem Bus in die Stadt, zu ihrem Abendjob.
Meine Mutter hatte zwei Jobs.
Morgens arbeitete sie in einem großen Glaskasten, der aus vielen kleinen Glaskästen bestand. Sie putzte für die Mitarbeiter, die teure Anzüge trugen und Krawatten. Außerdem brachte sie ihnen Büroklammern, Briefumschläge und Textmarker – und manchmal auch einen Kühlakku. Es kam gar nicht so selten vor, dass jemand gegen eine Tür oder Wand lief. Abends kellnerte meine Mutter in einer Bar.
»Der Barjob hält uns zwar bei Laune«, sagte sie, wenn sie nach der Schicht ihr Trinkgeld zählte, »aber der Putzjob hält uns am Leben.«
In der Firma, wo meine Mutter arbeitete, sah sie die verrücktesten Dinge. Das lag daran, dass sie nicht gesehen wurde. Wenn sie in ihren Jeans und ihrem Kittel durch die Flure ging, die Drucker mit Papier befüllte oder die Toiletten putzte, war sie unsichtbar. Man hatte sich im Laufe der Jahre an sie gewöhnt wie an einen Rollcontainer oder an eine Stehlampe. Erst, wenn sie nach Hause kam, die Kleider wechselte, die Haare öffnete und die Lippen rot anmalte, wurde der Mensch aus ihr, der sie eigentlich sein wollte.
Einmal pro Schicht machte meine Mutter eine Runde durch alle Büros, um die Papierkörbe zu leeren.
»Den wahren Charakter von Menschen erkennst du daran, wie sie Dinge behandeln, die sie nicht mehr haben wollen«, sagte meine Mutter.
Der Mann am Ende des Flurs stopfte alles in seinen Papierkorb: Essensreste, halb volle Pappbecher mit Kaffee, CDs, Schuhe. Einmal fand meine Mutter ein blutiges Taschentuch. Sie konnte den Papierkorb nicht einfach ausleeren, sondern musste jedes Mal mit den Händen hineinfassen und nachhelfen. Sie holte sein halbes Leben aus seinem Papierkorb.
Als meine Mutter an diesem Abend aus der Bar zurückkam, war ich noch wach. »Rück mal ein Stück«, sagte sie, und dann schlüpfte sie neben mich ins Bett. Meine Mutter drehte sich zu mir, sodass wir Gesicht an Gesicht lagen.
»Können wir mit dem Geld ans Meer fahren?«, fragte ich.
»Klar, an welches?«, sagte meine Mutter und grinste.
»Atlantik. Oder Karibik.«
Wenn ich an das Meer dachte, dann war es nie langweilig. Es war entweder wild, oder es war türkis, wie auf den Plakaten im Schaufenster der Reisebüros. So oder so sehnte ich mich danach. Manchmal war diese Sehnsucht wie ein Mückenstich an einer Stelle meines Körpers, wo ich zum Kratzen nicht hinkam.
»Ich will nach Florida«, sagte meine Mutter. »Dann esse ich jeden Morgen Pancakes am Strand.«
»Ja, das ist klar«, sagte ich, und mein Magen begann zu knurren.
Meine Mutter war verrückt nach Florida, seit sie diesen einen Film gesehen hatte. Darin leben ein kleines Mädchen und seine Mutter in einem Wohnwagen. Es passiert nichts in diesem Film. »Warum machen Leute einen Film, in dem nichts passiert?«, wollte ich wissen. Wenn ich Geschichten schrieb, dann passierte darin immer eine ganze Menge. »Solange nichts passiert, ist alles möglich«, hatte meine Mutter gesagt, und irgendwie stimmte das ja.
Meine Mutter stand auf.
»Ich mach uns welche«, sagte sie.
Dann verschwand sie in der Küche.
Die Pancakes meiner Mutter waren die besten, die ich jemals gegessen hatte. Es gab sie immer dann, wenn wir etwas zu feiern hatten. Und wir fanden eine Menge Gelegenheiten. Da waren zum Beispiel die Geburtstage. Nicht nur unsere, sondern die Geburtstage von allen Kindern, die in unserem Block wohnten. Und hier wohnten eine Menge Kinder.
Meine Mutter brachte mir einen vollbeladenen Teller ans Bett und fragte: »Hängen sie dir nicht schon aus der Nase heraus?«
Das fragte sie jedes Mal.
»Es heißt aus den Ohren«, sagte ich, tunkte den Zeigefinger in den Ahornsirup und leckte ihn ab. Meine Mutter hatte immer noch ein Problem mit deutschen Redewendungen. Sie brach Dinge über den Fuß, fuhr den Karren an die Mauer und sagte: »Dieser Idiot sollte sich erst einmal an die eigene Stirn fassen!«
Meine Mutter setzte sich auf die Bettkante.
»Alles nutzt sich ab mit der Zeit.«
»Ein Lied zum Beispiel«, sagte ich.
Manchmal hörte ich so oft hintereinander dasselbe Lied, dass ich nach einiger Zeit nicht mehr wusste, warum es mir einmal gefallen hatte.
»Ja, zum Beispiel. Oder ein Mensch«, sagte sie. »Aber du nicht. Du nutzt dich niemals ab.« Meine Mutter schlang die Arme um mich, und beinahe wäre mein Teller auf dem Boden gelandet.
Später, als meine Mutter längst im Wohnzimmer eingeschlafen war, stand ich noch einmal auf. Ich öffnete mein Fenster weit und lehnte mich hinaus in die warme Sommerluft.
Wir wohnten beinahe ganz oben. Es war der siebzehnte Stock. Von hier aus hätte man das Meer sehen können, wenn es ein Meer gegeben hätte. Aber es gab nur eine Autobahn. Die Autobahn schlängelte sich durch das Naturschutzgebiet und schnitt das Grün in zwei Teile. Das Rauschen der Autos war immer da, und mittlerweile hörten wir es kaum noch. Früher hatte mich das Rauschen oft in den Schlaf gewiegt. »Hey, kannst du das Meer hören?«, flüsterte meine Mutter dann.
In den Ferien wurde der Verkehr dichter. Manchmal füllte meine Mutter Fruchtsaft mit Eiswürfeln in große Gläser und schmückte sie mit pinkfarbenen Strohhalmen und Schirmchen. Sie drückte mir die Cocktails in die Hand, nahm zwei Liegestühle und stellte sie nach draußen in den Gang, zwischen unsere Haustür und die Brüstung, von der die Farbe an vielen Stellen abblätterte.
Dann spielten wir Urlaub.
Wir setzten uns nebeneinander, meine Mutter in einem weißen Bikini, ich in einem Badeanzug, und ließen uns die Sonne auf den Bauch scheinen. Wir freuten uns, dass wir schon da waren, während die anderen in ihren Autos feststeckten.
Ich stand am Fenster und lauschte.
Die Wahrheit wurde mir erst jetzt klar. Die Wahrheit war natürlich, dass wir sofort getauscht hätten. Wir hätten liebend gerne in einem Auto festgesteckt, um nach Italien, Frankreich oder Spanien zu fahren.
3
Ich saß im Laubengang und blätterte durch Reisekataloge. Die Kataloge waren dick, und der Einband war aus glänzendem Papier.
Der Mann im Reisebüro hatte wissen wollen, wohin ich verreisen wollte, aber so genau wusste ich das ja selbst noch nicht. Ich wusste nur, dass ich meine Mutter mit einer guten Idee überraschen wollte.
»Ans Meer!«, sagte ich.
»Europa?«, fragte der Mann, und ich nickte.
»Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Griechenland?«
»Genau«, sagte ich. »Und kann ich bitte auch einen Ungarn-Katalog haben?«
»Ungarn liegt aber nicht am Meer«, sagte er und packte einen Stapel Kataloge in eine Tasche.
Ich wusste natürlich, dass Ungarn nicht am Meer lag, und ich wusste, dass meine Mutter niemals nach Ungarn fahren würde. Aber ich schaute mir gerne Bilder von dort an.
Ich war schon in der Tür, als mir noch etwas einfiel.
»Haben Sie auch einen Katalog für Florida?«
Jetzt starrte ich abwechselnd in den hellblauen Himmel über mir und auf eine Straße, die mitten durch türkisblaues Wasser führte. Ich sah Palmen an pudrigen Stränden und rosafarbene Hotels mit riesigen Pools und Veranden mit geflochtenen Schaukelstühlen und Gärten mit Pflanzen, deren Blüten so groß waren wie Fußbälle.
Und dann sah ich die Preise.
Sie waren so hoch, dass wir uns nicht einmal den Hinflug leisten konnten. Wir konnten uns keinen einzigen Flug leisten, selbst wenn es erlaubt gewesen wäre, sich einen Sitz zu teilen.
Ich klappte den Florida-Katalog zu und schloss die Augen. Die Sonne stand hoch am Himmel und färbte die Dunkelheit hinter meinen Lidern rot. Ich hatte den ganzen Laubengang für mich, aber ich wusste, dass das nicht lange so bleiben würde. Meine Mutter und ich waren nicht die Einzigen, die ihr Leben nach draußen verlagerten, sobald es warm wurde. Wir teilten uns den Gang mit unseren Nachbarn, die alle, genauso wie wir, keinen Balkon hatten.
Da war zum Beispiel Luna. Luna war älter als ich, aber jünger als meine Mutter. Wie alt sie genau war, wussten wir nicht. Mal sagte sie 23, dann 32. Die Wahrheit spielte zwischen diesen beiden Zahlen Verstecken. Alter war für Luna davon abhängig, wie sie sich fühlte. Luna arbeitete ganz in der Nähe im Sunset Sonnenstudio. Wenn sie jemanden mochte, ließ sie ihn gratis auf die Sonnenbank. In den Taschen ihrer Jeans steckten immer ein, zwei Coins, die man statt Münzen in den Schlitz werfen konnte. Wir mochten Luna, und Luna mochte uns. Das nützte uns allerdings nichts. Ich war zu jung, um ins Solarium zu gehen. Der Besuch war erst ab sechzehn erlaubt. Ich versuchte immer wieder, Luna zu überreden, aber sie schüttelte nur den Kopf, dass ihre rosa Haare flogen. Meine Mutter brauchte kein Sonnenstudio. Wenn sich im Winter die Haut der meisten um uns herum in die Farbe von Fleischwurst zurückverwandelte, war sie immer noch braun. »Das ist das Roma-Blut«, sagte sie und seufzte. Sie konnte es nicht fassen, dass sie die Chance verpasste, etwas zu bekommen, ohne dafür bezahlen zu müssen.
Ich schlug den nächsten Katalog auf. Italien. Italien war natürlich nicht Florida, aber dort gab es auch schöne Strände, und es gab gute Pizza. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ich verglich Hotels und Campingplätze miteinander. Ich blätterte vor und zurück und wieder vor. Es dauerte nicht lange, bis mir klarwurde, dass unser Gewinn einfach nicht reichte. Er reichte vielleicht für eine neue Matratze oder für ein, zwei Ausflüge in einen großen Freizeitpark. Er reichte auch für eine Schwimmbad-Jahreskarte. Wahrscheinlich reichte er sogar für eine Fahrt nach Italien mit unserem Nissan. Aber was dann?
»Fahrt ihr diesen Sommer weg?«, fragte plötzlich eine Stimme neben mir. Es war Ahmed. Über seiner Schulter hing eine Sporttasche, und an der Sporttasche hingen Boxhandschuhe. Ahmeds Haut glänzte schweißnass, aber bei diesem Wetter konnte man nicht sagen, ob jemand auf dem Weg ins Training war oder schon trainiert hatte. Ahmed war noch dunkler als meine Mutter. Er war offiziell Israeli, aber eigentlich Palästinenser. Ich verstand nicht, wie das sein konnte, aber im Grunde war es mir egal.
Ich überlegte einen Moment, ob ich ihm von unserem Gewinn erzählen sollte, aber dann ließ ich es sein. Ich wollte ihn nicht traurig machen. Ahmed war nach Deutschland gekommen, um Chemie zu studieren, aber aus irgendwelchen Gründen kam er nicht richtig voran. Wenn meine Mutter ihn fragte, wie es ihm ginge, lachte er und sagte jedes Mal: »Gut, gut!« Aber seit Kurzem schwieg er. Ich wusste, dass er seinen Job als Prospektverteiler verloren hatte.
»Wir wollten ans Meer fahren«, sagte ich stattdessen. »Aber wahrscheinlich bleiben wir hier.« Ich legte den Italien-Katalog neben mich auf den Boden. »Ist alles viel zu teuer.«
»Fahrt doch an die Nordsee. Das ist nicht so weit, und ich habe gehört, es soll sehr schön sein.«
Ahmed schloss seine Tür auf. Er wohnte direkt neben uns. Wenn wir bei irgendetwas Hilfe brauchten, dann klopften wir bei ihm. Er hatte viel Kraft und große Hände, mit denen er jedes Marmeladenglas aufbekam. Ich mochte Ahmed. Er roch nach Seife und Shisha, und er hatte die längsten Wimpern, die ich jemals gesehen hatte. Außerdem hatte er gute Ideen.
Ich stand auf. Am liebsten wäre ich direkt noch einmal ins Reisebüro gegangen und hätte einen Deutschland-Katalog besorgt. Aber nachmittags hatte das Reisebüro geschlossen. Stattdessen holte ich von drinnen meinen Schulatlas, Zettel und Stift und einen Taschenrechner. Ich öffnete den Atlas und suchte eine Übersichtskarte. Von hier aus gab es mehr als eine Autobahn in den Norden. Die Autobahnen führten natürlich nicht ganz bis ans Meer. Niemand wollte am Strand sitzen, wenn hinter einem die Autos vorbeischossen. Aber es gab genügend Landstraßen. Ich suchte die kürzeste Strecke. Dann notierte ich mir den Namen des Ortes. Ich fing an zu rechnen. Wir hatten genug Geld, um das Benzin zu bezahlen. Vielleicht konnten wir sogar eine Nacht in einem Hotel schlafen.
Am Ende zeichnete ich die Sonne, einen Strand und das Meer auf den Zettel und schrieb ›Nordsee‹ darüber.
»Was machst du da?«, fragte meine Mutter hinter mir.
Sie war vor zehn Minuten von der Arbeit zurückgekommen. Ich musste mich nicht umdrehen, um zu wissen, dass ihre Jeans und ihr T-Shirt im Flur auf dem Boden lagen. Wenn sie aus dem Büro kam, ließ sie ihre Klamotten einfach fallen. Dann schob sie das Mittagessen in die Mikrowelle.
Meine Mutter beugte sich mit einem dampfenden Stück Lasagne über die Rückenlehne meines Liegestuhls.
»Ich dachte, du hast jetzt Ferien«, sagte sie mit Blick auf den Atlas.
»Ich plane unseren Urlaub.«
Ich nahm den Teller und stellte ihn neben mich auf den Boden. Meine Mutter zog den zweiten Liegestuhl näher an meinen.
»Zeig mal«, sagte sie.
Nach drei Sekunden gab sie mir meine Notizen zurück.
»Nein. Auf gar keinen Fall. Wie kommst du darauf?« Meine Mutter verschränkte die Arme vor ihrem Körper.
»Warum nicht?«, wollte ich wissen.
»Was sollen wir an der Nordsee?«, fragte sie. »Am Strand frieren? Wir mögen keinen Wind, hast du das vergessen?«
»Es sind tausend Grad. Wir werden nicht frieren.«
»Lass uns nach Frankreich fahren«, sagte meine Mutter und lehnte sich zurück.
»Frankreich ist zu teuer«, sagte ich. »Wir könnten uns gerade so die Fahrt leisten. Wo sollen wir schlafen?«
»Da fällt uns schon was ein«, sagte meine Mutter und trank einen Schluck von meiner Cola.
»Ach ja, und was?«
»Es ist warm. Wir könnten draußen schlafen.«
»Und wenn es regnet?«
»Dann schlafen wir im Auto.«
Als meine Mutter mein Gesicht sah, sagte sie: »Wusstest du, dass es Menschen gibt, die ihr ganzes Leben in einem Auto verbringen? Ich wette, sie verpassen ihrem Auto jedes Jahr einen neuen Anstrich.«
Ich mochte unseren Nissan, das war nicht das Problem. Der Nissan war der einzige Luxus, den wir uns leisteten. Meistens fuhren wir mit dem Bus. Manchmal kauften wir sogar Fahrscheine. Nur manchmal, wenn ein neuer Monat begann, fuhren wir mit dem Nissan in die Stadt.
Das Problem war, dass unser Wagen seit einem Jahr keinen TÜV mehr hatte. Außerdem schloss die Beifahrertür nicht richtig. Aber meine Mutter war erfinderisch: Sie hatte die Tür mit einem dicken Stück Schnur am Rahmen befestigt. In den Kurven musste ich sie aber trotzdem festhalten wie einen geliebten Menschen, der über einem Abgrund baumelt.
»Denk an die übereifrigen Polizisten, die einen wegen so etwas anscheißen, anstatt richtige Verbrecher zu jagen«, hatte sie einmal gesagt.
Aber so schnell gab ich nicht auf.
»Es ist schön an der Nordsee«, sagte ich.
»Woher willst du das wissen?«, fragte meine Mutter.
»Von Ahmed. Woher willst du wissen, dass es nicht schön ist?«
»Manche Sachen weiß ich einfach.«
Ich hatte keine Ahnung, was meine Mutter gegen die Nordsee hatte. Ich stand auf, nahm den Stapel Reisekataloge und ließ ihn auf den Boden fallen.
»Hey, was soll das?«, fragte meine Mutter.
»Wenn du schon alles weißt, habe ich die ja umsonst besorgt.«
Meine Mutter starrte auf die Kataloge. Auf dem Katalog ganz oben war ein Flamingo abgebildet.
»Ist das Florida?«
Ich nickte.
Meine Mutter schob ihre Sonnenbrille in den Haaransatz.
»Hast du den extra für mich geholt?«
»Ja«, sagte ich, und da nahm meine Mutter mich in den Arm. Natürlich umarmte ich sie zurück. Wenn man nur zu zweit ist, ist es besser, sich schnell wieder zu vertragen.
»Hey, was ist denn bei euch los?«
Luna war herausgekommen. Ihre Schritte auf den Fliesen machten ein schmatzendes Geräusch, das von den Flip-Flops kam. Sie trug sie den ganzen Sommer lang. Sie hatte sie im Internet entdeckt, ein Paar kostete nicht mehr als eine Kugel Eis. Weil der Versand aber viermal so teuer war, hatte Luna einfach einen ganzen Berg davon bestellt. Jetzt besaß sie Flip-Flops in allen Farben des Universums. Die Flip-Flops waren aus China und aus Kunststoff. Meine Mutter sagte, dass Luna davon Hautkrebs an den Füßen bekommen würde. Es sei nur eine Frage der Zeit.
Wir rückten auseinander.
»Wir fahren in den Urlaub«, sagte meine Mutter.
Luna schnappte sich die Kataloge und setzte sich zwischen uns auf den Boden. Und dann erzählte meine Mutter, dass wir gewonnen hatten. Zum Schluss sagte sie: »Billie will an die Nordsee fahren, aber ich will nach Frankreich.«
»Frankreich!«, sagte Luna in meine Richtung. »Denk an die Croissants. Und ist da nicht auch das Wetter besser?«
Was hatten nur alle mit dem verdammten Wetter? Ich wollte gerade etwas sagen, aber Luna redete schon weiter.
»Außerdem haben die Franzosen einen coolen Lifestyle. Wie sagt man?«
»Savoir vivre?«, fragte ich.
»Nee, das hieß irgendwie anders.«
»Laisser-faire?«
»Genau das«, sagte sie.
Meine Mutter sah mich an und grinste. Mir war klar, dass ich keine Chance mehr hatte. Ich war gerade von jemandem überstimmt worden, der im Grunde gar kein Stimmrecht hatte. Ich seufzte. Wenn meine Mutter sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, war sie nicht davon abzubringen. Und mit den Croissants hatte Luna ja recht.
Luna kramte aus der Tasche ihrer Shorts ein Fläschchen Nagellack. Sie ließ den Nagellack in den Schoß meiner Mutter fallen und lachte, als hätte jemand einen Witz gemacht.
Luna lachte oft ohne richtigen Grund. Vielleicht hatte es damit zu tun, dass Luna gleichzeitig der fröhlichste und der traurigste Mensch war, den ich kannte.
Luna hatte mehr Träume am Tag als ich in der Nacht. Ihr größter Traum war, einen Mann zu heiraten, der sie von ihren Schulden erlöste.
»Darauf kann sie lange warten«, sagte meine Mutter einmal.
Meine Mutter schraubte das Fläschchen auf und nahm Lunas Hand. Meine Mutter und Luna lackierten sich oft gegenseitig die Nägel. Luna lackierte meiner Mutter die rechte Hand, weil meine Mutter Rechtshänderin war, und meine Mutter lackierte Luna die linke Hand, weil Luna Linkshänderin war.
Der Lack sah aus wie geschmolzenes Vanilleeis.
»Wann bekomme ich endlich eine Postkarte aus Hollywood?«, fragte meine Mutter.
Während Luna auf den richtigen Mann wartete, versuchte sie, Schauspielerin zu werden. Das war ihr zweiter Traum. Sie lernte dauernd Texte: unten bei den Waschmaschinen, in der Schlange beim Discounter und wenn sie die Sonnenbänke desinfizierte. Sie wartete darauf, entdeckt zu werden.
»Bald«, sagte Luna. »Und dann kaufe ich ein großes Haus, in dem wir zusammenleben können.«
Luna hatte ständig solche Ideen. Ich dachte, dass wir doch schon in einem großen Haus zusammenlebten, Wand an Wand sogar, und sagte nichts dazu.
»Und du? Wovon träumst du?«, fragte Luna meine Mutter.
Meine Mutter schwieg. Dann sagte sie: »Von einer Klimaanlage.«
Luna lachte. »Okay. Und jetzt wirklich?«
»Von Frankreich. Ab heute träume ich von Frankreich.«
Meine Mutter lehnte sich zurück und schloss die Augen.
»Und was ist dein Traum?«, fragte Luna jetzt mich.
Ich musste nicht lange nachdenken.
»Ich will Schriftstellerin werden«, sagte ich.
»Pass auf, was du sagst«, sagte meine Mutter zu Luna. »Sie schreibt den ganzen Tag lang Sachen in ihr Notizheft.«
Später füllte ich Popcorn in eine Plastikschüssel und stellte sie zusammen mit der Colaflasche und Gläsern auf den Wohnzimmertisch. Luna brachte Chips mit.
»Süß und salzig«, sagte sie und steckte sich Chips und Popcorn gleichzeitig in den Mund. »Wenn ihr euch entscheiden müsstet … Was würdet ihr nehmen?«
»Süß«, sagte meine Mutter.
»Salzig«, sagte ich.
Wir machten den Fernseher an und warteten auf Lunas Auftritt. Währenddessen hatte ich die ganze Zeit den Duft ihrer frisch gewaschenen Haare in der Nase. Sie rochen nach Kokosnuss.
»Da! Da hinten!«, schrie meine Mutter plötzlich.
Luna saß in einem Bahnabteil und hielt dem Schaffner ihr Ticket hin. Wir spulten ungefähr achtundsiebzig Mal zurück.
Wir ließen uns gerne von dem anstecken, was Luna ihr »Glamourleben« nannte.
4
Ein paar Tage später hatte meine Mutter frei. Das war die eine gute Sache. Die andere war, dass ein neuer Monat begann. Ein neuer Monat war wie ein neues Leben. An jedem Monatsanfang versuchte meine Mutter das Monatsende wieder gutzumachen. An jedem Monatsanfang sagte meine Mutter: »Lass uns etwas unternehmen.«
Ich lauschte auf das leise Quietschen aus dem Wohnzimmer. Meine Mutter würde gleich aufwachen. Sie wälzte sich auf der großen Luftmatratze hin und her. Abends pumpte sie Luft hinein, morgens ließ sie die Luft wieder heraus und faltete ihr Bett zu einem Paket zusammen, das sie hinter das Sofa schob.
Dann hörte ich, wie meine Mutter mit nackten Füßen in der Küche hin und her lief. Sie füllte Wasser in den Wasserkocher, sie öffnete den Backofen, holte ein Backblech heraus, schob es wieder hinein und schloss den Backofen.
Ich lag in meinem Bett und träumte von unserem Urlaub. Die letzten Tage hatte ich immer wieder Fotos von der Nordsee mit Fotos aus Frankreich verglichen. Natürlich hatte ich doch noch einen Nordsee-Katalog geholt. Als ich mit dem Katalog unter dem Arm nach Hause gekommen war, hatte meine Mutter nur die Augenbrauen hochgezogen, aber nichts gesagt.
Dann war etwas Merkwürdiges passiert. Je länger ich die Fotos aus Frankreich betrachtete, desto blasser wurden die von der Nordsee. Je länger ich auf endlose, von Palmen gesäumte Strandpromenaden, bunte Altstädte, riesige Jachten in Häfen und Crêpes mit Schokolade starrte, desto mehr Lust bekam ich, nach Frankreich zu fahren. Am Ende war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob es überhaupt ein richtiger Urlaub war, wenn man in Deutschland blieb.
Und als meine Mutter an diesem Morgen mit warmen Croissants und einem Milchkaffee in mein Zimmer kam, war ich schon längst überzeugt.
»In Frankreich schmeckt das alles tausendmal besser«, sagte sie.
»Okay, wir fahren nach Frankreich!«, sagte ich mit vollem Mund.
Meine Mutter führte einen kleinen Tanz auf und verbeugte sich. »Merci, Madame!«
Ich schätze, das waren die einzigen französischen Wörter, die sie kannte. Außer Croissant und Crêpe natürlich.
Und dann sagte meine Mutter: »Lass uns etwas unternehmen. Lass uns in die Stadt fahren. Du darfst dir ein neues Kleid aussuchen.«
Wir parkten den Nissan in einer Tiefgarage am Fluss. Von dort aus musste man zehn Minuten in die Stadt laufen, aber das war es wert. Die Tiefgarage war die billigste von allen. Außerdem spazierte man am Fluss entlang.
Der Fluss teilte unsere Stadt in zwei Hälften. Auf unserer Seite gab es einen Abschnitt, in dem man grillen durfte. Wenn es warm war, versammelten sich dort Großfamilien. Sie waren so groß, dass man nicht wissen konnte, wer der Vater von wem war oder der Onkel oder die Schwester oder die Cousine. Aber es spielte auch keine Rolle, denn jeder gehörte zu jedem. Die Frauen saßen auf bunten Decken, die Männer spielten Boule oder Frisbee. Später legten sie riesige Spieße auf den Grill. Die Kinder tobten herum, und manchmal stritten sie. Aber dann suchten sie sich einfach jemand anderen zum Spielen.
Manchmal lagen Lea und ich nach der Schule am Fluss im Gras. Lea war meine beste Freundin. Wir lagen zusammen am Ufer und machten Hausaufgaben. Jedenfalls machte ich Hausaufgaben. Lea kommentierte währenddessen die Kleider der Leute, die an uns vorbeispazierten. Lea hatte einen richtigen Klamottentick. Ihre Kleider waren wie: genug Geld zu haben, um ans Meer zu fliegen, und zwar erster Klasse; ein Drei-Gänge-Menü zu bestellen, ohne hungrig zu sein; oder shoppen zu gehen, ohne dass die alten Sachen kaputt waren.
Als meine Mutter und ich im Zentrum angekommen waren, wollte ich unseren Secondhand-Laden ansteuern, aber meine Mutter hielt mich am Arm fest.
»Nein, heute bekommst du etwas ganz Neues.«
»Aber …«, sagte ich, aber meine Mutter legte mir den Finger auf die Lippen.
Und so kam es, dass ich den ganzen Mittag in einer Umkleidekabine im größten Kaufhaus der Stadt verbrachte. Meine Mutter brachte mir ein Kleid nach dem anderen. Ich probierte alle an, und in allen kam ich mir fremd vor. Ich hatte keine Lust auf geblümtes Lila oder auf bunte Streifen.
»Wir suchen einfach weiter«, sagte meine Mutter.
Aber das mussten wir gar nicht.
Mein Kleid hing nicht bei den anderen. Es hing versteckt bei den Jeans. Ich wusste sofort, dass ich das perfekte Kleid gefunden hatte. Es war, als stünde mein Name drauf. Es war zitronengelb und passte so gut, als wäre es extra für mich geschneidert worden. Die Träger waren zwei Fingerbreit und doppellagig. Auf jeder Seite ließ sich die Länge mit einem Knopf anpassen. Und das Beste war: Die Knöpfe sahen aus wie Sonnenblumen.
»Und, wie findest du es?«, fragte ich, als ich aus der Umkleidekabine trat.
»Diese Knöpfe!«, sagte meine Mutter. »Wunderschön! Sind die aus Porzellan?«
Meine Mutter liebte Sonnenblumen. Ganz in der Nähe unserer Wohnung wuchsen Abertausende. Manchmal, wenn meine Mutter Trost brauchte, sagte sie: »Hey, Billie, lass uns zu den Sonnenblumen gehen!« Wir blieben so lange, bis die gelben Blätter in der untergehenden Sonne glühten. »Sie sind clever«, sagte meine Mutter. »Sie drehen sich immer ins Licht.«
Die Verkäuferin steckte das Kleid in eine weiße Schachtel. Die Schachtel steckte sie in eine pinkfarbene Tüte.
Meine Mutter und ich verließen das Kaufhaus Hand in Hand. Wir spazierten durch die Sonne, und meine Mutter fragte: »Hast du Lust auf ein Eis?«
Wir gingen ins Venezia, und ich durfte den Paradise Garden bestellen, den größten Eisbecher, den das Café zu bieten hatte.
»Du isst nicht, du malst«, lachte meine Mutter, als ich Erdbeere, Maracuja und Kokos mischte und die neu entstandene Sorte Flamingo nannte.
Nachdem ich die dickflüssige Masse durch den Strohhalm gesaugt hatte, bestellte meine Mutter die Rechnung. Sie gab ein großzügiges Trinkgeld.
Dann sagte sie: »Heute springen wir vom Zehnmeterturm. Heute ist ein guter Tag dafür.«
Ihren Blick kannte ich schon. So schaute sie, wenn sie sich selbst überrascht hatte. Spontaneität war für meine Mutter das, was für andere Leute Routine war: Sie gab ihr Halt.
Ich hatte nachts schon oft davon geträumt zu springen. Aber jedes Mal war ich, kurz vor dem Eintauchen ins Wasser, davongeflogen. Wenn ich aufwachte, klopfte mein Herz von innen heftig gegen meine Brust.
Kurz bevor wir am Schwimmbad ankamen, fing es an zu regnen, und in der Ferne donnerte es. Die Ticketverkäuferin wollte uns nicht mehr einlassen.
»Kassenschluss ist eine Stunde vor Ende der Badezeit«, sagte sie durch das vergitterte Fenster hindurch und legte ihre dicken Finger mit den rot lackierten Nägeln und den billigen Ringen auf die Tischplatte vor sich. Daneben lag ein Päckchen Zigaretten. Es war geöffnet, und eine Zigarette schaute heraus. Bestimmt würde sie bald eine Raucherpause machen.
»Wir könnten uns reinschleichen«, flüsterte ich meiner Mutter ins Ohr, aber meine Mutter schüttelte den Kopf und machte dieses Geräusch mit der Zunge, wie immer, wenn sie fand, dass ich Unsinn erzählte. Dann wandte sie sich an die Ticketverkäuferin.
»Diese junge Lady« – meine Mutter zeigte auf mich – »hat etwas zu erledigen. Und es ist« – sie schaute demonstrativ auf ihre Armbanduhr – »62 Minuten vor Ende der Badezeit.« Sie verschränkte die Arme vor der Brust. Obwohl sie so zierlich war, wirkte die Geste.
Bis auf ein paar Schwimmer war fast keiner mehr da. Wir stellten unsere Taschen ins Gras und zogen uns bis auf die Unterwäsche aus. Zum Glück trug meine Mutter eine normale Unterhose und keines von ihren »Ich-bin-verabredet-und-muss-heiß-aussehen«-Höschen.
Sie sprang zuerst. Meine Mutter ging, den Blick nach vorne gerichtet, ans Ende der Plattform, stand einen Moment lang ganz ruhig. Dann streckte sie die Arme nach oben, als wollte sie den Himmel mit den Fingerspitzen berühren, und faltete die Hände. Ihr Körper spannte sich wie ein Bogen und tauchte schließlich beinahe lautlos ins Wasser ein. Ihr Kopfsprung war perfekt.
»Jetzt du«, lächelte sie, als sie sich am Beckenrand hochzog und das Wasser aus ihrem Haar strich. »Es geht nicht darum, dass es schön aussieht. Es geht darum, dass du dich traust.«
Meine Mutter hatte immer genau die richtigen Worte.
Ich stieg die Metallleiter nach oben. Meine Mutter wurde kleiner, die blaue Fläche bedrohlicher. Ich stellte mir vor, der Turm sei ein Felsen und das Schwimmbecken das Meer. Ich stellte mir vor, ich sei eine Meerjungfrau und das Meer meine Heimat.
Und dann sprang ich. Als ich mit zittrigen Beinen aus dem Wasser stieg, zog meine Mutter ein Päckchen aus ihrer Tasche. »Für das mutigste Mädchen, das ich kenne«, sagte sie. Ich strich mit den Händen über das Einwickelpapier. Es knisterte. Darin war ein roter Badeanzug. Auf der Vorderseite prangte eine Haifischflosse, darunter stand BEWAREOFTHESHARK! Es war der coolste Badeanzug, den ich jemals gesehen hatte.
»Wo hast du den denn her?«, fragte ich.
Meine Mutter lachte. »Na, aus dem Kaufhaus!«
Ich schlang meine Arme um sie.
»Und woher wusstest du, dass ich springen würde?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich bin deine Mutter.«
Das alles hier, das war das beste Nicht-Geburtstagsgeschenk, das ich jemals bekommen hatte.
Zu Hause warteten wir darauf, dass das Gewitter zu uns kam, aber nichts passierte. Wir hatten die Wohnungstür und alle Fenster geöffnet. Wir hofften, dass eine frische Brise hereinwehen würde, aber es blieb drückend heiß. Und dann riss der Himmel einfach auf, und das Wasser verdunstete aus dem Boden und von den Blättern der Bäume.
Meine Mutter und ich saßen auf dem Sofa und aßen Wassermelone.
Das Sofa war unser Lieblingsplatz. Meine Mutter hatte es vor Jahren vom Sperrmüll geholt. Ahmed hatte ihr dabei geholfen, und von ihm kam auch die Idee mit dem Teppichshampoo. Er reinigte damit seine Gebetsteppiche, die vor unserer Wohnung in der Sonne trockneten, meine Mutter reinigte damit den Bezug aus blauem Samt, der an manchen Stellen ziemlich fleckig war.
Irgendetwas an unserem Sofa war magisch, davon war ich fest überzeugt. Es brachte meine Mutter zum Reden. Ich wusste fast nichts über ihre Vergangenheit. Ich wusste nicht einmal, wer mein Vater war. Aber manchmal erfuhr ich doch etwas.
Ich erfuhr zum Beispiel, dass meine Mutter in der Nähe von Budapest auf dem Land groß geworden war. Ihr Vater hatte das Haus mit seinen eigenen Händen gebaut.
Es gab drei Kinderzimmer, aber nur eines davon wurde benutzt. Die anderen beiden Zimmer waren für die Geschwister meiner Mutter geplant worden.
»Sie kamen nie zur Welt. Sie sind alle vorher gestorben.«
»Warum?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht.«
An das Haus grenzten ein Garten und Ställe. Als Kind spielte meine Mutter mit Katzen, Hühnern und Ziegen. In unserem Wohnzimmer hing ein Foto von ihr, wie sie auf einem riesigen Schwein sitzt und in die Kamera lacht. Es gab damals viel zu tun, aber keinen Vater. Der Krebs hatte ihn meiner Mutter weggenommen, Monat für Monat ein bisschen mehr. Als sie zehn Jahre alt war, setzte sie sich zu ihrem Vater auf die Bettkante und nahm seine Hand.
»Die Haut war beinahe durchsichtig«, sagte meine Mutter.
Sie musste ihm versprechen, immer allein zurechtzukommen.
Er starb noch am selben Tag.
»Was war das Schlimmste daran, keinen Vater mehr zu haben?«, fragte ich.
»Mit meiner Mutter allein zu sein«, sagte sie knapp. »Ihre Hand war immer schneller als ihr Mund.«
Wahrscheinlich, dachte ich, war das der Grund, warum wir sie noch nie in Ungarn besucht hatten.
Ich biss ein großes Stück Wassermelone ab. Der Saft rann an meinem Kinn entlang und tropfte auf den Zettel, der auf meinen Oberschenkeln lag.
»Sonnencreme, Sonnenhüte, Sonnenbrillen«, diktierte meine Mutter und freute sich darüber, dass alles, was sie sagte, mit »Sonnen-« begann. Meine Mutter hatte verdammt gute Laune. Ich weiß nicht, ob es an dem Sekt lag, den sie in ihren Fruchtsaft gekippt hatte, oder an Frankreich.
Wir wollten so schnell losfahren, wie es ging. Meine Mutter musste nur noch etwas bei der Arbeit klären.
Nach einer halben Stunde war die Liste fertig.
Und dann fiel mir plötzlich etwas ein.
»Wir haben gar keine Koffer. Oder?«
Meine Mutter schaute mich einen Moment lang an, als ob sie verarbeiten musste, was ich eben gesagt hatte. Dann lachte sie los. Das Lachen brach aus ihr heraus wie die Lava aus einem Vulkan, und ich war sicher, dass jeder auf unserer Etage sie hören konnte. Als sie sich beruhigt hatte, zuckte sie mit den Schultern und sagte: »Wir werfen einfach alles ins Auto.«
In dieser Nacht kroch ich zu meiner Mutter auf die Luftmatratze. Irgendwann wurde ich wach, weil ich schlecht geträumt hatte. Zuerst war ich auf Seepferdchen durch bunte Unterwasserwelten geritten, hatte mich in riesigen Muschelschalen ausgeruht und war an Algen in Richtung Wasseroberfläche geklettert, wo die Sonne glitzerte. Dann, auf einmal, wurde es immer dunkler um mich herum. Je dunkler es wurde, desto weniger Luft bekam ich. Als ich aufwachte, hämmerte mein Herz.
»Ich habe schon wieder vom Meer geträumt«, sagte ich.
»Was?«, fragte meine Mutter verschlafen.
»Haben wir irgendwann einmal am Meer gelebt?«, fragte ich.
»Vielleicht in einem anderen Leben«, sagte meine Mutter, und dann war sie auch schon wieder eingeschlafen.
5
In den nächsten Tagen sammelten meine Mutter und ich überall in der Wohnung Krempel, den wir mitnehmen wollten. In der Küche sammelten wir ihn auf dem Tisch, im Wohnzimmer auf einem Sessel, im Bad auf der Ablage unter dem Spiegel und in meinem Zimmer auf dem Fußboden. Nur unsere Kleidung lag dort noch nicht. Es war klar, dass wir sie erst kurz vorher einpacken konnten. Wir hatten einfach nicht genug Klamotten, um sie tagelang nutzlos auf dem Boden herumliegen zu lassen. Wir wussten zwar noch nicht genau, wann wir losfahren würden. Aber wir wussten, dass es bald sein würde, und wir wollten vorbereitet sein.
Meine Mutter hatte noch fast ihren ganzen Jahresurlaub übrig. Dort, wo sie arbeitete, war es nicht üblich, mehr als zwei Wochen am Stück zu nehmen. Aber zum Glück verstand meine Mutter sich gut mit ihren Chefs.
Und als sie eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, sagte sie grinsend: »Mach den Fernseher aus, und schmeiß die Waschmaschine an!«
»Ab wann hast du Urlaub?«, fragte ich.
»Ab morgen!«
Meine Mutter sagte »mo-o-o-o-o-rgen« und tanzte im Rhythmus ihrer eigenen Worte. Dann verschwand sie in der Küche. Ich hörte, wie sie eine Madeleine aus der Plastikverpackung holte. Seit klar war, dass wir nach Frankreich fuhren, aß sie nur noch solche Sachen.
»Und wie lange?«, rief ich nach nebenan.
»Vier Wochen!«
»Vier Wochen?!«
Ich konnte es nicht fassen, dass ich zwei Drittel meiner Sommerferien oder einen ganzen Monat oder dreißig Tage in Frankreich verbringen würde.
Ich musste sofort Lea davon erzählen. Immer, wenn es etwas Neues gab, erzählte ich ihr als Erster davon. Ich wusste ihre Telefonnummer auswendig, seit sie letztes Schuljahr neu in unsere Klasse gekommen war. Zuerst hatte ich gedacht, dass ihre Eltern umgezogen waren und sie deshalb die Schule gewechselt hatte. Aber dann ließ sie sich auf den einzigen freien Platz fallen, direkt neben mich. Sie roch nach Rauch, Parfum und Kaugummi. Sie sagte: »Ich bin geflogen.«
»Wohin?«, wollte ich wissen.
»Von der Schule.«
»Oh. Warum?«
»Bin da bei was erwischt worden.«
Lea winkte ab. Ich fragte nicht weiter nach. Ich war nicht sicher, ob ich wissen wollte, was passiert war. Lea verströmte eine Mischung aus Gedankenlosigkeit und Energie, die mich verwirrte.
»Lass uns in der Stadt treffen«, sagte sie, als ich sie jetzt anrief und erzählte, dass wir in den Urlaub fuhren. »Ich habe was für dich.«
Den ganzen Weg in die Stadt überlegte ich, was Lea mir schenken wollte, aber ich hatte keine Ahnung.
Wir trafen uns am Brunnen.
Lea umarmte mich und setzte ihren Rucksack ab. Oben aus dem Rucksack ragte etwas Lilafarbenes aus Plastik oder Gummi, so genau konnte ich es nicht erkennen.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Für dich«, sagte Lea und grinste. Dann holte sie das Ding aus dem Rucksack und überreichte es mir.
»Schwimmflossen?« Dann kapierte ich. Das waren nicht einfach Schwimmflossen. »Eine Meerjungfrauenflosse?«
Ich schrie fast. Dann umarmte ich Lea so heftig, dass sie beinahe das Gleichgewicht verlor.
»Man sagt Monoflosse dazu«, sagte Lea und setzte sich auf den Rand des Brunnens. »Gefällt sie dir?«
Ich hatte schon meine Schuhe ausgezogen und meine Füße in die Flosse gesteckt. Dann drehte ich mich um und hielt meine Fischfüße ins Brunnenwasser. Lea zog ihre Schuhe ebenfalls aus und krempelte die Beine ihrer Jeans hoch.
»Wo hast du die denn so schnell aufgegabelt?«, fragte ich und bewegte die Flosse im Wasser hin und her.
»Meine Mutter hat sie mir mal geschenkt«, sagte Lea. »Ist mir eingefallen, als du erzählt hast, dass ihr ans Meer fahrt.«
»Ich kann sie dir danach wieder zurückgeben«, sagte ich.
»Quatsch«, sagte Lea.
Ich freute mich so, dass ich unbedingt auch etwas Nettes für Lea tun wollte. Ich dachte kurz nach, und dann hatte ich eine Idee. Ich suchte in meiner Hose nach einer Münze.
»Wünsch dir was«, sagte ich und hielt die Münze zwischen Zeigefinger und Daumen in die Luft.
Lea schaute mich skeptisch an. »Glaubst du an so was?«
»Jedenfalls glaube ich nicht nicht daran«, sagte ich. »Los, wünsch dir was. Aber es muss etwas sein, das man nicht kaufen kann.«
Lea überlegte einen Moment. »Darf ich den Wunsch laut aussprechen?«
»Auf jeden Fall. Du musst sogar!«
In Wahrheit hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich wusste, dass man Sternschnuppen-Wünsche auf keinen Fall laut aussprechen durfte. Aber das hier war etwas anderes, und ich war gespannt, was Lea sich ausgedacht hatte. Ich zeigte ihr, wie sie sich hinstellen sollte, und dann warf sie die Münze hinter sich in den Brunnen.
Sie schloss die Augen und sagte: »Ich wünsche mir, dass ich und Billie ewig befreundet sind.«
Ich fand, dass das Verschwendung war. Wir würden doch sowieso ewig miteinander befreundet sein. Aber es war Leas Wunsch, und ich mischte mich nicht ein. Außerdem war es jetzt sowieso zu spät. Man konnte Wünsche nicht einfach umtauschen wie ein Paar Jeans.
»Holen wir uns am Kiosk ein Eis?«, fragte Lea jetzt.
»Muss ich dafür die Flosse ausziehen?«
Lea lachte. »Ich glaube schon.«
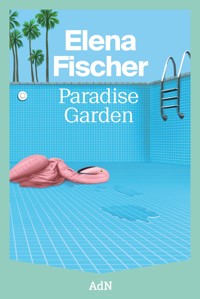
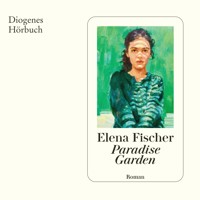














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












