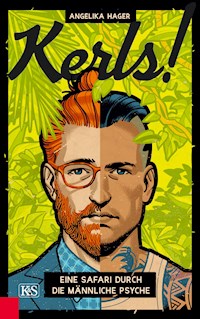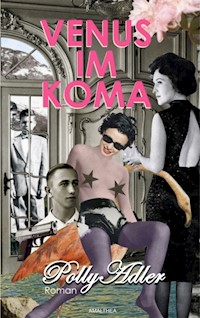Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Polly Adler auf dem letzten Opernball ihrer Karriere als Society-Journalistin, denn ihr Magazin »Flash« fiel eben der Printkrise zum Opfer. Das Society-Ereignis der Saison gerät jedoch zum Desaster. Unbekannte Anarchisten haben ein rabiates Bienenvolk in den Tanzsaal der Oper geschleust. Und der Stargast der neuen Kanzlerin, die Influencerin Coco Kaputt, schwimmt wenig später kopfüber in einem Schokoladebottich in der Tortenproduktion des Hotel Kranzler. Dummerweise übernimmt Kommissar Gerry Sturz, mit dem Polly vor 12 Jahren ein schwieriges Liebesverhältnis hatte, den Fall. Eine rasante Krimikomödie, deren Heldin die Kultfigur Polly Adler ist, bekannt durch die beliebt »Kurier«-Kolumne. »Witzig, gescheit und irrsinnig unterhaltsam: Polly Adler in Bestform.« (Harald Schmidt) »Liest sich wie Jazz und ist sehr amüsant.« (Caroline Peters)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!
Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf em Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?
Folgen Sie
auch auf Social Media
& abonnieren Sie unseren Newsletter
Über das Buch
Zwischen privatem Chaos und vielen durchaus auch komischen Katastrophen pendelt Journalistin Polly Adler durch ein Wien, das in Zuckerguss-Seligkeit, Traditionskitsch, Gier und Leidenschaft versinkt.
Eine Bundeskanzlerin, die Stressbewaltigung mit einem Callboy betreibt. Ein Opernball, der wegen Anarchisten aus dem Ruder gerat. Eine Influencerin, die tot in einem Schokobottich treibt. Ein Kommissar, der ein Gesicht wie ein ungemachtes Bett hat. Und mittendrinnen Polly Adler, die eben ihren Job bei einem Societymagazin verloren hat. Eine rasante Krimikomodie durch die Niederungen einer High Society, deren Treibstoff die Eitelkeit ist.
Angelika Hager
„Pardon, aber da schwimmt eine Leiche in der Schokolade“
Inhalt
Beim „Scharfen Hansi“
Katastrophenstimmung am Ballhausplatz
Im Schokoladen-Hades
Die Walzerqueen verbarrikadiert sich im Schockmodus
Der Honig-Heinzi versteht die Welt nicht mehr
„Das kriegst einfach nicht mehr aus dem System raus“ & ein kleines Pandabären-Trauma
De-licious oder Verzweiflung steht ihm fantastisch
Wo ist die Vantschi? Die Walzerqueen braucht dringend eine neue Ladung in Rosa
Sonderkommando Maja & „Priorisierungsstress“
Pollys Adrenalin schlägt Blasen & ein Überraschungsbesuch
Gerichtsmedizin-Debut für Inspektor Britney Wurnitsch
Mizzi Frondl und ihre Fake-Coco-Kaputt-Vita
Karli Riesenhuber macht eine Entdeckung
Das „Mopserl“ gibt ein Lebenssignal
Welpen-Vibes und ein Fahndungsdurchbruch
Karli findet Tattoo-Thea und gibt Vollgas
De-licious dreht durch und Herr Georg ist außer sich
Gucki Trampusch sieht dunkelrosa
Die Augen weit offen und der Maskenfall
Der Honig-Heinzi hat einen pinken Schutzengel & verplappert sich
Willkommen am Höllentor des sozialen Abstiegs & einmal Löffelstellung gratis
Marx-Maxis & Pollys Meltdown
Orgasmus-Premiere und unsanftes Erwachen
Im „Knödelparadies“ bei Pollys Erzfeind
Gerry bekommt den kalten Hauch der Macht zu spüren & Gucki erlebt die Enttäuschung ihres Lebens
Pollys Besuch bei der Hunnen-Fürstin
Kein „Tonilein hin, Tonilein her“-Gesülze mehr
Noch ein Schock im Hades des Kranzlers
„Ibiza-Dimensionen, Gerry, hörst du, Ibiza-Dimensionen!“
Interimskanzlerin der Herzen & ein Blick ins Schwarze
Höchste Zeit für eine Käsekrainer
Über die Autorin
Beim „Scharfen Hansi“
Es war gegen sechs, klirrend kalt und das Morgenlicht in ein nahezu surreales Pink getaucht. Einer von Pollys selbsthaftenden Strümpfen hatte das Versprechen des Herstellers nicht eingelöst und kringelte sich um den rechten Knöchel. Ein Anblick perlgrauer Traurigkeit. Natürlich, eh klar, wie denn auch anders. In dieser Art von Pannen war sie schon immer Bezirksmeisterin gewesen. Während sie noch überlegte, ob sie sich für einen Blasenkatarrh oder eine entwürdigende Ganghaltung entscheiden sollte, indem sie den Strumpf nach vorne gebeugt festhielt, stieg ihr der Geruch überbratener Käsekrainer in die Nase. Sie entschied sich für die Kategorie „Würde mit Blasenkatarrhrisiko“. Und außerdem dafür, die „Eitrige“ (was für ein ekelerregender Ausdruck für eine Wurst mit flüssigem Industriekäse) heuer auszulassen. Ihr war nach heißer Schokolade in eleganten Gefäßen. Und sie wusste auch, wo sie eine solche in den nächsten zwanzig Minuten schlürfen würde.
Und abgesehen von der Sehnsucht nach Schokolade hatte sie auch keine Lust, vor den abgefüllten Cholesterin-Junkies, die sich in ein paar Metern Entfernung rund um den Würstlstand scharten, eine Lachnummer abzugeben und Fragen wie „San Sie net die von … na, na? Hölfens ma schnell?“ und „Ist des net jetzt abg’würgt worden … i glaub, da hab ich was g’lesen, oder?“ zu beantworten.
Die Ballrobe – Vintage-Yves-Saint-Laurent in Pink-Schwarz-Orange –, die sie sich von ihrer Fashionista-Freundin Iris geborgt hatte, war inzwischen reif für den Putzerei-Premiumservice. Irgendein Vollidiot war ihr in der allgemeinen Panik auf den Saum gestiegen, aber dem Himmel sei Dank keine Risse, nur eine aufgelöste Naht. Verkehrswert unter Vintage-Hysterikerinnen nämlich siebentausend Euro. Mindestens. Doch auf dem letzten Opernball ihres Lebens hatte sie im Lifestyle-Redakteurinnen-Sprech „effortless chic“ demonstrieren wollen, um sich von den überladenen Versace- und Dolce &Gabbana-Zirkusprinzessinnen mit unaufgeregter Stilsicherheit zu unterscheiden. Lookgebot: Parisienne aus der Hüfte. Bemüht unbemüht eben. All der Aufwand völlig sinnlos, wie sich sehr bald herausgestellt hatte.
Nichts war diesmal wie immer gewesen. Und irgendwie doch. Denn wie immer hatte „der Ball der Bälle“, wie einem die TV-Kommentatoren mit ihrer abgestandenen Launigkeit (bis zu jenem jede Contenance zerbröselnden Panik-Zeitpunkt) nicht müde gewesen waren, mitzuteilen, auch heuer am Würstlstand geendet. Und als hätten die Katastrophen der vergangenen Nacht nie stattgefunden, sammelte sich rund um den fettverschmierten Glaskobel neben der Oper, auf dem der scharlachrote Neon-Schriftzug „Zum scharfen Hansi“ prangte, ein soziologisches Mischvölkchen. „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht mehr zu ändern ist“, heißt die Dauerbrenner-Zeile in der Operette „Fledermaus“.
Der Scharfe Hansi diente den hartnäckigsten Ballistas schon immer als (durchaus promifrequentierte) Absturzrampe. Bei jenem Menschenschlag, der die goldene Wiener Trinkerregel „Aner geht immer noch“ (womit jede Form von Alkohol gemeint war) sehr ernst nahm und es unter seiner Würde fand, vor neun Uhr morgens schlappzumachen, lösten sich ab einem gewissen Promillegrad die sozialen Barrieren im Alkoholnebel auf.
Drei Straßenkehrer in der grellorangefarbenen Plastikkluft der Gemeinde Wien, einer davon bis weit über den Kehlkopf mit einer schwimmenden Nixe tätowiert, hatten sich unter drei Damen mit entgleisenden Hochsteckfrisuren und rustikalem Idiom (schätzungsweise obere Steiermark) gemischt. Sie prosteten einander mit ihren „Hülsen“ der Brauerei Schwechater zu. Einer der Straßenkehrer erhob die Dose über seinen Kopf und rief: „Mein persönlicher Psychiater heißt Schwechater!“ Tosendes Gejohle. Eine der drei Grazien hatte nicht einmal bemerkt, dass ihr der linke falsche Wimpernkranz wie eine Hängeleiter aus dem Augenwinkel baumelte. Zu tief war das Damentrio in die Ereignisse der vergangenen Nacht verstrickt. Zwischen Empörung und wohligem Schauern, bei so einem Mega-Desaster dabei gewesen zu sein, wurde der Morgenfrost von ihren Gesprächsfetzen wie „Na, unseren ersten Opernball hätt’ ma sich a anders vorg’stellt!“, „Bist du deppert, des waren ja auf amal so vüle“ und „Mich hat kane derwischt, i bin glei g’rennt“ durchschnitten.
Daneben lehnte der landesweit bekannte Immobilieninvestor Stanislaus Kopp, der wie die Danilo-Parodie einer Provinzbühne wirkte: Einen weißen Seidenschal hatte er theatralisch über sein schwarzes Kaschmir-Cape geworfen, und mit schwerem Zungenschlag wollte er alle, wirklich alle, auf Wodka-Shots einladen. Möglicherweise ein tollpatschiger Versuch, seine in den Medien bereits sachte angekündigte Pleite als übles Gerücht hinunterzustufen. Oder um simple Volksverbundenheit zu demonstrieren.
„Was is’ mit an Frühstücks-Wodka, Frau Polly, oder fallt des wieder unter dera Compliance?“, lallte er wiederholt, als Polly im vermeintlichen Sicherheitsabstand gerade den widerspenstigen Strumpf in ihrer pinkfarbenen Clutch verstaut. Ja „dera Compliance“, das Anfütterungsverbot für Journalisten war in vielen Fällen eine wirkliche Spielverderber-Regelung, nur in dem Fall mehr die perfekte Ausrede.
Sie zwitscherte: „Danke, ganz lieb, aber nein danke.“
„Weiber! Warum des immer solche Spaßbremsen sein müssen!“, antwortete der Kopp, und seine Zunge war von promillebedingter Schwere. Diese Bemerkung bedachte sie mit einem vitriolhaltigen Lächeln, durchzogen von Spurenelementen von Mitleid. Er hatte ja seine Gründe, der Arme.
Der Möchtegern-Danilo rasselte nämlich nicht nur in eine Mega-Pleite, er führte auch gerade mit seiner Ehefrau Nummer drei, Danila (paradoxerweise hieß sie wirklich so), eine herausfordernde Scheidungsschlacht. Wie viele andere in diesem Trophywife-Genre war die Dame den Medien einst als eine promovierte ungarische Kunsthistorikerin verkauft worden. Im Zuge der abrupten Trennung wurde sie dann schnell zu einer „miesen Ostschlampe“, wie er auch jetzt wieder dem inzwischen sehr mürbe blickenden Scharfen Hansi in einem Alter-Weißer-Mann-Gespräch erklärte: „De Ostweiber holen da des Weiße aus die Augen, so schnell kannst gar net schauen.“ Und außerdem lasse sie sich jetzt ständig „Goldene“ kommen, nur, um ihn noch mehr fertigzumachen, „von dera Inkognito-Agency“.
Diese kryptische Anmerkung von den Goldenen (vielleicht ging es um Kreditkarten?) waren weder der inzwischen sehr müde Hansi noch Polly in der Lage zu entschlüsseln. Der Scharfe Hansi schien auch nicht mehr die Kraft aufzubringen, da nachzuhaken, sondern hob und senkte den Kopf nach Art dieser Wackeldackel, die manche Menschen aus unerfindlichen Gründen auf der Heckablage ihrer Autos positionieren. Die Nacht mit all ihren Abgründen hatte dem einst scharfen Hansi inzwischen die eigentliche Voraussetzung für einen florierenden Würstlstand abgesaugt: die Nerven und das Einfühlungsvermögen für seine oft aus dem Ruder geratende Klientel. Denn letztlich hatte so ein Würstelstand ja durchaus etwas von einer psychotherapeutischen Betreuungsstation.
Der Danila-Rosenkrieg gestaltete sich als doppelt herausfordernd, weil Stani Kopp Ehefrau Nummer drei sträflich unterschätzt hatte und Frau Superclever sich von allen Briefkastenfirmen in der Karibik und Subunternehmen von Strohmännchen und -weibchen penibel aufgelistete Notizenkolonnen gemacht hatte. Inklusive Fotos der „classified“ Unterlagen, wie in Spionagethrillern gerne Geheimstufe Dunkelrot bezeichnet wurde. In bester Ivana-Trump-Tradition, die nach der Scheidung von „The Donald“ mit dem schönen Spruch „Don’t get mad, geteverything“ durch die Talkshows gesegelt war. Restinpeace, Ivana.
Polly bog in die Kärntner Straße ein, wo ein paar verfrorene Debütantinnen mit verstörten Blicken nach einem offenen McDonald’s suchten.
Solche weltbewegenden „Danilo versus Danila“-Details kannte sie natürlich als langjährige Leiterin des sogenannten „Menschenressorts“, eines Wochenmagazins, wobei bei „Flash“ der interne Untertitel dazu „Tragödien, Trennungen, Tode und Tralala“ lautete. Unter Tralala fielen Ödnisse wie Hochzeiten, Babyreportagen, Urlaubsfeatures oder – Pollys ultimatives Hass-Genre – Homestorys. Irgendein Startenor in einem geschmacklosen Dachbodenausbau in der Innenstadt, der ein buntes Wok-Gericht brutzelte, fand sich immer. Irgendeine Moderatorin einer peinlichen Astro- oder Rateshow zögerte keine Sekunde, ihr neues Glück mit einem Ex-Fußballer und dem Jack Russell Terrier Balzac/Archie/Rufus in einem umgebauten Fuhrwerkerhäuschen im Wald- oder Weinviertel zu demonstrieren. Und dazu gab es mit achtundneunzigprozentiger Trefferquote die einfallslose Sprachhülse „Ich bin endlich angekommen“.
Bei Tragödien, Trennungen und Todesfällen, also den Geschichten jenseits des Heile-Welt-Kitsches diverser A- bis F-Promis, war Polly verlässlich zur Hochform aufgelaufen.
„Glück ist harte Arbeit“, hatte der Dalai Lama einmal irgendwo abgesondert. Dem konnte sie nur entgegensetzen: „Unglück die noch viel härtere, Eure Heiligkeit.“ Und hatte die besseren Auflagezahlen und exorbitant höhere Klicks sowieso. Nichts Neues unter der Sonne.
Aber darüber musste sie jetzt nicht mehr grübeln, denn seit drei Wochen war „Flash“ Geschichte. Eine absehbare Entwicklung, die Stammleserschaft – man konnte es sich nicht mehr hübschreden – driftete in die Demenz ab oder starb zunehmend gleich weg. Und ihr hassgeliebter Chef, der noch immer analog tickende Anatol Grünberg, hatte den Online-Lesekonsum zehn Jahre lang verschlafen und „Flash“ nicht entsprechend fürs Netz aufgestellt.
Trotzdem hatte der Realitätsbiss, dass das Blatt, ihr Blatt, tatsächlich „zuardraht worden“ ist, wie die Frau Elfi in der Kantine vermerkt hatte, Polly anhaltend unter Schock gesetzt. Schließlich hatte sie dort sechzehn Jahre lang Frondienste geleistet. Eigentlich hatte sie dort nur ein paar Jahre den Ball flachhalten wollen, solange die Resi klein war. Keine hochkomplizierten Storys mit Rechercheaufwand, sondern Wohlfühl-Tralala mit Society-Schabracken und allzu oft schnell verglühenden Shootingstars, also kleinkindverträglich.
Nach der Scheidung von Max, dessen innenarchitektonischer Arbeitsenthusiasmus einem gewissen Spontaneitätsprinzip unterlag, hatte sie ein fixes Einkommen gebraucht, das ihr keine wahnsinnig große Geistesakrobatik abverlangte. Und die Jahre gingen ins Land. „Wir sind auch die Entscheidungen, die wir nicht treffen“, hatte sie Charlotte Rampling als vom Leben zerschundene TV-Kommissarin in irgendeiner Serie sagen gehört.
Inzwischen war die Resi aus dem Windelalter doch schon ein bisserl hinaus und wohnte allein beziehungsweise mit wechselnden Tinder-Dates in Berlin. Und das seit vier Jahren.
Doch irgendwie hatte Polly den Absprung in ein intelligenteres Medium verpasst. Die Angebotslage stagnierte inzwischen sowieso. Das war nicht immer so gewesen. Aber Anatol hatte stets alle Register gezogen, wenn sich Möglichkeiten zu einem Jobwechsel auch nur abzeichneten. Wie ein Spürhund hatte er abgecheckt, wenn sie auch nur daran dachte, sich neu aufzustellen. Und entsprechend mit Benefits wie Dienstwagen, mehr Urlaub, ein paar Prozent mehr aufs Gehalt oder einem Wellness-Aufenthalt (natürlich ein Gegengeschäft der damals noch funktionierenden Anzeigenabteilung) gewedelt.
„Inzwischen ist Print so tot wie Disco“, pflegte ihr ehemaliger Fotograf Lo zu sagen, der sich inzwischen als Hundeflüsterer und Hochzeitsknipser über Wasser hielt, „ich kenne keinen Menschen, der sich noch ein Magazin kauft.“
Und jetzt war sie fünfundfünfzig, also in der Todeszone des Arbeitsmarkts.
Aus, Schluss, Ende Gegrübel, es war sechs Uhr zehn, ihr letzter und mit Sicherheit aufregendster Opernball lag hinter ihr. Während die Kollegen, also eigentlich Ex-Kollegen anderer Medien, gerade in Blasen schlagendem Adrenalin online Berichts-Purzelbäume schlugen, konnte sie ganz entspannt sein. Kein Deadline-Druck mehr, der ihr wie eine Eisenklammer im Nacken lag.
„Beenthere, donethat, gottheT-shirt“, ermunterte sie sich innerlich wie ein Sportcoach. In wenigen Minuten würde sie ein flaumiges Briochekipferl in die beste heiße Schokolade der Stadt tauchen. Rein vordergründig also alles sehr geschmeidig.
„Es ist immer jetzt“, sang einst Michael Heltau, der Burgtheater-Doyen, einer der letzten Botschafter aus einer versinkenden Welt. Eine Philosophie, die sie sich jetzt antrainieren musste, um nicht völlig zu verzweifeln. Wie sehr liebte sie diesen Menschenschlag, in dem sich Feinsinn, Stil und Gelassenheit zu einer Edelmischung vermengten, und nirgends waren für diesen Menschenschlag Nachfolger in Sicht. Düstere Zukunftsaussichten nicht nur für ihr soziales Leben, sondern auch für ihre Branche.
Vielleicht sollte sie auf Optimismus-Coach umsatteln und traurigen Prekariats-Menschen (denen es ähnlich erging wie ihr) Sprachhülsen à la „Das Glas ist immer halb voll und nie halb leer“ oder „Krisen sind gleichzeitig solche Chancen“ um die Ohren pfeifen. Aber auch von diesen Klangschalen-Karins und Edelsteintherapie-Evis, die mit Sicherheit einen zehnmal filternden, isotonisch einwandfreien Trinkwasserspender in ihrer in hellem Ocker gehaltenen Praxis stehen hatten (wo sie unermüdlich Selbstliebe trichterten), war der Markt inzwischen bis zum Abwinken überschwemmt.
Endlich in Sicherheit. Die mit geschliffenem Glas durchsetzten Eichenschwingtüren des „Kranzlers“ wurden von dem alten Portier Hermann geflissentlich mit einem weichen „Verehrung, Frau Adler“ geöffnet. Früher hatte er sie manchmal mit „Küss’ die Hand, Gnädigste“ begrüßt. Das hatte ihm seine Chefin leider ausgetrieben. Ungeziemend, weil zu persönlich.
„Bitte davon Abstand nehmen, lieber Hermann“, hatte die Iris ihr Faktotum mit einer in Pollys Augen etwas übertriebenen Schärfe getadelt.
Hinter der Rezeptionstheke stand sie jetzt, die Chefin des Hauses, trotz der frühen Morgenstunde mit perfektem Fönschwung und ebensolchem Make-up in einem karmesinroten Samtkostüm mit Stehkragen. Polly war sicher, dass Iris kaum drei Stunden Schlaf hinter sich hatte: Der Opernball und alles, was dazugehörte, waren für sie und die Hotelcrew die anstrengendsten achtundvierzig Stunden des Jahres. Wenn man ehrlich war, sah Iris wie die Bildungsbeauftragte einer konservativen Partei aus, die am Wochenende liebe Freunde in ihre Hietzinger Villa zu einem Hausmusik-Brunch einlud, nur eben einen Hauch schnittiger. Polly vermutete, dass man ihre „BFF“ – wie die wie alle in „Börlin“ mit Anglizismen verseuchte Resi sagen würde, als Abkürzel für „bestfriendforever“ – eigentlich das ganze Jahr über nachts aus dem Bett scheuchen könnte, und Frisur wie Lippenstift säßen innerhalb kürzester Zeit an der richtigen Stelle.
So war die Iris Kranzler eben, sie vereinte perfekt Resolutheit, auf Herzlichkeit geölte Freundlichkeit und den Drang nach Perfektion in der Tradition ihrer Mutter. Zumindest in diesen heiligen Hallen.
Iris konnte allerdings auch anders, und zwar ganz anders: nämlich beschwingt von Tequila, lustigen Zigaretten, wie Iris Joints gerne nannte, durchaus auch mithilfe beschleunigender Substanzen wie Marschierpulver in engen schwarzen Lederhosen zu „Talking Heads“ ausdruckstanzen oder, wie sie ihre ekstatische Solo-Choreographie auf Partys im Zustand der hemmungsbefreienden Auflösung nannte, „mit der Luft ficken“. Aber natürlich nur im privaten Ambiente. Und – bei genauem Nachdenken – war das auch schon eine sehr lange Weile her.
Sag mir, wo diese Nächte sind, dachte Polly, wo sind sie geblieben … Mon dieu, was wäre das für ein Eklat gewesen, wenn einer der Hotelgäste Madame Kranzler je so zu Gesicht bekommen hätte.
Während Iris mit der Geduld einer buddhistischen Heiligen das Allergien-Protokoll einer überbotoxten Südstaatenschönheit (deren Role ModelNicole Kidman sein dürfte) aufnahm („Goatcheesecouldbefatal, youknow“, wurde die nicht müde, hinzuweisen), wartete Polly im Abseits und strich sich rasch noch einmal das geborgte Vintage-Juwel aus dem Haus Yves Saint Laurent glatt. Der arme Yves, so schöne Kleider hatte er gezaubert und war doch zeitlebens nicht aus seinen Ängsten und Depressionen herausgekommen. Hoffentlich konnte sie den deprimierend lädierten Saum verbergen. Bei ihren Vintage-Juwelen verstand Iris wenig Spaß. Dass sie das Kleid überhaupt geborgt hatte, war eine echte Liebeserklärung und auch eine Art Trostpflaster für Polly in deren beschissener Situation gewesen, wobei Iris prinzipiell einer der großzügigsten Menschen war, die Polly kannte.
Nach gefühlten fünfzehn und tatsächlichen acht Minuten der Ziegenkäse-Diskursdauer hörte sie ihre geliebte Freundin schnurren: „Da schau her, unsere Ballkönigin ist ja auch schon da. Und schaut mir sehr nach heißer Schokolade aus. Also Georg, bitte übernehmen Sie.“
Der Herr Georg, der eigentliche Chefrezeptionist, lächelte geflissentlich, er kannte das Ritual zwischen den beiden Freundinnen nach jedem Opernball. Der Herr Georg war der Typ Mann, der jederzeit seinen Impfpass finden würde. Und, so vermutete Polly, im September bereits einen Termin für den Winterreifenwechsel buchte. Ein hornbebrillter, glatzköpfiger Fels der totalen Verlässlichkeit.
Der Verlässlichkeitsfels Georg konnte nicht mehr sehen, dass Polly in Tränen ausbrach, während ihre Freundin schützend den Arm um sie legte. Ein Blick auf ihr unbestrumpftes Bein ließ Iris sofort in Richtung ihrer Hausdame, Frau Ruth, winken, die dank jahrelanger Kenntnis der Chefin sogleich wusste, was es unverzüglich zu erledigen galt.
Nichts wie hinunter in das Kranzler’sche Alchemie-Paradies, wo es nach Schokolade, Nougat, frisch gebackenem Biskuit und heiler Idylle ohne Kündigungen, Übernahmen, Attacken, gewaltbereiten Aktionismus und anderen Rücksichtslosigkeiten roch. Hier musste nur das Verhältnis zwischen Bitter- und Milchschokolade stimmen, alles andere war irrelevant. Die Mademoiselle-Kranzler-Nougat-Schoko-Biskuit-Torte konnte es übrigens mit der vom Sacher durchaus aufnehmen und war auch weniger trocken. Allerdings leider auch weniger haltbar, weswegen (und nur deswegen) daraus kein Welterfolg hatte werden können.
„Ist der Stargast schon eingetrudelt?“, wollte Polly dann doch noch wissen, als ihr Schluchzen endlich verebbt war (und zwar in einem Schluckauf, was nicht unkomisch klang), während sie den Geheim-Lastenaufzug hinunterfuhren.
„Keine Ahnung“, antwortete Iris, „ich denke schon. Nach dem Irrsinn, den ihr da alle mitmachen musstet … Hände hoch und tief durchatmen, beste Schluckaufvernichtungswaffe!“ Zusatz: „Mit dir hätte unser Fräulein Superpromi ohnehin nicht kuscheln wollen.“
Stimmt. Mit ihrer Geschichte für „Flash“ im Vorfeld zum Opernball hatte sie eine echte Blutspur gezogen. Denn der groß promotete VIP-Fang der Interimskanzlerin war nach der Lektüre von Pollys Enthüllungen im „Flash“ öffentlich beschädigt worden. Und natürlich war die VIP-Tussi selbst höchst notamused gewesen. Mindest ebenso wie die Frau Interimskanzlerin, die die Wahl ihres Logengasts als echten Scoop verkündet hatte und höchst sauer war, dass „Flash“ vulgo Polly ihr diesen Fang versaut hatte.
Polly fröstelte, Iris legte den Arm um sie. „Armes, armes Mausl. Das muss ja der Horror gewesen sein in der Oper.“
Sie lehnte sich an Iris und schniefte: „Der absolute Wahnsinn. Ich habe echt solche Angst bekommen. Man wusste ja nicht, ob die Bienen nur das Vorspiel sind und vielleicht danach noch was Härteres kommt wie Tränengas oder eine Bombe.“ Nach einer Pause fügte sie hinzu: „Danke, dass es dich in meinem Leben gibt.“
„Und vice-versa.“
Katastrophenstimmung am Ballhausplatz
Die Interimskanzlerin Sissi Kogelnik lag in ihrem Büro am Ballhausplatz erschöpft auf einer sogenannten Ohnmachts-Chaiselongue, einem Möbel, das man im Biedermeier erfunden hatte, um die von männlichen Flirtoffensiven aus der Spur gekippten Damen darauf zu betten und sie unter dem Einsatz von Riechsalzfläschchen wieder ins Bewusstsein gleiten zu lassen.
Keine Liegestatt könnte jetzt passender sein, dachte sich Kogelnik, während sie kurz die Augen schloss und den weißen Bademantel enger um sich zog. Bloß auf das Riechfläschchen, das sie wieder in die mühsame Realität zurückpeitschen könnte, verzichtete sie gern.
Irrationalerweise hoffte sie, dass der Bademantel wie ein Tarnkleid wirken und sie vor allem, was ihr in den nächsten Stunden bevorstand, bewahren könnte. Auf dem Boden lag die mitternachtsblaue Escada-Robe, die aus der Deutschland-Zentrale extra noch gestern Nachmittag mit heißen Propellern eingeflogen worden war. Das wäre wieder Futter für die Klima-Kinder, aber natürlich alles topsecret. Inzwischen war die Robe mit satteltaschengroßen Schweißflecken in der Achselgegend verziert. Kaum rauszukriegen. Das wusste sie noch von ihrer Mutter, die ein kleines Schneideratelier betrieben hatte. Daneben standen die strassbesetzten Louboutins, die ihr ihre Assistentin eingeredet hatte: „Voll stylish, die Loubis, Chefin, und überhaupt nicht konsi.“ Irgendwann würde sie ihr unter Strafandrohung beibringen müssen, dass das konservativ hieß. Dieser Abkürzungswahn! Bereits ab Beginn dieses in jeder Hinsicht beschissenen Opernballs hatte sie die Assi dafür verflucht – einfach zu hoch für eine Frau mit Bandscheibenproblemen, diese Loubis. Und für diese bescheuerten roten Sohlen zahlte man mit Sicherheit um ein Eckhaus mehr als für anständige Stuart Weitzmans oder Sergio Rossis, ihre sonstigen Hausmarken.
Das aber war, im ernüchternden Morgenlicht eines kalten Februartags betrachtet, ihr geringstes Problem. Wie war sie nur in einem Wellness-Bademantel auf diese Chaiselongue in die wichtigste Amtsstube der Republik geraten?
Einfache Frage, einfache Antwort: Weil die Eitelkeit im Endeffekt dann doch das Steuerpult übernommen hatte. Irgendwann hatte sie sich unter ein bisschen halbherzigem Gezicke und Geziere zu dem Wahnsinn überreden lassen.
Staatsbürgerliche Verantwortung und der ganze Tralala.
Vor acht Wochen war die Koalition mit ihrer Partei, den Konservativen, und den Rechtspopulisten mit Karacho geplatzt. Offiziell ließen sie wie in einem Scheidungsprotokoll „unüberbrückbare Differenzen“ anführen.
Tatsächlich lag diese sowieso von Anfang an äußerst filigrane Konstruktion aus einem erschreckend banalen Grund in Trümmern. De facto hatte der rechte Schreihals sich zwar oft in Nazi-Terminologien verstiegen (zuletzt mit der Variation der SS-Parole „Österreich, Österreich über alles“), aber daran hatte man sich, so schien ihr, irgendwann gewöhnt, wie an den „Orange Man“, wie Jane Fonda diese Ausgeburt von Trump gerne nannte. Fortschreitende Desensibilisierung für Grauslichkeiten, auch im mittleren Flügel. Völliges Nazi-Teflon. Aber dann war eine explosive Spesenabrechnung an den Investigativpodcast „Nicht zu fassen“ geleakt worden. Darin hatte der „Volkskanzler“, der Kleine-Mann-und-kleine-Frauen-Versteher, dieser Bierzelt-Goebbels, die private Geburtstagsfeier für seine neunzigjährige Mutter in einem Nobel-Rindfleischtempel als Regierungsveranstaltung deklariert. Und sich auch nicht entblödet, dafür Security auf Staatskosten zu ordern.
„So sind wir nicht“, strapazierte der Bundespräsident auch im Zusammenhang mit diesem dreisten Spesenmissbrauch seinen Redeklassiker bei Krisen aller Art. Es folgten vor Selbstmitleid triefende Rücktrittsinszenierungen – inklusive vielem „Ich habe alles gegeben“- und „Mir ging es nur um dieses Land, die Festung unserer Freiheit“-Pipapo –, und flugs wurden Neuwahlen terminiert. Was gleichbedeutend war mit dem erneuten Anwerfen der Geldverbrennungsmaschine, was ein Millionenfaches der Geburtstagsfeierkosten verschlingen würde.
Dass man die rechten Rumpelstilzchen mit dieser Aktion auf Dauer in die Schranken würde weisen können, blieb jedoch höchst fraglich. Wahrscheinlich würden sie bei diesem Wahlgang nur noch mehr Prozente abstauben. Und die Roten und die Grünen benahmen sich nach wie vor wie Rehe auf der Autobahn – panisch und planlos.
Wie hatte ihr Dirk Klinsmann, Herausgeber der fettesten deutschen Boulevardzeitung, ein in Berlin sitzendes „Exklusiv! Exklusiv!“-Brüllorgan, bei einem Antritts-Hintergrundgespräch nach dem dritten Cognac im „Steirereck“ zugegrölt: „Gnädigste, nur voll Bescheuerte und echte Flachzangen gehen heutzutage noch freiwillig in die Politik. Grottenschlechte Bezahlung, ein Bruchteil von dem, was du in der Privatwirtschaft an Kohle einfahren kannst, ständig unter Strom, Big Brother is always watching, und nebenbei kriegst du dauernd auf allen Kanälen eine in die Fresse. Das tut sich doch keiner an, bei dem alle Tässchen im Schrank sind. Hab ich recht oder hab ich recht?“ Klinsmann war so begeistert von seiner Erkenntnis gewesen, dass er sich gleich noch einen vierten Cognac bestellte, diesmal verlangte er, präpotent wie immer, einen Jahrgang „rund um den Zweiten Weltkrieg“. Den hatte sie nicht auf die Regierungsspesen nehmen können, sondern ihn aus ihrer privaten Tasche bezahlt. „Man soll der Not kan Schwung geben“, hatte ihre Klagenfurter Großmutter immer gesagt, und so rechtfertigte sie diese astronomische Ausgabe vor sich selbst, schließlich wollte man sich keine unnötigen Feinde machen.
Der Termin für die Neuwahlen war erst in drei Monaten. Wegen irgendwelcher Fristen, die einzuhalten waren. Und da hatte ihr Parteikollege, der Vize-Franzi, wie man den Vizekanzler Franz Hauspflug im Volksmund gerne nannte – ein lieber Mensch, aber null Cojones – die Flucht ergriffen, indem er sich ein Burnout bastelte. Wer konnte es ihm verübeln, denn seine Umfragewerte waren schon vor dem Krach unter aller Sau gewesen, er wäre mit Höchstgeschwindigkeit ins Verderben gestürzt.
Bis zu dessen Anruf auf dem Festnetz ihres nicht gerade überladenen Schreibtischs war das Land führungslos durch diese Superkrise geschlingert, wie ein Schiff, das man nachlässigerweise nicht richtig verankert hatte und keiner eine Ahnung hatte, wie man es einfangen und – Schritt zwei – wohin man es überhaupt führen solle.
Sie war für den Job als Interimskanzlerin aus dem Weißen-Elefanten-Haus geholt worden, so der Terminus für Abteilungen innerhalb von Ministerien für Jobs, die eigens für Menschen kreiert worden waren, die man eigentlich nicht mehr brauchte, aber auch – sei es aus Solidarität, aus arbeitsrechtlichen Gründen oder wegen zu großem Insiderwissen – nicht ganz loswerden konnte. Sie war sich noch immer nicht sicher, zu welcher Kategorie sie zählte. Und wie viele vor ihr mit fliegenden Fahnen vor diesem Angebot in Panik weggesprengt waren. Danke, ganz lieb, aber nein danke.
Sissi Kogelnik hatte ihre komfortable, gemächliche „Sonderbeauftragte“-Existenz im Weißen-Elefanten-Trakt des Landwirtschaftsministeriums tatsächlich gemocht. Ab und zu Kühe streicheln bei Viehauktionen, Anti-Phosphat-Blogger und Gülle-Aktivisten zu einem Panel einladen, ein Bieranstich, ein Almabtrieb vor den Landesstudiokameras, eine gar nicht so mickrige Charity-Sache zugunsten von Arbeitsunfallopfern bei der Landwirtschaft, alles pomali (*ursprünglich aus dem Tschechischen: gemächlich).
Behinderte – pardon: eingeschränkte – Bauern und natürlich Bäuerinnen (sonst regen sich diese Woke-Rabiaten wieder auf) über die Mähdrescher gedonnert waren, die ein wild gewordener Stier niedergetrampelt hatte oder die mit dem Traktor einen Hang hinuntergekippt waren, gut versorgt zu sehen, war ihr wichtig. Das war wenigstens sinnvoll. Ein seltenes Gefühl in diesem Job, das man auskosten musste.
Und ihre Idee, die bayrische Ex-Snowboarderin Coco Kaputt (in Wahrheit hieß sie Mizzi Frondl) mit ihren 1,2 Millionen Followern als Opernball-Stargast in ihre Loge zu bitten, war da ein genialer Schachzug gewesen. Coco Kaputt hatte aus ihrem verlorenen Bein und der Prothese ein echtes Geschäftsmodell gebastelt und die volle Medientauglichkeit: Coolness,Empowerment (das haben die Jungen ja heutzutage so gern), tragisches Schicksal, aus eigener Kraft wieder nach oben, Snowboarder-Kultfigur, Erdverbundenheit, Heimat war für die endlich kein Schimpfwort, Inklusion und ein Aussehen wie eine junge Kate Moss (minus Nikotin und Alkohol). „Allinone, eine popkulturelle Brand“, wie ihr Mediensprecher das nannte, „die alle Stückerln spielte“. Unter Coco Kaputts Insta-Postings reihten sich verlässlich die Hashtags #fuckdestiny, #tötedeineschwächen, #seiderpilotundnichtderpassagier, und bis zu fünfzigtausend Herzchen likten diese Optimismus-Parolen verlässlich innerhalb weniger Minuten. Mit ihren Self-Empowerment-Vorträgen füllte Mizzi/Coco inzwischen ganze Mehrzweckhallen.
Ihr Stargast-Casting war also prinzipiell durch und durch eine Spitzenwahl gewesen und nicht so was vorhersehbar Ödes wie den finnischen Gesundheitsminister einzuladen, der in einer Regenbogenfamilie lebt, wie ihr der Fleischmann in seiner Queer-Besessenheit vorgeschlagen hatte. Dass die Schwulen immer glaubten, dass das Schwulsein heute noch irgendwen interessierte oder aufregte. Danke, ganz lieber Vorschlag, aber nein danke, damit holt man sich doch nurmehr ein müdes Medien-Gähnen …
Was für ein Pech aber auch! Es wäre ein Trumpf gewesen, mit Coco an ihrer Seite Audienzen in der Loge zu geben. Dabei hatte sie noch mit dem Trick, dass der Prothesen-Mogul Carl Zwock diskret alle Kosten – einschließlich des von der Kaputt-Agentur angeforderten Privatjets (diese Abgehobenheit gönnte sich das Fräulein dann doch) – übernommen hatte, den Vernaderern und Kepplern1 den Wind bereits im Vorfeld aus den Segeln genommen. So konnte sich niemand darüber beklagen, dass sie Steuergelder verschwendete.
Unter hundertzwanzigtausend Euro war jemand in dieser Liga für ein Gesichtsbad bei so einem Event einfach nicht mehr zu kriegen. Nun ja. Aber der Coup war leider nicht aufgegangen.
„Deppert gelaufen, Sissi, aber nicht deine Schuld“, flüsterte sie sich ermunternd zu. Sie sprach gerne mit sich selbst; ihr Psycho-Coach hatte ihr erklärt, dass sie jetzt, in dieser „herausfordernden“ Phase als Interimskanzlerin, verstärkt in den Dialog mit ihrer inneren Stimme treten müsse. Die konnte ihr allerdings auch keine Antwort auf die Fragen geben: Wie hatte die Security nur so versagen können? Und wo waren diese verfluchten Viecher überhaupt hergekommen?
Eine Blamage vor der ganzen Welt und die Beschädigung eines Nationalheiligtums, des Opernballs.
Wie hatte dieser Aristo-Schnösel von einem Außenminister, der inzwischen längst Geschichte war, einmal so treffend gesagt: „Andere Länder haben Atomwaffen, wir haben den Opernball.“
Aber dass der diesmal in eine solche Katastrophe explodiert war, war eine himmelschreiende Ungerechtigkeit! Und wo war diese Coco Kaputt eigentlich hin? Nach der Eröffnung hatte sie noch ein etwas – was heißt etwas, ein sehr peinliches Interview vor einer TV-Kamera gegeben. Peinlich deswegen, weil die Moderatorin sie allen Ernstes gefragt hatte, ob sie mit einer Prothese überhaupt Walzer tanzen könne, was die Kaputt mit der recht originellen Antwort pariert hatte: „Ich kann ungefähr so gut Walzer tanzen, wie Sie Fragen stellen.“ Und danach ward sie nicht mehr gesehen, wie Aschenputtel einfach abgehaut. Ja, doch daraus konnte man ihrem Management jetzt leider keinen Strick drehen, denn mit dem vorzeitigen Abgang hatte sie sich einiges an Horror erspart. Und durch die Bienen-Katastrophe war alles sowieso egal und alle Abmachungen sinnlos geworden.
Wenigstens fiel jetzt auch der unnötige Anpatzer dieser Schreibhyäne, dieser Adler-Trüffelsau, unter den Tisch. Das war inzwischen völlig wurscht geworden. Recht geschah’s dieser Giftspritze. Cui bono, konnte man sich da nur fragen, warum hatte die Adler sich das in ihrem sowieso untergehenden Käseblatt nicht verkneifen können … Und das drei Wochen vor dem Ball. Kosmetische Korrekturen machte doch jeder irgendwann beim Verfassen seines Lebenslaufs. Und das arme Fräulein Kaputt hatte ja wohl genug um die Ohren mit einem Leben minus einem Bein, also minus einem halben Bein, bei Lichte betrachtet. Gnade kennt dieser Presse-Mob einfach nicht.
„Ist dir nicht langweilig mit diesem Bauernzeugs?“, hatten sie manchmal die Freundinnen im CKF, dem Club konservativer Frauen, gefragt. „Geht so“, antwortete sie dann. Und dachte sich: Wenn ihr wüsstet, ihr Perlenkette tragenden Josefstadt-Abonnentinnen und Golfspielerinnen, bei mir spielt es noch ordentlich Musik privat. Seit es De-licious (oder wie immer er tatsächlich heißen mochte) in ihrem Leben gab, holte sie sich die Aufregung, das Kribbeln, diese Lebenswürze definitiv nicht mehr im Job. Doch das konnte sie den CKF-Tussen leider – wirklich ewig schade – nicht ums Maul schmieren. Die meisten der dazugehörigen Ehemänner waren so langweilig und sexy wie ein langer Regentag.
Die Initialzündung hatte ihr der Film „Meine Stunden mit Leo“ gegeben. Die britische Schauspielerin Emma Thompson spielte da eine verwitwete Spießerin, die sich einen solchen Mietliebhaber gönnt. Warum nicht?, hatte sie sich damals gedacht. Warum nicht ihr fades Leben im Landwirtschaftsschuppen würzen. Und recht hatte sie gehabt. In ihrem aktuellen Job brauchte sie diese Form der Entspannung sowieso wie Sauerstoff, um funktionieren zu können.
Durch De-licious´ schiere Existenz konnte sie inzwischen auch mehr Freundlichkeit für ihren langweiligen Mann mobilisieren. Das machte Theo um so vieles erträglicher. Theo, der Fürst der Ödnis im Karstland der verlorenen Leidenschaft. Der nurmehr beim Kalbsgulaschessen oder bei einer Rotweinverkostung einen Orgasmus oder zumindest irgendetwas in der Nähe davon bekam. Wahnsinn!
Wo De-licious jetzt wohl war? In welcher Powerfrau er jetzt wohl gerade steckte? Sie verscheuchte den Gedanken. Dabei hätte sie ihn jetzt so gut gebrauchen können, um ihre Nervenenden aus der Gefahrenzone zu manövrieren.
Sex im Kanzleramt, in diesen „War-Room-Vibes“, wie ihr Pressesprecher gerne mit wohligem Schauern anmerkte, wenn er eine entrische2 Situation herannahen sah. Die Bedeutung von War Room hatte er ihr beigebracht, davon hatte sie keine Ahnung. Solche Dinge lernte man nicht im Landwirtschaftsministerium. War Room hieß die Location, in die man im Weißen Haus übersiedelte, wenn es brenzlig wurde und Entscheidungen getroffen werden mussten. Wusste Super-Hipster Elias Fleischmann natürlich alles, schließlich war er ein Politthriller-Junkie. Unter Herrn Trump kam man aus dieser Location wahrscheinlich kaum mehr heraus.
Und jetzt: Bloß keine Entscheidungen mehr treffen müssen, sondern nurmehr Entspannung, Ausblenden und das Kopfkino anwerfen. Film läuft! In Zeitlupe sah sie De-Licious, wie er sie herrisch über den Schreibtisch spannte und ihr rücksichtlos den knallengen Bleistiftrock hochschob, in ihrem Film trug sie natürlich keine Shapewear, in wahrer Wirklichkeit natürlich schon. Der blöde Menopausenbauch war einfach nicht wegzukriegen! Doch darüber verlor er kein Wort. Das war auch nicht seine Aufgabe. Und wenn sie sich pseudomäßig zur Wehr setzte und irgendetwas brabbelte wie „Nicht so fest“ oder „Achtung, du tust mir weh“, sagte er mit seiner schönen, dunklen Stimme so etwas wie: „Die Gnädigste halt jetzt anfach amal die Gosch’n.“ Was für ein Glück, dass er sie vor dem Opernballstress noch einmal so fantastisch entspannt hatte. Ohne den Quickie in der Geheimwohnung wäre das Danach nicht auszuhalten gewesen. „Ich kann nicht“, hatte er ihr geantwortet, als sie ihm am „Burner“-Handy das Codewort ANAIS durchgegeben hatte, „privatestuffgoingon.“
Es sei eine Notsituation, ihr ganzer Körper schreie nach Entspannung, ließ sie ihn per Voicemail wissen, dreitausend Euro statt der üblichen fünfzehnhundert. Diese Ansage verfehlte ihre ermunternde Wirkung nicht. Fünfundfünfzig Minuten später war er in der Wohnung am Ende der Höhenstraße am idyllischen Stadtrand. Würde sie irgendwann sein Gesicht sehen können? Sein Körper roch irgendwie nach Vanille und Basilikum. Wahrscheinlich so eine Hipster-Duschbadnote aus dem Drogeriemarkt. Die Frage, wie er verlässlich einen hoch bekam, trotz ihres nicht mehr taufrischen Körpers, stellte sie sich längst nicht mehr. Sie nahm es als Geschenk, ein teuer bezahltes Geschenk, aber auch darüber wollte sie nicht mehr nachdenken. Wie hieß der schwachsinnige Werbespot dieses Kosmetikkonzerns? „Weil ich’s mir wert bin.“ Genau.
Elias Fleischmann, ihr überambitionierter Pressesprecher, unterbrach jetzt ihren kleinen Privatporno und stürmte ohne anzuklopfen in ihre erstmals durch die nervliche Aufregung in Unordnung geratenen Prunkräume.
„Es wären jetzt alle da, zum Stratego-Tuning volle Besetzung. Wir müssen abchecken, wie wir die Situation most efficient3 kalmieren.“ Er konnte einfach nur in diesem Eliteuni-Kauderwelsch reden.
Sie antwortete mit geschlossenen Augen: „Ich bin noch nicht so weit.“
Dagegen gab es aus seiner Warte allerhand auszusetzen, aber in seiner hierarchisch untergeordneten Position nichts einzuwenden. Also beschränkte Fleischmann sich auf einen missbilligenden Blick. Für die Migräneattacken seiner „Chef-Bitch“, wie Elias sie insgeheim nannte (obwohl er sie eigentlich mochte, aber immer wieder von ihrer Anti-Woke-Attitüde und Langsamkeit genervt war, hatte er jetzt echt keine zeitlichen Kapazitäten.
Sie blinzelte: Er trug ja schon wieder ein Fred-Perry-Polo, obwohl sie ihm mehrfach erklärt hatte, dass das ein Style-Fetisch der Identitären war. Aber Tennis war seine Leidenschaft, wahrscheinlich hatte er schon Fred-Perry-Strampelanzüge und Lacoste-Windeln getragen. Und von diesen Identitären, „diesen teilalphabetisierten Playmobil-Faschisten“, hatte er erklärt, wolle er sich seine Lieblingsmarke nicht versauen lassen. Das liebe Privatschulen-Protektionskind, ein Nepobaby, wie das neuerdings hieß, wie aus dem Bilderbuch, aber man konnte nicht klagen, er zeigte Zug zum Tor und gehörte nicht zu diesen trägen „Dienst nach Vorschrift“-Youngsters, deren größte Sorge ihre Work-Life-Balance war.