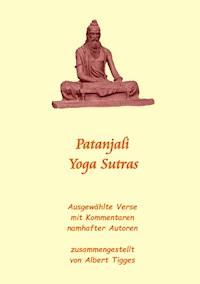
Patanjali Yoga Sutras E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Yoga Sutren des Patanjali sind ein Standardwerk zu Philosophie und Praxis des Yoga im klassischen Sinne ( SELBST-Verwirklichung ).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Im Lauf der Jahre habe ich mehrere Bücher über Patanjalis Yoga Sutras gekauft. Kürzlich erstand ich als letztes Buch das von I.K. Taimni. Weil in seinem Titel Patanjali nicht vorkommt, kam ich erst auf Umwegen zu dem Buch. Es ist von allen das ausführlichste. Beim Lesen kam mir die Idee, eine Synopsis mehrere Kommentare zu erstellen.
Jeder der Kommentatoren bringt eigene Aspekte ein, die sich ergänzen.
Manchmal verlassen sie dabei den Rahmen der Texte von Patanjali, z.B. in der Aussage, Erleuchtung bedeute die Vereinigung von Shiva und Shakti. Sie verlassen aber nie die Grundlagen der spirituellen Traditionen. Alles in allem eine Bereicherung.
Yoga ist vor allem Üben. Es geht also um praktische Philosophie. Im Nachwort ab Seite → füge ich noch einige Zitate aus anderen Quellen an.
Ausgewählt wurden die Verse I. 2, 3, 4, 12, 13, 16, 23, 27, 51 II. 2, 3, 4, 5 III. 1, 2, 3, 4, 8, 50, 51 IV. 29, 30, 31, 32, 34.
In den Texten sind etliche Sanskrit Worte. Es gibt für sie (z.B. Karma) keine passende Übersetzung. Auf S. → ist ein Glossar.
Yoga hat die Wurzel Yug, was „vereinigen“ bedeutet. Es ist verwandt mit dem deutschen Joch. Gemeint ist die Wieder-Vereinigung der Seele (Jivatma) mit ihrem göttlichen Ursprung (Paramatma). Yoga umfasst die Übung zur Erreichung der Einheit und den Zustand der Vereinigung.
Was heute allgemein unter Yoga verstanden wird, hat damit nichts mehr zu tun und ist eine Erfindung des 20. Jahrhundert, die zunehmend kommerzialisiert wird. Patanjali meint mit Asana die Körperstellung, in der man lange Zeit beschwerdefrei meditieren kann.
Über Patanjali ist wenig bekannt. Man vermutet, dass er im 2. Jht. n. Chr. gelebt hat. Sein Standardwerk über Yoga beschreibt in 195 Versen 8 Glieder: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Die letzten 3 bilden den zentralen Kern.
Das erste Kapitel „Samadhi (befreites oder erwachtes Bewusstsein, vollkommenes Erkennen) Pada“ befasst sich mit Definition und Methodik des Yoga.
Das zweite Kapitel „Sadhana (Übung) Pada“ befasst sich mit den Hindernissen und den ersten fünf (äußeren) Übungen.
Das dritte Kapitel „Vibhuti (Entwicklung, Kräfte) Pada“ beschreibt die letzten 3 (inneren) Übungen und die außergewöhnlichen Kräfte (Siddhis).
Im vierten Kapitel „Kaivalya (Befreiung) Pada“ geht es um die Natur des Verstandes, um die Begrenzung durch mentale Muster und deren Überwindung.
I.2. Yogas citta-vrtti-nirodhah.
Taimni (Inder)
I.2. Yoga ist die Unterbindung/das Aufhören der Modifikationen der Psyche.
Diese ist eine der wichtigsten und bekanntesten Sutren der Abhandlung, nicht nur, weil sie sich mit einem bedeutenden Grundsatz bzw. einer Technik von praktischem Wert befaßt, sondern auch, weil sie in nur vier Worten das Wesen des Yoga definiert.
Beginnen wir mit dem Worte Yoga. Dieses hat in Sanskrit zahlreiche Bedeutungen. Es leitet sich ab von der Wurzel Yuj; das heißt „vereinigen“, und der Gedanke der Vereinigung liegt all seinen Bedeutungen zugrunde. Welches sind die beiden Dinge, die durch Übung des Yoga vereinigt werden sollen? Nach den höchsten Vorstellungen der Hindu-Philosophie, von der die Wissenschaft des Yoga ein integraler Bestandteil ist, ist die menschliche Seele, der Jivatma, eine Facette bzw. ein partieller Ausdruck der Überseele oder Paramatma, der göttlichen Wirklichkeit, welche der Ursprung bzw. die Grundlage des manifestierten Universums ist. Obschon diese beiden ihrem Wesen nach gleich und unteilbar sind, wurde dennoch der Jivatma subjektiv vom Paramatma getrennt und ist dazu bestimmt, nach Durchlaufen eines Entwicklungszyklus im manifestierten Universum mit ihm im Bewußtsein wiedervereint zu werden. Dieser Zustand der Einheit beider im Bewußtsein wie auch der mentale Prozeß und die Disziplin, durch die diese Vereinigung erreicht wird, werden beide Yoga genannt.
Dann kommen wir zu dem Wort Citta, das sich ableitet von Cit oder Citi(IV-34), einem der drei Aspekte des Paramatma, die im Vedanta Sat-Cit-Ananda heißen. Dieser Cit-Aspekt liegt der Formseite des Universums zugrunde, und durch ihn wurde es erschaffen. Die Spiegelung dieses Aspektes in der individuellen Seele, die ein Mikrokosmos ist, wird Citta genannt. Citta ist also jenes Instrument bzw. Medium, durch das der Jivatma seine individuelle Welt materialisiert, in der er lebt und sich entwickelt, bis er vervollkommnet und mit dem Paramatma vereint wird. Grob gesagt, entspricht Citta demnach der „Psyche“ der modernen Psychologie, doch seine Bedeutung und sein Wirkungsfeld sind umfassender. Während Citta als universelles Medium angesehen werden kann, durch welches das Bewußtsein auf allen Ebenen des manifestierten Universums funktioniert, ist die „Psyche“ der modernen Psychologie lediglich auf die Äußerungen des Denkens, Fühlens und Wollens beschränkt.
Wir sollten jedoch nicht den Fehler machen, Citta als eine Art materiellen Mediums anzusehen, das in verschiedene Formen gestaltet wird, wenn Mentalbilder verschiedener Art produziert werden. Es ist grundsätzlich von der Art des Bewußtseins, das immateriell ist, aber von der Materie beeinflußt wird. Es mag in der Tat als ein Erzeugnis beider gelten, von Bewußtsein und Materie bzw. Purusa und Prakrti, da seine Funktion das Vorhandensein beider bedingt. Es gleicht einem ungreifbaren Bildschirm, mit Hilfe dessen das Licht des Bewußtseins in die manifestierte Welt projiziert wird. Das wirkliche Geheimnis seines Wesens liegt indessen im Ursprung des manifestierten Universums verborgen und kann erst erfahren werden, wenn Erleuchtung erreicht wurde.
Das dritte Wort, das wir in dieser Sutre zu untersuchen haben, ist Vrtti. Es entstammt der Wurzel Vrt, das heißt „existieren“. Vrtti ist also eine Art des Existierens. Wenn wir die Art und Weise untersuchen, wie ein Ding existiert, können wir auch seine Veränderungen, Zustände, Tätigkeiten bzw. Funktionen erkennen. All diese Bedeutungen sind in der von Vrtti mit inbegriffen; doch wird dieser Ausdruck in dem vorliegenden Zusammenhang am besten als „Modifikationen“ oder „Funktionsweisen“ übersetzt.
Bei dem Versuch, die Citta-Vrttis zu verstehen, müssen wir uns vor einigen Mißverständnissen hüten, die bisweilen eintreten, wenn der Gegenstand nicht gründlich genug studiert wurde. Als erstes müssen wir beachten, daß Citta-Vrtti keine Schwingung ist. Wie weiter oben erwähnt, ist Citta nicht materiell und daher kann nicht von einer Vibration in ihm die Rede sein.
Zweitens müssen wir in diesem Zusammenhang beachten, daß Citta kein Mentalbild ist, obwohl es im allgemeinen mit Mentalbildern assoziiert wird. Die fünffältige Klassifizierung der Citta-Vrtti in Spruch I.5 zeigt dies deutlich. Es mag unzählige Arten von Mentalbildern geben, doch der Verfasser hat sie in nur fünf Klassen eingeteilt.
Als letztes Wort haben wir Nirodha zu untersuchen, das von dem Ausdruck Niruddham stammt. Dieser heißt „zurückgehalten“, „kontrolliert“, „unterdrückt“. All diese Bedeutungen sind auf die verschiedenen Stadien des Yoga anwendbar. Zurückhaltung ist auf den Anfangsstufen geboten, Kontrolle in den fortgeschritteneren Stadien und Unterbindung bzw. vollkommene Unterdrückung im Endstadium. Spruch III.9 befaßt sich näher mit dem Thema Nirodha, und der Schüler lese aufmerksam, was in diesem Zusammenhang ausgeführt wurde.
Hat der Studierende den Sinn der vier Worte dieser Sutre begriffen, wird er erkennen, daß sie das Wesen des Yoga meisterhaft definiert. Die Wirksamkeit der Definierung liegt in der Tatsache, das sie auf alle Stadien anwendbar ist, durch die der Yogi vorwärtsschreitet, sowie auf alle Entwicklungsphasen des Bewußtseins, die dieser Fortschritt zur Folge hat.
Govindan (US-Amerikaner)
I.2.Yoga ist das Aufhören der [Identifizierung mit den] Fluktuationen [die] im Bewußtsein [entstehen].
An dieser Stelle ist es angebracht, zunächst einige Begriffe aus der Tradition des indischen metaphysischen Denkens zu erläutern: den Begriff der Natur (prakrti) und den Begriff des Selbst (purusa). Prakrti ist alles, was außerhalb des Selbst existiert. Sie schließt den gesamten Kosmos von der materiellen bis zur geistigen Ebene ein. Anders als das Selbst (Ich bin....), das rein subjektiv ist, ist prakrti objektive Realität. Sie ist das, was vom Selbst wahrgenommen wird. Sie ist wirklich, wie vergänglich sie auch immer sein mag. Purusa, das Selbst, existiert als reines Subjekt im innersten Kern des Bewußtseins. Es erhellt das Bewußtsein. Ohne das Selbst gäbe es keine bewußten Regungen in Intellekt und Psyche, ebenso wie eine Glühbirne ohne die unsichtbare Elektrizität kein Licht ausstrahlen würde. Prakrti existiert als Natur sowohl in ihrem transzendenten, undefinierten Zustand als auch in ihren vielförmigen, differenzierten Manifestationen. Dieses Selbst muß unterschieden werden vom Begriff des Selbst, wie es innerhalb der Begrenzungen von Persönlichkeit und Körper verstanden wird. Daher spricht man auch vom „wahren Selbst“ als dem ewig unveränderlichen Wesenskern im Menschen, dem atman oder jiva, im Unterschied zu dem „kleinen Selbst“, der Person oder Persönlichkeit als Summe unserer Erinnerungen und begrenzten Identifikationen, die durch Egoismus zusammengehalten werden.
Die scheinbare und irrtümliche Identifikation des Selbst, des Sehenden, mit den Manifestationen der Natur, dem Gesehenen, ist die Ursache des menschlichen Leids und das grundlegende Problem des menschlichen Bewußtseins. Die Gewohnheit, sich mit seinen Gedanken, Emotionen und Wahrnehmungen, d. h. dem Ego, zu identifizieren, ist die Krankheit des menschlichen Bewußtseins. Die Fluktuationen (vrtti), die im Bewußtsein entstehen, müssen gereinigt werden von Egoismus, von der hartnäckigen Gewohnheit zu meinen „Ich bin dieses Gefühl“, „Ich bin diese Erinnerung“, „Ich bin diese Wahrnehmung“. Dies geschieht durch systematisches Üben des Loslassens, wobei man sich sagt: „Ich bin mir dieser Emotion, Erinnerung, Wahrnehmung bewußt, aber ich bin nicht diese Emotion, Erinnerung, Wahrnehmung“.
Sukadev (Deutscher)
I.2. Yoga ist das Zur-Ruhe-Bringen der Gedanken im Geist.
Der Geist ist wie das Wasser in einem See, auf dessen Grund ein Schatz ruht. Wenn das Wasser sich bewegt, entstehen Wellen, und wir können nicht auf den Grund schauen, um diesen Schatz zu sehen. Nirodha ist das Zur-Ruhe-Kommen des Geistes, was als einer der fünf Grundzustände des Geistes gilt.
Die 5 Grundzustände des Geistes:
•
nirodha
ganz ohne Gedanken
•
ekagrata
vollkommen konzentriert
•
viksipta
sammelnd
•
ksipta
zerstreut
•
mudha
unklar
Wenn man die Gründe für die Bewegung ausschaltet, also nicht mehr so zwanghaft auf äußere Ereignisse reagiert, wenn man sein Unterbewußtsein langsam reinigt - das ist ein langanhaltender Prozeß - und sein prana harmonischer macht, wird der See langsam ruhiger. Dann kommt man öfter zu viksipta und ekagrata, dann allmählich zu nirodha und schließlich auch zu „tada drastuh svarupe vasthanam“, wo „der Sehende in seinem wahren Wesen ruht“. - Aber bis dahin dauert es eine Weile!
I.3. Tada drastuh svarupe vasthanam.
Taimni
I.3. Dann hat sich der Seher in seinem eigenen, ursprünglichen Wesen niedergelassen.
Diese Sutre zeigt in genereller Weise auf, was geschieht, wenn alle Regungen des Verstandes auf allen Ebenen vollkommen blockiert wurden. Dann hat sich der Seher in seinem eigenen Svarupa niedergelassen oder - mit anderen Worten - seine Verwirklichung erreicht. Wir können nichts über diesen Zustand der Selbstverwirklichung erfahren, solange wir in das Spiel der Citta-Vrttis verwickelt sind. Er kann nur von innen verwirklicht, doch nicht von außen verstanden werden.
Govindan
I.3. Dann ruht der Sehende in seinem wahren Wesen.
„Dann“ bedeutet, daß das, was folgt, eine Konsequenz des im vorangegangenen Vers beschriebenen Reinigungsprozesses ist. Gemeint ist das Aufgeben der Gewohnheit, sich mit den Fluktuationen des Bewußtseins zu identifizieren. Daraus ergibt sich ein permanenter Zustand der Selbstverwirklichung, d. h. es handelt sich nicht um eine vorübergehende Erfahrung, die wieder untergehen kann in den Wellen geistiger Ablenkung. Im normalen Körper-Bewußtsein identifiziert man sich gewohnheitsmäßig mit Gedankenformen und Emotionen. Durch die Anwendung von Meditationstechniken wie suddhi dhyana kriya oder mantras kann man eine tiefe Empfindung des Loslassens entwickeln. Der „Sehende“ ist das Selbst. Am Ende des Yoga-Weges erfährt die Einzelseele (jiva), daß sie eins mit „Siva“, dem Allerhöchsten, ist. Durch Ausdehnung nimmt die Einzelseele (jiva) ihr wahres Wesen bzw. ihre wahre Form (Siva) an und identifiziert sich nicht mehr mit der niederen physischen oder mentalen Ebene.
Sukadev
I.3.Dann ruht der Wahrnehmende (Sehende) in seinem wahren Wesen.
Sind die Gedanken, die vrttis, ruhig, dann ruht man in seinem wahren Wesen, in der eigentlichen Natur. Wir sind nicht der Geist, wir sind nicht die Gedanken, wir sind reines Bewußtsein, Bewußtsein jenseits der Gedanken, was als sat-cit-ananda, Sein-Wissen-Glückseligkeit, erfahrbar ist.
I.4. Vrtti-sarupyam itaratra.
Taimni
I.4. In anderen Zuständen herrscht Assimilierung/Identifikation (des Sehers) mit den Modifikationen (der Psyche).
Wenn die Citta-Vrttis nicht im Nirodha-Zustand sind und der Drasta nicht in seinem Svarupa weilt, hat er sich mit dem bestimmten Vrtti assimiliert, das gerade in dem Augenblick sein Bewußtseinsfeld besetzt.
Govindan
I.4. Andernfalls kommt es zur Identifizierung [des individualisierten Selbst] mit den Fluktuationen [des Bewußtseins].
Auf der Ebene des menschlichen Alltags-Bewußtseins identifiziert sich der Mensch mit all seinen mentalen und emotionalen Regungen, die meist aus dem Unterbewußtsein stammen. Wenn man jemanden fragt: „Wer bist du?“ bekommt man in der Regel zur Antwort, daß er oder sie Herr X bzw. Frau X ist, welchen Beruf die Person ausübt, welchem Geschlecht, welcher Religion oder Familie sie angehört, möglicherweise auch noch, wer ihr Arbeitgeber ist, oder was sie am meisten auf dieser Welt liebt. Aber all diese Identifizierungen sind nur Gedanken, die auf Erinnerungen beruhen. Selten findet man jemand, der sich mit seinem wahren Selbst, dem atman, wie es die yogis nennen, identifiziert, dem Wesenskern, in dem es keine Unterscheidungen zwischen Ich und Du gibt.
Sukadev
I.4. In allen anderen Zuständen (als nirodha) identifiziert sich der Wahrnehmende mit seinen Gedanken.
Je mehr man sich mit den Gedanken identifiziert, um so stärker werden sie. Wenn man sich weniger auf die Gedanken einläßt, verschwinden sie auch leichter wieder. Wenn ein Gedanke kommt und man wenig mit ihm anfangen kann, dann ist er schnell wieder weg. Wenn aber ein Gedanke auftaucht, mit dem man sich sofort identifiziert, dann wird er sehr stark. Trotzdem sagt Patanjali, eine gewisse Identifikation sei immer da, sowie man anfängt zu denken. Ohne Identifikation gäbe es keine Gedanken und ohne Gedanken keine Identifikation.
Patanjali ordnet die Inhalte des Bewusstseins in 5 Kategorien: Wissen, Irrtum, Einbildung, Erinnerung und Schlaf (Sutra I.5 bis I.11).
Taimni
I.12. Ihre Unterdrückung (wird herbeigeführt) durch beharrliche Übung und Nichtanhaften.
Nachdem der Autor die verschiedenen Formen erläutert hat, welche die Verstandesfunktionen annehmen können, nennt er in dieser Sutre die hauptsächlichen Mittel, um diese Funktionen zu unterdrücken, nämlich Übung und Nichtanhaften. Zwei scheinbar einfache Worte; doch welche ungeheure Willensanstrengung und welche Vielzahl von Übungen erfordern sie.
Govindan
I.12. Durch ständiges Üben und Loslassen (kommt es zum) Aufhören der Identifizierung (mit den Fluktuationen des Bewusstseins).
Hier beschreibt Patanjali die wichtigste Technik des Kriya Yoga zur Reinigung von Egoismus, der aus der Identifizierung mit den Fluktuationen des Bewußtseins entsteht.
„Durch ständiges Üben“ (abhyasa) bedeutet Konzentration auf das, was der Mensch wirklich ist, das wahre Selbst. Bei den vorbereitenden Übungen sind hiermit die Objekte der Konzentration gemeint (da es leichter ist, sich auf ein Objekt zu konzentrieren als auf das formlose Absolute). Loslassen (vairagya) bezieht sich auf das Aufhören der Identifikation mit dem, was wir nicht sind - den flüchtigen Gedanken und Emotionen, die aus Sinneswahrnehmungen oder Erinnerungen herrühren. Wenn der Übende diese Eindrücke, die in das Unterbewußtsein verdrängt wurden, mit Hilfe solcher Techniken wie suddhi dhyana kriya oder durch die Wiederholung heiliger Keim-Silben (bija mantras) losläßt, bleibt das reine Bewußtsein zurück, d. h. es manifestiert sich das wahre Selbst. Ständiges Üben ist so zu verstehen, als ob man das Wasser aus einem sinkenden Boot ausschöpft. Wenn wir aufhören, uns auf das reine bewußte Selbst auszurichten, werden wir überwältigt von dem starken gewohnheitsmäßigen Drang des Egoismus, genauso wie man von dem Hereinströmen des Wassers überflutet wird, wenn man aufhört, das Wasser auszuschöpfen. Ständiges Üben heißt, sich inmitten aller Veränderungen und vorübergehenden Schau an das Höchste Absolute zu erinnern.
Sukadev
I.12. Übung (abhyasa) und Nichtanhaften (vairagya) führen zur Ruhe des Geistes (nirodha).





























