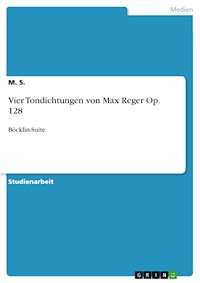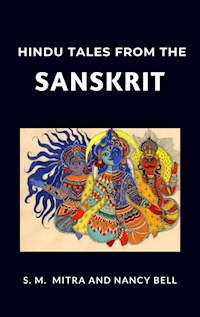13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Musik - Sonstiges, Note: 1,7, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Sprache: Deutsch, Abstract: I. Einleitung Mathis der Maler zählt heute wohl zu den weniger bekannten Opern der deutschen Operngeschichte. Dennoch nimmt sie eine wichtige Rolle in Hindemiths Schaffenszeit ein. Die Oper, mit unverkennbarem Zeitbezug, wurde in der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben. Die Nationalsozialisten verhinderten zunächst die Uraufführung in Deutschland, da das „deutsche“ Thema der Oper ein zu großer Anstoß gewesen wäre. In dieser Zeit der persönlichen Angriffe, der Aufführungsverbote seiner Werke und der ausbleibenden Konzertverpflichtungen intensivierte Hindemith seine musiktheoretische Arbeit. Hindemith hielt die zentralen Bereiche der Musiktheorie, vor allem die Natur von Tonbeziehungen für unveränderbar und kritisierte die traditionelle Harmonie- und Kontrapunktlehren. Aufschlüsse über die Eigenschaften des musikalischen Materials holte er sich aus den unterschiedlichsten Bereichen wie „der Physik, der Akustik, der Ästhetik, der Physiologie, der historischen Musiktheorie, dem Vorgang des Musikmachens als Singen oder Spielen, der Musikgeschichte und nicht zuletzt aus den musikalischen Meisterwerken“. Was ist jedoch das Spezifische an der Musik Hindemiths? Zum einen fügen sich modale Passagen (Originalzitate aus dem von Böhme editierten Altdeutschen Liederbuch von 1877) homogen ein. Zum anderen werden Situationen in der Handlung durch ihren Charakter entsprechende Formen begleitet (zum Beispiel: der Auftritt des Kardinals durch ein Concerto Grosso). Infolgedessen betrachte ich allgemeine Fakten der Oper, entstehungsgeschichtliche Informationen mit historischen Bezügen, handelnde Personen und die Handlung sowie die musikalische Gestaltung des Werkes. Abschließend erläutere ich Hindemiths Kompositionstechnik noch einmal im Allgemeinen Sinne.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Allgemeines
III. Entstehung
3.1 Biographische Bezüge
3.2 Historische Bezüge
IV. Handelnde Personen
V. Handlung
VI. Musikalische Gestaltung
6.1 Musikalische Zitate
6.2 Musikalische Anlage
VII. Hindemiths Kompositionstechnik
VIII. Fazit
IX. Literaturverzechnis
I. Einleitung
Mathis der Maler zählt heute wohl zu den weniger bekannten Opern der deutschen Operngeschichte. Dennoch nimmt sie eine wichtige Rolle in Hindemiths Schaffenszeit ein.
Die Oper, mit unverkennbarem Zeitbezug, wurde in der Zeit des Nationalsozialismus geschrieben. Die Nationalsozialisten verhinderten zunächst die Uraufführung in Deutschland, da das „deutsche“ Thema der Oper ein zu großer Anstoß gewesen wäre. In dieser Zeit der persönlichen Angriffe, der Aufführungsverbote seiner Werke und der ausbleibenden Konzertverpflichtungen intensivierte Hindemith seine musiktheoretische Arbeit. Hindemith hielt die zentralen Bereiche der Musiktheorie, vor allem die Natur von Tonbeziehungen für unveränderbar und kritisierte die traditionelle Harmonie- und Kontrapunktlehren.[1] Aufschlüsse über die Eigenschaften des musikalischen Materials holte er sich aus den unterschiedlichsten Bereichen wie „der Physik, der Akustik, der Ästhetik, der Physiologie, der historischen Musiktheorie, dem Vorgang des Musikmachens als Singen oder Spielen, der Musikgeschichte und nicht zuletzt aus den musikalischen Meisterwerken“.[2]
Was ist jedoch das Spezifische an der Musik Hindemiths? Zum einen fügen sich modale Passagen (Originalzitate aus dem von Böhme editierten Altdeutschen Liederbuch von 1877) homogen ein. Zum anderen werden Situationen in der Handlung durch ihren Charakter entsprechende Formen begleitet (zum Beispiel: der Auftritt des Kardinals durch ein Concerto Grosso).
Infolgedessen betrachte ich allgemeine Fakten der Oper, entstehungsgeschichtliche Informationen mit historischen Bezügen, handelnde Personen und die Handlung sowie die musikalische Gestaltung des Werkes. Abschließend erläutere ich Hindemiths Kompositionstechnik noch einmal im Allgemeinen Sinne.
II. Allgemeines
Die Musik sowie der Text der Oper wurden von Paul Hindemith selbst komponiert. Die Uraufführung fand am 28. Mai 1938 im Stadttheater Zürich statt. Die deutsche Fassung wurde am 13. Dezember 1946 in Stuttgart uraufgeführt. Die Spieldauer beläuft sich auf ungefähr drei Stunden und fünfzehn Minuten. Dementsprechend lang und verworren ist auch die Handlung, die in und um Mainz, in Königshofen, in der Martinsburg und im Odenwald zur Zeit der Bauernkriege und Reformation spielt.[3] Dabei werden die Verstrickungen des Malers Matthias Grünewald in Fragen von Politik, gesellschaftlich nützlichem Handeln und moralischer Verantwortung behandelt.[4] Die Oper ist in sieben Bilder untergliedert, eine Art der sinfonischen Dichtung die sich im 19. Jhd. mit Franz Liszt entwickelte.[5]
Das Orchester ist mit zwei Flöten (auch Piccolo), zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotten, vier Hörnern, zwei Trompeten, drei Posaunen, einer Tuba, Pauken, Schlagwerk und Streichern besetzt.[6] Im vierten Bild erklingen zusätzlich noch drei Trompeten für die Bühnenmusik. Die Besetzung (von Anton Bruckner übernommen) ist nach dem Vorbild des Barock und der Klassik in den Instrumentengruppen meist gegeneinander gesetzt. Dabei verzichtet Hindemith auch nicht auf die Symbolik der Instrumente. Die Hörner im ersten Bilde deuten zum Beispiel auf Unruhen im Lande hin und am Schluß des sechsten Bildes verleihen die Blechbläser dem „Alleluia“ den sakralen Charakter.[7]