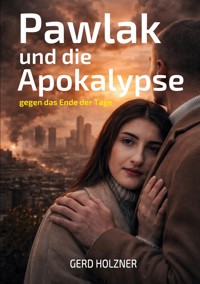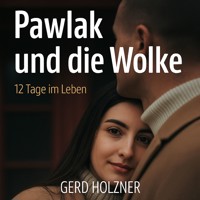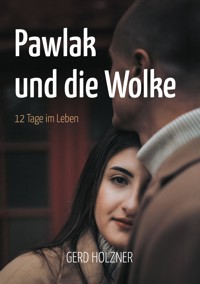
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Pawlak, ein einsamer freier Journalist, verzweifelt über den Zustand der Menschheit und der Erde, findet durch dramatische Ereignisse zu sich selbst und übernimmt eine Rolle, die ihn immer wieder zu Entscheidungen zwingt, die er sich nie zuvor zugetraut hätte. Eine giftige Wolke taucht plötzlich über der Stadt auf und er spürt Gefahr und reagiert schnell und intuitiv. Eine Anschlagserie von unbekannter Hand, eine rechtsradikale Partei, die US-Armee und ein russischer Agent spielen ein Roulette mit noch nicht greifbaren Motiven. Und dabei treibt ihn eine magische Kraft aus der Einsamkeit heraus ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pawlak, ein einsamer freier Journalist, verzweifelt über den Zustand der Menschheit und der Erde, findet durch dramatische Ereignisse zu sich selbst und übernimmt eine Rolle, die ihn immer wieder zu Entscheidungen zwingt, die er sich nie zuvor zugetraut hätte. Eine giftige Wolke taucht plötzlich über der Stadt auf und er spürt Gefahr und reagiert schnell und intuitiv. Eine Anschlagserie von unbekannter Hand, eine rechtsradikale Partei, die US-Armee und ein russischer Agent spielen ein Roulette mit noch nicht greifbaren Motiven. Und dabei treibt ihn eine magische Kraft aus der Einsamkeit heraus ...
Die Orte, Personen und die Handlungen sind frei erfunden und die Namen der handelnden Personen rein zufällig ausgewählt.
Inhaltsverzeichnis
Tag 1
Tag 2
Tag 3
Tag 4
Tag 5
Tag 6
Tag 7
Tag 8
Tag 9
Tag 12
Personen
Tag 1
Es gibt Tage, die möchte er am liebsten überspringen, ihnen ausweichen, die Zeit vergessen, Tage, die ihm im Wege zu stehen scheinen, die er nicht auszuräumen vermag – an diesen Tagen steht er sich selbst im Weg. Es ist seine Unentschlossenheit, ein lähmendes Gefühl der Nervosität, das ihn plötzlich und unvorbereitet überfällt, ihm schlagartig seine Unsicherheit, sein mangelndes Vertrauen zu sich selbst, vielleicht auch die Angst, die unbegründete Angst vor endlichen Entscheidungen, die er zu treffen hat, aber nicht trifft, vor Augen hält. An solchen Tagen ist er einer inneren Konfrontation ausgesetzt, aus der er nur durch selbst gefasste Entscheidungen als Gewinner hervorgehen kann. Wie einfach und leicht ist es doch, sich den möglichen Ablenkungen preiszugeben, um der Konfrontation auszuweichen. Aber tief drinnen, unbemerkt, wirkt sie weiter, ihre bewusste Auswirkung wird nur vertagt.
Dies ist so ein Tag. Pawlak umkreist sich wie ein lahmer Fuchs den Vogel, wohl wissend, die Beute niemals erreichen zu können, er setzt den Nagel an, um sich festzunageln, allein der Nagel findet keinen Halt in ihm. Er kennt sich, er weiß seine Schwächen zu beurteilen, doch will es ihm an solchen Tagen nicht gelingen, aus dieser Kenntnis heraus Stärke zu ziehen. Seine Schwächen versagen ihm die Stärke, die er braucht, um seine Schwächen zu bändigen. Hilflos taumelt er im Kreis herum auf der Suche nach dem Fixpunkt, der ihm Rettung gibt. Auch das Schreiben wird nicht helfen; es überbrückt nur die Zeit. Früher hatte er viel geschrieben. Immer wenn es ihn drängte, griff er zum Stift und schrieb sein Innerstes nach außen, las erstaunt, sah, wie es sich niederließ wie ferne Vögel auf bunten Bäumen, erkannte sich nicht wieder, nicht sofort, in den vielen geschriebenen Worten, nur allmählich wuchs sein Erkennen, wie zum traumhaften Erlebnis wurde er sich selbst. Zahllose Blätter füllte er so mit Leben, seinem Leben, einem Leben, das sonst niemand richtig wahrzunehmen schien, er selbst oft auch nicht. Erst beim schreibenden Lesen, beim lesenden Schreiben erlebte er sein Leben ganz, erlebte er sich selbst. Dieses Schreiben war ihm Hoffnung, es gab ihm Kraft und Mut. Wie Anklagen schrien ihm seine Schwächen und Triebe entgegen, so manches Gedicht, das er schrieb, ist gefüllt von Schwermut und Trauer. Aber gerade dadurch, durch das Erkennen seiner selbst kann er sich gerade in die Augen sehen, kann er sich annehmen, so wie er ist. So sind manche Qualen zu ertragen.
Dass er leidet, wurde ihm erst spät bewusst. Es wurde ihm bewusst in dem Augenblick, als er zum ersten Mal von Liebe schrieb – und dabei wusste, es ist mehr als nur ein Wort, diese Liebe, die ihn auszufüllen vermochte, Tag und Nacht, Stunde um Stunde.
Aufmerksam begann er sich zu studieren, maß seinen Reaktionen diese oder jene Bedeutung zu, und mit dieser Aufmerksamkeit sich selbst gegenüber betrachtet er fortan auch die Welt, die ihn umgibt. Er misst mit prüfendem Blick jede Rundung eines Gesichts, das ihm begegnet, liest in den Augen, versucht die Bewegung der Augenbrauen zu deuten, freut sich über lachende Münder, erkennt, dass lachende Münder nicht immer Fröhlichkeit signalisieren, wenn die Augen kalt und stumpf dabei bleiben, wundert sich über die maßlose Nervosität so vieler Menschen, ihre Hände zittern, Nikotin als einziges Mittel zur Beruhigung, sieht dabei, wie unvollkommen doch die Schöpfung Mensch geraten ist, erkennt klar und erschrocken, wie unüberlegt, selbstvergessen, ganz dem sinnlosen Konsum hingegeben sich diese Menschen, die geniale und doch unvollkommenen Schöpfung der Evolution, entfernen von jener Vollendung, von jedem Streben nach Vollkommenheit, Klarheit, Wahrhaftigkeit.
Wie ein Seher begann er zu sehen. Manchmal sieht er die Zukunft in traurigen Bildern vorbei fluten, dann beginnen sie ihn zu überschwemmen – glühende Leiber, zu Staub gewordene Himmelsschöpfung, verstümmelte Bäume, abgestorbene Hirne in menschlichen Kadavern, Dantes Bilder des Grauens und Erschreckens. Dies ist der Preis der Erkenntnis, sagte er zu sich selbst, schrieb es auf.
Wie weh es doch tut zu lieben, diese Welt mit ihren irrsinnigen Menschen. Wie weh es doch tut, einem Grashalm zuzuschauen, wie er sich im Sommerwind wiegt, während in der Ferne schon die Sense gewetzt wird. Wie weh es doch tut zu lieben, und dabei zu sehen, wie sich alles auflöst, zu Staub, zu Schmutz und Abfall. Und er liebt mit jeder Faser seines Ichs.
Gerade an diesem Tag, jetzt gerade, heute, weiß Pawlak, Schreiben wird nicht mehr helfen, die Worte würden nur stummes Stammeln werden, nichts weiter, es würde nichts bewegen, höchstens seine Hand mit dem Stift übers Papier. Ich muss etwas tun, denkt er, sagt es, schreit es stumm gegen die Wand. Etwas tun, es ist Zeit, etwas zu tun!
Die Traumwelt Wirklichkeit greift nach ihm, er sieht zum Fenster hinaus, während er am Tisch sitzt, sieht die rauchenden Schlote, denkt „schwefelige Morgensonne aufgehängt an grauem Schwermetall hinterm noch dunklen Häuserhorizont“ – überlegt, ob er das aufschreiben soll, hört des Nachbars Kind bellend husten, spürt die Angst der Mutter, schaut einer Straßenbahn nach, die unten in der Straße vollgefüllt mit grauen Gesichtern den Fabriktoren entgegenrollt auf ihren Schienen, unfähig, sich dem richtenden Zwang zu entziehen, die Richtung zu ändern, hört das Hupen, die Frühschicht beginnt, glaubt das monotone Stampfen der Maschinen zu hören mit ihren stereotypen Bewegungen, schaltet genervt das Radio aus, man wollte ihn zum Kauf eines neuen Waschmittels animieren, es soll noch weißer waschen als weiß. Er glaubt es nicht! Er glaubt nichts mehr. Sein Misstrauen ist gewachsen, langsam gewachsen mit seinem Gefühl für die Schöpfung, seiner Liebe zu allem Lebenden, Wachsenden, Sterbenden. Feinfühlig spürt er versteckte Animationen, verstecktes Werben auf, sein Misstrauen bewahrt ihn vor dem Überfluss. Er kennt seine Schwächen – das Werben ist stark, nicht immer kann er sich ihm entziehen. Die Zeit aber hat ihn gelehrt, durch die Dinge hindurch ihre wahre Gestalt zu erkennen, alles zu hinterfragen, nichts so einfach stehen zu lassen. Das ist seine Waffe gegen die anstürmenden Krakenarme derer, die ihn locken, ihn umwerben und geld- und machtgierig auf seine Manipulationsfähigkeit vertrauen. Es ärgert ihn dabei die Tatsache, dass es niemandem auffällt, dass er nicht anspringt auf die Logik des großen Konsums – seine Reaktion, der Kauf bleibt aus. Was ist sein Anderssein schon im Vergleich zu den Millionen Menschen, die kaufen, die ihr Leben kaufen, die sich verkaufen, Mensch gegen Ware, gegen Zeit, Ware gegen Geld, gegen Mensch, die ihr Leben verpfänden dem allmächtigen Kommerz? Ein heißer Tropfen auf den kalten Stein?
Sein Blick wandert vom Fenster weg, streift prüfend über das Bücherbord, das Bild darüber, es zeigt eine düstere Landschaft mit einem fernen Licht – magisch leuchten weiße Berge aus dem Dunklen hervor. Er verliert sich, wie so oft schon in diesem fernen Licht, es zieht ihn an wie ein Magnet zerstreute Eisenspäne; dieses Bild hat ihm schon oft geholfen, es dient ihm als Medium, als Sammelpunkt für eine Art von Meditation. Er überlässt sich dabei ganz der Magie des Lichts und spürt die Kraft in sich wachsen, eine Kraft, die er nicht zu definieren vermag.
Pawlak atmet auf, dankbar blinzelt er das Bild an, treuer Freund an der Wand – dein Schöpfer war ein guter Geist, muss viel gelitten und doch nicht die Hoffnung verloren haben, denkt er.
Er steht auf, geht zum Fenster und sieht wieder hinaus. Das Kind in der Nebenwohnung hat aufgehört zu husten, die Kamine der Fabrik rauchen noch. Ihm gegenüber in einem grauen Wohnblock, der aus der Ferne aussieht wie ein überdimensionaler Hasenstall, lauter Nischen bilden die Front - es sind Balkone - leuchtet ein Fenster auf, Schatten huschen auf den zugezogenen Gardinen hin und her, jetzt wird eine Gardinenhälfte beiseite gezogen, jemand blickt flüchtig durchs Fenster auf die Straße, es ist eine Frau, so viel erkennt Pawlak, trotz des kurzen Moments – er denkt sich nichts dabei, registriert nur die Bewegungen, verfolgt den Ablauf dieses Morgens. Unten auf der Straße wird gerade die Zeitung ausgetragen. Es regnet – er sieht die Mütze des Zeitungsausträgers feucht im Dämmerlicht glänzen.
Wie gut dass es regnet, denkt Pawlak, es wird ein Tag, der nichts von mir fordert. Ich werde ihm gewachsen sein, sagt er laut, um sich zu bekräftigen. Doch nichts kann ihn über das ungute Gefühl hinwegtäuschen, das ihn nach dem Aufwachen befallen hat. Vielleicht war es schon im Traum da, dieses Gefühl. Er hat Angst vor diesem Tag. Nein, ich habe keine Angst, denkt er, spricht es in sich hinein. Sein Spiegelbild im Bad sagt: Doch, du hast Angst! Er weiß es, gibt sich geschlagen. Es ist besser, sich seiner Angst bewusst zu sein, man kann zu ihr stehen, sie als einen Teil von sich selbst annehmen und sie mit Kreativität auflösen.
Er rasiert sich gründlich, zieht sich an, eine graue Jeans, ein blaues Jeanshemd, weiße Turnschuhe, zieht sich seinen Parka über und geht.
Im Treppenhaus begegnet er der Nachbarin mit ihrem Kind auf dem Arm. Ihr besorgter Blick, etwas hilflos, ängstlich an ihrem Kind hängend, schmerzt ihn, er will an ihr vorbei gehen, hinüber zum Aufzug. Da treffen sich ihre Blicke. Beide bleiben stehen, sehen einander wortlos in die Augen. Pawlak begreift sofort. Er sieht das regungslose Kind auf ihrem Arm, die Panik in den Augen der Mutter, sagt: „Kommen Sie, schnell, ich fahre Sie.“
Es kann ihm nicht schnell genug gehen. In der Tiefgarage flucht er, die Tür seines alten Käfers geht etwas schwer. Er hilft der Frau beim Einsteigen. Der Motor zündet sofort. Pawlak weiß den Weg, er ist ihn oft gefahren, damals.
Den Wehrdienst hatte er verweigert. Beim zweiten Verfahren zur Feststellung seiner Gewissensgründe wurde er angenommen. Beifahrer im Notarztwagen war er, später Krankenpfleger im städtischen Krankenhaus. Es ist gut, dass um diese Zeit die Straßen leer sind, denn er fährt schnell, wie damals, nur hat er kein Blaulicht auf dem Dach und kein Martinshorn. Eine wütende Solidarität treibt ihn an, er spürt denselben Schmerz wie die Mutter, als wäre er der Vater des Kindes. Pawlak ahnt, nein weiß, dass es um Sekunden geht. Wie oft hat er schon diese Fälle erlebt. Kleine Kinder fangen an mitten in der Nacht zu husten, sie bekommen keine Luft mehr, drohen zu ersticken. Meist sind es Säuglinge. Er kennt die eigenen Hilflosigkeit in solchen Fällen. An eine Nacht erinnert er sich mit Grauen: Elf Fälle wurden gemeldet, nur drei Notarztwagen standen bereit, vier Kinder starben sofort, jede Hilfe kam zu spät, zwei starben später.
Mit diesen Gedanken verlangt er dem Motor seines Käfers die letzten Reserven ab, Wut und Trauer treiben ihn wortlos rasend durch die noch leeren Straßen dieser alten kalten Stadt. Die Frau neben ihm weint. Er hat keine Zeit sich um sie zu kümmern, zu sehr muss er sich auf die Fahrt konzentrieren.
In der Notaufnahme geht alles sehr schnell. Das eingespielte Team reagiert routinemäßig. Trotz allem ist aber die Beklemmung spürbar – auch sie, die solche Fälle gewohnt sind, zeigen Wut und Trauer. Nach einer halben Stunde, Pawlak wartet mit der Frau, ist das Kind gerettet. Die Frau bricht weinend zusammen. Er will sie nicht alleine lassen. Mit brennender Wut im Bauch legt er, um sie zu trösten, seine Hand auf ihre Schulter, dankbar blickt sie ihn an, der Trost wirkt gut. „Danke“, sagt sie, „Sie haben meinem Kind das Leben gerettet, und damit auch meines. Ich habe nicht gewusst, was ich tun sollte. Das war das erste Mal, das mit dem Husten. Christian ist doch so ein fröhliches Kind. Er ist schon dreizehn Monate alt.“ Sie blickt Pawlak mit tränennassen Augen an, er lächelt ein wenig. „Wir haben Glück gehabt“, sagt er mit etwas heiserer Stimme. Die Frau nickt stumm. „Kann ich Sie einen Augenblick allein lassen?“ Sie nickt wieder, nun etwas ruhiger geworden. „Aber Sie kommen doch wieder?“ „Ja“ sagt Pawlak etwas hilflos, er weiß nicht, wie er mit seinem eigenen Schmerz, seiner Wut fertig werden soll. Sie rauben ihm die Sprache.
In dem Glaskasten, der die Notaufnahme beherbergt, fragt er einen Sanitäter, den er von früher kennt, sie waren gute Kameraden, was er von dieser Sache hält. Jogi, so sein Spitzname, klärt ihn auf: „Das ist heute der dritte Fall. Zum Glück kamen sie alle rechtzeitig. Das hier war hoffentlich der letzte für heute. Lange halte ich das nicht mehr aus, alter Junge, weißt du! Es ist die Luft, es kann nur die Luft sein. Und immer nachts … Du hast sicher davon gelesen. Pseudokrupp nennen sie diese Krankheits-, diese Erstickungsanfälle. Wie soll denn das weitergehen?“
Er schimpft auf die Regierung, die seiner Meinung nach immer den Profit der Industrie für wichtiger hält als die Gesundheit der Bürger - mit dem Totschlagargument Arbeitsplätze sichern zu müssen. Man solle doch eher das Leben sichern.
„Hast du mal Feuer, Pawlak? Ich weiß, ich rauche immer noch. Es ist nicht gut … aber wenn Kinder sterben, nur weil sie atmen …?“ Sie stehen am offenen Fenster und Pawlak findet ein paar Zündhölzer in seiner Jacke und gibt ihm Feuer. Wie in Gedanken nickt er stumm. Er denkt an jene Nacht, damals sind sie zusammen gefahren.
„Jogi“ sagt er und blickt ihn dabei ernst an „was können wir bloß tun? Wir müssen doch was tun! Diese Wut im Bauch, die schafft mich noch. Ich hab´ heute morgen schon so ein ungutes Gefühl gehabt, ein verdammt ungutes Gefühl. Wer weiß, was heut´noch alles passiert.“ Jogi nickt „ich ruf dich an“ sagt er. „Ja, sprich mir auf den AB, wenn ich nicht ran gehe.“
Pawlak fährt die Frau nach Hause, nachdem sie ihr Kind sehen durfte. Es muss noch einige Tage im Krankenhaus bleiben. Zu sehr ist es geschwächt und medizinische Versorgung wird deshalb für einige Zeit notwendig sein. Erst jetzt, vor ihrem gemeinsamen Haus, als die Frau aussteigt, sich nochmals bedankt, spürt er den Hunger. Er hat noch nichts gegessen heute morgen. Nach einigem Überlegen erinnert er sich an ein Café, das schon früh am Tage offen hat. Es sind nur fünf Minuten mit dem Auto zu fahren. Dort bestellt er sich ein Frühstück.
Der Kaffee, der gute starke Kaffee verströmt wohlige Wärme im Magen. Die Beklemmung lockert sich ein wenig. Hier fühlt er sich geborgen. An einem runden Tisch sitzend, zurückgelehnt in den gepolsterten Stuhl, die Luft riecht nach Kaffee und frischen Brötchen, fühlt er sich ausgespuckt aus dem Alltäglichen, er sitzt fern von dem Getriebe, vom wilden Hetzen um Geld und Reichtum, Macht und Leben, er sitzt da, wie auf einer Insel inmitten sturmbewegter See. Nur leicht streift ihn der Wind, er spürt ihn kaum. Und er ist froh darüber. Es ist gut, denkt er, dieser Anspannung für Augenblicke zu entfliehen, dieses Café ist meine Rettungsinsel. Er träumt eine Weile vor sich hin, vergisst die Zeit, vergisst das Gewesene, vergisst die Wut in seinem Bauch, lässt sich treiben im Duft des Kaffees, des frisch Gebackenen, und atmet dabei tief und regelmäßig. Die Bilder in seinem Gehirn verschwimmen, sie werden nicht mehr greifbar, nur allmählich vereinen sie sich wieder zu einer einzigen Vision: Er sieht sich auf einem hohen Gipfel stehen, schneebedeckt und schroff zeigt er in den azurnen Himmel, einsamer Steiger in schwindelnder Höhe, und spürt den kühlen Schneewind frostig klar wie eine raue Bürste reinigend über seine Gedanken ziehen. Pawlak atmet tief, nicht genug von dieser Luft ist ihm genug. Die Sonne blitzt über der Ferne, rötlich färbt sie die leuchtenden Berge, groß und flammend erhebt sie sich, um ihre Wärme auszusenden. Herrlich ist doch die Welt, das Leben, denkt Pawlak. Herrlich …
„Was sagten Sie? Wollen Sie noch etwas?“ Pawlak zuckt zusammen, schreckt hoch. Die Bedienung des Cafés sitzt ihm gegenüber und mustert ihn dabei aufmerksam. „Verzeihen Sie, aber haben Sie vielleicht geträumt?“ fragt sie nicht unfreundlich. Mit verlegenem Lächeln verlässt Pawlak seinen Berg, etwas Wehmut im Herzen, schön war es dort oben, und sagt: „Ja, es scheint wohl so dass ich geträumt habe. Das passiert mir öfter als mir lieb ist. Ich bin Ihnen nicht böse, dass Sie mich zurück geholt haben.“ Er reckt sich ein wenig und stöhnt dabei. „Noch etwas Kaffee? Sie sind heut´ morgen der erste und einzige Gast – es hat keine Eile, Sie können ruhig sitzen bleiben.“ Pawlak nickt und während die Frau den Kaffee holt, sucht er nach der Tageszeitung, die er an der Garderobe hat hängen sehen. „Was haben Sie denn geträumt, vorhin?“ fragt sie als sie Kaffee nachschenkt. Der Ausdruck in ihrem Gesicht verrät Interesse, nicht nur Neugierde, sie setzt sich wieder auf den Stuhl gegenüber, stützt die Ellbogen auf den kleinen Tisch, ihren Kopf auf die Hände und blickt ihn aufmerksam an. Sie hat offene Augen, denkt Pawlak, selten sieht man so offene Augen. Diese Augen können strahlen, leben, lieben – sie sind lebendig! „Wie wunderbar der Kaffee duftet, und das frische Gebäck“ murmelt Pawlak, und laut sagt er: „Ich glaub´ ich war auf einem hohen Berg, kühl und schneebedeckt, und habe die klare Gebirgsluft eingeatmet, vielleicht um meine Gedanken ein wenig zu reinigen. Im Traum waren´s zwar die Lungen, aber Sie wissen vielleicht, dass Träume durchaus etwas bewirken können. Träumen Sie auch manchmal so vor sich hin?“ Die Frau wird nachdenklich, sie runzelt die Stirn, ihre Augen fragen nach innen; Pawlak kennt die Sprache der Augen und wartet.
Nach einer Weile sagt sie: „Ja, ich glaube schon, dass ich das manchmal tue, aber wohl mehr unbewusst. Warum träumen Sie gerade vom Gebirge? Ihnen schmeckt wohl unsere Luft nicht?“ Sie schaut ihn fragend an und beantwortet, bevor Pawlak etwas sagen kann, ihre letzte Frage selbst. „Manchmal frage ich mich ob man das hier …“ und dabei greift sie mit der Hand durch die Luft, wie als ob sie eine Fliege fangen wolle „… ob man das hier noch Luft nennen kann. Dass meine Hand nicht schwarz geworden ist, kann doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es hier zum Himmel stinkt! Der Kaffee ist zwar gut, manchmal zu gut. Er übertönt so gerne alles … na ja, Gott sei Dank … allerdings im Gebirge war ich noch nie, ich weiß gar nicht, wie das ist.“
„Schön und gut“ sagt Pawlak und lächelt. „Am schönsten ist es, wenn man alleine ist, alleine mit sich selbst und der Natur. Dabei lernt man sich selbst Rede und Antwort zu stehen. Man lernt Aufrichtigkeit. Dieses Aufsichzurückgeworfensein, die Einsamkeit zusammen mit dem gigantischen Naturschauspiel, das die Erde zu bieten hat, öffnet jedem Menschen die Augen, Ohren und vor allem das Herz, unter einer Voraussetzung allerdings – man muss wollen! Vielleicht auch muss man reif dazu sein. Schön ist es und gut. Mit einem lieben Menschen zusammen, der das auch so empfindet, ist es aber noch schöner.“
Pawlak nickt dabei langsam mit dem Kopf, so als müsste er dem Gesagten dadurch das richtige Gewicht geben.
„Sehen Sie, liebe …“ „Marianne heiße ich“ unterbricht sie ihn – „sehen Sie, Marianne, hat man erst einmal begonnen, diese Erde zu lieben, nicht nur die Menschen, sondern diese Welt, dann beginnt man auch zu begreifen, wie empfindlich, wie verletzlich sie ist. Mit offenen Augen, nicht mehr blind und selbstsüchtig, sieht man auf einmal die offenen Wunden, aus denen unsere gute Erde blutet. Man begreift – sie ist schon fast am Verbluten. Dass das weh tun kann, habe ich erst begriffen, als ich so zu empfinden begann.“ Ihre groß gewordenen Augen lassen ihn verstummen.
„Sie sind ein seltsamer Mensch“, sagt sie, „aber ich glaube ich mag Sie. Was Sie da sagen klingt zwar seltsam, aber ich denke, ich kann es verstehen. So wie wir mit unserer Erde umgehen und nicht nur mit ihr, auch mit den Menschen, ohne Gewissensbisse, ohne Verantwortungsgefühl – ich habe mich auch schon oft gefragt, wie das alles kommen konnte. War diese Entwicklung ein großes Missverständnis?“
Pawlak überlegt. Nachdenklich fährt er fort: „Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass viele da nicht begriffen haben, wozu wir da sind. Ich habe für mich eine Definition des Wortes Liebe gefunden, die allumfassend ist. Leider reiten zu viele auf den verschiedenen Dogmen herum. Die einen sagen so, die anderen anders. Allen gemeinsam aber ist das faktische Missverständnis, Liebe sei der Ausdruck für geschlechtliche Beziehungen zwischen Menschen, meist fixiert auf Mann und Frau, oder etwas ausgedehnter für den Bereich der Beziehungen innerhalb einer Familie. Das bloße Zusammengehörigkeitsgefühl wird als Liebe verstanden. Solange ich nicht die Welt als Ganzes liebe und damit wertschätze, solange ich beim Erkennen ihrer Zerstörung keinen Schmerz verspüre, kann es keine Liebe sein in dem Sinne, wie es ja alle Religionen gemeinsam fordern. Denn es bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen für das was man liebt, oder nicht? Wenn es nur ein Gefühl, ein menschlicher Trieb ist, ein schöner, und ja auch wichtiger Trieb, wird sich nichts ändern. Es ist so einfach nur sich selbst oder jemand anderen zu lieben. Und die Erde geht hops …“
Pawlak erzählt ihr von seinem unguten Gefühl am Morgen, erzählt ihr von dem Kind und der hilflosen Mutter.
„Mein Gott“ murmelt Marianne leise. Sie ist sichtlich bestürzt. „Ist es schon so weit? Diese Luft stinkt also nicht nur, sie kann sogar töten? Ist das wahr?“
„Ja Marianne, Sie sind betroffen, ich glaube Sie spüren den Schmerz der Mutter, Sie können ihn nachvollziehen. Sie können es, aber wie viele können es nicht mehr? Seien Sie froh, dass Sie es können. Bewahren Sie sich das.“
Eine Weile sitzen sie beide stumm am Tisch, schauen verlegen auf das bunte Tischtuch, sie sammelt gedankenversunken ein paar Krümel auf, er sehnt sich nach einer Zigarette, obwohl er schon lange nicht mehr raucht, er spielt dabei mit der Kaffeetasse.
„Wie heißen Sie eigentlich?“ Der Satz, den Marianne mit etwas belegter Stimme spricht, zersprengt die Stille, holt die Gedanken zurück. So weit aber waren ihre Gedanken nicht voneinander entfernt.
„Gerade wollte ich´s sagen! Ich heiße Hermann Pawlak, aber alle nennen mich nur Pawlak, ich weiß nicht warum, mir ist es recht, Hermann mag ich sowieso nicht. Komisch ist das schon, Sie wollten meinen Namen wissen und ich wollte ihn Ihnen sagen, und das im gleichen Augenblick.“
„Telepathie“ sagt sie und beide müssen lachen.
Das Lachen tut gut, denkt Pawlak dabei und ärgert sich, dass er schon wieder denkt, sich und seine Reaktion analysiert, kritisch, und ein wenig spöttisch.
„Was machen Sie eigentlich?“ fragt sie nach einer Weile. „Haben Sie Urlaub?“ Sie runzelt die Stirn, überlegt einen Augenblick, neigt den Kopf zur Seite, so dass ihr eine Strähne ihres langen schwarzen Haares vor das rechte Auge fällt, mit einer unbewussten Handbewegung streicht sie das Haar zur Seite und sagt: „Ihr Name sagt mir was, irgendwie, irgendwo hab ich ihn schon gehört.“ „Gelesen“ sagt er darauf „gelesen, in der Zeitung gelesen.“
„In der Zeitung?“ fragt sie, „in dieser?“ und zeigt dabei mit spitzem Finger auf die Zeitung, die neben Pawlaks Tasse auf dem Tisch liegt. Er nickt, schaut etwas missmutig: „Ja, ich bin freier Journalist. Schreibe gelegentlich für dieses Blatt, auch für andere. Irgendwie muss man leben. Und irgendwie muss man etwas tun, um seinem eigenen Gewissen gerecht zu werden. Also schreibe ich über Dinge, die mir so auffallen, von denen ich denke, dass es gut ist, darüber zu berichten. Heute morgen, die Sache mit dem Kind zum Beispiel. Vielleicht schreibe ich darüber.“
Er überlegt eine Weile, schaut sie dabei nachdenklich an: „Wenn nur die Wut nicht wäre, die ich habe. Diese Stumpfsinnigkeit, mit der zu viele Menschen die Zerstörung ertragen, mit der sie achselzuckend Kriege, Hungersnöte, soziale Ungerechtigkeiten, Neid und Habgier, Profitsucht und Machthunger hinnehmen, als seien dies selbstverständliche Werte, schützenswerte Normen unserer Zivilisation. Diese Stumpfsinnigkeit will mir nicht in den Kopf. Ich verstehe sie nicht. Dabei sind doch die Meisten im Grunde genauso ängstlich, genauso wütend. Nur sagen tun sie´s nicht. Das sei Politik, und damit will man nichts zu tun haben. Viele haben mir das genau so gesagt. Wörtlich!“ Pawlak schüttelt den Kopf. Seine Rettungsinsel Café hat den Halt verloren. Nun schwimmt sie wieder mitgerissen vom schmerzvollen Treiben, das ihn so sehr bewegt. Er seufzt, schaut dabei Marianne etwas hilflos an, zieht die Schultern hoch, wie um sich vor dem Ansturm der Eindrücke zu schützen, die nun wieder mit Eile und Unrast durch sein Hirn rasen.
„Pawlak, was ist mit Ihnen? Wollen Sie schon gehen? Bitte bleiben Sie doch. Ich weiß nicht – wie lange ist das her, dass ich mich mit jemandem so unterhalten habe. Nein, missverstehen Sie mich nicht. Das war keine Unterhaltung, das wollten Sie doch sagen, nicht wahr? Das war mehr als das. Wenn Sie gehen wollen, bitte, aber Sie kommen wieder, ja?“
Sie schaut ihn dabei mit großen Augen an, rehbraun leuchtend und freundlich, dabei ist sie ein wenig verwirrt über die Intensität des Gesprächs, auch des Gefühls, das sie wahrnimmt. Beide sehen sich etwas erstaunt in die Augen, die mehr sagen, als sie sagen wollten. „Wie sich so etwas entwickelt,“ bemerkt Pawlak und bricht damit das Schweigen. Abrupt steht er auf, bleibt einen Augenblick sinnierend stehen, holt den Geldbeutel aus der Tasche, zahlt, sagt: „Ich komme wieder“ zieht seinen Parka an, gibt Marianne die Hand, Wärme springt über bei der Berührung, zwei Wesen, einander ähnlich, erkennen den Strom, der fließt, nicht messbar, aber spürbar. „Danke“ sagt sie leise. Er drückt leicht ihre Hand, lächelt dabei und sagt: „Auf gute Freundschaft. Ich glaube wir haben sie beide nötig.“ Sie nickt und er geht.
Dabei denkt er: Ich werde mich nicht umdrehen, nein. Aber zurückkommen. Und irgendwie freut er sich darüber. Da ist jemand, der ihn versteht. Es tut gut das zu wissen. Pawlak schaut auf die Uhr, es ist bereits halb elf, um fünf etwa ist er heute aufgewacht. Seit dieser Zeit hat er nicht mehr auf die Uhr gesehen, hat die Zeit Zeit sein lassen, wozu hätte er sie auch gebrauchen können. Diese Zeit ist sowieso eine dumme Erfindung des Menschen, sie dient dazu, ihn anzutreiben, ihn zu hetzen, wie anders hätte sonst der Spruch „Time is Money“ entstehen können, überlegt er, während er langsam die Straße entlang trottet und mal hier, mal dort stehenbleibt, um zwischen den Häusern hindurch einen Blick in die Hinterhöfe zu werfen.
Es hat aufgehört zu regnen, die Straße ist nass, überall glänzen ölige Pfützen, der leise Wind streicht die letzten Tropfen von den Blättern der wenigen Bäume, die in Asphalt und Beton gefesselt die Straße säumen. Aus einem Durchgang hört er das laute Toben von Kindern, sie Spielen wohl Ball, er hört das Knallen des Balles gegen harten Stein, gegen die Hauswand, gegen Mülltonnen. Eine Frau schimpft zeternd „Ruhe, hört endlich auf mit diesem Krach, das ist kein Spielplatz, wie oft hab ich euch das schon gesagt, verdammte Bande!“ Die Kinder stört ihr Geschreie nicht. Sie spielen weiter. Pawlak geht den Geräuschen nach, sie ziehen ihn an, neugierig lugt er um die Ecke in den Innenhof. Die Kinder, drei Jungen und zwei Mädchen, jung sind sie alle, vielleicht sieben Jahre, schätzt Pawlak, bemerken ihn nicht, zu sehr nimmt sie ihr Spiel in Anspruch. Sie spielen Fußball. Zwei Mülltonnen bilden das Tor. Verbissen kämpfen sie um den Ball. Dabei schreien sie in wilden Tonlagen. Pawlak versteht die Frau – der Lärm wird durch die Hauswände verstärkt – er versteht aber auch die Kinder. Eine Weile schaut er ihnen zu, betrachtet ihr wildes Spiel, ihre Verbissenheit macht ihm Sorge, zu sehr kämpfen sie, anstatt zu spielen. Die zwei Mädchen haben es dabei nicht leicht. Sie wirken dünn und verletzlich, das eine hat ein großes Pflaster am Knie. Die Kinder haben zwei Mannschaften gebildet, zwei und zwei jeweils gegeneinander, während ein Spieler im Tor steht. Ein Junge und ein Mädchen bilden dabei ein Team. Der dritte Junge, ein dunkelbrauner wieselflinker Kerl, ist der Torwart.
„Pass doch auf, du Arsch“. „Drecksau“ ruft der andere zurück. „Ich hack dich gleich in Stücke. Wart nur, du Zombie“. „Angeber“ schreit das Mädchen mit dem Pflaster. Der Torwart fängt den Ball, flink wie er ist, und jagt ihn gleich darauf mit einem vehementen Tritt in die Höhe. Direkt vor Pawlaks Füßen knallt er auf den Boden, springt wieder hoch über seinen Kopf, Pawlak federt leicht ab und platziert den Ball mit einem gekonnten Kopfball wieder zurück, genau zwischen die Mülltonnen. Das braune Wiesel fängt ihn und nickt dabei anerkennend. „He, das war gut“ sagt er „suchen Sie was oder wen, oder ham Sie sich verlaufen?“ Die Mädchen kichern. Pawlak schüttelt den Kopf, ruft „Nee, spielt weiter“ und will gehen. Eine zeternde Stimme, die Stimme der Frau, die vorhin schon schimpfte, hindert ihn daran. Er bleibt stehen, schaut nach oben. „He Sie, was fällt Ihnen ein, den Kindern zu sagen, sie sollen weiter lärmen! Das ist ja nicht zum Aushalten! Verschwinden Sie. Oder suchen Sie was?“ Pawlak zuckt mit den Schultern, grinst dabei den Kindern zu, der Braune kickt ihm den Ball rüber, volley, aus der Luft versetzt Pawlak dem Ball einen kräftigen Stoß, er fliegt hoch, saust an der Nase der Frau vorbei, die sich aus einem Fenster im dritten Stock hinauslehnt, trifft über ihr die Mauer und segelt zum zweiten Mal an ihrem verblüfften Gesicht vorbei. Sie schnappt nach Luft, sucht nach passenden Worten, sie braucht lange, um dann zu rufen: „Das ist doch die Höhe!“
Aber Pawlak hört sie nicht mehr. Er ist gegangen. Nur noch die Kinder hört er jubeln. Diese Kinder, denkt er, diese Kinder sollen unsere Zukunft sein. Wie gehen wir nur mit ihnen um. So wie die Kinder behandelt werden wird auch die Zukunft behandelt. Nachlässig und lustlos.
Oft hat Pawlak den Eindruck, dass viele Menschen gar keine Zukunft wollten. Wenn Kinder lästig werden, wenn sie stören, nicht mehr spielen dürfen, wenn die verschiedensten Wirtschaftszweige Kinder vermarkten, in ihnen durch Werbung Wünsche wecken, die nur durch Konsum zu befriedigen sind – welch eine Zukunft soll das denn sein, wenn die Kinder so behandelt werden. In den Schulen suchen sie nach Wissen, und was bekommen sie dort? Leistungsdruck, Konkurrenzkampf, nichts als Enttäuschungen. Und diese Enttäuschungen werden ihnen gar nicht bewusst, zu sehr sind sie bereits vom System gefangen. Pawlak schüttelt den Kopf. Generation „No Future“ – den Begriff hat er erst gelesen. Alle Wege führen zum Abgrund, wie mir scheint. Noch will ich es nicht glauben, denkt er und geht weiter.
Er fühlt sich müde, denkt an Marianne, an das hustende Kind, an die Luft, die offensichtlich Kinder töten kann, findet an einer Plakatwand Relikte eines Bildes, einzelne Papierfetzen, seine Fantasie überbrückt die Lücken, es stellt einen Atompilz dar, darunter in roten Buchstaben EUROSHIMA Nein! Er nickt, weiß um die Gefahr, auch er spürt die Verunsicherung, geht voll Trauer weiter und fühlt dabei eine Leere in sich wachsen. Sie füllt ihn aus, nichts bleibt übrig, nichts wird verschont. Er sehnt sich nach fröhlichem Lachen, nach farbigen Blumen, nach duftenden Wiesen, nach guter Erde, nach freundlichen Augen, Augen, wie Marianne sie hat. Der Berg fällt ihm wieder ein, Traumvision, weit weg liegt er, unerreichbar. Zu sehr ist er gefangen von Bildern und Eindrücken, die pausenlos auf ihn einhämmern, ihn zermürben, ihn auslaugen, auspumpen, sie saugen alles aus ihm heraus: Seine Ängste, seine Freuden, sein Leid und seine Schmerzen, seine Wut, sein Glück und seine Sicherheit. Dies alles wird ihm bewusst, er bemerkt die Veränderung, verfolgt aufmerksam das Werden, das Kommen und Gehen, das Füllen und Leeren in seinem Inneren. Für Augenblicke empfindet er nichts mehr. Er schwebt in Ruhe, während er ziellos die Straße entlang schlendert. Er muss lächeln. Ist das Frieden? fragt er sich, Frieden, wenn ich nichts empfinde?
Er schüttelt den Kopf. Unsinn, ich liebe doch das Leben. Und ich brauche dieses Gefühl, etwas tun zu können für die Zukunft. Aber was ist Zukunft, wenn die Zeit Erfindung ist, eine wertlose, eine sinnlose Erfindung menschlichen Ehrgeizes im Widerspruch zum ewigen Sein. Alles ist jetzt, alles ist gestern, ist morgen, wird sein und ist gewesen. Sicher, die Zeit geht, bestimmt von Tag und Nacht. Tage gehen wie ziehende Wolken am Himmel, als hätten sie es eilig, als wollten sie nichts versäumen vom Morgen, von der Zukunft. Und doch, es ist etwas Ewiges im Leben, im Gang der Weltenzeit; man muss es nur begreifen. Ist ein Tag vorüber, folgt die Nacht, nach ihr aber wieder der Tag. Das Licht der Sonne ist dasselbe. Die Wolken kommen wieder, es ist dasselbe Wasser, das sie regnen. Da steckt die Einheit verborgen. Das ist Poesie, denkt Pawlak. Ach die Poesie – er muss wieder lächeln. Ich spinne schon, murmelt er leise. Ob ich mir den Text merken kann??
Aber so unsinnig ist das nicht, was ich da denke, überlegt er, wenn es auch Poesie ist, vielleicht muss man erst diese Einheit von Gestern, Heute und Morgen erkennen, um zu begreifen, was Zerstörung ist. Diese Einheit ist es doch, die langsam mit stetiger Sicherheit zerstört wird. Beton, Gift, Müll, alles das, mit dem die Menschheit sich selbst in eine Sackgasse manövriert, mit der sie nicht mehr fertig wird, all das ist endgültig, irreparabel, der Kreislauf zwischen Geburt, Leben und Tod aller Dinge, auch des Wassers, wird unterbrochen. Dummes Volk, diese Menschheit, was hilft ihr das Begreifen, die Erkenntnis, wenn sie nichts dagegen tut. Ob der kleine Christian überleben wird?
Pawlak bleibt stehen. Es kommt ihm der Gedanke zum Krankenhaus zu fahren, um nach dem kleinen Jungen zu sehen, aber er verwirft die Idee wieder. Ich kann ihm doch nicht helfen, murmelt er vor sich hin und schüttelt dabei den Kopf. Er weiß nicht, wie weit er schon gegangen ist, denn als er eben aus seinen Gedanken aufwacht, findet er sich plötzlich vor einem Straßencafé stehen. Ein alter Mann wischt gerade die Stühle und Tische ab, sie sind noch etwas nass vom Regen. Die Sonne hilft ihm dabei, schnell ist alles trocken. Pawlak blinzelt geblendet von den schneeweißen Tischen, fragt den Mann grüßend, ob er sich setzen darf. Dieser nickt wortlos, vollführt mit der Hand, in der er den Lappen hält, eine einladende Bewegung und Pawlak setzt sich dankend. Er bestellt wieder eine Kaffee, und weil ihm dieser nicht schmeckt einen Cognac dazu. Am Kiosk gegenüber sieht er Zeitungen aushängen.
Er geht hinüber und kauft sich eine. Wieder an seinem Tisch sitzend, sieht er, während er gleichzeitig die Zeitung aufschlägt und noch einen Cognac bestellt, wie ein paar Häuser weiter eine junge Mutter, in der einen Hand eine Plastiktüte, mit der anderen ein kleines Kind führend mit offenbar eiligen Schritten, die aber doch etwas verhalten wirken, gebremst, gleichzeitig zögernd und zielstrebig auf eines der großen Kaufhäuser zugeht, das seinen weiten Schlund geöffnet hält und mit Zähnen aus Sonderangeboten lockend die Passanten verschluckt. Niemand scheint diesem Riesenmaul ausweichen zu können. Vielleicht wollen sie gar nicht ausweichen, denkt Pawlak. Er sieht die Frau ihren zielstrebigen Gang unterbrechen, sie bleibt plötzlich stehen, er ahnt Schlimmes, und bevor er die Ursache erkennt, sieht er schon die Reaktion. Ein, zwei, drei schnelle Schläge mit der flachen Hand über den schutzlosen Kopf des Kindes, dabei ein paar schrille Töne ausstoßend, reagiert die Frau auf das Gequengel des Kindes. Das Kind schreit nun, laut und vernehmlich, der Frau ist es peinlich, das Kind wehrt sich, zieht an ihrem Mantel, stößt zurück, nur um neue Schläge einzufangen. Das Kind, ein vielleicht dreijähriges Mädchen will sicher nur ein Eis, denkt Pawlak, denn die beiden sind eben an einem Eisstand vorbei gekommen. Wahrscheinlich mag die Mutter kein Eis, überlegt er, und ärgert sich dabei. Die Passanten gehen weiter, zu alltäglich ist wohl die Situation, nichts Besonderes, sie gehen weiter, als wäre nichts gewesen. Pawlak sieht die Frau mit dem Kind im schmatzenden Maul des Kaufhauses verschwinden. Liebt sie ihr Kind? Oder ist das die erzieherische Strenge, die der Mensch schon als Kind braucht, um Disziplin zu lernen? Hat dieser Vorfall, wie oft geschieht er wohl täglich, stündlich, hat er eine Bedeutung im Lauf der Dinge? War überhaupt etwas geschehen? Pawlak schaut noch einmal zum Kaufhaus hinüber: Alles ist, wie es vorher war. Die Leute werden verschluckt und ausgespuckt, glücklich und unglücklich, zufrieden und unzufrieden, mit erfüllten und unerfüllten Wünschen. Sie kommen und gehen. Nein, es ist nichts geschehen. Nichts hat sich verändert. Ein Kind wurde geschlagen, aber nur er, nur Pawlak hat es gesehen. Alles, was sich verändert, scheint immer nur er zu sein. Alles, was trifft, trifft scheinbar nur ihn. Er weiß nicht, wie viele Wunden er schon davongetragen hat. Was hält mich eigentlich noch zusammen? Pawlak überlegt, blinzelt in die Sonne und sagt laut: „Liebe wohl.“ Er nickt und freut sich über diesen Gedanken. Nein, es ist nichts geschehen, nur seine Liebe ist etwas gewachsen.