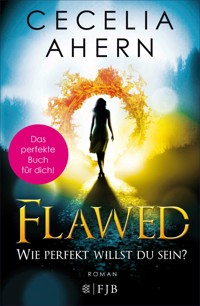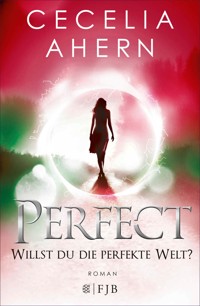
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band des furiosen Zweiteilers. Mitreißend und leidenschaftlich erzählt Cecelia Ahern, wie die 17-jährige Celestine um die Freiheit kämpft, Fehler machen zu dürfen und aus ihnen zu lernen. Celestine wurde als »fehlerhaft« gebrandmarkt, sie gehört nun zu den Menschen zweiter Klasse. Doch statt sich den strikten Regeln des Systems zu unterwerfen, flieht sie. Denn Celestine ist auch ein Symbol der Hoffnung für alle anderen Fehlerhaften. Gelingt es ihr, den grausamen Richter Crevan zu überführen? Das wäre die Chance auf einen Neuanfang für die Fehlerhaften. Aber gibt es auch für ihre große Liebe eine neue Chance? Für Celestine geht es um alles – um Gerechtigkeit für sich selbst und alle anderen und um eine lebenswerte Zukunft. »Es ist mein erster All-Age-Roman, aber die Idee hat mich selbst fast überrollt. Ich kam kaum hinterher, sie aufzuschreiben. Es ist eine einzigartige Geschichte, aber wie in allen meinen Büchern steckt eine besondere Botschaft und ganz viel Gefühl drin."« Cecelia Ahern
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Cecelia Ahern
Perfect - Willst du die perfekte Welt?
Roman
Über dieses Buch
Celestine wurde als »fehlerhaft« gebrandmarkt, sie gehört nun zu den Menschen zweiter Klasse. Doch statt sich den strikten Regeln des Systems zu unterwerfen, flieht sie. Denn Celestine ist auch ein Symbol der Hoffnung für alle anderen Fehlerhaften.
Gelingt es ihr, den grausamen Richter Crevan zu überführen? Das wäre die Chance auf einen Neuanfang für die Fehlerhaften. Aber gibt es auch für ihre große Liebe eine neue Chance?
Für Celestine geht es um alles – um Gerechtigkeit für sich selbst und alle anderen und um eine lebenswerte Zukunft.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Cecelia Ahern ist eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt. Sie wurde 1981 in Irland geboren und studierte Journalistik und Medienkommunikation in Dublin. Mit 21 Jahren schrieb sie ihren ersten Roman, der sie sofort international berühmt machte: ›P.S. Ich liebe Dich‹. Danach folgten Jahr für Jahr weitere weltweit veröffentlichte Bücher in Millionenauflage. ›Flawed – Wie perfekt willst du sein?‹ und ›Perfect – Willst du die perfekte Welt?‹ sind ihre ersten beiden Romane für junge Erwachsene. Cecelia Ahern lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern im Norden von Dublin.
www.cecelia-ahern.com
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "Perfect" bei Harper Collins Children's Books, a division of Harper Collins Publishers Ltd., London.
© Cecelia Ahern 2017
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Jake Olson / Trevillion und Ebru Sidar, Arcangel
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403543-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Definition PERFEKT]
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Teil 2
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
Teil 3
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
Perfekt: ideal, mustergültig, makellos, fehlerfrei, unübertrefflich, vollkommen, beispielhaft, vorbildlich, vollendet, tadellos; (bezogen auf eine Person) im Besitz aller erforderlichen oder wünschenswerten Elemente, Qualitäten oder Charaktereigenschaften; so gut sein wie möglich.
Teil 1
1
Für jeden Menschen gibt es die Person, die er meint sein zu müssen, und die Person, die er wirklich ist. Ich habe für alle beide jedes Gefühl verloren.
2
Ein Unkraut ist eine Blume, die am falschen Ort wächst.
Das sind nicht meine Worte, sondern die meines Großvaters.
Er sieht die Schönheit in allem, oder vielleicht ist es eher so, dass er Dinge, die ungewöhnlich sind oder vielleicht auch mal fehl am Platz wirken, am schönsten findet. Diesen Charakterzug sehe und erlebe ich jeden Tag an ihm; er wohnt lieber im alten Farmgebäude als im modernisierten Pförtnerhaus, er kocht seinen Kaffee lieber in dem alten gusseisernen Topf auf dem Aga-Herd über offenem Feuer als in der schicken Espressomaschine, die Mum ihm vor drei Jahren zum Geburtstag gekauft hat und die jetzt unbenutzt auf der Küchentheke steht und Staub ansammelt. Nicht, dass Granddad den Fortschritt fürchtet – im Gegenteil, er ist ein Mensch, der sich oft für Veränderungen starkmacht, aber er mag Echtheit und Originalität, alles in seiner wahrhaftigsten Form. Das beinhaltet auch, dass er das Unkraut bewundert, weil es den Mumm hat, an Orten zu wachsen, wo keiner es gepflanzt hat. Genau diese Eigenschaft ist der Grund, warum ich in meiner Notsituation zu ihm geflohen bin und warum er bereit ist, seine eigene Sicherheit aufs Spiel zu setzen, um mir Zuflucht zu gewähren.
Zuflucht.
Dieses Wort hat die Gilde benutzt: »… jedem, der Celestine North hilft oder ihr gar Zuflucht gewährt, droht eine schwere Strafe«. Bisher wurde diese Strafe noch nicht genauer festgelegt, aber da wir die Gepflogenheiten der Gilde kennen, können wir es uns ungefähr vorstellen. Das Risiko, das Granddad eingeht, indem er mich auf seinem Grundstück aufnimmt, scheint ihn nicht zu schrecken, sondern sogar noch mehr davon zu überzeugen, dass er die Pflicht hat, mich zu beschützen.
»Ein Unkraut ist einfach eine Pflanze, die an einer Stelle wachsen möchte, an der die Leute lieber etwas anderes sehen würden«, sagt er jetzt, während er sich über einen dieser frechen Eindringlinge bückt, um ihn mit seinen großen Händen auszureißen.
Er hat Kämpferhände, dicke, schaufelartige Pranken, die aber auch fürsorglich und sehr liebevoll sein können und die gerne helfen, wenn Not am Mann ist. Diese Hände, die jederzeit fähig wären, einen anderen Menschen zu erwürgen, haben auf diesem Boden gesät und geerntet, sie haben eine Tochter und mehrere Enkelkinder gehalten, gewiegt und beschützt. Vielleicht haben alle wirklich großen Kämpfer auch fürsorgliche Eigenschaften, denn sie sind in ihrem Inneren sehr tief mit etwas verbunden, wofür es sich zu kämpfen lohnt – und das es wert ist, beschützt zu werden.
Granddad besitzt fünfundsechzig Hektar Land. Natürlich wachsen nicht überall Erdbeeren wie auf dem Feld, auf dem wir gerade stehen und das er im Juli immer für Selbstpflücker zur Verfügung stellt. Dann können Leute – hauptsächlich sind es Familien – für einen nicht allzu hohen Betrag so viele Erdbeeren pflücken, wie sie wollen; Granddad sagt immer, das hält den Laden am Laufen.
Dieses Jahr will er natürlich nicht damit aufhören, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern vor allem, weil die Gilde sonst wissen würde, dass er mich bei sich versteckt. Er wird beobachtet, deshalb muss er weitermachen wie immer. Aber es fällt mir schwer, daran zu denken, wie ich mich fühlen werde, wenn ich aus meinem Versteck den fröhlichen Lärm der Kinder höre, die Erdbeeren pflücken und auf der großen Wiese herumtollen. Oder auch daran, dass es gefährlich für mich ist, wenn sich demnächst so viele fremde Leute auf der Farm aufhalten werden, weil jemand von ihnen mich entdecken könnte.
Als Kind bin ich in der Erdbeersaison immer zusammen mit meiner Schwester Juniper hierhergekommen. Nach einem langen Tag hatten wir am Abend meistens mehr Beeren im Bauch als in unseren Körben, und ich bin traurig, dass sich dieser Ort gar nicht mehr so magisch anfühlt wie damals. Jetzt jäte ich dort das Unkraut, wo ich früher Phantasiewelten erschaffen habe.
Wenn Granddad von den Pflanzen spricht, die dort wachsen, wo man sie nicht haben will, weiß ich, dass er im Grunde über mich spricht, fast so, als hätte er für mich eine eigene Therapieform erfunden. Aber obwohl er es gut meint, führt er mir dabei hauptsächlich eine Tatsache überdeutlich vor Augen.
Ich bin das Unkraut.
An fünf Stellen meines Körpers – dazu noch an einer geheimen sechsten – bin ich als fehlerhaft gebrandmarkt worden. Weil ich einem Fehlerhaften, einem alten Mann, geholfen und die Gilde belogen habe, hat die Gesellschaft mir mit dieser Strafe klargemacht, dass sie mich nicht haben will. Man hat mich sozusagen an den Wurzeln aus dem Boden gezerrt, mich eingehend betrachtet, ein paarmal gründlich durchgeschüttelt und dann beiseitegeworfen.
»Aber wer war es eigentlich, der auf die Idee gekommen ist, diese Pflanzen Unkraut zu nennen?«, fährt Granddad fort, während wir uns durch die Erdbeerbeete arbeiten. »Die Natur jedenfalls nicht. Das war die Idee der Menschen. Die Natur erlaubt diesen Pflanzen zu wachsen, die Natur gibt ihnen ihren Platz. Es sind die Menschen, die sie brandmarken und fortwerfen.«
»Weil sie die Blumen ersticken«, sage ich schließlich und blicke von meiner Arbeit auf. Mir tut der Rücken weh, meine Nägel sind schwarz von der Erde.
Unter seiner weit in die Stirn gezogenen Tweed-Kappe wirft Granddad mir einen Blick zu. Seine Augen sind leuchtend blau, immer hellwach, immer auf Draht, wie bei einem Habicht. »Das sind Überlebenskünstler, deshalb. Sie kämpfen um ihren Platz.«
Ich schlucke meine Traurigkeit hinunter und schaue weg.
Ich bin ein Unkraut. Ich bin fehlerhaft.
Heute werde ich achtzehn Jahre alt.
3
Die Person, von der ich meine sie sein zu müssen: das ist Celestine North, Tochter von Summer und Cutter North, Schwester von Juniper und Ewan, feste Freundin von Art. Außerdem hätte ich vor kurzem meine Abschlussprüfung machen und mich zum Mathematikstudium an der Universität vorbereiten sollen.
Heute ist mein achtzehnter Geburtstag.
Heute müsste ich eigentlich auf der Yacht von Arts Vater feiern. Als besonderes Geschenk für meinen großen Tag hatte Bosco Crevan mir nämlich versprochen, dass ich dort mit meinen Freunden und meiner Familie nach Herzenslust feiern könnte – vielleicht sogar mit einem kleinen Feuerwerk. Und auf jeden Fall mit einem Schokoladenbrunnen, zum Dippen von Marshmallows und Erdbeeren. Ich stelle mir meine Freundin Marlena mit einem Schokoladenbart und ihrem typischen ernsten Gesichtsausdruck vor, ich höre ihren Freund, der seine üblichen derben Witze macht und damit droht, seine diversen Körperteile in die Schokolade zu tauchen, ich sehe, wie Marlena genervt die Augen verdreht. Ich höre mich lachen. Ein Pseudostreit, so etwas mögen die beiden, sie lieben die Dramatik, nur um sich anschließend umso gefühlvoller versöhnen zu können.
Dad müsste auf der Tanzfläche den Coolen spielen, mit allen meinen Freundinnen tanzen und maßlos mit seinen Breakdance-Künsten und seinen Michael-Jackson-Imitationen angeben. Ich stelle mir vor, wie meine Model-Mum in einem geblümten Sommerkleid an Deck steht, die leichte Brise bewegt sanft wie eine perfekt platzierte Windmaschine ihre langen blonden Locken. An der Oberfläche wirkt sie ganz entspannt, aber sie hat ihre Umgebung jede Sekunde unter Kontrolle, ihre Gedanken rasen, und sie nimmt alles wahr, was um sie herum vorgeht, vor allem das, was verbessert werden muss – wer etwas zu trinken braucht, wer nicht ins Gespräch einbezogen wird –, und dann schwebt sie im Handumdrehen an die richtige Stelle und sorgt dafür, dass alles in Ordnung kommt.
Mein Bruder Ewan müsste sich eine Überdosis Marshmallows und Schokolade verabreichen, zusammen mit Mike – seinem besten Freund, einem rotgesichtigen, ständig schwitzenden Jungen – überall herumrennen, sich die abgestandenen Reste aus den Bierflaschen hinter die Binde kippen und wegen Magenschmerzen vorzeitig nach Hause begleitet werden. Ich sehe meine Schwester Juniper mit ihrer besten Freundin in der Ecke stehen und alles beobachten, ohne sich von der Stelle zu rühren. Mit einem zufriedenen, stillen Lächeln würde sie das Geschehen analysieren und wie immer alles besser durchschauen als jeder andere von uns.
Mich sehe ich auch. Ich müsste mit Art tanzen. Ich müsste glücklich sein. Aber schon der Gedanke daran fühlt sich nicht richtig an. Ich würde ihn anschauen und merken, dass er nicht mehr der Gleiche ist. Er ist dünner geworden, er sieht älter aus, müde, ungewaschen und schmuddelig. Und er würde mich zwar auch anschauen, aber in Gedanken wäre er ganz woanders. Seltsam schlaff würde er mich anfassen, eine seltsam zögernde Berührung mit feuchtkalten Händen. Es würde sich so anfühlen wie beim letzten Mal, als wir uns begegnet sind. So soll es aber nicht sein, so war es früher nicht. Früher war alles perfekt. Doch ich kann die alten Gefühle nicht einmal mehr in meinen Tagträumen heraufbeschwören. Es fühlt sich an, als wäre das alles sehr lange her. Ich habe die Perfektion vor langer Zeit hinter mir gelassen.
Ich öffne die Augen und bin wieder in Granddads Haus. Vor mir steht in einer Aluform ein gekaufter Apfelkuchen mit einer einzelnen Kerze. Von der Person, die ich glaube sein zu sollen, kann ich nicht mal mehr richtig träumen, ohne dass die Realität störend dazwischenfunkt.
Und dann ist da die Person, die ich jetzt wirklich bin – dieses Mädchen hier, das auf der Flucht ist, aber noch immer reglos dasitzt und auf einen kalten Apfelkuchen starrt. Weder Granddad noch ich selbst tun so, als wäre es anders. Granddad ist komplett unverfälscht, bei ihm weiß man immer, woran man ist. Und er schaut mich traurig an. Er bemüht sich gar nicht erst, das Thema zu vermeiden, dafür ist die Lage viel zu ernst. Jeden Tag sprechen wir darüber und versuchen, einen Plan zu entwerfen, aber der Plan ändert sich auch jeden Tag. Ich bin aus meinem Zuhause geflohen und meiner Whistleblowerin Mary May entwischt, meiner von der Gilde eingesetzten Bewacherin, deren Job es ist, mich auf Schritt und Tritt im Auge zu behalten und dafür zu sorgen, dass ich mich an die Regeln für Fehlerhafte halte. Aber jetzt bin ich vom Radar verschwunden. Ich bin offiziell »flüchtig«. Aber je länger ich hier bleibe, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man mich irgendwann findet.
Es ist zwei Wochen her, dass meine Mum mir gesagt hat, ich soll weglaufen, ein geflüsterter Befehl, den sie mir eindringlich ins Ohr gezischt hat. Lauf! Beim Gedanken daran bekomme ich immer noch eine Gänsehaut. Das Oberhaupt der Gilde, Bosco Crevan, saß bei uns zu Hause und verlangte von meinen Eltern, mich ihm auszuliefern. Obwohl Bosco der Vater meines Exfreunds ist, obwohl wir seit einem Jahrzehnt Nachbarn sind, obwohl wir uns noch vor wenigen Wochen zu einem Festessen in unserem Haus getroffen haben, wollte meine Mutter lieber, dass ich meine Familie verlasse, als dass ich ein weiteres Mal in seine Fänge gerate. Manchmal dauert es ein ganzes Leben, um eine Freundschaft aufzubauen, aber manchmal braucht es nur eine Sekunde, um sich jemanden zum Feind zu machen.
Es gab nur einen einzigen wichtigen Gegenstand, den ich auf meine Flucht mitnehmen musste: einen Zettel, den meine Schwester Juniper mir zugesteckt hatte. Er stammte von Carrick, meinem Zellennachbarn in Highland-Castle, dem Sitz der Gilde, der meinen Prozess verfolgt hat, während er auf seinen eigenen wartete. Er war auch bei meiner Brandmarkung anwesend, vor allem in den letzten Augenblicken. Und das bedeutet, er hat alle meine Brandmale gesehen – auch das geheime sechste Brandmal, von dessen Existenz nur sehr wenige wissen. Denn die sechste Markierung war nicht geplant, Crevan hat sie wutentbrannt befohlen und mir das Brenneisen ohne Betäubung auf die Haut gedrückt. Meine Narbe ist der Beweis für seinen Fehltritt.
Wenn es überhaupt einen Menschen gibt, der verstehen kann, wie ich mich jetzt fühle, ist es Carrick, denn er macht fast das Gleiche durch wie ich. Den Zettel, den er mir gegeben hat, habe ich nicht mehr, aber das ist auch nicht notwendig. Ich habe mir jedes Wort genau eingeprägt und ihn dann vernichtet.
Mein Wunsch, Carrick zu finden, ist nach wie vor riesig, aber die Suche ist nicht einfach. Er hat es geschafft, seinem Whistleblower zu entkommen, als er aus Highland-Castle entlassen wurde, aber vermutlich hat meine Vorgeschichte es ihm wiederum auch nicht leichter gemacht, mich zu finden. Vor zwei Wochen ist es ihm aber geglückt, er hat mich bei einem Aufruhr in einem Supermarkt aus der Menge gerettet und nach Hause gebracht. Ich war bewusstlos, und unser langersehntes Wiedersehen war nicht wirklich so, wie ich es mir erhofft hatte. Er hat mir dann lediglich den Zettel hinterlassen und ist wieder verschwunden.
Bisher ist es mir nicht gelungen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Ich konnte mich ja nicht einfach in der Stadt nach ihm umschauen, weil ich Angst hatte, erkannt zu werden. Ganz Highland weiß, wer ich bin. In Humming, unserer Hauptstadt, wäre ich deshalb sofort aufgegriffen worden. Deshalb habe ich Granddad angerufen. Zwar vermutete ich, dass die Gilde dort als Erstes nach mir suchen würde, und eigentlich wäre es vernünftiger, mich irgendwo anders zu verstecken, irgendwo, wo es sicherer ist, aber wenigstens hat mein Granddad hier auf der Farm das Sagen. Nur haben wir beide nicht damit gerechnet, dass die Whistleblower mich dermaßen unerbittlich verfolgen würden. Seit ich auf der Farm bin, hat es zahllose Suchaktionen gegeben. Bisher haben sie mein Versteck nicht gefunden, aber sie kommen immer wieder, und mir ist klar, dass meine Glückssträhne irgendwann abreißen wird.
Jedes Mal wenn sie sich meinem Versteck nähern, wenn ich ihre Schritte, manchmal sogar ihren Atem höre, glaube ich, vor Angst zu ersticken. Manchmal sind meine Verstecke so offensichtlich, dass die Whistleblower es nicht für nötig halten hinzusehen, und manchmal so gefährlich, dass sie sich dort nicht zu suchen trauen.
Ich blinzle und versuche, den Gedanken an sie zu verdrängen.
Stattdessen blicke ich auf die einzelne Kerze, die vor mir auf dem Apfelkuchen flackert.
»Wünsch dir was«, sagt Granddad.
Ich schließe die Augen und denke gut nach. Ich habe viel zu viele Wünsche und das quälende Gefühl, dass sie alle unerfüllbar sind. Aber ich glaube auch, dass wir in dem Moment, in dem wir uns nichts mehr wünschen, entweder wahrhaft glücklich sind oder endgültig resignieren und aufgeben wollen.
Na ja, glücklich bin ich nicht. Aber ich habe auch nicht vor aufzugeben.
Ich glaube nicht an Magie, aber wenn man sich etwas wünscht, ist das meiner Ansicht nach immer ein Zeichen von Hoffnung – man gesteht sich ein, dass man etwas will, man bekennt sich zu seiner Absicht. Vielleicht macht es den Wunsch ein kleines bisschen real, wenn man ihn für sich ausspricht. Vielleicht hilft es einem, ihn am Ende zu verwirklichen. Kanalisiere deine positiven Gedanken, denke daran, was du willst, wünsche es dir, und dann sorge dafür, dass es wahr wird.
Ich schließe die Augen und blase die Kerze aus.
Kaum habe ich die Augen wieder aufgemacht, da hören wir Schritte auf dem Korridor draußen.
Dahy, Granddads treuer Farmmanager, erscheint in der Küche.
»Die Whistleblower sind wieder da. Bewegt euch.«
4
Granddad springt so schnell auf, dass sein Stuhl umkippt und laut polternd auf den Steinboden kracht. Niemand hebt ihn auf. Auf diesen Besuch sind wir nicht vorbereitet. Erst gestern haben die Whistleblower die Farm von oben bis unten durchkämmt, und wir dachten, wenigstens heute wären wir in Sicherheit. Wo war die Sirene, deren Geheul einen normalerweise vorwarnt? Der Ton, bei dem jede Menschenseele in jedem Haus erstarrt, bis die Fahrzeuge vorbeigefahren sind und die Glücklichen, denen sie nicht gegolten hat, erleichtert aufatmen können.
Es gibt keinerlei Diskussion. Wortlos laufen wir aus dem Haus, denn wir wissen instinktiv, dass unsere Glückssträhne zu Ende geht und ich mich hier im Haus nicht mehr verstecken kann. Dahy läuft mit uns nach draußen. Wir biegen nach rechts ab, weg von der Auffahrt mit den Kirschbäumen. Ich weiß nicht, wohin wir wollen, auf jeden Fall so weit wie möglich weg vom Eingang der Farm.
Während wir rennen, sagt Dahy: »Dane hat sie vom Turm aus gesehen. Hat mich sofort gerufen. Keine Sirenen heute. Überraschungseffekt.«
Auf Granddads Grundstück steht die Ruine eines normannischen Turms, der als Wachturm gute Dienst leistet, denn man sieht schon von weitem, wenn die Whistleblower sich nähern. Seit ich hier bin, hat dort Tag und Nacht einer der Farmarbeiter Wache geschoben, alle übernehmen abwechselnd eine Schicht.
»Und sie sind definitiv hierher unterwegs?«, fragt Granddad, sieht sich um und denkt angestrengt nach. Leider spüre ich außerdem, dass er panisch wird. Das habe ich bei ihm bisher noch nicht erlebt.
Dahy nickt.
Ich lege einen Schritt zu, um nicht von den beiden abgehängt zu werden. »Wohin gehen wir eigentlich?«
Die beiden Männer schweigen, und Granddad schaut sich im Laufen suchend um. Anscheinend bemerkt das auch Dahy, denn er beobachtet ihn besorgt und versucht offensichtlich dahinterzukommen, was er vorhat. Ihr Gesichtsausdruck macht mir Angst. Ich fühle es in der Magengrube und daran, wie mein Herz rast.
In Höchstgeschwindigkeit nähern wir uns der Grenze von Granddads Land, nicht etwa, weil das Granddads Plan ist, sondern weil er keinen Plan hat. Er braucht Zeit, um sich etwas einfallen zu lassen.
So jagen wir über die Felder und durch die Erdbeerbeete, in denen wir gerade noch gearbeitet haben.
Wir hören, wie sie näher kommen. Bei den bisherigen Aktionen kamen sie immer nur mit einem Wagen, aber dem heftigen Motorenlärm nach zu urteilen, sind es diesmal mehrere. Und es klingt auch nicht nach normalen Pkws, sondern nach ihren Vans, in denen sie nicht nur zu zweit, sondern zu viert sitzen. Drei Stück sind es, glaube ich, dann wären zwölf Whistleblower hierher unterwegs. Eine großangelegte Suche, ich beginne zu zittern. Sie haben mich gefunden, ich sitze in der Falle. Keine Ahnung, was diese Leute jetzt mit mir vorhaben, aber als ich vor zwei Monaten in ihrem Gewahrsam war, haben sie mir sechs Brandmale verpasst. Ich trage das rote F an sechs verschiedenen Stellen meines Körpers, damit jeder meine Fehler erkennen kann. Die Schmerzen waren furchtbar, und ich möchte ungern herausfinden, wozu sie sonst noch fähig sind.
Dahy sieht meinen Großvater an. »Die Scheune?«
»Nein, die haben sie im Visier.«
Die beiden Männer lassen den Blick über das Ackerland schweifen, als würde die Erde darauf ihnen die Antwort geben. Die Erde!
Das bringt mich auf eine Idee. »Wir nehmen die Grube«, schlage ich leise vor.
Unsicher schaut Dahy mich an. »Ich glaube nicht, dass das eine …«
»Könnte funktionieren«, meint Granddad entschlossen und rennt los.
Es war meine eigene Idee, aber beim Gedanken an die Grube möchte ich weinen. Mir wird schwindlig bei der Vorstellung, mich dort verstecken zu müssen. Dahy streckt den Arm aus, um mich vorgehen zu lassen, und ich sehe Mitgefühl und Traurigkeit in seinen Augen.
Und so etwas wie ein Lebewohl.
Wir folgen meinem Großvater zu der Wiese vor dem dunklen Wald, der an das Grundstück grenzt. Während ich heute Vormittag auf der faulen Haut lag, träge einen Löwenzahn zwischen den Fingern kreisen ließ und beobachtete, wie der Wind ihm langsam die Schirmchen abriss, haben Dahy und Granddad hier ein Loch gebuddelt.
»Ihr seht aus, als wolltet ihr ein Grab schaufeln«, habe ich sarkastisch bemerkt.
Ich wusste ja nicht, dass ich damit ins Schwarze getroffen hatte.
5
Das Zubereiten von Speisen in der Kochgrube ist meinem Großvater zufolge die einfachste und älteste Garmethode der Welt. Man bezeichnet die Grube auch als Erdherd oder Erdofen, und es handelt sich, wie der Name schon sagt, um eine mit flachen Steinen ausgelegte Vertiefung im Boden, in der man die Hitze einschließen und alle Arten von Nahrungsmitteln kochen, backen, räuchern oder dämpfen kann.
Die Lebensmittel – Kartoffeln, Kürbis, Fleisch, was man eben essen möchte – werden direkt auf die Glut in die Grube gelegt und abgedeckt. Dann werden wieder Erde und Steine darübergeschichtet, und alles wird den ganzen Tag gegart. Einmal im Jahr lässt Granddad diese Tradition zusammen mit allen Farmarbeitern aufleben, für gewöhnlich allerdings erst um die Erntezeit und nicht schon – wie jetzt – im Juli. Dieses Jahr macht er es vor allem im Zeichen der Teambildung, wie er es ausdrückt, das heißt, er möchte mit einem gemeinschaftlichen Event unseren Gruppenzusammenhalt stärken. Granddad beschäftigt ausnahmslos Fehlerhafte, und nachdem sie in den letzten Tagen alle die gnadenlosen Suchaktionen der Whistleblower über sich ergehen lassen mussten und die Gilde zurzeit meinetwegen ein ganz besonders wachsames Auge auf Granddads Farm hat, können alle ein bisschen moralischen Auftrieb gut gebrauchen.
Bis vor zwei Wochen wusste ich nicht, dass Granddad Fehlerhafte beschäftigt. Ich erinnere mich nicht, überhaupt je seine Farmarbeiter gesehen zu haben, wenn wir ihn hier besucht haben, und Mum und Dad haben sie nie erwähnt. Vielleicht hatten sie auch die Anweisung, sich nicht blicken zu lassen. Oder vielleicht waren sie immer da, ich habe sie nur genauso wenig wahrgenommen wie die meisten anderen Fehlerhaften – bevor ich selbst eine von ihnen geworden bin.
Ich kann mir jedenfalls gut vorstellen, wie die Kluft zwischen Mum und Granddad dadurch noch tiefer geworden ist. Mum missbilligte Granddads Meinung über die Gilde, das von der Regierung unterstützte Tribunal, das Menschen wegen unethischen, unmoralischen Verhaltens verurteilt. Wir dachten lange, Granddads Tiraden seien weiter nichts als phantastische Verschwörungstheorien, aber wie sich herausstellte, hatte er absolut recht. Und mittlerweile verstehe ich auch, warum Granddad für Mum immer so eine Art schmutziges Geheimnis war. Als prominentes Model war Mum – zumindest äußerlich – die Verkörperung der Perfektion, und obwohl sie überall auf der Welt erfolgreich war, musste sie dafür sorgen, dass ihr guter Ruf auch in Humming erhalten blieb. Dass ihr Vater sich so freimütig für die Fehlerhaften einsetzte, war eine Bedrohung für ihr Image. Das alles habe ich erst in letzter Zeit begriffen.
Manche Arbeitgeber behandeln Fehlerhafte wie Sklaven. Lange Arbeitszeiten, Bezahlung bestenfalls nach den Mindestlohnbestimmungen. Viele Fehlerhafte sind schon froh, wenn sie für Kost und Logis arbeiten dürfen. Dabei sind die meisten von ihnen gebildete, aufrechte Bürger. Sie sind auch keine Kriminellen, sie haben nichts Illegales getan. Sie haben Entscheidungen getroffen, die nach moralisch-ethischen Gesichtspunkten von der Gesellschaft nicht gutgeheißen werden. Und dafür sind sie gebrandmarkt worden. Ich denke, man könnte das mit einer Art öffentlicher Bloßstellung gleichsetzen. Das erklärte Motto der Gilde-Richter lautet: Wir sorgen für Perfektion.
Dahy beispielsweise war früher Lehrer und ist von den Sicherheitskameras in der Schule dabei gefilmt worden, wie er ein Kind etwas grob angefasst hat.
Außerdem habe ich durch all die Geschehnisse der letzten Zeit erfahren, dass die Leute manchmal jemanden bewusst bei der Gilde als »Fehlerhaft« denunzieren. Zum Beispiel, um einen Konkurrenten auszuschalten oder um an jemandem Rache zu nehmen. Menschen missbrauchen das System. Die Gilde ist für Mitläufer und Glücksritter ein wahres Schlaraffenland.
Ich habe eine fundamentale Gilde-Regel missachtet – ich habe einem Fehlerhaften geholfen. Eigentlich steht darauf lediglich eine Gefängnisstrafe, aber ich wurde stattdessen selbst als fehlerhaft verurteilt. Richter Crevan hatte mir noch ein Schlupfloch angeboten; ich sollte lügen und behaupten, ich hätte dem alten Mann gar nicht helfen wollen. Aber ich konnte nicht lügen und erklärte während des Prozesses, dass der fehlerhafte alte Mann Hilfe brauchte und dass sie ihm zustand wie jedem anderen auch. Damit hatte ich nicht nur Crevan selbst gedemütigt, er fand auch, dass ich mit meinem Geständnis sein ganzes Gericht zum Gespött gemacht hatte.
Also musste an mir ein Exempel statuiert werden. Inzwischen ist mir klar, dass ich meine Brandmale nicht nur deshalb bekommen habe, weil ich die Gilde getäuscht und in Misskredit gebracht habe, sondern vor allem, weil ich viel Aufmerksamkeit auf mich gezogen und die Menschen dazu gebracht habe, das ganze Gilde-System in Frage zu stellen.
Zu den Stärken der Gilde gehört es, die Medien nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen, sie arbeiten beide Hand in Hand. Die Medien füttern die Bürger mit gildegenehmen Informationen. Man erzählt uns, dass die Richter stets im Recht und die Fehlerhaften stets im Unrecht sind. Geschehnisse werden falsch beziehungsweise tendenziös dargestellt, nie vollständig gehört, und die Stimme der Vernunft geht im Lärm der Whistleblower-Pfeifen unter.
Zur langen Liste der Fehlerhaften-Regeln gehört, dass Fehlerhafte am Arbeitsplatz keine Machtpositionen einnehmen dürfen, also keine Managerposten, von wo aus sie womöglich auf die Meinung und das Denken ihrer Untergebenen Einfluss nehmen könnten.Theoretisch sind alle anderen Jobs für Fehlerhafte zugänglich, aber trotzdem werden die meisten am Arbeitsplatz diskriminiert. Granddad ist einer der wenigen Arbeitgeber, die das nicht tun. Er scheut keine Mühe, fehlerhafte Arbeiter zu finden, um sie dann genauso zu behandeln, wie er alle anderen Menschen auch behandeln würde.
Dahy arbeitet am längsten bei ihm, schon dreißig Jahre. Dafür, dass er das Kind zu hart angefasst hat, ist er damals mit einer hässlichen Narbe an der Schläfe bestraft worden – seine Entscheidung wurde als fehlerhaft angesehen. Damals ging die Gilde in der Markierungskammer noch mit recht groben Instrumenten zu Werke, wenn sie die Fehlerhaften mit einem »F« brandmarkten, doch Dahys Brandmal ist harmlos gegen mein geheimes sechstes an der Wirbelsäule, das Richter Crevan mir eigenhändig verpasst hat. Mein sechstes Brandmal ist eine persönliche Botschaft, er hat es mir rein aus Wut zugefügt, ungeübt, ohne Betäubung. Eine grobe, schockierende Narbe.
Jetzt und hier trifft Dahy zusammen mit Granddad eine weitere im Sinne der Gilde fehlerhafte Entscheidung, nämlich die, mich zu verstecken. Granddad könnte dafür eine Strafe von mindestens sechs Monaten Haft bekommen, aber da Dahy selbst fehlerhaft ist, möchte ich mir gar nicht vorstellen, welche Strafe ihm droht. Ist man erst mal ein Fehlerhafter, denkt man, es könne nicht mehr schlimmer kommen, aber perfiderweise geht die Gilde auch gegen die Familien der Gebrandmarkten vor, um einen noch schlimmer unter Druck zu setzen.
Jetzt stehen wir hier und starren alle drei in die rechteckige Grube hinunter. Ich höre mehrmals Autotüren schlagen und stelle mir sofort vor, wie eine ganze Whistleblower-Armee in roter Kampfausrüstung und schwarzen Stiefeln aussteigt. In wenigen Minuten werden sie hier sein. Entschlossen springe ich in die Grube und lege mich platt auf den Boden.
»Deckt mich zu«, sage ich.
Granddad zögert, mich mit dem Holz zu bedecken, aber Dahy wird sofort aktiv – Abwarten könnte mich teuer zu stehen kommen. Meine dunkle Haut erweist sich in diesem Versteck jedoch als echter Vorteil. Ich liege in der Grube und fühle, wie sie haufenweise Äste und Moos auf mich werfen, das ich heute früh im Wald gesammelt habe. Ich habe mir also nicht nur mein eigenes Grab geschaufelt, sondern sogar gleich noch den Sarg mitgebracht.
Die Decke aus Holz und Erde wird immer schwerer.
Und die Stiefelschritte kommen unaufhaltsam näher.
»Wir müssen Carrick unbedingt erreichen«, sagt Granddad leise, und ich pflichte ihm in Gedanken bei.
Knirschend kommen die Stiefel ganz in meiner Nähe zum Stehen.
»Cornelius«, sagt plötzlich Mary Mays Stimme, und mein Herz beginnt wild zu pochen. Ich habe Angst vor dieser herzlosen Frau, einer Whistleblowerin, die für mich zuständig ist und ihre ganze Familie wegen unmoralischer Machenschaften an die Gilde verpfiffen hat. Angeblich, weil auf ihrem kleinen Biobauernhof unsolide gearbeitet wurde, in Wahrheit aber aus Rache, weil ihre Schwester ihr den Freund ausgespannt hat.
Mary May war bisher an sämtlichen Durchsuchungen auf Granddads Farm beteiligt, aber diesmal ist sie anscheinend mit einer ganzen Armee angerückt. Jedenfalls mit mindestens elf Kollegen.
»Mary May«, sagt Granddad barsch. »Haben die Sirenen keinen Saft mehr?«
Noch ein Schwung Holz landet auf mir, absichtlich grob, damit die Whistleblowerin keinen Verdacht schöpft. Ich muss mich beherrschen, um nicht zu stöhnen oder wegzurollen.
Mary May kennt kein Geplänkel, keinen Humor, keine Konversation. Sie kommt gleich zur Sache. »Was ist das denn, Cornelius?«
»Eine Kochgrube«, antwortet Granddad ebenso kurz angebunden.
Die beiden stehen direkt über mir, am linken Rand der Grube. Da die Bündel mit den Ästen jetzt von beiden Seiten auf mir landen, ist Dahy wohl auch noch da.
»Und was bitte schön ist eine Kochgrube?«
»Haben Sie noch nie von einer Kochgrube gehört? Ich dachte, ein Bauernmädchen wie Sie wüsste das bestimmt.«
»Nein, tu ich nicht.« Ihre Worte klingen abgehackt. Es gefällt ihr ganz und gar nicht, dass Granddad etwas über ihre Herkunft weiß, aber er genießt es, ihr genau das ganz nebenbei unter die Nase zu reiben. Sein Ton ist freundlich, aber die Drohung darin dennoch unmissverständlich.
»Na ja, man hebt eine Grube aus, wirft Holz rein und zündet es an. Wenn alles ordentlich heruntergebrannt ist, gibt man das, was gekocht werden soll, auf die Glut und deckt es mit Steinen und Erde zu. Vierundzwanzig Stunden später ist das Essen gar – in dem Boden, auf dem es gewachsen ist. Absolut köstlich, besser geht es kaum. Ich habe es von meinem Vater gelernt und der von seinem.«
»Was für ein seltsamer Zufall«, erwidert Mary May. »Kurz bevor wir hier auftauchen, heben Sie eine Grube aus. Aber Sie haben da unten nicht zufällig etwas versteckt, oder?«
»Wie soll das ein seltsamer Zufall sein, wenn wir Sie doch heute überhaupt nicht erwartet haben? Es ist unser jährliches Ritual, das wissen alle. Stimmt’s, Dahy?« Eine weitere Ladung Holz und Moos landet auf mir.
»Ganz richtig, Boss«, bestätigt Dahy.
»Erwarten Sie etwa, dass ich einem Fehlerhaften glaube?« Wie sehr es sie anwidert, von einem Fehlerhaften auch nur angesprochen zu werden, ist ihrer Stimme deutlich anzuhören.
Eine lange Pause tritt ein, ich konzentriere mich darauf zu atmen. Zwischen den Ästen gibt es kleine Löcher, und dort kommt Luft herein, aber leider nicht genug. Dieses Versteck war eine lächerliche Idee, aber dummerweise meine eigene. Inzwischen bereue ich es, dass ich nicht das Risiko eingegangen bin, mich im Wald zu verstecken. Vielleicht hätte Mary May sich auf der Suche nach mir in seiner Finsternis für immer verlaufen. Und dann würden wir beide dort für den Rest unseres Lebens, blind vor Dunkelheit, als Jägerin und Gejagte im tiefen Dickicht umeinander herumirren. Zugegebenermaßen ist das auch kein schöner Gedanke.
Ich höre, wie Mary May langsam um die Grube herumgeht, vielleicht erkennt sie die Umrisse meines Körpers. Vielleicht wird sie gleich in die Grube springen und mich entlarven.
Verzweifelt konzentriere ich mich darauf, ein wenig Luft zu bekommen, aber ich werde fast erdrückt, hoffentlich stapeln sie nicht noch mehr Holz auf mich.
»Also ist das Brennholz?«, fragt Mary May.
»Ja«, antwortet Granddad.
»Dann zünden Sie es gefälligst an«, befiehlt sie.
6
»Was?«, fragt Granddad.
»Sie haben mich genau gehört.«
Auf mir liegen mehrere Kilo Holz und Moos. Beklemmung macht sich in mir breit. Die Äste, die mir bisher einen kleinen Raum zum Atmen über dem Gesicht freigehalten hatten, drücken sich plötzlich enger an meine Haut. Ich versuche, meinen Kopf zu drehen, aber das Holz bewegt sich nicht. Und jetzt will Mary May mich anzünden. Ich sitze in der Falle wie eine Maus.
Granddad versucht, ihr die Idee auszureden. Er wollte das Feuer erst später anzünden, das Essen muss noch vorbereitet und eingepackt werden. Das braucht alles seine Zeit. Aber die Whistleblowerin erwidert, dass sie jede Menge Zeit hat. Sie fragt oder bittet auch nicht, sie befiehlt: Dahy soll die Sachen einpacken und sofort in die Grube legen, Granddad soll sich einfach auf das Feuer konzentrieren. Das Essen ist ihr sowieso egal – es geht ihr ja nur darum, mich auszuräuchern. Außerdem weiß sie, dass sich außer einer Bande Fehlerhafter niemand an dem Festessen beteiligen wird – und vor deren Plänen oder gar der Qualität ihrer Küche hat sie natürlich keinerlei Respekt.
Was nun?
Ich spüre, wie ein Bündel auf meinen Beinen landet. Granddad lässt sich Zeit, plaudert, trödelt, spielt trickreich die Rolle des zerstreuten alten Mannes.
»Werfen Sie eines hierher«, sagt Mary May.
Ein schwerer Packen landet auf meiner Brust.
Panik überkommt mich. Ich kann nicht mehr atmen! Ich kriege keine Luft mehr! Mit fest geschlossenen Augen versuche ich, mich in meine Phantasie zurückzuziehen. Auf die Yacht, zu meinem achtzehnten Geburtstag, zu der anderen Celestine, zu der, die ich sein sollte, möglichst weit weg von der, die ich bin. Aber sosehr ich mich anstrenge, kann ich doch nicht verschwinden. Ich bin im Hier und Jetzt. Schwere Holzscheite lasten auf meinem Körper, die Luft wird immer knapper.
Mary May drängt Granddad, sich zu beeilen. Wenn ich entdeckt werde, wird auch er bestraft. Ich bemühe mich, möglichst gleichmäßig weiterzuatmen, ganz ruhig zu bleiben. Es ist wenig Luft zum Atmen da, aber wenn ich einfach ruhig bleibe, wird alles gut. Und ich muss vermeiden, dass meine Brust sich unter dem Holz allzu deutlich hebt und senkt.
»Hier, ich habe ein Feuerzeug«, sagt Mary May.
Granddad lacht über ihr Angebot. Laut, herzhaft und dröhnend. »Nichts für ungut, aber so geht das nicht. Meine Werkzeuge sind in der Scheune. Bleiben Sie hier bei Dahy und schauen Sie zu, wie er das Essen vorbereitet. Ich bin gleich wieder da.«
Es ist die Art, wie er das sagt – er klingt dermaßen unglaubwürdig, dass jeder sofort eine Lüge wittert. Aber Granddad ist schlau. Jetzt denkt Mary May nämlich, er will weg von ihr, weil sich in der Scheune etwas – oder jemand – befindet, das – oder den – er unbedingt verstecken will. Er bedrängt sie so nachdrücklich, bei Dahy zu bleiben, dass ihre Aufmerksamkeit wie selbstverständlich von der Grube abgezogen wird und sie plötzlich den dringenden Wunsch verspürt, ihn zur Scheune zu begleiten. Und sobald sie weg sind, wird Dahy mir dabei helfen können, endlich aus der Grube zu kommen.
Doch stattdessen weist sie ihre Kollegen per Funk an, sie sollen zusammen mit Dahy die anderen Farmarbeiter holen und an der Kochgrube versammeln.
Sie will mich ausräuchern, und alle sollen zuschauen.
7
Als ich höre, wie die Schritte sich entfernen und ihre Stimmen leiser werden, versuche ich erst mal, Luft zu schnappen. Voller Angst, dass es ein Trick ist und Mary May mit einem Schwarm Whistleblower neben mir steht, bewege ich mich unter dem Holz. Es ist schwieriger, als ich dachte, denn sie haben wirklich ordentlich viel Holz auf mich gestapelt.
Mit beiden Beinen kicke und strample ich Äste und Moos so heftig von mir, dass alles durch die Gegend fliegt. Dann mache ich das Gleiche mit den Armen. Einiges landet schmerzhaft auf meinen Schienbeinen, aber dann ist endlich mein Gesicht frei – viel, viel frische Luft streicht über meine Haut, und ich sauge sie gierig ein. So schnell ich kann, steige ich aus meinem Grab und laufe zu dem finsteren Wald an der Grenze des Grundstücks. Ehe ich in seine Dunkelheit eintauche, in der ich hoffentlich sicher sein werde, schaue ich mich noch einmal um. Die Grube ist ein einziges Chaos. Wenn ich sie so hinterlasse, ist jedem klar, dass Granddad mich hier versteckt und Mary May weggelockt hat, um mir die Flucht zu ermöglichen. Doch dann wird er für meine Nachlässigkeit büßen müssen, die Whistleblower werden wissen, dass ich hier bin, und mich wahrscheinlich in Sekundenschnelle finden. Bei so vielen Jägern habe ich selbst in diesem finsteren Wald keine Chance zu entkommen.
Von fern höre ich Granddads und Mary Mays Stimme, sie kommen schon von der Scheune zurück. Vermutlich spricht Granddad so laut, um mich zu warnen.
Ich schaue zu der Grube und wieder zum Wald, der vielleicht mein Weg in die Freiheit ist. Mir bleibt keine Wahl.
Ich sprinte zurück zu der Grube, und während sich die Schritte unablässig nähern, schichte ich so rasch und sauber wie möglich alles Holz und Moos wieder hinein. Mein Herz klopft wie verrückt, ich spüre es im Hals, es dröhnt in meinem Kopf. Ich komme mir vor, als bewege ich mich in Zeitlupe, als wäre das alles ein Albtraum, und ich kann nur hoffen, dass ich bald aufwache. Aber es ist kein Traum. Es passiert wirklich. Ich sehe Mary Mays rote Uniform aufblitzen – und renne zurück zum Wald. Kaum habe ich mich hinter dem ersten Baum versteckt, als die beiden auch schon in Sichtweite kommen. Voller Angst drücke ich den Rücken an den Baumstamm, mein Herz rast, meine Brust hebt und senkt sich krampfhaft.
»Ich verstehe nicht, warum ich mein Feuerzeug nicht benutzen konnte«, sagt Mary May irritiert und offensichtlich verärgert, weil sie mich in der Scheune nicht gefunden hat.
Granddad lacht spöttisch, was sie garantiert noch mehr ärgert. »Das geht deshalb nicht, weil wir authentisch bleiben müssen. Diese Tradition ist Jahrtausende alt. Es ist eine Sache, dass Sie mich zwingen, das Feuer vor der Zeit anzuzünden, aber wenn ich es schon anzünde, dann auf meine Art.«
Er klingt unerschütterlich, aber ich weiß, dass alles nur Theater ist. Natürlich mag er Authentizität, keine Frage, aber er hat nichts gegen Streichhölzer oder Feuerzeuge. Mit einem Feuerstein und seinem Taschenmesser beginnt er nun, Funken zu erzeugen. Ich habe ihm dabei schon oft zugeschaut, er kann auf diese Art in Sekundenschnelle eine Flamme emporspringen lassen, aber jetzt stellt er sich extrem ungeschickt an – immer noch ganz der verwirrte alte Mann. Er schindet Zeit, entweder weil er weiß, dass ich geflohen bin, und er mir einen größeren Vorsprung verschaffen will, oder weil er fürchtet, dass ich immer noch unter den Holzbündeln liege, und davor zurückschreckt, mich anzuzünden. Am liebsten würde ich ihm zurufen, dass alles okay ist, aber mir bleibt nichts anderes übrig, als zuzuschauen, wie er sich abmüht. Als ich einen Blick auf sein Gesicht erhasche, wirkt es gar nicht mehr zuversichtlich.
»Was ist denn heute los mit Ihnen, Cornelius?«, fragt Mary May hinterhältig. »Haben Sie etwa Angst davor, Ihre Kochgrube in Brand zu setzen?«
Granddad sieht verloren aus. Hin- und hergerissen. Gequält.
Kurz darauf trifft Dahy mit den anderen Whistleblowern ein. Es sind gar nicht so viele, wie ich erwartet habe, alles andere als eine Armee – nur zwei Männer und eine Frau rücken mit den acht Farmarbeitern an. Die Fehlerhaften sehen blass aus, wahrscheinlich hat Dahy ihnen erzählt, was hier vorgeht.
»Die Papiere sind alle in Ordnung«, sagt die Whistleblowerin zu Mary May.
»Wirklich? Sie sind in Ordnung, obwohl sie doch erst gestern überprüft worden sind?«, hakt Granddad ironisch nach. »Die ganzen Male davor nicht mitgezählt. Wissen Sie eigentlich, dass ich Sie wegen gezielter Einschüchterungsversuche bei der Polizei melden könnte?«
»Und wir könnten Sie jetzt gleich mitnehmen, weil Sie Fehlerhaften helfen«, erwidert Mary May kalt.
»Mit welcher Begründung?«, will Granddad wissen.
»Mit der Begründung, dass die Arbeiter, die Sie hier auf Ihrem Grundstück einstellen, anscheinend durchweg Fehlerhafte sind.«
»Das ist vollkommen legal.«
»Aber die Bedingungen, unter denen sie hier arbeiten, gehen weit über das hinaus, was legal wäre. Die meisten Fehlerhaften werden nach dem Mindestlohn bezahlt. Aber Ihre Arbeiter bekommen wesentlich mehr. Sie werden besser bezahlt als manche Whistleblower.«
»Was sagst du denn dazu, Fehlerhafter?«, mischt sich einer der Whistleblower ein. Mary May schweigt. »Kriegst du von dem alten Mann eine Sonderbehandlung? Glaubst du, dass ihr euch hier vor uns verstecken könnt?«
Dahy ist klug genug, ihm nicht zu antworten.
»Ich lasse den Leuten nichts durchgehen«, geht Dan dazwischen – der Whistleblower, der für die Fehlerhaften auf Granddads Farm zuständig ist. Hier ist sein Territorium, und die Andeutungen seiner Kollegen, dass er den Farmarbeitern illegale Freiheiten durchgehen lässt, ist eine persönliche Beleidigung für ihn.
»Zünden Sie das Feuer an«, meldet sich Mary May an dieser Stelle zu Wort und beendet damit die Auseinandersetzung.
Inzwischen sprühen tatsächlich Funken zwischen Feuerstein und Messer. Ich wage nicht, mich zu rühren, denn ich habe Angst, dass einer der Whistleblower mich hört. Der Waldboden ist bedeckt von Ästen, Zweigen und Blättern, und ein Knacken kann mich im Handumdrehen verraten.
Granddad trägt die Flamme zum Moos, und einen Moment habe ich wieder Angst, dass er sich nicht traut, es anzuzünden, und damit alles preisgibt. Hab Vertrauen zu mir, Granddad. Hab Vertrauen, dass ich es geschafft habe abzuhauen.
»Was haben Sie zu verbergen, alter Mann? Ist es womöglich doch Celestine? Liegt sie dort unten in der Grube? Wenn ja, machen Sie sich keine Sorgen, ich habe Ihnen ja versprochen, dass wir sie da rausbekommen«, sagt Mary May sarkastisch.
»Und ich hab Ihnen gesagt, dass sie nicht hier ist«, sagt Granddad plötzlich sehr laut und wirft das lodernde Stück Holz in die Grube. Blitzschnell fängt das Moos Feuer, im Handumdrehen brennen Zweige und Holzscheite. Dahy schaut besorgt zu Granddad, alle beobachten, wie das Feuer sich ausbreitet, und warten wahrscheinlich insgeheim darauf, mich schreien zu hören. Ich sehe es in den selbstgefälligen, zufriedenen Gesichtern der Whistleblower, und auf einmal bin ich so wütend und so voller Hass, dass jeder Gedanke, mich auszuliefern, meine Freiheit aufzugeben, verflogen ist. Ich werde mich nicht unterkriegen lassen, sie dürfen nicht gewinnen, niemals.
»Und was jetzt?«, fragt einer der Whistleblower, offensichtlich enttäuscht, dass das große Spektakel ausbleibt.
»Tja«, meint Granddad und räuspert sich. Er bemüht sich nach Kräften, cool zu bleiben, aber ich weiß, dass er ziemlich aus der Fassung ist. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass er seine Enkeltochter angezündet hat. Ich könnte ohnmächtig dort unten liegen, bewusstlos durch den Sauerstoffmangel. Das Feuer dehnt sich immer weiter aus.
»Wir lassen es brennen, bis es glüht, dann stellen wir das Essen rein und bedecken alles wieder mit Erde.«
»Nur zu.«
Granddad sieht Mary May an, verloren, alt, resigniert, wie es scheint. Aber sein Hass ist größer denn je. »Zu warten, bis Glut entsteht, dauert Stunden.«
»Wir haben Zeit«, erwidert sie.
8
Drei Stunden verharren die Whistleblower bei Granddads Kochgrube. Meine Muskeln schmerzen, meine Füße tun weh, aber ich wage immer noch nicht, mich zu rühren.
Als das Feuer heruntergebrannt ist, befehlen die Whistleblower Granddad und Dahy, die Bündel mit den Nahrungsmitteln in die Hitze zu legen. Die Farmarbeiter schauen ordentlich aufgereiht zu, die Armbinden mit dem F gut sichtbar am rechten Arm, gleich über dem Ellbogen.
Eigentlich sollte das Kochen auf dem Erdherd ein Fest sein, ein gemeinsames Festmahl, das zeigt, dass sich die Fehlerhaften von der Gilde nicht unterkriegen lassen. Aber jetzt sind die Whistleblower hier. Versteckt hinter meinem Baum, auf den Boden gekauert, die Arme um die Knie geschlungen und in der feuchten Waldluft fröstelnd, kann ich wirklich nicht behaupten, dass ich mich stark fühle. Die Situation gleicht viel eher einer Niederlage.
Granddad und Dahy decken das Essen mit Erde zu, damit es sich erhitzt und gar wird. Als alles fertig ist, blickt Granddad in die Grube, als hätte er mich gerade lebendig begraben, und wieder möchte ich ihm zurufen, dass mit mir alles in Ordnung ist, dass ich wohlbehalten entkommen bin. Aber das ist unmöglich.
Ein Handy klingelt, eine Whistleblowerin nimmt das Gespräch an und entfernt sich einige Schritte von den anderen, um ungestört reden zu können. Leider kommt sie dabei immer näher auf den Wald zu. Ich werde wieder nervös.
»Hallo, Richter Crevan. Hier ist Kate. Nein, Celestine ist nicht hier. Wir haben alles durchsucht.«
Eine Weile ist es still, sie hört zu, und von meinem Platz aus kann ich die Stimme am anderen Ende der Leitung hören. Kate geht noch ein Stück weiter und bleibt direkt am Waldrand vor meinem Baum stehen.
Auf der anderen Seite des Baumes drücke ich mich mit dem Rücken an den Stamm, schließe die Augen, so fest ich kann, und halte die Luft an.
»Bei allem Respekt, Richter Crevan, das ist bereits der fünfte Besuch der Gilde auf dem Grundstück, und ich denke, Mary May ist höchst gewissenhaft vorgegangen. Wir haben alles überprüft, was man sich vorstellen kann. Ich glaube wirklich nicht, dass sie hier ist. Ich denke, der Großvater sagt die Wahrheit.«
Ich höre den Frust in ihrer Stimme. Sie stehen alle unter Druck, mich zu finden, und dieser Druck geht unzweifelhaft von Richter Crevan aus. Kate bewegt sich noch ein paar Schritte vorwärts und steht plötzlich direkt in meiner Sichtlinie.
Langsam lässt sie den Blick durch den Wald schweifen.
Und dann schaut sie mir mitten ins Gesicht.
9
Gleich wird sie Crevan sagen, dass sie mich gefunden hat, dann wird sie auflegen, die anderen rufen und in ihre Trillerpfeife blasen, die sie an einer Goldkette um den Hals trägt. Ich rechne fest damit. Aber sie bleibt vollkommen ruhig, und ihre Stimme verändert sich kein bisschen. Sie schaut durch mich hindurch, als würde sie mich gar nicht sehen. Bin ich inzwischen schon so bedeutungslos, dass ich unsichtbar geworden bin? Instinktiv schaue ich auf meine Hände hinunter, um mich zu vergewissern, dass ich mich wenigstens selbst noch sehen kann.
»Sie möchten, dass wir den Großvater nach Highland-Castle bringen?«, sagt Kate gerade, und jetzt mustert sie mich ganz offen, während sie gleichzeitig mit dem Telefongespräch fortfährt, als wäre nichts passiert.
Warum sagt sie ihm nicht, dass sie mich gefunden hat?
Die Nachricht, dass Granddad nach Highland-Castle, zu Richter Crevan gebracht werden soll, zu dem Mann, der mich persönlich gebrandmarkt und mein Leben zerstört hat, macht mich erst panisch, doch dann überflutet mich auf einmal eine große Wut. Sie können meinen Granddad doch nicht einfach wegschleppen!
»Wir nehmen ihn gleich fest«, sagt die Whistleblowerin gerade, ohne mich aus den Augen zu lassen, und ich warte immer noch auf die Bombe, auf den Moment, in dem sie Mary May und Richter Crevan wissen lässt, dass ich direkt neben ihr stehe. »In zwei Stunden sind wir da.«
Ich will sie anschreien, sie treten und schlagen, ich will sie anbrüllen, dass sie mich und meinen Granddad nicht einfach abführen kann, aber ich reiße mich zusammen. Denn etwas an der Art, wie sie mich ansieht, ist höchst merkwürdig.
Schließlich steckt die Whistleblowerin ihr Handy wieder in die Tasche und fixiert mich mit einem langen Blick, als wollte sie etwas sagen, aber dann entscheidet sie sich offensichtlich dagegen, dreht sich wortlos um und geht weg.
»Hören Sie, alter Mann«, ruft sie Granddad zu. »Wir nehmen Sie mit. Richter Crevan möchte sich mit Ihnen unterhalten.«
Selbst nachdem die Vans weggefahren sind, bleibe ich, wo ich bin, zusammengekauert und an einen feuchten Baumstamm gepresst, und versuche, aus dem schlau zu werden, was da gerade passiert ist. Warum hat die Whistleblowerin mich nicht mitgenommen?
10
Eine Stunde nachdem Mary May meinen Großvater wie einen Verbrecher abgeführt hat, kauere ich immer noch in dem hohlen Baum, erschöpft, hungrig, frierend und ziemlich ängstlich. Ich kann den Rauch von der Grube riechen, das Feuer unter der Erde, in dem eine leckere Mahlzeit gart, die wahrscheinlich niemand essen wird – jetzt, wo Granddad weg ist. Ich habe ein entsetzlich schlechtes Gewissen, dass Granddad meinetwegen in diese Lage geraten ist, und ich mache mir große Sorgen, was sie ihm in Highland-Castle antun werden. Und ich habe Angst, er könnte denken, dass er mich bei lebendigem Leib in der Kochgrube verbrannt hat. Wenn ich ihm doch irgendwie die Nachricht zukommen lassen könnte, dass ich geflüchtet bin.
Ich traue mich immer noch nicht, mich zu rühren, denn es könnte ja eine Falle sein, und die Whistleblower warten nur darauf, mich zu packen, sobald ich mein Versteck verlasse. Eine Weile hoffe ich darauf, dass die Farmarbeiter mich holen, aber inzwischen ist längst Ausgangssperre, und Dan passt auf, dass sie eingehalten wird.
Nach der Sperrstunde um dreiundzwanzig Uhr nehmen Kontrollen und Suchaktionen generell zu. Deshalb ist es auch keine gute Idee, sich um diese Zeit alleine im Freien zu bewegen, selbst wenn man wie ich im Schutz der Dunkelheit unterwegs ist. Ich habe beschlossen, dass es für mich nicht in Frage kommt, ins Farmhaus zurückzugehen, obwohl es dort warm ist und das Licht auf der Veranda verlockend schimmert.
Vielleicht schaffe ich es zu Granddads nächsten Nachbarn. Aber kann ich ihnen wirklich vertrauen? Und kann ich darauf vertrauen, dass sie mir helfen, Carrick zu finden?
Denn was hat Granddad mir eingeschärft? Regel Nummer eins: Traue niemandem.
Auf einmal höre ich Motorengeräusch. Eine Autotür knallt zu. Dann noch zwei weitere. Sie sind tatsächlich zurückgekommen! Jetzt komme ich mir richtig blöd vor. Warum bin ich nicht längst weggelaufen? Warum habe ich es praktisch provoziert, dass sie mich erwischen?
Schritte nähern sich. Männerstimmen, die ich nicht erkenne, aber dann eine, die mir vertraut ist, klar und deutlich.
»Hier ist die Grube«, sagt Dahy. »Da war sie drin.«
Kann ich Dahy trauen, oder ist womöglich er es, der die Whistleblower überhaupt alarmiert hat? Hat er mich verraten? Oder haben sie ihn dazu gezwungen, ihnen zu helfen? Auf wen kann ich zählen? Ich würde so gerne aufspringen und um Hilfe rufen, aber damit würde ich womöglich alles kaputtmachen, was ich bereits erreicht habe. Alles, was ich tun musste, um bis in dieses Versteck zu kommen. Ich muss mich still verhalten und abwarten. Abwarten. Abwarten.
»Bestimmt ist sie in den Wald gelaufen«, sagt ein anderer Mann.
Ich sehe das Licht einer Taschenlampe, und es kommt mir vor, als erhellte sie den dunklen Wald mindestens auf hundert Meilen. Große dicke Baumstämme, so weit das Auge reicht. Selbst wenn ich jetzt losrenne und die Whistleblower mich nicht sofort entdecken, werde ich mich im Handumdrehen verirrt haben. Ein schrecklicher Gedanke durchfährt mich.
Es ist vorbei, Celestine. Es ist vorbei.
Aber ich gebe nicht auf. Ich denke an Crevans Gesicht, als er mich in der Markierungskammer angebrüllt hat, ich solle widerrufen. Ich denke an Carricks Hand, die sich an die Glasscheibe drückt, während er alles beobachtet, was dort drin mit mir passiert, an sein Freundschaftsangebot. Die Wut brennt in mir, ich höre Schritte ganz nahe bei meinem Baum, und nun richte ich mich endlich aus meiner verkrampften Position auf, strecke Arme und Beine, und bei eins, zwei … springe ich hinter dem Baum hervor, renne in den Wald, scheuche alles auf, was in der Nähe lebt, und sprinte auf meinen steifen Beinen in die Dunkelheit hinein.
Sofort kommt Bewegung in die Männer.
»Da!«
Der Strahl der Taschenlampe sucht mich, aber ich entwische ihm blitzschnell und nutze das Licht stattdessen, um zu sehen, was vor mir liegt. Ich weiche Bäumen und spitzen Tannennadeln aus, ducke mich, tauche ab, höre aber die schnellen Schritte der Männer immer noch allzu deutlich hinter mir.
»Celestine«, zischt eine ungehaltene Stimme ziemlich dicht hinter mir. Ich renne weiter und knalle mit dem Kopf gegen einen Ast. Einen Moment ist mir schwindlig, aber ich habe keine Zeit, stehen zu bleiben und mich zu fassen. Meine Verfolger kommen immer näher, jetzt sehe ich, dass es drei sind. Drei wild schwankende Taschenlampenlichter folgen mir durchs Unterholz.
»Celestine!«, ruft eine Stimme etwas lauter, und eine andere mahnt, leise zu sein.
Warum wollen sie leise sein? Mir ist schwindlig, ich glaube, ich habe mir die Stirn blutig geschlagen, aber ich weiß, ich muss weiterlaufen, das hat meine Mom mir gesagt. Granddad hat gesagt, ich darf keinem Menschen trauen. Dad hat gesagt, ich soll Granddad vertrauen. Ich muss weiter.
Plötzlich erlöschen die Taschenlampen, und ich renne durch die stockdunkle Nacht. Schlagartig bleibe ich stehen, es ist totenstill, nur mein Atem ist zu hören. Ich weiß nicht mehr, wo vorn und wo hinten ist. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll und wo ich hergekommen bin, ich habe jede Orientierung verloren. Wieder meldet sich die Panik, aber ich raffe mich auf, schließe einen Moment die Augen und zwinge mich zur Ruhe. Ich kann es schaffen. Vorsichtig öffne ich die Augen wieder und suche das ferne Licht des Farmhauses oder irgendeinen anderen Orientierungspunkt. Als ich mich bewege, knacken Zweige unter meinen Füßen.
Dann spüre ich Arme um meine Mitte, Schweißgeruch steigt mir in die Nase.
»Ich hab sie«, sagt einer der Männer.
Ich wehre mich, aber es hilft nichts, er hält mich zu fest, ich kann mich kaum rühren. Trotzdem versuche ich es weiter, winde mich, so gut ich kann, schlage nach ihm, kratze und trete.
Dann schalten sie wieder eine der Taschenlampen an und scheinen mir damit ins Gesicht. Der Mann, der mich gefangen hat, und ich drehen beide den Kopf zur Seite, um dem grellen Licht zu entgehen.
»Lass sie los, Lennox«, sagt der andere Mann mit der Taschenlampe, und sofort höre ich auf mit dem Gezappel.
Die Arme geben mich frei, reichen die Taschenlampe an Dahy weiter, der sie so hält, dass ich sehen kann, wer gerade gesprochen hat.
Der Typ scheint sich über mich zu amüsieren …
Der Typ ist Carrick.
11
Ziemlich aufgeregt gehe ich hinter Dahy zurück zum Farmhaus, Carrick und sein Freund Lennox folgen uns im Gänsemarsch. Am liebsten möchte ich mich dauernd umdrehen und Carrick anstarren, aber jedes Mal, wenn ich es versuche, werde ich von Lennox dabei erwischt. Ich bin sehr froh, Carrick wiederzusehen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so kribbelig werde – ich bin regelrecht aus dem Häuschen.
Endlich habe ich ein bisschen Glück. Und mein Geburtstagswunsch ist in Erfüllung gegangen.
Aber ich verbeiße mir das Lächeln, während wir, einer hinter dem anderen, zum Haus zurückwandern, denn jetzt ist wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für ein strahlendes Lächeln, kein Mensch würde mich verstehen.
»Hast du irgendwas von Granddad gehört?«, frage ich Dahy.
»Nein«, antwortet er, und als er sich kurz zu mir umdreht, sehe ich den besorgten Ausdruck auf seinem Gesicht. »Aber Dan tut, was er kann, um etwas rauszukriegen.«
Ich bin Dan, dem Whistleblower der Farmarbeiter, gegenüber eher misstrauisch. Zwar hat er sich auf ein Arrangement mit Granddad eingelassen, die Zügel bei seinen fehlerhaften Arbeitern etwas lockerer zu lassen, aber ich glaube, dass er es in erster Linie deshalb tut, weil er trinkt und Granddad ihm als Gegenleistung etwas von seinem selbstgebrannten Whiskey zukommen lässt, und nicht so sehr, weil er ein anständiger Mensch ist.
»Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas weißt?«
»Du wirst die Erste sein, die es erfährt.«
»Und lässt du Granddad bitte wissen, dass ich in Sicherheit bin?«
Dan hat nie erfahren, dass ich auf der Farm untergeschlüpft bin, so freundlich war das Arrangement dann wohl doch nicht, also kann er Granddad auch nicht die Nachricht überbringen, dass mir nichts passiert ist. Vielleicht könnte die Whistleblowerin Kate meinem Granddad bereits erzählt haben, dass ich wohlauf bin, aber einem Whistleblower zu vertrauen ist wirklich nur der letzte Ausweg – auch wenn Kate mich hat laufen lassen. Ich halte Dahy am Arm mit der roten Armbinde fest, damit er stehen bleibt. Auch Lennox und Carrick machen halt.
»Dahy, kannst du Kontakt zu meiner Familie aufnehmen? Ihnen sagen, dass Granddad in Highland-Castle sitzt und ich in Sicherheit bin?«
»Das mit deinem Großvater wissen sie schon, aber über dich kann ich am Telefon nicht sprechen, das ist viel zu riskant, Celestine. Du weißt doch, dass die Gilde die Telefonleitungen anzapft.«
»Aber du musst eine Möglichkeit finden, sie zu informieren.«
»Celestine …«
»Nein, Dahy, hör zu.« Ich hebe die Stimme und höre das Zittern darin. »Ich kann es nicht aushalten, dass Granddad in einer Zelle sitzt und glaubt, er hätte seine Enkeltochter bei lebendigem Leibe verbrannt.« Meine Stimme bricht. »Er muss so schnell wie möglich die Wahrheit erfahren.«
Jetzt versteht Dahy endlich, und er wird weicher. »Ja, natürlich. Ich werde eine Möglichkeit finden.«
Ich lasse seinen Arm wieder los.
»Er wird zurechtkommen, Celestine, du weißt doch, wie zäh er ist«, fügt Dahy hinzu. »Die werden ihn schnell wieder laufenlassen, ehe er sie mit seinen Verschwörungstheorien zum Wahnsinn treibt.«
Sein Versuch, witzig zu sein, entlockt mir zwar nur ein schwaches Lächeln, aber ich bin ihm trotzdem dankbar, nicke ihm zu und versuche, die Tränen zu ignorieren, die mir in die Augen steigen. Wahrscheinlich sollte ich die ganzen schrecklichen Szenarien, die sich mein Hirn für Granddad ausdenkt, lieber verdrängen. Wie er ausgebuht und beschimpft wird, wenn er über den kopfsteingepflasterten Innenhof von Highland-Castle geht. Wie die Leute ihn anschauen und anbrüllen, als wäre er der letzte Abschaum, wie sie ihn mit Gegenständen bewerfen und ihn anspucken, während er versucht, seine Würde zu wahren und sich nicht zu ducken. Granddad in einer Zelle, eingesperrt. Granddad, wie er vor dem Gilde-Gericht Crevans Fragen beantworten muss. Granddad in der Markierungskammer. Granddad, dem all das passiert, was mir passiert ist. Wenn man selbst betroffen ist, kann man es eher aushalten, als wenn es den Menschen passiert, die man liebt.
Was Crevan mir angetan hat, war ein Sonderfall – dem Stress geschuldet, ein momentaner Kontrollverlust. Jedenfalls denke ich das. Aber letztlich kann ich nur hoffen, dass er Granddad nicht ebenso behandelt wie mich.
Wir gehen zurück zu dem Jeep, der vor dem Farmhaus parkt. Keine Zeit, über alte Zeiten zu quatschen und sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Es ist nach elf Uhr abends, wir sind alle Fehlerhafte und dürfen uns um diese Zeit laut Anordnung nicht mehr draußen aufhalten. Drei von uns sind sogar »Flüchtige«, die auch den anderen Regeln für Fehlerhafte nicht gehorchen.