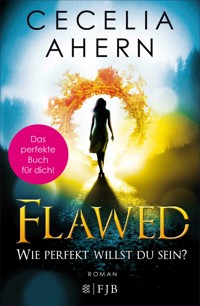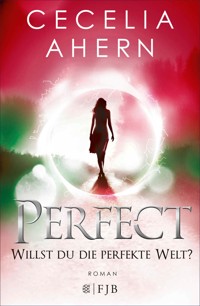8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer magischen Liebe – und einer Familie auf dem Weg zu sich selbst. Zum Freuen und Weinen schön, voller Hoffnung, Tiefe und Humor. Elizabeth hat ihr Leben fest im Griff. Sie kümmert sich um ihr Designbüro, ihren mürrischen Vater, die unzuverlässige Schwester und ihren sechsjährigen Neffen Luke. Doch niemanden lässt sie wirklich an sich heran – zu schmerzhaft war die Vergangenheit. Ivan ist nicht von dieser Welt. Niemand kann ihn sehen. Wirklich niemand? Nur seine Schützlinge: Sein Job ist, "bester Freund" zu sein für jemanden, der ihn braucht. So wie der einsame kleine Luke. Als Ivan jedoch plötzlich auch eine Verbindung zu Elizabeth spürt, ist er verwirrt – sie gehört doch gar nicht zu seinen Aufgaben … »Eine wunderbare Geschichte voller Überraschungen und mit einem Hauch von Magie.« NDR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Cecelia Ahern
Zwischen Himmel und Liebe
Roman
Roman
Über dieses Buch
Elizabeth hat ihr Leben fest im Griff. Sie kümmert sich um ihr Designbüro, ihren mürrischen Vater, die unzuverlässige Schwester und ihren sechsjährigen Neffen Luke. Doch niemanden lässt sie wirklich an sich heran – zu schmerzhaft war die Vergangenheit. Ivan ist nicht von dieser Welt. Niemand kann ihn sehen. Wirklich niemand? Nur seine Schützlinge: Sein Job ist, „bester Freund“ zu sein für jemanden, der ihn braucht. So wie der einsame kleine Luke. Als Ivan jedoch plötzlich auch eine Verbindung zu Elizabeth spürt, ist er verwirrt – sie gehört doch gar nicht zu seinen Aufgaben ...
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Cecelia Ahern, geboren 1981, ist in Dublin zu Hause. Schon als Kind schrieb die Tochter des irischen Ministerpräsidenten Geschichten. Direkt nach dem Uni-Abschluss in Journalistik und Film begann sie mit dem Roman, der sie berühmt machte: ›P.S. Ich liebe Dich‹. Danach folgten die Weltbestseller ›Für immer vielleicht‹ und ›Zwischen Himmel und Liebe‹.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbldung: Getty Images/Karin Smeds
Die Originalausgabe erschien 2005 unter dem Titel ›If you could see me now‹ im Verlag HarperCollins, London
Die deutsche Erstausgabe erschien 2006 bei Krüger, einem Verlag der S. Fischer Verlag GmbH
© Cecelia Ahern 2005
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH 2006
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-400653-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Vierzig
Einundvierzig
Zweiundvierzig
Dreiundvierzig
Für Georgina, die dran glaubt …
Eins
Es war ein Freitagmorgen im Juni, als Luke und ich beste Freunde wurden. Präzise gesagt passierte es um Viertel nach neun, das weiß ich noch genau, weil ich da auf die Uhr schaute. Ich weiß nicht mehr, warum. Eigentlich gab es keinen Grund dafür, ich musste nicht zu einer bestimmten Zeit irgendwo sein. Andererseits bin ich überzeugt, dass alles irgendwie einen Grund hat, also hab ich vielleicht auf die Uhr gesehen, damit ich meine Geschichte anständig erzählen kann. Einzelheiten sind wichtig beim Erzählen, stimmt’s?
Ich freute mich, Luke zu treffen, denn ich fühlte mich ein bisschen traurig, weil ich mich gerade von meinem alten besten Freund Barry getrennt hatte. Er konnte sich nicht mehr mit mir treffen. Aber das spielt eigentlich keine Rolle, denn jetzt ist er glücklicher, und darauf kommt es an, denke ich. Schließlich gehört es zu meinem Job, dass ich meine besten Freunde verlassen muss. Sicher, es ist nicht der angenehmste Teil, aber ich glaube daran, dass an allem etwas Gutes ist, und deshalb sage ich mir, wenn ich meine besten Freunde nicht verlassen müsste, dann könnte ich auch keine neuen besten Freunde kennen lernen. Und genau das ist es ja, was mir am allerbesten gefällt – neue Freundschaften zu schließen. Wahrscheinlich hat man mir den Job deswegen auch angeboten.
Wie mein Job genau aussieht, erkläre ich gleich, aber erst mal möchte ich von dem Morgen erzählen, an dem ich meinen besten Freund Luke kennen gelernt habe.
Ich zog Barrys Gartentor hinter mir zu und marschierte los. Ohne ersichtlichen Grund ging ich erst links, dann rechts, dann links, dann ein Stück geradeaus, dann wieder rechts, bis ich schließlich in einer Wohnsiedlung namens Fuchsia Lane landete. Vermutlich hat man den Namen gewählt, weil da überall Fuchsien blühen. Die wachsen hier nämlich wild. Wenn ich »hier« sage, dann meine ich eine Stadt namens Baile na gCroíthe, in der Nähe von Killarney, im County Kerry. Das liegt in Irland.
Aus Baile na gCroíthe wurde irgendwann im Lauf der Zeit auf Englisch Hartstown, aber wenn man den Namen direkt aus dem Irischen übersetzt, heißt er ›Stadt der Herzen‹. Ich finde, das klingt viel hübscher.
Ich war froh, wieder da zu sein. In meiner Anfangszeit hatte ich ein paar Aufträge hier zu erledigen, aber dann war ich jahrelang anderswo unterwegs. Bei meiner Arbeit komme ich viel herum, und manchmal nehmen mich meine Freunde auch mit in den Urlaub ins Ausland. Ich war schon in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Griechenland, Australien und sogar ein paar Mal in Disney World in Amerika. Erstaunlich, wie viele meiner besten Freunde mit mir nach Disney World wollen. Eigentlich würde man ja denken, bei den ganzen Attraktionen, bei den Süßigkeiten und wundervollen Zauberdingen ist ein Freund unnötig, aber das zeigt mal wieder, dass man immer einen besten Freund braucht, ganz gleich, wo man ist.
Tut mir Leid, ich schweife ab. Zurück zur Fuchsia Lane. Sie bestand aus zwölf Häusern, sechs auf jeder Seite, und alle ganz unterschiedlich. Manche aus roten Backsteinen, andere aus grauen Klinkern, manche mit spitzem Dach, andere mit flachem, und eins hatte sogar ein Reetdach. Manche hatten mehrere Stockwerke, andere nur eins. Es gab lange Auffahrten und riesige Bäume, die viel älter waren als ich. Und obwohl ich finde, man soll alles Ältere respektieren, bedeutet das nicht, dass man keinen Spaß damit haben kann.
Überall wimmelte es nur so von Menschen. Klar, es war ja Freitagmorgen. Außerdem auch noch Juni und so richtig sonnig und hell, da hatten alle gute Laune. Na ja, jedenfalls die meisten.
Auch jede Menge Kinder waren auf der Straße, fuhren Fahrrad, spielten Himmel und Hölle, Fangen, Dosenwerfen und jede Menge anderes Zeug. Man hörte sie schreien und lachen. Vermutlich waren sie froh, dass sie Ferien hatten. Aber so nett sie auch zu sein schienen, fühlte ich mich nicht zu ihnen hingezogen. Wissen Sie, ich kann mich nicht mit jedem X-Beliebigen anfreunden. Das ist nicht mein Job.
In einem Vorgarten mähte ein Mann den Rasen, und eine Frau werkelte mit dreckverkrusteten Handschuhen an einem Blumenbeet herum. Der angenehme Duft von frisch geschnittenem Gras hing in der Luft, und das Geräusch, wie die Frau schnitt und schnippelte, stutzte und putzte, war Musik in meinen Ohren. Im nächsten Garten pfiff ein Mann ein Lied, das ich nicht kannte, während er mit dem Gartenschlauch seinen Wagen abspritzte und zusah, wie der Seifenschaum über den Lack glitschte und darunter ein blitzblankes Glitzern zum Vorschein kam. Hin und wieder wirbelte er mit dem Schlauch herum und spritzte zwei kleine Mädchen in gelbschwarz gestreiften Badeanzügen nass. Die beiden sahen aus wie zwei große Hummeln. Ich freute mich an ihrem Gegiggel.
In der nächsten Auffahrt spielten ein Junge und ein Mädchen Himmel und Hölle. Ich sah ihnen ein Weilchen zu, aber da keiner der beiden auf mein Interesse reagierte, ging ich weiter. In jedem Garten sah ich spielende Kinder, aber keins nahm mich wahr oder lud mich zum Mitspielen ein. Fahrräder, Skateboards und ferngesteuerte Autos flitzten an mir vorbei, ohne dass jemand mich auch nur eines Blickes würdigte. Allmählich begann ich mich zu fragen, ob es vielleicht ein Fehler gewesen war, in die Fuchsia Lane zu kommen, was mich verwirrte, weil ich im Orteaussuchen eigentlich sehr gut bin und weil auch so viele Kinder da waren. Schließlich setzte ich mich auf die Gartenmauer beim letzten Haus und dachte darüber nach, wo ich falsch abgebogen sein könnte.
Nach ein paar Minuten kam ich zu dem Schluss, dass ich doch in der richtigen Gegend gelandet war. Ich biege wirklich nur ganz, ganz selten mal falsch ab. Langsam drehte ich mich auf meinem Hinterteil um, sodass ich das Haus sehen konnte, das zu der Gartenmauer gehörte, auf der ich gerade saß. Es hatte zwei Stockwerke und eine Garage, vor der ein teures Auto stand und in der Sonne funkelte. Auf einem Schild, das unter mir an der Gartenmauer angebracht war, stand: »Fuchsia House«. Der gleiche Name wie die Straße. Aber an diesem Haus kletterten die blühenden Fuchsien überall über die Wände, klammerten sich an die braunen Backsteine über der Eingangstür und wucherten bis hinauf zum Dach. Es sah sehr hübsch aus. Ein Teil des Hauses war aus braunem Backstein, an anderen Stellen war es honigfarben gestrichen. Ein paar Fenster waren viereckig, andere rund. Ziemlich ungewöhnlich. Die Haustür war fuchsienrot und hatte zwei lange Fenster, deren obere Scheiben aus Milchglas bestanden. Darunter waren ein Messingtürklopfer und ein Messingbriefschlitz, sodass es aussah wie ein Gesicht: zwei Augen, eine Nase und ein Mund, der mir zulächelte. Ich winkte und lächelte zurück, für den Fall des Falles. Heutzutage kann man ja nie wissen.
Während ich noch das Gesicht studierte, ging die Tür auf und fiel dann ziemlich laut wieder ins Schloss. Ein Junge kam heraus. Anscheinend war er ziemlich wütend. In der rechten Hand trug er ein großes rotes Feuerwehrauto, in der linken einen Polizeiwagen. Ich liebe rote Feuerwehrautos. Der Junge hopste von der untersten Stufe der Veranda und rannte auf die Wiese, wo er sich auf die Knie fallen ließ und ein Stück rutschte. Ich musste lachen, weil seine schwarze Trainingshose dabei natürlich Grasflecke kriegte. Grasflecke sind lustig, weil sie nie wieder rausgehen. Mein alter Freund Barry und ich sind immer gern im Gras rumgerutscht. Der Junge fing an, die Feuerwehr gegen das Polizeiauto krachen zu lassen und dabei verschiedene Geräusche von sich zu geben. Das konnte er gut. Barry und ich haben das auch immer gemacht. Es macht Spaß, Dinge zu spielen, die im richtigen Leben normalerweise nicht passieren.
Der Junge rammte die rote Feuerwehr mit dem Streifenwagen, und der Cheffeuerwehrmann, der sich an die Leiter auf der Seite des Wagens klammerte, stürzte ab. Ich musste laut lachen, und der Junge blickte auf.
Er sah mich an. Direkt in die Augen.
»Hi«, sagte ich, räusperte mich und trat nervös von einem Fuß auf den anderen. Ich hatte meine Lieblingsschuhe an, blaue Converse-Sneakers, und die hatten noch Grasflecke vorn auf den Gummikappen, vom Grasrutschen mit Barry. Während ich überlegte, was ich sagen sollte, rubbelte ich damit über die Backsteinmauer, um die Flecken abzureiben. So gern ich neue Freundschaften schließe, bin ich dabei immer auch ein bisschen aufgeregt. Schließlich besteht ja die Chance, dass jemand mich nicht leiden kann, und das macht mir jedes Mal so ein flaues Gefühl im Magen. Bisher hatte ich zwar Glück, aber das bedeutet ja nicht, dass es ewig so bleiben muss.
»Hi«, antwortete der Junge, während er den Feuerwehrmann wieder an der Leiter befestigte.
»Wie heißt du?«, fragte ich, kickte mit dem Fuß gegen die Mauer und kratzte mit der Gummikappe am Stein. Das Gras ging natürlich trotzdem nicht ab.
Eine Weile musterte mich der Junge von oben bis unten, als überlege er, ob er mir seinen Namen sagen wollte oder eher nicht. Diesen Teil meines Jobs hasse ich aus tiefstem Herzen. Es ist echt blöd, wenn man sich mit jemandem anfreunden will, der umgekehrt gar kein Interesse daran hat. Manchmal passiert das schon, aber irgendwann entscheidet sich der Betreffende dann immer doch für mich, weil er merkt, dass er gern mit mir zusammen sein möchte, auch wenn er es anfangs nicht kapiert hat.
Der Junge hatte weißblonde Haare und große blaue Augen. Ich kannte das Gesicht von irgendwo, aber ich konnte mich nicht erinnern, woher.
Schließlich sagte er: »Ich heiße Luke. Und du?«
Ich stopfte die Hände tief in die Hosentaschen und konzentrierte mich ganz darauf, mit dem rechten Fuß gegen die Mauer zu treten. Ein paar Backsteinkrümel lösten sich und fielen auf den Boden. Ohne den Jungen anzusehen, antwortete ich: »Ivan.«
»Hi, Ivan.« Er lächelte. Er hatte vorn eine Zahnlücke.
»Hi, Luke«, grinste ich zurück.
Ich hab keine Zahnlücke.
»Deine Feuerwehr gefällt mir. Mein best…, äh, mein alter bester Freund Barry hatte auch so eine, und wir haben immer damit gespielt. Eigentlich ist Feuerwehr aber ein blöder Name, weil sie nämlich schmilzt, wenn man sie durchs Feuer fahren lässt«, fügte ich hinzu, die Hände immer noch in den Taschen vergraben. Dadurch schoben sich meine Schultern aber bis zu den Ohren hoch, sodass ich nicht richtig hören konnte, und ich nahm meine Hände lieber wieder raus.
Luke rollte im Gras herum und lachte. »Du hast deine Feuerwehr durchs Feuer fahren lassen?«, kreischte er.
»Na ja, schließlich heißt sie doch Feuerwehr, oder?«, verteidigte ich mich.
Jetzt rollte er sich auf den Rücken und johlte: »Nein, du Dummi! Eine Feuerwehr ist dafür da, dass sie das Feuer löscht!«
Ich ließ mir seine Erklärung eine Weile durch den Kopf gehen. »Hmmm. Tja, ich kann dir jedenfalls sagen, womit man eine Feuerwehr löschen kann«, erklärte ich sachlich. »Nämlich mit Wasser.«
Luke schlug sich mit der flachen Hand an den Kopf, schrie »Neeeinnn!«, verdrehte die Augen, bis er schielte, und ließ sich dann wieder ins Gras plumpsen.
Ich lachte. Luke war echt lustig.
»Willst du mit mir spielen?«, fragte er und zog die Augenbrauen hoch.
»Klar, gern. Spielen tu ich immer am liebsten«, grinste ich, sprang über die Gartenmauer und kam zu ihm ins Gras.
»Wie alt bist du?«, erkundigte er sich argwöhnisch. »Du siehst aus, als wärst du genauso alt wie meine Tante«, fügte er stirnrunzelnd hinzu. »Und die spielt überhaupt nicht gern mit meiner Feuerwehr.«
»Na ja, dann ist deine Tante ein langweiliger alter Reliewgnal!«
»Ein Reliewgnal!«, wiederholte Luke und brüllte vor Lachen. »Was ist denn ein Reliewgnal?«
»Jemand Langweiliger«, antwortete ich und rümpfte die Nase, als wäre Langeweile eine schlimme Krankheit. Ich drehe Wörter gern um, das ist, als erfinde man seine eigene Sprache.
»Wie alt bist du überhaupt?«, fragte ich Luke, während ich die Feuerwehr mit dem Polizeiauto rammte. Wieder stürzte der Feuerwehrmann von der Leiter. »Du siehst nämlich aus wie meine Tante«, behauptete ich, während Luke sich vor Lachen den Bauch hielt. Er lachte ziemlich laut.
»Ich bin erst sechs, Ivan! Und kein Mädchen!«
»Oh.« In Wirklichkeit habe ich gar keine Tante, ich wollte ihn bloß zum Lachen bringen. »Aber warum sagst du erst sechs, als würde das nicht reichen? Ich finde, sechs ist genau richtig.«
Gerade als ich ihn nach seinem Lieblingscomic fragen wollte, ging die Haustür auf, und ich hörte, wie jemand schrie. Luke wurde ganz weiß, und ich schaute auch dorthin, wo er hinstarrte.
»SAOIRSE, GIB MIR SOFORT MEINEN SCHLÜSSEL ZURÜCK!«, brüllte eine verzweifelte Stimme. Dann kam eine zerzauste Frau mit geröteten Wangen, wilden Augen und langen, ungewaschenen roten Haaren, die ihr strähnig ums Gesicht wehten, aus dem Haus gerannt. Ein weiterer Entsetzensschrei ertönte aus dem Haus hinter ihr, und sie geriet vor Schreck mit ihren Plateauschuhen auf der Verandatreppe ins Stolpern. Laut fluchend und schimpfend suchte sie Halt an der Hauswand. Als sie aufblickte, starrte sie zu Luke und mir herüber. Ihr Mund dehnte sich zu einem Lächeln und entblößte eine Reihe schiefer gelber Zähne. Unwillkürlich zog ich mich ein paar Schritte zurück und merkte, dass Luke das Gleiche tat. Aber sie streckte den Daumen in die Höhe und krächzte: »Bis dann, Kiddo!«, ließ die Wand los und eilte zu dem Auto, das in der Auffahrt parkte.
»SAOIRSE!«, schrie die Person im Haus wieder. »ICH RUF DIE POLIZEI, WENN DU VERSUCHST, IN DEN WAGEN ZU STEIGEN!«
Die Rothaarige schnaubte und drückte auf den Autoschlüssel. Die Lichter begannen zu blinken, und ein Piepen ertönte. Blitzschnell riss sie die Tür auf, kletterte hinein, stieß sich den Kopf, fluchte wieder und knallte die Tür hinter sich zu. Ich hörte, wie die Verriegelung einrastete. Ein paar Kinder draußen auf der Straße hatten aufgehört zu spielen, denn sie wollten sich das Drama nicht entgehen lassen, das sich da vor ihren Augen abspielte.
Nun kam auch die Besitzerin der geheimnisvollen Stimme aus dem Haus gelaufen, in der Hand das Telefon. Sie sah völlig anders aus als die andere Frau. Ihre Haare waren ordentlich im Nacken zusammengesteckt und sie trug einen eleganten grauen Hosenanzug, der allerdings gar nicht zu der schrillen, unbeherrschten Stimme passte, die aus ihrem Mund kam. Außerdem war sie knallrot im Gesicht, völlig außer Atem, und ihre Brust hob und senkte sich krampfhaft, während sie auf ihren hohen Absätzen mehr schlecht als recht zum Auto rannte. Als sie merkte, dass die Türen verschlossen waren, drohte sie erneut mit der Polizei.
»Ich rufe die Garda, Saoirse«, rief sie warnend und wedelte mit dem Telefon vor dem Seitenfenster herum.
Aber Saoirse grinste nur und ließ den Motor an. Mit sich überschlagender Stimme bekniete die andere Frau die Rothaarige auszusteigen, und wie sie da aufgeregt von einem Fuß auf den anderen hüpfte, sah sie aus, als hätte sie ein anderes Wesen in sich, das herauswollte, und ich musste an Hulk denken.
Schließlich gab Saoirse Gas und bretterte die lange, mit Kopfsteinen gepflasterte Auffahrt hinunter. Auf halbem Weg verlangsamte sie das Tempo, worauf sich die Schultern der Frau mit dem Telefon entspannten und ihr Gesicht einen erleichterten Ausdruck annahm. Aber das Auto hielt nicht an, sondern schlich im Schritttempo weiter, und aus dem Fenster auf der Fahrerseite erschien eine Hand mit zwei in die Höhe gestreckten Fingern.
»Ah, sie kommt in zwei Minuten zurück«, sagte ich zu Luke, der mich seltsam ansah.
Entsetzt sah die Frau mit dem Telefon dem Auto nach, das die Straße hinunterfegte und fast ein Kind mitgerissen hätte. Ein paar Haare waren aus dem strengen Knoten in ihrem Nacken rausgekommen, als wollten sie der Flüchtigen auf eigene Faust nachjagen.
Luke senkte den Kopf und befestigte den Feuerwehrmann wieder an seiner Leiter. Die Frau mit dem Telefon stieß einen Wutschrei aus, warf die Hände in die Luft und drehte sich um. Man hörte ein leises Knacken, als der Absatz im Kopfsteinpflaster stecken blieb. Die Frau schüttelte wild ihr Bein, wurde offensichtlich mit jeder Sekunde frustrierter und schaffte es schließlich mit einer gewaltigen Anstrengung, den Fuß frei zu bekommen. Der Schuh flog heraus, aber der Absatz blieb in der Ritze stecken.
»VERDAAAAAAMMT!«, schrie sie. Auf einer hohen Hacke und einem flachen Pumps humpelte sie die Verandatreppe wieder hinauf. Die Fuchsientür krachte ins Schloss, und das Haus verschluckte die Frau. Jetzt lächelten die Fenster, der Türknauf und der Briefschlitz mich wieder an, und ich lächelte zurück.
»Wen grinst du da an?«, erkundigte sich Luke argwöhnisch.
»Die Tür«, war meine nahe liegende Antwort.
Aber er starrte mich nur weiter stirnrunzelnd an, in Gedanken halb bei den Ereignissen, deren Augenzeugen wir gerade geworden waren, halb bei der Frage, ob es nicht seltsam war, eine Tür anzugrinsen.
Durchs Glas der Haustür sahen wir, wie die Frau mit dem Telefon in der Eingangshalle auf und ab tigerte. »Wer ist sie?«, fragte ich und sah Luke an.
Er sah fix und fertig aus.
»Das ist meine Tante«, erklärte er mit kaum hörbarer Stimme. »Sie kümmert sich um mich.«
»Oh«, sagte ich. »Und wer war die Frau im Auto?«
Langsam schob Luke seine Feuerwehr durchs Gras und walzte die Halme platt. »Ach die. Das ist Saoirse«, erwiderte er leise. »Meine Mom.«
»Oh.« Wir schwiegen, und ich merkte, dass er traurig war. »Sier-scha«, wiederholte ich den Namen, denn ich mochte das Gefühl, das er auf meiner Zunge erzeugte. Es hörte sich an, als käme der Wind in einem breiten Schwall aus meinem Mund oder als unterhielten sich die Bäume an einem windigen Tag miteinander. »Siiiiiier-schaaaaaa.« Schließlich hörte ich auf, weil Luke mich komisch ansah. Ich pflückte eine Butterblume und hielt sie ihm unters Kinn. Auf seiner blassen Haut erschien ein gelblicher Glanz. »Du magst Butter«, stellte ich fest. »Dann ist Saoirse also nicht deine Freundin?«
Augenblicklich strahlte Luke wieder und kicherte. Wenn auch nicht mehr ganz so entspannt wie vorhin.
»Wer ist eigentlich dieser Barry, von dem du die ganze Zeit redest?«, fragte Luke und rammte meinen Polizeiwagen noch viel doller als vorhin.
»Er heißt Barry McDonald.« Ich lächelte, weil ich an die Spiele denken musste, die Barry und ich immer gespielt hatten.
Lukes Augen leuchteten auf. »Barry McDonald ist in meiner Klasse!«
Da endlich fiel bei mir der Groschen. »Ich wusste doch, dass ich dein Gesicht irgendwoher kenne, Luke. Ich hab dich jeden Tag in der Schule gesehen, wenn ich mit Barry dort war.«
»Du warst mit Barry in der Schule?«, fragte er überrascht.
»Ja, mit Barry hat die Schule echt Spaß gemacht«, lachte ich.
Luke kniff die Augen zusammen. »Hmm, ich hab dich aber nie gesehen.«
Ich fing an zu lachen. »Natürlich hast du mich nicht gesehen, du Dummbeutel«, stellte ich sachlich fest.
Zwei
Elizabeth wanderte ruhelos über den Ahornfußboden der langen Halle ihres Hauses, und ihr Herz hämmerte so laut in ihrer Brust, dass ihre Rippen bebten. Das Telefon hielt sie zwischen Ohr und Schulter geklemmt, und ihre Gedanken waren wie ein Blizzard, der ihr die Sicht raubte, während sie dem schrillen Klingeln in ihrem Ohr lauschte.
Zwischendurch blieb sie lange genug stehen, um ihr Spiegelbild anzustarren, und ihre braunen Augen weiteten sich vor Entsetzen. Sie gestattete es sich eigentlich nie, ungepflegt zu wirken. Sich so gehen zu lassen bedeutete Kontrollverlust. Wilde Strähnen ihrer schokobraunen Haare waren aus dem strengen französischen Knoten gerutscht, sodass sie aussah, als hätte sie einen Finger in die Steckdose gesteckt. Unter ihren Augen klebte Mascara, ihr Lippenstift war verwischt bis auf den pflaumenfarbenen Lipliner, der jetzt einen krassen Rahmen um ihren Mund bildete, und die Grundierung pappte auf den trockenen Stellen ihrer olivfarbenen Haut. Verschwunden war der sonst übliche makellose Look, und das ließ ihr Herz nur noch schneller schlagen und steigerte ihre Panik.
Tief durchatmen, Elizabeth, einfach nur tief durchatmen, sagte sie sich. Mit zitternden Händen glättete sie die zerzausten Haare. Die Mascarakrümel wischte sie mit einem nassen Finger ab, spitzte die Lippen und rieb sie aufeinander, strich ihr Jackett glatt und räusperte sich. Ein Augenblick der Konzentrationsschwäche, das war alles. Und es würde nicht wieder passieren. Entschlossen verlagerte sie das Telefon ans linke Ohr und bemerkte dabei, dass ihr Claddagh-Ohrring einen deutlichen Abdruck auf dem Hals hinterlassen hatte. Ihre Schultern hatten wohl ziemlich fest zugepackt.
Endlich hob auf der anderen Seite jemand ab. Elizabeth wandte dem Spiegel den Rücken zu und nahm Haltung an. Zurück zur Sache.
»Hallo, hier Polizeirevier von Baile na gCroíthe.«
Elizabeth zuckte zusammen, als sie die Stimme am Telefon erkannte. »Hi, Marie, hier ist Elizabeth … mal wieder. Saoirse hat das Auto genommen.« Sie machte eine Pause. »Mal wieder.«
Vom anderen Ende der Leitung hörte man einen leisen Seufzer. »Wann genau, Elizabeth?«
Elizabeth ließ sich auf die unterste Stufe der Haustreppe sinken und machte sich auf das übliche Verhör gefasst. Sie schloss die Augen, eigentlich nur, um zu blinzeln, aber die Erleichterung, einfach alles auszublenden, war so groß, dass sie sie einfach nicht wieder aufmachte. »Vor fünf Minuten.«
»Gut. Hat sie gesagt, wo sie hinwill?«
»Zum Mond«, antwortete Elizabeth sachlich.
»Wie bitte?«, hakte Marie nach.
»Du hast es doch genau gehört. Sie hat gesagt, sie will zum Mond«, erwiderte Elizabeth mit fester Stimme. »Sie meint, die Leute dort würden sie bestimmt besser verstehen.«
»Die Leute auf dem Mond«, wiederholte Marie.
»Ja«, bestätigte Elizabeth irritiert. »Du könntest sie vielleicht auf der Autobahn suchen lassen. Vermutlich ist das der schnellste Weg, wenn man zum Mond will, oder nicht? Obwohl ich nicht ganz sicher bin, welche Ausfahrt sie nimmt. Die am weitesten im Norden wahrscheinlich. Vielleicht fährt sie nach Nordosten in Richtung Dublin, oder wer weiß, vielleicht ist sie auch unterwegs nach Cork; womöglich haben die Mondleute ein Flugzeug geschickt, das sie abholt. Ganz egal, ich würde an deiner Stelle jedenfalls die Autobahn checken …«
»Entspann dich, Elizabeth, du weißt doch, dass ich dir solche Fragen stellen muss.«
»Ja, ich weiß.« Elizabeth versuchte sich zu beruhigen. In diesem Augenblick verpasste sie ein wichtiges Meeting. Wichtig für sie, wichtig für ihr kleines Architekturbüro. Da Lukes Kinderfrau Edith vor ein paar Wochen zu der dreimonatigen Weltreise aufgebrochen war, mit der sie Elizabeth schon seit sechs Jahren drohte, hatte heute ausnahmsweise die Babysitterin auf Luke aufgepasst. Aber das arme Mädchen kannte Saoirse und ihr sonderbares Verhalten nicht und hatte Elizabeth völlig panisch bei der Arbeit angerufen … wieder einmal. Elizabeth musste alles stehen und liegen lassen und nach Hause hetzen … wieder einmal. Eigentlich hätte sie nicht überrascht sein dürfen, dass das passiert war … wieder einmal. Das einzig Überraschende war, dass Lukes Nanny Edith abgesehen von ihrer Reise überhaupt noch jeden Tag zur Arbeit auftauchte. Seit sechs Jahren half sie Elizabeth nun schon mit Luke, sechs Jahre voller Dramatik, und trotz Ediths Loyalität erwartete Elizabeth praktisch jeden Tag einen Anruf oder einen Kündigungsbrief. Denn Lukes Nanny zu sein war mit einer Menge Belastungen verbunden. Aber es war auch ganz schön schwer, Lukes Adoptivmutter zu sein.
»Elizabeth, bist du noch da?«
»Ja«, sagte sie und machte schnell die Augen wieder auf. Sie wurde schon wieder unkonzentriert. »Entschuldige, was hast du gerade gesagt?«
»Ich hab dich gefragt, welches Auto Saoirse genommen hat.«
Elizabeth verdrehte die Augen und schnitt dem Telefon eine Grimasse. »Dasselbe wie immer, Marie. Dasselbe wie letzte Woche, wie die vorletzte Woche und auch die Woche davor«, fauchte sie.
Aber Marie blieb fest. »Und das ist der …«
»Der BMW«, unterbrach Elizabeth. »Das gleiche verdammte schwarze BMW-Cabrio. Vier Räder, zwei Türen, ein Steuer, zwei Seitenspiegel, Scheinwerfer und …«
»So weiter«, fiel Marie ihr ins Wort. »In was für einem Zustand?«
»Frisch geputzt und blitzeblank«, antwortete Elizabeth frech.
»Sehr schön, und in was für einem Zustand war Saoirse?«
»Dem üblichen.«
»Abgefüllt.«
»Ganz genau.« Elizabeth stand auf und ging durch die Halle zur Küche. Ihr Sonnenspeicher. Das Klicken ihrer Absätze auf dem Marmorboden hallte laut durch den luftigen Raum mit der hohen Decke. Alles war an seinem Platz. Dank der stärker werdenden Sonnenstrahlen, die durch die Glasfenster des Wintergartens fielen, war es richtig warm hier, und Elizabeth musste die Augen gegen die Helligkeit zusammenkneifen. Die makellose Küche glänzte im Sonnenlicht, die schwarzen Granitarbeitsflächen funkelten, in den Chromarmaturen spiegelte sich der strahlende Tag. Ein Paradies aus Edelstahl und Walnussholz. Elizabeth hielt direkt auf die rettende Espressomaschine zu, denn ihr erschöpfter Körper brauchte dringend eine Energiespritze. Sie öffnete ein kleines Küchenschränkchen aus Walnussholz und holte eine kleine beige Kaffeetasse heraus. Ehe sie den Schrank wieder zumachte, drehte sie noch schnell eine Tasse um, damit der Henkel wie bei allen anderen nach rechts zeigte. Dann zog sie die Besteckschublade auf, merkte, dass ein Messer im Gabelfach lag, transferierte es an seinen rechtmäßigen Platz, holte einen Löffel heraus und schob die Schublade wieder zu.
Aus dem Augenwinkel entdeckte sie ein Handtuch, das unordentlich über den Herdgriff gehängt worden war, warf es in den Wäschekorb im Hauswirtschaftsraum, holte ein frisches Handtuch aus dem ordentlichen Stapel im Schrank, faltete es sauber auf die Hälfte und drapierte es sorgsam über den Herdgriff. Alles hatte seinen Platz.
»Na ja, ich hab meine Wagennummer in der letzten Woche nicht ändern lassen, also ist es immer noch dieselbe«, beantwortete sie gelangweilt eine weitere von Maries sinnlosen Fragen, während sie die dampfende Tasse Espresso auf einen Marmoruntersetzer stellte, um den gläsernen Küchentisch zu schonen. Dann strich sie sich den Rock glatt, entfernte eine Fluse von ihrem Jackett, setzte sich in den Wintergarten und sah hinaus in den Garten und die sanften, scheinbar endlosen Hügel dahinter. Vierzig Schattierungen von Grün, Gold und Braun.
Als sie das üppige Aroma des Espressos einatmete, fühlte sie sich augenblicklich belebt. Sie stellte sich vor, wie ihre Schwester in ihrem – Elizabeths – Cabrio mit heruntergeklapptem Dach über die Hügel brauste, die Arme in der Luft, die Augen geschlossen, das flammend rote Haar im Wind flatternd, in dem festen Glauben, frei zu sein. Saoirse war das irische Wort für Freiheit. Ihre Mutter hatte den Namen ausgesucht, in ihrem letzten verzweifelten Versuch, die Mutterpflichten, die sie so verachtete, weniger als Strafe zu sehen. Sie wünschte sich, ihre zweite Tochter würde sie befreien – von den Fesseln der Ehe, von der Mutterschaft, von der Verantwortung … und von der Realität.
Saoirses und Elizabeths Mutter hatte ihren Mann und Vater ihrer beiden Töchter mit sechzehn kennen gelernt. Sie kam mit einer Gruppe von Dichtern, Musikern und Träumern durch die Stadt und begegnete im örtlichen Pub dem jungen Farmer. Er war zwölf Jahre älter als sie und hingerissen von ihrer wilden, mysteriösen Art und ihrem sorglosen Wesen. Sie fühlte sich geschmeichelt. So heirateten sie. Mit achtzehn bekam sie das erste Kind, Elizabeth. Doch wie sich herausstellte, konnte ihre Mutter sich nicht damit zufrieden geben, ihr Leben in dem verschlafenen Städtchen in den Hügeln zu fristen, wo sie doch eigentlich nur auf der Durchreise gewesen war, und wurde immer frustrierter. Das schreiende Baby und die vielen schlaflosen Nächte sorgten dafür, dass sie sich im Kopf immer weiter entfernte. Träume von persönlicher Freiheit vermischten sich mit der Realität, und sie war oft tagelang einfach verschwunden. Sie ging auf Entdeckungsreise, suchte neue Orte und Menschen.
Mit zwölf Jahren sorgte Elizabeth nicht nur für sich selbst, sondern auch für ihren stillen, grüblerischen Vater. Sie fragte nie, wann ihre Mutter zurückkommen würde, denn sie wusste, dass sie immer wieder auftauchte, mit geröteten Wangen, funkelnden Augen und voller Geschichten über die Welt und alles, was sie zu bieten hatte. Wie eine frische Sommerbrise wehte sie durch das Leben ihres Mannes und ihrer Tochter, Aufregung und Hoffnung im Schlepptau. Wenn sie da war, veränderte sich die Atmosphäre in dem kleinen Farmhaus schlagartig, alle vier Wände lauschten und absorbierten ihre Begeisterung. Dann saß Elizabeth am Fußende des Betts ihrer Mutter und lauschte den atemlos erzählten Geschichten, ganz kribbelig vor Freude. So blieb es ein paar Tage, bis ihre Mutter des Berichtens müde war und lieber neue Geschichten erleben wollte.
Oft brachte sie Andenken mit, in Form von Muscheln, Steinen oder Blättern. Elizabeth erinnerte sich noch an eine Vase mit langen frischen Grashalmen, die mitten auf dem Esstisch stand, als enthielte sie die exotischsten Pflanzen, die jemals erschaffen worden waren. Auf die Frage, wo die Halme gepflückt worden waren, zwinkerte ihre Mutter nur geheimnisvoll, tippte sich mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze und versprach Elizabeth, sie würde es eines Tages verstehen. Ihr Vater saß meist still auf seinem Stuhl am Kaminfeuer und las die Zeitung, ohne sie jemals umzublättern. Auch er verlor sich in der Welt der Worte.
Als Elizabeth zwölf war, wurde ihre Mutter wieder schwanger, und obwohl sie dem neugeborenen Baby den Namen Saoirse gab, schenkte das Kind ihr nicht die Freiheit, nach der sie sich so sehnte. Kurze Zeit später brach sie zu einer neuen Expedition auf, von der sie nicht mehr zurückkehrte. Brendan, Elizabeths und Saoirses Vater, hatte kein Interesse an dem jungen Leben, das seine Frau vertrieben hatte, wartete weiter schweigend in seinem Stuhl am Feuer auf ihre Rückkehr und las die Zeitung, ohne je eine Seite umzublättern. Jahrelang. Immerzu. Bald war Elizabeths Herz es müde, auf ihre Mutter zu hoffen, und Saoirse wurde ihre Verantwortung.
Saoirse hatte das keltische Äußere ihres Vaters geerbt, die rotblonden Haare und die helle Haut, während Elizabeth das Ebenbild ihrer Mutter war: olivfarbene Haut, schokobraune Haare, fast schwarze Augen – die Einflüsse des Jahrtausende alten spanischen Bluts. Mit jedem Tag ähnelte Elizabeth ihrer Mutter mehr, und sie wusste, dass das für ihren Vater schwer war. Sie begann, sich dafür zu hassen, und strengte sich nicht nur an, ihren Vater aus seiner Schweigsamkeit zu locken, sondern noch viel mehr, ihm und sich selbst zu beweisen, dass sie ganz anders war als ihre Mutter. Vor allem, dass sie loyal sein konnte. Als Elizabeth mit achtzehn die Schule beendete, stand sie vor dem Dilemma, nach Cork ziehen zu müssen, um auf die Universität zu gehen. Eine Entscheidung, für die sie all ihren Mut brauchte. Ihr Vater fühlte sich im Stich gelassen, genauso wie jedes Mal, wenn Elizabeth eine neue Freundschaft schloss. Er verzehrte sich nach Zuwendung und wollte das einzig Wichtige im Leben seiner Töchter sein – als würde sie das daran hindern, ihn zu verlassen. Nun, er schaffte es beinahe. Zumindest zum Teil war er ganz sicher dafür verantwortlich, dass Elizabeth kaum ein Sozialleben und so gut wie keinen Freundeskreis besaß. Sie war darauf konditioniert worden, sich zurückzuziehen, sobald Konversation gemacht wurde, denn sie wusste, dass sie für jede Minute, die sie unnötigerweise außerhalb des Farmhauses verbrachte, mit mürrischen Worten und missbilligenden Blicken bestraft wurde. Sich gleichzeitig um Saoirse zu kümmern und zur Schule zu gehen war ohnehin ein Vollzeitjob. Trotzdem warf ihr Vater ihr vor, sie sei genau wie ihre Mutter, sie halte sich für etwas Besseres und es sei wohl unter ihrer Würde, bei ihm in Baile na gCroíthe zu bleiben. Elizabeth fand die kleine Stadt beengend, und im Farmhaus herrschte eine düstere, leblose Atmosphäre. Als warte selbst die Großvateruhr in der Halle auf die Rückkehr ihrer Mutter.
»Und wo ist Luke?«, fragte Marie leise am Telefon, womit sie Elizabeth rasch wieder in die Gegenwart zurückholte.
Sie lachte bitter. »Glaubst du etwa, Saoirse würde ihn mitnehmen?«
Schweigen.
Elizabeth seufzte. »Er ist hier.«
›Freiheit‹ war für ihre Schwester mehr als ein Name. Es war ihre Identität. Ihr Lebensstil. Alles, was der Name repräsentierte, war ihr in Fleisch und Blut übergegangen. Sie war feurig, unabhängig, wild und frei. Sie folgte dem Muster der Mutter, die sie nie kennen gelernt hatte, so extrem, dass Elizabeth fast das Gefühl hatte, auf ihre Mutter aufzupassen. Aber immer wieder verlor sie ihre Schwester aus den Augen. Saoirse wurde mit sechzehn schwanger, und niemand wusste, wer der Vater war, am allerwenigsten Saoirse selbst. Als das Baby auf der Welt war, gab sie sich keine große Mühe, einen Namen für es zu finden, aber irgendwann fing sie an, den Kleinen Lucky zu rufen. Der Ausdruck eines Wunsches, genau wie bei ihrer Mutter. Sie wollte glücklich sein. Also gab Elizabeth ihm schließlich den Namen Luke. Als Elizabeth achtundzwanzig war, lastete auf ihr von neuem die Verantwortung für ein Kind.
Wenn Saoirse Luke anschaute, war in ihren Augen nie die Spur eines Erkennens zu entdecken. Es machte Elizabeth Angst, wenn sie sah, dass ihre Schwester keinerlei Beziehung zu ihrem Kind hatte – es bestand keine wie auch immer geartete Verbindung zwischen ihnen. Elizabeth hatte nie vorgehabt, Kinder in die Welt zu setzen, sie hatte sich sogar geschworen, niemals Kinder zu bekommen. Sie hatte sich und ihre Schwester alleine großgezogen und nicht das Bedürfnis, dies zu wiederholen. Es war Zeit, dass sie sich um sich selbst kümmerte. Mit achtundzwanzig hatte sie nach der Schufterei in der Schule und auf der Uni erfolgreich ihr eigenes Innenarchitekturbüro aufgezogen, und dank ihrer harten Arbeit war sie die Einzige in der Familie, die in der Lage war, Luke ein gutes Leben zu bieten. Sie hatte ihre Ziele erreicht, indem sie die Kontrolle behielt, für Ordnung sorgte, sich selbst nicht aus den Augen verlor, realistisch blieb, sich an Tatsachen orientierte, nicht in Träumereien verlor, und vor allem, indem sie sich unermüdlich abrackerte. Ihre Mutter und ihre Schwester hatten ihr mit ihrem Beispiel gezeigt, dass man nirgendwohin kam, wenn man wehmütigen Träumen nachging oder unrealistische Hoffnungen züchtete.
Jetzt war sie fünfunddreißig und lebte allein mit Luke in einem Haus, das sie liebte. Sie hatte es gekauft und zahlte es alleine ab. Ein Haus, das ihre Zuflucht war, ein Ort, an den sie sich zurückziehen und wo sie sich sicher fühlen konnte. Sie blieb allein, weil Liebe eins jener Gefühle war, die man nicht kontrollieren konnte. Und sie brauchte die Kontrolle. Sie hatte geliebt und war geliebt worden, sie hatte erlebt, wie es war, zu träumen und auf Wolken zu tanzen. Sie hatte auch erfahren, wie es war, wenn man mit einem dumpfen Schlag unsanft wieder auf der Erde landete. Und so hatte sie auch gelernt, nie mehr die Kontrolle über ihre Gefühle aufzugeben.
Die Haustür knallte zu, und sie hörte das Getrappel kleiner Füße, die durch die Halle sausten.
»Luke!«, rief sie und legte die Hand über den Hörer.
»Was’n?«, fragte er unschuldig, als seine blauen Augen und blonden Haare an der Tür erschienen.
»Es heißt Ja, bitte und nicht Was’n«, verbesserte sie ihn streng. In ihrer Stimme hörte man die Autorität, die sie sich in den letzten Jahren angeeignet hatte.
»Ja, bitte?«, wiederholte Luke brav.
»Was machst du denn?«
Luke trat vollends in die Halle, und Elizabeth bemerkte sofort die Grasflecken auf seinen Knien.
»Ich und Ivan spielen bloß mit dem Computer«, erklärte er.
»Ivan und ich«, korrigierte sie und hörte dabei weiter Marie zu, die ihr am anderen Ende der Leitung versprach, einen Streifenwagen loszuschicken, um Saoirse zu suchen. Luke sah seine Tante kurz an und ging zurück in sein Spielzimmer.
»Warte mal«, rief Elizabeth ins Telefon, als sie etwas zeitverzögert registrierte, was Luke gerade gesagt hatte. Sie sprang auf, knallte gegen das Tischbein und verschüttete den Espresso, der eine unschöne Pfütze auf dem Glas bildete. Sie fluchte. Die schwarzen gusseisernen Stuhlbeine kratzten über den Marmorfußboden. Das Telefon an die Brust gedrückt, rannte sie durch die lange Halle zum Spielzimmer. Dort streckte sie den Kopf durch die Tür und sah Luke auf dem Boden sitzen, die Augen gebannt auf den Bildschirm gerichtet. Das Spielzimmer und Lukes Schlafzimmer waren die einzigen Räume im Haus, wo Spielzeug erlaubt war. Dass sie sich um ein Kind kümmern musste, hatte Elizabeth längst nicht so verändert, wie manche es erwartet hatten. Luke hatte ihre Ansichten nicht weniger streng gemacht. Natürlich hatte sie, wenn sie Luke zu seinen Freunden brachte oder ihn dort abholte, zahlreiche Häuser gesehen, wo so viele Spielsachen herumlagen, dass jeder stolperte, der sich in die Nähe wagte. Widerwillig hatte sie mit Müttern Kaffee getrunken, umgeben von Flaschen, Babybrei und Windeln, einen Teddy unter dem Hintern. Aber in ihrem eigenen Haus hatte sie Edith gleich zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses die Regeln klargemacht, und Edith hatte sie befolgt. Während Luke größer wurde, stellte auch er sich auf ihre Art ein, respektierte ihre Wünsche und beschränkte seine Spiele auf das Zimmer, das sie seinen Bedürfnissen gewidmet hatte.
»Luke, wer ist Ivan?«, fragte Elizabeth, während sie mit den Augen das Zimmer absuchte. »Du weißt doch, dass du keine Fremden heimbringen darfst«, fügte sie besorgt hinzu.
»Er ist mein neuer Freund«, antwortete er wie ein Zombie, ohne die Augen von dem muskelbepackten Wrestler zu nehmen, der auf dem Bildschirm seinen Gegner vermöbelte.
»Du weißt, ich bestehe darauf, dass ich deine Freunde kennen lerne, ehe du sie mit nach Hause bringst. Wo ist Ivan?«, fragte sie, schob die Tür ein Stück weiter auf und betrat Lukes Zimmer. Sie hoffte nur, dass dieser Freund besser war als die letzte kleine Nervensäge, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, mit Textmarker ein Bild seiner glücklichen Familie an ihre Wand zu malen, das inzwischen glücklicherweise überstrichen war.
»Da drüben.« Luke nickte mit dem Kopf in Richtung Fenster, aber er nahm die Augen immer noch nicht vom Bildschirm.
Elizabeth ging zum Fenster und schaute in den Garten hinaus. Dann verschränkte sie die Arme und fragte: »Versteckt er sich?«
Luke drückte die Pausentaste und riss sich endlich von den Wrestlern auf dem Bildschirm los. Verwirrt verzog er das Gesicht. »Er sitzt doch direkt vor dir!«, sagte er und deutete auf den Sitzsack zu Elizabeths Füßen.
Mit großen Augen starrte Elizabeth auf den Sitzsack. »Wo?«
»Direkt vor dir!«, wiederholte Luke.
Elizabeth blinzelte ihn an. Dann hob sie ratlos die Arme.
»Neben dir, auf dem Sitzsack.« Lukes Stimme wurde lauter und nervös. Er starrte den Sitzsack an, als wolle er seinen Freund mit purer Willenskraft dazu bringen, in Erscheinung zu treten.
Elizabeth folgte seinem Blick.
»Siehst du ihn jetzt?« Er schob die Tastatur weg und stand schnell auf.
Angespanntes Schweigen trat ein. Elizabeth spürte Lukes Hass wie eine körperliche Berührung. Sie wusste, was er dachte: Warum kannst du meinen Freund nicht einfach sehen, warum kannst du nicht ausnahmsweise mal mitmachen, warum kannst du nie mit mir spielen? Aber sie schluckte den Kloß in ihrem Hals hinunter und blickte sich noch einmal um, ob ihr nicht doch etwas entgangen war. Aber da war nichts.
Sie ging in die Knie, um auf Augenhöhe mit ihm zu sein, und ihre Gelenke knackten. »Außer uns beiden ist niemand im Zimmer«, flüsterte sie. Irgendwie war es leichter, das leise zu sagen. Ob leichter für sie oder für Luke, das wusste sie allerdings nicht.
Lukes Wangen röteten sich, und seine Brust hob und senkte sich schneller. So stand er mitten im Zimmer, umgeben von den Kabeln der Tastatur, ließ die Schultern hängen und sah total hilflos aus. Elizabeths Herz hämmerte in ihrer Brust, bitte sei nicht wie deine Mutter, bitte sei nicht wie deine Mutter. Sie wusste nur zu gut, wie leicht die Welt der Fantasie einen in ihren Bann schlagen konnte.
Schließlich hielt Luke es nicht mehr aus und schrie in die Gegend: »Ivan, sag doch was zu ihr!«
Schweigen. Luke starrte weiter ins Nichts. Dann kicherte er hysterisch. Grinsend sah er Elizabeth an, aber sein Lächeln erstarb rasch, als er merkte, dass sie nicht reagierte. »Siehst du ihn echt nicht?«, fragte er ungläubig und setzte dann etwas ärgerlicher hinzu: »Warum siehst du ihn denn nicht?«
»Okay, okay.« Elizabeth kämpfte die in ihr aufsteigende Panik nieder. Sie stellte sich wieder aufrecht hin. Auf diesem Niveau hatte sie die Sache wieder unter Kontrolle. Sie konnte diesen Ivan nicht sehen, und ihr Gehirn weigerte sich, sie so tun zu lassen, als ob. Jetzt wollte sie nur noch so schnell wie möglich das Zimmer verlassen. Schon hob sie den Fuß, um über den Sitzsack zu steigen, überlegte es sich dann aber doch anders und ging lieber darum herum. An der Tür schaute sie ein letztes Mal zurück, um sich zu vergewissern, dass sie den geheimnisvollen Ivan nicht doch übersehen hatte. Aber nichts dergleichen.
Luke setzte sich achselzuckend wieder auf den Boden und machte mit seinem Spiel weiter.
»Ich schieb gleich eine Pizza in den Ofen, Luke.«
Schweigen. Was sollte sie sonst noch sagen? In Augenblicken wie diesem wurde ihr immer klar, dass alle Elternratgeber auf der ganzen Welt nichts nützten. Gute Elternschaft kam von Herzen, instinktiv, und nicht zum ersten Mal machte Elizabeth sich Sorgen, dass sie Luke nicht gerecht werden konnte.
»Sie ist in zwanzig Minuten fertig«, fügte sie unbeholfen hinzu.
»Was?« Luke drückte wieder auf Pause und schaute zum Fenster.
»Ich hab gesagt, die Pizza ist in ungefähr zwan…«
»Dich hab ich nicht gemeint«, entgegnete Luke und ließ sich wieder von der Welt der Videospiele aufsaugen. »Ivan möchte gern auch was. Er hat gesagt, Pizza ist sein Lieblingsessen.«
»Oh.« Elizabeth schluckte. Sie war ratlos.
»Mit Oliven«, fuhr Luke fort.
»Aber Luke, du hasst Oliven.«
»Ja, aber Ivan liebt sie. Er sagt, die mag er am liebsten.«
»Oh …«
»Danke«, sagte Luke zu seiner Tante, schaute zum Sitzsack, streckte den Daumen triumphierend nach oben, lächelte und sah dann wieder weg.
Langsam zog Elizabeth sich aus dem Spielzimmer zurück. Auf einmal merkte sie, dass sie noch immer das Telefon an ihre Brust drückte. »Marie, bist du noch dran?« Ratlos kaute sie an einem Fingernagel, starrte auf die geschlossene Tür zum Spielzimmer und überlegte, was sie tun sollte.
»Ich dachte schon, du wärst auch zum Mond geflogen. Fast hätte ich auch einen Streifenwagen zu deinem Haus geschickt«, kicherte Marie.
Da sie Elizabeths Schweigen als Ärger auslegte, entschuldigte sie sich schnell: »Aber du hattest Recht, Saoirse wollte wirklich zum Mond. Zum Glück hat sie unterwegs angehalten, um aufzutanken. Sich selbst natürlich. Man hat deinen Wagen auf der Hauptstraße gefunden, mit laufendem Motor, die Fahrertür weit aufgerissen. Er hat alles blockiert. Du kannst von Glück sagen, dass Paddy ihn entdeckt hat, ehe jemand einfach mit ihm davongesaust ist.«
»Lass mich raten – stand das Auto genau vor einem Pub?«, erkundigte sich Elizabeth, obwohl sie die Antwort genau kannte.
»Korrekt.« Marie hielt inne. »Möchtest du Anzeige erstatten?«
Elizabeth seufzte. »Nein danke, Marie.«
»Kein Problem, wir lassen das Auto zu dir bringen.«
»Was ist mit Saoirse?« Elizabeth wanderte in der Halle auf und ab. »Wo ist sie?«
»Wir behalten sie eine Weile hier, Elizabeth.«
»Ich hole sie ab«, sagte Elizabeth schnell.
»Nein«, widersprach Marie entschieden. »Ich melde mich wieder bei dir. Saoirse muss sich erst mal beruhigen, bevor sie irgendwohin geht.«
Aus dem Spielzimmer hörte man Lukes Stimme. Er lachte und plauderte munter mit sich selbst.
»Warte mal, Marie«, fügte Elizabeth mit schwacher Stimme hinzu. »Wenn wir schon mal dabei sind, dann sag bitte demjenigen, der das Auto herfährt, er soll gleich einen Psychologen mitbringen. Luke fängt nämlich an, sich Freunde einzubilden …«
Im Spielzimmer verdrehte Ivan die Augen und rutschte tiefer in den Sitzsack. Er hatte gehört, was Elizabeth am Telefon gesagt hatte. Seit er mit diesem Job angefangen hatte, behaupteten Eltern solche Dinge, und allmählich störte ihn das echt. Es war überhaupt nichts Eingebildetes an ihm.
Sie konnten ihn nur nicht sehen.
Drei
Es war echt nett von Luke, dass er mich an dem Tag damals zum Essen eingeladen hat. Als ich ihm sagte, dass Pizza mein Lieblingsessen ist, hatte ich eigentlich nicht vor, damit eine Einladung zu provozieren. Aber wie kann man so was Leckeres wie Pizza an einem Freitag ablehnen? Das ist doch ein Grund zum Doppelfeiern.
Nach dem Vorfall im Spielzimmer hatte ich den Eindruck, dass Lukes Tante mich nicht besonders mochte, aber das überraschte mich nicht, weil das meistens so geht. Eltern denken immer, es ist Verschwendung, für mich Essen zu machen, weil sie es am Schluss sowieso wegschmeißen müssen. Aber das ist ganz schwierig für mich – ich meine, versucht doch mal zu essen, wenn man euch kaum Platz lässt am Tisch und alle euch anstarren und sich fragen, ob das Essen auch wirklich vom Teller verschwindet. Irgendwann packt mich so der Verfolgungswahn, dass ich nichts mehr runterkriege und mein Essen stehen lassen muss.
Natürlich will ich mich nicht beklagen, es ist nett, zum Essen eingeladen zu werden, aber die Erwachsenen tun mir auch nie die gleiche Menge auf den Teller wie allen anderen. Normalerweise nicht mal die Hälfte, und dann sagen sie Sachen wie: »Oh, bestimmt ist Ivan heute nicht so hungrig.« Ich meine, woher wollen sie das denn wissen? Sie fragen ja nicht mal. Normalerweise werde ich zwischen meinen derzeit besten Freund und irgendeinen blöden großen Bruder oder eine doofe große Schwester gequetscht, die mein Essen klauen, wenn grade keiner guckt.
Meistens vergisst man auch, mir eine Serviette oder Besteck zu geben, und auch mit dem Wein ist man mir gegenüber alles andere als großzügig. (Manchmal stellt man mir auch einfach nur einen leeren Teller hin und sagt meinem besten Freund, unsichtbare Leute würden unsichtbares Essen essen. Also wirklich. Ich meine, schüttelt der unsichtbare Wind etwa unsichtbare Bäume?) Meistens kriege ich ein Glas Wasser, aber auch nur, wenn ich meinen Freund höflich darum bitte. Die Erwachsenen finden es schon sonderbar, wenn ich ein Glas Wasser zum Essen möchte, aber wenn ich dann auch noch Eiswürfel will, dann geht echt die Post ab. Ich meine, Eiswürfel gibt’s doch umsonst, und wer möchte an einem heißen Tag nicht gern was Kühles zu trinken?
Normalerweise sind es die Mütter, die sich mit mir unterhalten. Allerdings stellen sie Fragen und hören bei den Antworten nicht zu, oder sie tun so, als hätte ich etwas ganz anderes gesagt, nur wegen des Lacherfolgs. Wenn sie mit mir sprechen, dann glotzen sie mir auf den Brustkorb, als wäre ich nicht mal einen Meter groß. Das ist so ein Klischee. Damit das mal klar ist: Ich bin eins achtzig, und da, wo ich herkomme, spielt das Altersding keine Rolle – wir fangen an zu existieren und wachsen eher geistig als körperlich. Für das Wachstum ist das Gehirn verantwortlich. Sagen wir mal, mein Gehirn ist inzwischen ziemlich groß, aber es kann immer noch weiterwachsen. Ich mache meinen Job schon eine lange, lange Zeit, und ich mache ihn gut. Ich habe noch nie einen Freund im Stich gelassen.
Die Väter murmeln leise vor sich hin, wenn sie glauben, dass keiner mithört. Als ich mit Barry in den Sommerferien nach Waterford gefahren bin, lagen wir eines Tages beispielsweise mit seinem Vater am Strand von Brittas Bay, und da kam eine junge Frau im Bikini vorbei. »Na, wie wär’s denn damit, Ivan?«, meinte Barrys Papa ganz leise. Die Dads sind auch immer fest davon überzeugt, dass ich mit ihnen einer Meinung bin. Dann erzählen sie meinen besten Freunden Dinge wie: »Gemüse ist gesund, und ich soll dir von Ivan ausrichten, du sollst deinen Brokkoli aufessen«, und lauter so blödsinniges Zeug. Zum Glück wissen meine besten Freunde ganz genau, dass ich so was nie sagen würde.
Aber so sind halt die Erwachsenen.
Neunzehn Minuten und achtunddreißig Sekunden später rief Elizabeth Luke zum Essen. Mein Magen knurrte, und ich freute mich echt auf die Pizza. Also folgte ich Luke durch die lange Halle in die Küche und warf unterwegs einen Blick in die Zimmer, an denen wir vorbeikamen. Im Haus war es total still, und unsere Schritte machten ein richtiges Echo. Die Zimmer waren alle weiß oder beige gestrichen und so sauber und ordentlich, dass ich schon ganz nervös wurde wegen der Pizza. Ich wollte ja keine Sauerei machen. Soweit ich sehen konnte, gab es keine Anzeichen dafür, dass in diesem Haus ein Kind wohnte. Genau genommen gab es keine Anzeichen dafür, dass in diesem Haus überhaupt jemand wohnte. Keine Spur von Gemütlichkeit.
Aber die Küche gefiel mir. Sie war warm von der Sonne, und weil überall Glas war, hatte man das Gefühl, man würde im Garten sitzen. Wie bei einem Picknick. Ich sah, dass der Tisch für zwei Personen gedeckt war, also wartete ich erst mal ab, bis man mir sagte, wo ich mich hinsetzen sollte. Die Teller waren schwarz und glänzten, und die Sonne, die durch die Fenster hereinschien, brachte das Besteck zum Funkeln. Die beiden Kristallgläser malten einen Regenbogen auf den Tisch. In der Mitte standen eine Schüssel mit Salat und ein Krug Wasser mit Eis und Zitrone. Alles stand auf schwarzen Marmoruntersetzern. Als ich sah, wie das alles blitzte und blinkte, hatte ich schon Angst, auch nur die Servietten zu verschmieren.
Elizabeths Stuhlbeine scharrten über die Fliesen, als sie sich setzte und sich die Serviette auf den Schoß legte. Mir fiel auf, dass sie sich umgezogen hatte: Jetzt trug sie einen schokobraunen Jogginganzug, der zu ihren Haaren und ihrer Haut passte. Lukes Stuhl quietschte ein bisschen. Elizabeth nahm das große Salatbesteck und begann, sich Salatblätter und Kirschtomaten auf den Teller zu häufen. Luke sah ihr zu und runzelte die Stirn. Auf seinem Teller lag ein Stück Pizza Margherita. Ohne Oliven. Ich stopfte die Hände tief in die Taschen und trat nervös von einem Fuß auf den anderen.
»Stimmt irgendwas nicht, Luke?«, fragte Elizabeth, während sie sich Dressing über ihren Salat goss.
»Wo ist Ivans Platz?«
Elizabeth hielt inne, drehte den Deckel auf die Dressingflasche und stellte sie wieder auf die Mitte des Tischs. »Also, Luke, seien wir nicht albern«, sagte sie leichthin, aber sie konnte ihm dabei nicht in die Augen sehen.
»Ich bin nicht albern«, erwiderte Luke und runzelte seine Stirn noch mehr. »Du hast doch gesagt, dass Ivan zum Essen bleiben kann.«
»Ja, schon. Aber wo ist Ivan denn?« Sie bemühte sich, ihre Stimme nett klingen zu lassen, während sie geriebenen Käse über ihren Salat streute. Anscheinend wollte sie verhindern, dass die Sache sich zu einem Problem auswuchs. Sie wollte den Anfängen wehren und dem Gerede von unsichtbaren Freunden ein für alle Mal Einhalt gebieten.
»Er steht direkt neben dir.«
Elizabeth knallte Messer und Gabel so heftig auf den Tisch, dass Luke zusammenzuckte. Gerade als sie den Mund aufmachte, um ihn zu ermahnen, klingelte es an der Tür. Sobald sie das Zimmer verlassen hatte, stand Luke auf und nahm einen Teller aus dem Küchenschrank. Einen großen schwarzen Teller, genau wie die anderen beiden. Dann legte er ein Stück Pizza darauf, holte Besteck und eine Serviette und arrangierte alles auf einem dritten Platzdeckchen neben sich.
»Hier ist dein Platz, Ivan«, sagte er fröhlich und biss ein Stück von seiner Pizza ab. Ein bisschen geschmolzener Käse lief an seinem Kinn herunter. Es sah aus wie eine gelbe Schnur.
Ehrlich gesagt hätte ich mich nicht hingesetzt, wenn mein knurrender Magen nicht so eindringlich darauf bestanden hätte, dass ich etwas esse. Ich wusste ja, dass Elizabeth sauer werden würde, aber wenn ich die Pizza ganz schnell in mich reinstopfte, dann war ich fertig, wenn sie zurückkam, und sie würde nicht mal was merken.
»Möchtest du Oliven drauf?«, fragte Luke und wischte sich mit dem Ärmel über sein tomatiges Gesicht.
Ich lachte und nickte. Mir lief das Wasser im Mund zusammen.
In dem Moment, als Luke sich streckte, um die Oliven vom Regal zu angeln, trat Elizabeth wieder in die Küche.
»Was machst du denn da?«, wollte sie wissen und wühlte dabei suchend in einer Schublade herum.
»Ich hol die Oliven für Ivan«, erklärte Luke. »Er mag gern Oliven auf seiner Pizza, erinnerst du dich?«
Jetzt sah sie auf den Küchentisch und merkte natürlich sofort, dass er für drei gedeckt war. Müde rieb sie sich die Augen. »Hör mal, Luke, findest du nicht, dass es Verschwendung ist, wenn du Oliven auf die Pizza legst? Du hasst Oliven, und nachher muss ich sie bloß wegwerfen.«
»Nein, es ist keine Verschwendung, weil Ivan die Oliven ja gern isst, stimmt’s, Ivan?«
»Aber klar«, antwortete ich, leckte mir die Lippen und rieb meinen rumpelnden Bauch.
»Und?« Elizabeth zog eine Augenbraue hoch. »Was hat er gesagt?«
»Kannst du ihn auch nicht hören?«, fragte er stirnrunzelnd. Dann sah er mich an und ließ den Zeigefinger ein paar Mal über die Schläfe kreisen, womit er vermutlich andeuten wollte, dass seine Tante nicht ganz richtig tickte. »Er hat gesagt, dass er die Oliven natürlich alle aufisst.«
»Wie höflich von ihm«, murmelte Elizabeth, während sie weiter in der Schublade kramte. »Aber du solltest dafür sorgen, dass auch wirklich jeder Krümel verputzt wird, sonst isst Ivan heute zum letzten Mal mit uns.« Sie ging wieder aus der Küche.
»Keine Sorge, Elizabeth, ich werde das alles aufmampfen, garantiert«, versprach ich und nahm einen großen Bissen. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, nie mehr mit Luke und seiner Tante essen zu dürfen. Elizabeth hatte traurige Augen. Traurige braune Augen. Und ich war überzeugt, dass ich sie glücklich machen konnte, indem ich jeden Krümel verputzte. Deshalb beeilte ich mich mit dem Essen.
»Danke, Colm«, sagte Elizabeth müde und nahm dem Polizisten die Autoschlüssel ab. Langsam ging sie um den Wagen herum und inspizierte den Lack genau.
»Sieht aus, als wäre nichts kaputt«, meinte Colm, der sie beobachtete.
»Nicht am Auto jedenfalls«, versuchte sie zu scherzen und klopfte auf die Kühlerhaube. Ihr war das immer peinlich. Mindestens einmal pro Woche gab es irgendeinen Vorfall, bei dem die Polizei eingreifen musste, und obwohl die Polizisten die Situation nie anders als professionell und höflich behandelten, schämte sich Elizabeth trotzdem. Sie bemühte sich noch mehr als sonst, »normal« zu erscheinen, nur um zu beweisen, dass es nicht ihre Schuld und dass nicht jeder in dieser Familie verrückt war. Sie rieb die Schlammspritzer mit einem Papiertaschentuch sorgfältig ab.
Colm sah sie mit einem traurigen Lächeln an. »Sie ist verhaftet worden, Elizabeth.«
Elizabeth fuhr hoch. »Colm«, entgegnete sie schockiert. »Warum denn?« Das war noch nie vorgekommen. Bisher war Saoirse verwarnt und dann dort abgesetzt worden, wo sie eben gerade wohnte. Elizabeth wusste, dass das unprofessionell war, aber in einer Kleinstadt, wo jeder jeden kannte, hatten sie Saoirse einfach im Auge behalten und dafür gesorgt, dass sie nichts allzu Blödes anstellte. Aber jetzt hatte sie den Bogen anscheinend überspannt.
Nervös drehte Colm seine Garda-Mütze in den Händen. »Sie ist betrunken Auto gefahren, Elizabeth, in einem gestohlenen Wagen, und sie hat nicht mal einen Führerschein.«
Bei seinen Worten bekam Elizabeth eine Gänsehaut. Saoirse war gefährlich. Warum fühlte sich Elizabeth immer noch verpflichtet, sie zu beschützen? Wann würde sie endlich begreifen und auch akzeptieren, dass ihre Schwester niemals ein Engel werden würde, sosehr sie, Elizabeth, sich das auch wünschte?
»Aber das Auto war nicht gestohlen«, stammelte Elizabeth. »Ich hab ihr gesagt, sie k…«
»Nicht, Elizabeth.« Colms Stimme klang fest.
Sie musste sich den Mund zuhalten. Schließlich holte sie tief Luft, versuchte, die Nachricht zu verdauen und sich wieder in den Griff zu bekommen. »Muss sie vor Gericht?«, fragte sie, ihre Stimme nur ein Flüstern.
Verlegen sah Colm zu Boden und schob mit der Fußspitze ein Steinchen herum. »Ja. Inzwischen gefährdet sie ja nicht mehr nur sich selbst, sondern auch andere.«
Elizabeth schluckte schwer und nickte. »Nur noch eine Chance, Colm«, stieß sie kloßig hervor, während sie merkte, wie ihr Stolz verpuffte. »Geben Sie ihr noch eine Chance … bitte.« Vor allem das letzte Wort tat weh. Mit jedem Knochen in ihrem Körper flehte sie ihn an. Elizabeth bat nie um Hilfe. »Ich werde auf sie aufpassen, das verspreche ich Ihnen, ich werde sie keine Minute aus den Augen lassen. Sie wird sich bessern, ganz bestimmt, sie braucht nur ein bisschen Zeit.« Elizabeth spürte, wie ihre Stimme zitterte. Mit puddingweichen Knien bettelte sie für ihre Schwester.
Aber Colm antwortete ein bisschen traurig: »Es ist zu spät. Wir können es jetzt nicht mehr ändern.«
»Was für eine Strafe wird man ihr aufbrummen?« Elizabeth war übel.
»Das hängt alles davon ab, welcher Richter an dem Tag die Verhandlungen führt. Es ist ihr erster Gesetzesverstoß oder zumindest ihr erster, der bekannt geworden ist. Möglicherweise gibt es deshalb ein mildes Urteil, möglicherweise aber auch nicht.« Er zuckte die Achseln und blickte auf seine Hände hinunter. »Und es hängt auch davon ab, was der Polizist sagt, der Saoirse verhaftet hat.«
»Warum?«
»Wenn sie sich kooperativ verhalten und keinen Ärger gemacht hat, könnte das positiv bewertet werden. Vielleicht …«
»Vielleicht aber auch nicht«, ergänzte Elizabeth mit besorgter Stimme. »Und? Hat sie sich kooperativ verhalten?«
Colm lachte leise. »Na ja, zwei Leute mussten sie festhalten.«
»Verdammt!«, fluchte Elizabeth. »Wer hat sie denn festgenommen?« Sie knabberte nervös an den Nägeln.
Nach einer kurzen Pause antwortete Colm: »Ich.«