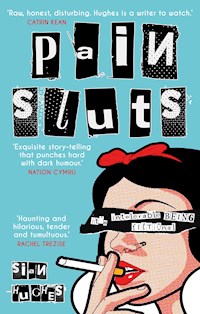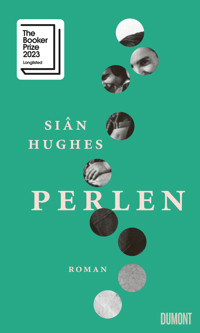
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Marianne ist acht Jahre alt, als ihre Mutter verschwindet. Sie bleibt mit ihrem Bruder und ihrem Vater in einem Haus am Rande eines kleinen Dorfes zurück, neben dem ein Fluss entspringt. Die bruchstückhaften Erinnerungen an die Liebe ihrer Mutter geben ihr Kraft: der Duft frischer Kräuter, die Spiele, die sie spielten, die Lieder und Märchen aus ihrer Kindheit. Doch da ist vieles, was verborgen liegt im Dunkel ihrer eigenen Geschichte. Die abwesende Mutter begleitet sie durch ihre gesamte Kindheit und Jugend, bleibt auch bei ihr, als sie längst erwachsen ist. Erst Jahre nachdem sie selbst eine Tochter bekommen hat, beginnt Marianne, sich auf die Spur ihrer Erinnerungen zu begeben, und stößt auf ein Geheimnis. ›Perlen‹ erzählt davon, wie es gelingen kann, trotz widriger Umstände den eigenen Weg zu finden. Ein zarter Roman, poetisch und unprätentiös zugleich, über das Wesen der Trauer und den Trost, den wir finden können, wenn es uns gelingt, uns mit der eigenen Vergangenheit auszusöhnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Marianne ist acht Jahre alt, als ihre Mutter verschwindet. Sie bleibt mit ihrem Bruder Joe und ihrem Vater in einem Haus mit verwildertem Garten am Rande eines kleinen Dorfes zurück. Die bruchstückhaften Erinnerungen an die Liebe ihrer Mutter geben ihr Kraft: der Duft frischer Kräuter, die Spiele, die sie spielten, die Lieder und Märchen aus ihrer Kindheit, die in Mariannes Fantasie weiterleben. Doch da ist so vieles, das verborgen liegt im Dunkel ihrer eigenen Geschichte. Die drängendste Frage: Warum ist ihre Mutter gegangen, wie hat sie Marianne nur zurücklassen können?
Die abwesende Mutter begleitet sie durch ihre gesamte Kindheit und Jugend, bleibt auch bei ihr, als sie längst erwachsen ist. Erst Jahre, nachdem sie selbst eine Tochter bekommen hat, beginnt Marianne, sich auf die Spur ihrer Erinnerungen zu begeben und stößt auf ein Geheimnis.
›Perlen‹ erzählt davon, wie es gelingen kann, trotz widriger Umstände den eigenen Weg zu finden. Ein zarter, poetischer Roman über das Wesen der Trauer und den Trost, den wir finden können, wenn es uns gelingt, uns mit der eigenen Vergangenheit auszusöhnen.
© Stretton Studios
Siân Hughes, geboren 1965, wuchs in dem kleinen Dorf in Cheshire auf, wo ›Perlen‹ auch spielt. Ihr Gedichtband ›The Missing‹ (2009) stand auf der Longlist des Guardian First Book Award. ›Perlen‹ ist ihr erster Roman, erschienen bei dem kleinen unabhängigen Verlag Indigo Press. Er wurde in England zum Überraschungserfolg, stand auf der Longlist für den Booker Prize und auf der Shortlist für den Author’s Club Best First Novel Award. Die Autorin besitzt und betreibt außerdem einen Buchladen.
Tanja Handels übersetzt aus dem Englischen, zuletzt u.a. Bernardine Evaristo, Zadie Smith und Toni Morrison. Für ihre Arbeit erhielt sie zahlreiche Preise und Stipendien, darunter den Preis der Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung.
Siân Hughes
PERLEN
Roman
Aus dem Englischenvon Tanja Handels
Die englische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel ›Pearl‹ bei The Indigo Press, London.
© SIÂN HUGHES 2023
E-Book 2025
© 2025 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag GmbH&Co.KG, Amsterdamer Straße 192, 50735 Köln, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne von §44bUrhG behalten wir uns explizit vor.
Übersetzung: Tanja Handels
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Ruth Botzenhardt – aus der Kollektion Rauschen
Satz: Fagott, Ffm
E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN E-Book 978-3-7558-1077-3
www.dumont-buchverlag.de
1
Kirmes
Adam and Eve and Pinch-Me
Went down to the river to bathe.
Adam and Eve were drowned
Who do you think was saved?
Immer wenn der Sommer zu Ende geht, fahre ich mit Susannah heim in mein Dorf, zu einer Art Kirmes, die dort nur The Wakes heißt. Es gibt einen Festumzug und ein paar Karussells. Auf dem Sportplatz wird ein ganzer Ochse am Spieß gebraten. Als ich klein war, wurde auch noch das sogenannte Kinderwagenrennen abgehalten. Den Regeln gemäß musste jede Mannschaft, bestehend aus zwei Männern, im Laufschritt einen Kinderwagen ins Nachbardorf und zurück befördern, der eine schob, der andere saß drin. Unterwegs mussten beide in jedem Pub an der Strecke ein Pint leeren. Und alle Teams waren als Mutter und Baby verkleidet: Ein Mann trug ein albernes altes Nachthemd, darunter Luftballons als Brüste, verschmierten Lippenstift und Lockenwickler im Haar, der andere war mit Lätzchen, Mützchen und einem Badetuch als Windel ausstaffiert.
Beim Start saß immer das Riesenbaby im Wagen und wurde von dem Mann mit Lockenwicklern und Lippenstift geschoben, aber um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben, mussten sie sich notgedrungen abwechseln, und daher tauschten sie nach dem ersten Halt, das Baby sprang aus dem Wagen, die Mutter sprang hinein, die Luftballons platzten, die Windel löste sich, und für die nächste Etappe schob das bärtige Baby die bärtige Mutter.
Mittlerweile gibt es kein Kinderwagenrennen mehr. Die Straßen sind zu stark befahren, darum hat die Polizei es untersagt.
Die Wakes finden schon sehr lange statt. Angefangen hat alles mit Binsenschneiden, und das wird auch heute noch gemacht. Früher, als die Böden aller Kirchen noch mit Binsen ausgelegt waren, wurden um diese Jahreszeit die alten Beläge entfernt und erneuert. Jetzt ist es so, dass wir die Gräber unserer Angehörigen mit Binsen schmücken. Wir fahren die Duckington Lane entlang und auf halber Strecke durch ein Tor hinter dem alten Tontauben-Schießplatz, um an einem der dortigen Tümpel nach Binsen zu suchen.
Dazu müssen wir unsere Gummistiefel anziehen. Ich hole die Gartenschere aus dem Kofferraum und lasse den Hund aus seiner Reisebox. Sofort nimmt er irgendeine Fährte auf und rennt hinter dem Tor wie verrückt im Kreis. Susannah sagt, nein danke, sie bleibe lieber im Wagen. Mit dreizehn macht ihr das Binsenschneiden nicht mehr so viel Spaß. Ich öffne die Tür zur Rückbank und biete ihr erneut an mitzukommen. Sie seufzt tief, sagt, ja, okay, wenn wir schon mal hier sind, dann legt sie ihr Smartphone weg und zieht ihre Stiefel an.
Die guten Binsen vorne am Rand haben schon andere abgeerntet. Von denen mit den schönen schwarzen Spitzen sind kaum noch welche übrig. Susannah ist so leicht, dass der sumpfige Untergrund sie trägt, und geht mitten hinein, um die wenigen verbliebenen Binsen abzuschneiden. Zurück im Wagen bekommt sie von mir die Aufgabe, sie mit Bändern zum Strauß zu flechten. Blau und lila dieses Jahr. Von zu Hause haben wir Lavendel- und Minzzweige aus dem Vorgarten mitgebracht, um sie dazwischenzustecken. Als Susannah mit dem Strauß fertig ist, duften ihre Hände und das ganze Auto danach.
Wir brauchen nur ein kleines Bündel. Das Grab, das wir schmücken wollen, ist nicht groß. Streng genommen ist es nicht einmal ein Grab. Es ist nur ein Gedenkstein und auch nicht an der Stelle, wo die Asche beigesetzt wurde. Susannah hat unsere Binsen wirklich schön geflochten. Ihre Großmutter wäre stolz auf sie. Von ihr hat sie die kleinen, kräftigen Hände und Füße, die rötlichen Lichter im Haar und die süße, leicht kratzige Singstimme.
Wir schaffen es gerade rechtzeitig zur traditionellen Wakes-Messe in die Kirche. Das ist so etwas wie ein gemeinschaftliches Totengedenken, zum Auftakt der Feierlichkeiten. Es werden die Namen aller verlesen, die in der Gemeinde begraben liegen. Einfach nur eine Auflistung von Namen. Das ist wunderschön, wie ein Gedicht oder eine Beschwörungsformel. Die ganzen alten Namen von den Grabsteinen draußen, all die Familien, die immer schon hier gelebt haben: Hewitt, Huxley, Leche, Proudlove, jemand aus ihrer Mitte, in dieser Gemeinde verstorben. Ich komme jedes Jahr wieder hierher und höre mir das an, obwohl die Namen derer, die zu meiner Familie gehört haben, nie in der Liste auftauchen.
Nach der Messe gehen wir mit unserem Binsenbündel hinter die Kirche, auf den Friedhof, wo schon etliche Familien Grabsteine schrubben, Vasen befüllen und Picknickdecken ausbreiten. Zu den Wakes kommen nämlich immer alle. Manche reisen von weit her an. Auch ich wohne nicht mehr hier, seit ich in Susannahs Alter war, aber ich komme jedes Mal.
Ich lege unsere Picknickdecke neben den Gedenkstein, packe die Sandwiches aus, die hart gekochten Eier und die kleinen Salz- und Pfefferstreuer. Ich habe Flapjacks mit dunklem Sirup gebacken, nach dem Rezept meiner Mutter. Das mache ich immer. Ich schaue den Menschen ringsum ins Gesicht, versuche, anhand der Namen auf den Grabsteinen neben ihnen herauszufinden, wer wer ist, suche in den Gesichtern ihrer Kinder nach Zügen, die ich noch aus Grundschulzeiten kenne.
An Auferstehung glaube ich nicht. Zumindest nicht richtig. Aber sollten die Toten wirklich einmal die Grasnarben beiseiteschieben und aus ihren Gräbern steigen, sich die Erde aus den Haaren schütteln und ins Sonnenlicht blinzeln, dann dürfte das auch nicht viel anders aussehen als so ein Wakes-Wochenende auf dem Friedhof von Tilston. Nur etwas voller vielleicht. Immer wenn der August zu Ende geht, sind wir Wiedergänger auf bunten Picknickdecken, sitzen an unseren Familiengräbern, sind auferstandener Leib unserer Vorfahren, samt Knochen und Blut, wir tragen ihre abgelegten schlechten Zähne und schwachen Achillessehnen auf und reichen Sandwiches und Kuchen herum.
Sollten die Toten auferstehen, ob sie dann wohl im selben Alter zurückkehren, in dem sie gestorben sind? Falls ja, wäre meine Mutter fein raus. Mein arthritisgeplagter Großonkel weniger.
Ich muss daran denken, wie Großonkel Matthew, dessen Gedenkstein, gleich neben dem, den wir gerade schmücken, praktisch ganz unter Flechten verschwunden ist, im Pflegeheim nach oben ging, um Mittagsschlaf zu halten, die knorrige Hand am Treppengeländer, immer nur eine Stufe auf einmal. Mit seinen geschwollenen Knien hätte der Ärmste es sicher schwer, aus dem Grab zu kommen. Wenn er die Treppe halb hinauf war, blieb er stehen und sagte: »Caesar se recipit in hiberna« (»So bezog Cäsar sein Winterquartier«), angeblich das Einzige, was ihm aus fünf Jahren Grammar School geblieben war. Ich glaubte lange, das hieße: »Ich mache dann jetzt mein Nickerchen«, bis ich es in der Uni-Bibliothek nachgeschlagen habe.
Von den anderen wollte keiner mit. Weder mein Vater noch mein Bruder. Das ist immer so. Wenn ich sage: »Aber zu den Wakes kommen alle zurück«, sieht mich mein Vater nur an, mit diesem langen traurigen Blick. Seit ich acht bin, erzählt er mir, dass meine Mutter nie mehr zurückkommt. Mittlerweile braucht er gar nichts mehr zu sagen: Ich weiß, was der Blick bedeutet. Aber falls doch, wo sonst würde sie uns suchen? Und wie sonst sollte sie mich erkennen, wenn nicht daran, dass ich beim Gedenkstein sitze und im Großen und Ganzen so aussehe wie sie vor dreißig Jahren? Wie sonst sollte ich sie erkennen?
Wenn sie plötzlich hier auf dem Friedhof stünde und nicht gleich wüsste, wer ich bin, würde ich ein Lied für sie singen. Ich würde ihr »Green Gravel« vorsingen. Manchmal singe ich es auch einfach so für sie, wenn ich Wäsche aufhänge oder abends allein im Auto sitze. Für mich ist es mein Lied, obwohl ich inzwischen erwachsen genug bin, um zu wissen, dass es um einiges älter ist als ich, um einiges älter auch als das Baby, für das meine Mutter es vor so vielen Jahren gesungen hat.
Green gravel, green gravel,
Your grass is so green,
The fairest young maiden
That ever was seen.
I’ll wash you in new milk
And wrap you in silk,
And write down your name
In a gold pen and ink.
Als Kind ahnte ich nicht, dass sie von einem Grab sang, von einem grünen Grab. Bei gravel dachte ich an Kies, wie er in der Einfahrt lag und bei schweren Regenfällen bis vor zur Straße gespült wurde. Und wer wird da überhaupt begraben? Die frische Milch muss für ein Neugeborenes gedacht sein, das schönste und reinste Geschöpf überhaupt, unberührt von auch nur einer Minute Leben. Die ganze Zeit, die ich glaubte, sie sänge es für mich, sang sie es für das andere Kind, dem er gehört, dieser schuhschachtelgroße Gedenkstein, auf dem nur ein einziges Datum steht, Geburts- und Todestag in einem.
Auch jetzt ertappe ich mich noch dabei, wie ich im Kopf ein Gespräch mit ihr anfange. Bei Susannahs Geburt sah ich mich nach ihr um, ich schaute auf vom nagelneuen Gesicht meiner Tochter und merkte, dass ich den Blick meiner Mutter suchte, der meinem begegnen würde und mit mir der Meinung wäre, Susannah sei in der Tat the fairest young maiden that ever was seen. Ich wartete darauf, dass sie in das Lied einstimmte. Weinend suchte ich überall nach ihr. Die Hebamme erkundigte sich, ob es in meiner Familie eine Vorgeschichte von Wochenbettpsychose gebe. Ich verneinte. Nur Trauer. Eine familiäre Vorgeschichte von Trauer. Auch die gibt man weiter. Wie das Immunsystem mit der Muttermilch. Wie ein Lied.
2
Wilbur und Charlotte
Cinderella, dressed in yella,
Went to a ball to kiss a fella,
By mistake, kissed a snake,
How many doctors did it take?
Was weiter passiert ist, nachdem ich der Hebamme das gesagt hatte, weiß ich nicht mehr. Ich sagte damals viel in der Art. Und war zu verwirrt, um mir zu merken, in welcher Reihenfolge alles ablief. Es kamen massenhaft Menschen, um auf mich einzureden. Die meisten waren nett. Ein paar hatten diese Miene, die ich noch aus der Schule und von der Polizei kannte, sie suchten die Sollbruchstelle in meinem Gesicht, das Falsche.
(Mit acht glaubte ich noch, sie würden in meinem Gesicht nach dem Grund suchen, aus dem meine Mutter verschwunden war. Dem einen Entsetzlichen, was mit mir nicht stimmte und sie veranlasst hatte, zur Tür hinauszugehen und nie mehr zurückzukommen. Als ich älter wurde, glaubte ich, sie suchten nach Ähnlichkeiten, nach einem Warnsignal, dass ich es ihr bald gleichtun würde.)
Nach ein paar solchen Besuchen sahen für mich alle gleich aus. Ich hörte kaum noch zu, wenn sie mit mir redeten. Susannah wurde immer properer und fröhlicher, und mit der Zeit färbte ihre Fröhlichkeit auf mich ab. Ich hatte die Aufgabe, ihr das Lächeln beizubringen. Da blieb mir nichts anderes übrig, als selbst zu lächeln.
Letztes Jahr, als Susannah mit einer Mandelentzündung zu Hause bleiben musste, kamen die Fragen zurück. In der Nacht hörte ich, dass sie auf war, und wollte ihr ein Glas Wasser bringen. Als ich in ihr Zimmer kam, hockte sie auf dem Boden und zerschnitt ihr Kopfkissen in kleine Schnipsel, die sie im Kreis um sich anordnete. Um ihren Kopf schwebte eine Wolke aus winzigen Daunenfedern, wie ein Heiligenschein.
»Was ist denn hier los?«, fragte ich und gab mir Mühe, normal zu klingen. Sie schnipselte weiter.
»Der mit den Locken ist seit Stunden hier, du drehst das Radio immer viel zu laut, und da kommt so was Komisches aus deinen Füßen.«
Ich fühlte ihr die Stirn. Mit vier hatte sie einmal wegen einer Mittelohrentzündung hohes Fieber gehabt und war dauernd aus dem Bett gesprungen, um im Zimmer Vögel einzufangen, aber diesmal war sie nicht besonders warm. Eher sogar etwas klamm, weil sie mitten in der Nacht auf dem Boden saß.
Mir zog es besagten Boden unter den Füßen weg, und ich erkannte das Gefühl, eine Erinnerung an meine Mutter tauchte auf, wie ich mit ihr in der Küche war, wie sie manchmal redete. Es war nur ein kurzer Moment. Ich wusste nicht genau, welche Erinnerung an meine Mutter da durch meine fantasierende Tochter heraufbeschworen wurde, aber es fühlte sich an, als würde unter meinen Füßen eine Schublade aufgezogen und dann schnell wieder zugeknallt, um mich an fast derselben neuralgischen Stelle einzuklemmen. Fast war es die richtige Stelle, aber doch nicht ganz.
Ich legte die Hand an den Türrahmen und konzentrierte mich mit aller Kraft auf dieses Stück lackiertes Holz, auf meine Erwachsenenhand mit Resten von Ölfarbe unter den Fingernägeln, auf die Farbe an den Wänden, die Susannah selbst ausgesucht hatte, dachte an den Namen der Farbe außen auf der Dose, Meeresbrise. Ich gab ihr das Wasserglas, dann ging ich nach unten, um den ärztlichen Notdienst anzurufen.
Diesmal war ich auf die Fragen vorbereitet. Als sie kamen, konnte ich ihnen in die Augen sehen und sagen: »Als ich acht Jahre alt war, ist meine Mutter einfach fortgegangen, sie wurde nie gefunden. Mein Bruder war noch ein Baby. Nein, eine Diagnose gab es nie, weil sie sich immer vor Ärzten versteckt hat. Sie hat sich vor allen versteckt. Mich hat sie zu Hause unterrichtet, weil … also, eigentlich weiß ich nicht, warum. Aber ja, es gibt eine Vorgeschichte. Von Wahn.« Diesmal nannte ich es anders. Wahn? Trauer? Ich meinte doch ein und dasselbe.
Als ich den Heimunterricht erwähnte, kam ich mir wie eine Verräterin vor. Und beantwortete die nächste Frage schon, bevor sie überhaupt jemand stellte. Warum? Warum hatte sie mich zu Hause behalten? Alle wollten ständig wissen, was mit ihr los gewesen war. Was hatte ihr solche Angst gemacht? Ich weiß es nicht. Das große Gebäude? Die Lehrkräfte? Die anderen Eltern? Aus dem Haus zu gehen? Nie hat mir jemand die Fragen gestellt, die ich eigentlich beantworten möchte. Was habt ihr denn den ganzen Tag gemacht? Was hat sie dir beigebracht? Wie war das für dich?
Sie hat mir den Fall Jerichos aus der King-James-Bibel vorgelesen, Alice im Wunderland und Sara, die kleine Prinzessin, wir ließen Stangenbohnen am Treppengeländer emporwuchern, bauten Insektenhotels aus Balsaholz, wir sangen sämtliche Strophen von »The Raggle Taggle Gypsies«, nähten Puppen aus Stoffresten und tauften sie später unten am Fluss, wir hielten Kaninchen und Entenküken, ernteten ganze Eimer voll Himbeeren und bauten Buntglasfenster aus Kuchenteig und Bonbonmasse.
Meine ersten Schulerfahrungen bestärkten mich in dem Verdacht, dass das Leben zu Hause besser war, und wenn jetzt jemand von mir wissen will, warum ich zu Hause unterrichtet wurde, sage ich: Weil meine Mutter das eben einfach richtig gut konnte. Und wie sich zeigte, sollte ich auch nicht allzu viel Zeit mit ihr haben, darum bin ich froh, dass wir all diese Tage gemeinsam verbringen konnten. Es gelang mir aber erst, als ich schon ein gutes Stück über dreißig und selbst Mutter war, das so zu betrachten, den Mut aufzubringen, auf diese Weise für sie einzustehen, und für mein Recht darauf, mich positiv an meine Mutter zu erinnern.
Wenn jemand sich das Leben nimmt, zieht diese Person nicht nur uns die Zukunft unter den Füßen weg, sie entweiht auch ihre eigene Vergangenheit. Das macht es sehr schwer, an dem festzuhalten, was diese Person Gutes an sich hatte. Aber kein Mensch hat es verdient, nach den schlimmsten fünf Minuten seines Lebens beurteilt zu werden, auch nicht, wenn diese fünf Minuten die letzten sind.
Wie oft wollte ich mit ihr reden, als Susannah klein war. Um ihr zu erzählen, dass Susannah ein neues Wort konnte, dass sie zum ersten Mal selbst ihre Jacke zugeknöpft oder ohne Hilfe ihre Schuhe angezogen hatte. Um sie irgendetwas Belangloses zu fragen, etwa: Glaubst du, ich kann Spinat in den Reisbrei tun? Oder schmeckt das dann eklig?
Auch jetzt würde ich mich oft noch gern an sie wenden. Es gibt ein anderes Wort dafür, möchte ich ihr sagen, und es ist überhaupt nicht nötig, ein ganzes Leben in so großer Angst zu verbringen. Du kannst Tabletten dagegen nehmen, dir einen Plan machen, um wieder gesund zu werden, dich an die zuständige Sozialarbeiterin wenden, und wenn du dann immer noch Engel auf der Treppe siehst, erzählst du das einfach der Therapeutin.
Es ist nicht deine Schuld, dass du krank warst, möchte ich ihr sagen. Ich habe dich so in Erinnerung, wie du gewesen bist. In deinen besten Zeiten. Ich erinnere mich an deinen Garten, an den langen Küchentisch, wo wir Kartoffeldrucke gemacht und Lebkuchenfiguren ausgestochen haben, und an die Fensterbank, auf der du mir Wilbur und Charlotte vorgelesen hast, um mich abzulenken, damit ich nicht an meinen Windpocken kratze.
Ich erinnere mich an den Text von »Green Gravel«. Ich erinnere mich an die Muster aus Salz, auf dem Boden verstreut, um den Teufel in Schach zu halten, an die Algen, die in Flaschen am Küchenfenster hingen, um böse Geister abzuwehren, an den Geschmack von Salzteig an meinen Fingern, den Geruch der Teerseife auf der Toilette unten, wie die Hintertür über die Beule im Steinboden schabte. Das alles verwahre ich sicher in mir. Verleibe es mir ganz ein. Ich weigere mich, auch nur etwas davon wieder herzugeben.
Das Haus war voller Geheimnisse: Viele Generationen von An- und Umbauten, Stufen zwischen den Zimmern, die mal aufwärts, mal abwärts führten, beharrlich eisige Ecken, mindestens vier verschiedene Fensterformen. Großonkel Matthew hatte meinen Eltern das baufällige Haus zur Hochzeit geschenkt, mitsamt der Scheune, die bis unters Dach mit seinen verworfenen Erfindungen vollstand, hauptsächlich Gartengeräte und andere Werkzeuge, die er für Menschen im Rollstuhl oder mit amputierten Gliedmaßen angepasst hatte.
Meine Mutter ließ das Haus außer acht und legte in einer Ecke des ummauerten Obstgartens perfekt symmetrische Kräuterbeete an, jedes einen knappen Quadratmeter groß. Sie hatte ihr Leben lang über einem Ladenlokal gewohnt: Vom Pflanzen und Züchten verstand sie nichts. Sie säte planlos, zu jeder Jahreszeit, und die Kräuterbeete durchmischten sich, sprossen oder verdorrten, wie sie lustig waren.
Als wir aus dem Garten meiner Mutter fortgingen, war er längst völlig verwildert. Die Erde braucht nie lange, um zurückzufordern, was ihr gehört. Wenn man Unkraut einfach als Pflanze am falschen Ort betrachtet, dann wurde in den Jahren, die wir dort im Haus auf ihre Rückkehr warteten, alles, was im Garten meiner Mutter wuchs, zu Unkraut. Vielleicht ist so ein Vorher-Nachher-Bild aber auch zu einfach. Vielleicht haben diese Pflanzen immer schon gemacht, was sie wollten, auch als sie noch von ihr betreut wurden.
Wir hatten nie vor, alles so verkommen zu lassen, die Wege versperrt von verrottenden Grashaufen, die Ränder der Beete dreckig und durchweicht. Aber wir gaben uns auch keine große Mühe, es zu verhindern. Wir ließen zu, dass die Äpfel von den Bäumen fielen und sich im Gras die Wespen darauf sammelten, und futterten stattdessen Süßkram aus großen Plastikpackungen, was sie entsetzlich gefunden hätte.
Wir kippten das Verbot, mit dem sie Fernsehen und Fast Food belegt hatte. Das kam uns wie eine Mutprobe vor. Eine Art böser Zauber, um sie zurückzuholen, fuchsteufelswild und bereit, alles wieder in Ordnung zu bringen. Und es war auch Ausdruck meiner eigenen Wut, Nachthemden mit Disney-Figuren zu tragen, mit Plastikponys samt Regenbogenmähne zu spielen und im Auto in der Einfahrt Fish and Chips zu futtern, weil wir uns nicht aufraffen konnten, damit im Regen durch den Vorgarten bis zum Haus zu laufen.
Wir versäumten, Joe von ihr zu erzählen. Wir sangen ihm Lieder aus der Fernsehwerbung vor und ließen König der Löwen in Dauerschleife laufen. Wir versäumten, ihn so großzuziehen, wie sie es gewollt hätte. Als wir ihm das Sprechen beibrachten, war sie die Vokabel, die wir wegließen. Er war unser sicherer Hafen, unser unbeschriebenes Blatt, der Kobold, der uns vergessen ließ, und wir hielten ihn wie einen Schutzschild zwischen uns und die Welt. Mittlerweile habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich gar nicht erst versucht habe, sie ihm im Gedächtnis zu halten.
Als wir dann doch wieder anfingen, von ihr zu sprechen, war die Lücke, die wir gelassen hatten, schon zu groß. Unsere Geschichten deckten sich nicht mehr ganz, und niemand konnte sagen, welche Version die richtige war. Ich weiß längst nicht mehr, was eine Erinnerung an sie ist und was eine Erinnerung an die Erzählungen anderer.
Die Windpocken hatte ich erst, als ich schon zur Schule ging, was ja auch einleuchtet. Wo hätte ich sie mir sonst einfangen sollen? Aber wer hat mir dann auf der Fensterbank Wilbur und Charlotte vorgelesen und mir die schlimmen schorfigen Hände vom Gesicht weggehalten? Hatte mein Vater sich freigenommen? Oder war es eine unserer Babysitterinnen? Saß ich überhaupt auf dieser Fensterbank? Ich kann mich an ein Polster mit blauem Weidenmuster erinnern. Mein Vater sagt, er wüsste nicht, dass es im alten Haus überhaupt irgendwo blaues Weidenmuster gegeben hätte. Er glaubt, die Polster auf den Fensterbänken seien aus Samt gewesen.
Sogar die Erinnerung an das Lied »The Raggle Taggle Gypsies« ist umstritten. Ich weiß genau, dass ich es nachgespielt habe, quer durch den Garten davongelaufen bin, mein Baumstumpfpferd geritten und mich ins lange Gras geworfen habe, um die letzte Zeile der Strophe zu illustrieren: »Tonight I’ll lie in a wide open field along with the raggle taggle gypsies-oh!«
Auch an die Zeile »Oh what care I for my high-heeled shoes, a-made of Spanish leather-oh!« erinnere ich mich. Ich erinnere mich, ein Paar solcher Schuhe aus dem Schrank meiner Mutter geholt und sie ins Kartoffelbeet geworfen zu haben, und später musste ich dann wieder nach draußen und sie mit der Taschenlampe suchen. Aber mein Vater sagt, sie hätte nie Schuhe mit hohen Absätzen besessen. Und wieso hätte sie mich abends im Dunkeln nach draußen schicken sollen, um ihre Schuhe zu suchen? Wo hätte sie denn hingewollt? Das ist alles Unsinn.
Ich weiß ja, wie unsinnig es ist. Eine frischgebackene Mutter, die ihr Baby im Körbchen schlafen lässt, zur Küchentür hinausgeht und nie wiederkommt. Sich nicht einmal die Zeit nimmt, die Tür hinter sich zuzuziehen.
Ich beanspruche alles für mich, was ich aus der Zeit davor hinüberretten kann. Auch noch, wenn jemand behauptet, dass bestimmte Einzelheiten falsch oder falsch angeordnet sind. Trotzdem gehören sie mir. Blaues Weidenmuster auf den Fensterbankpolstern. Wilbur und Charlotte. Lebkuchenfiguren mit Korinthenknöpfen. Stangenbohnen am Treppengeländer. Ins Kartoffelbeet geworfene Schuhe mit hohen Absätzen, mein Ritt auf dem Baumstumpfpferd.
Der Duft der Hände meiner Mutter, minzig, blättrig, wenn sie mich abends ins Bett brachte und mich noch ein bisschen neckte: »Oh what care I for my goose-feather bed, with the sheets turned down so bravely-oh!« Mein ganzes Leben lang habe ich jedes Laken genau so wacker-oh festgesteckt. Im Lauf der Jahre habe ich manches wackere Laken aufgeschüttelt, manche wackere Ecke glatt gezogen, und ihre Stimme, ihr Singen hat mich dabei begleitet. Ich musste ziemlich oft wacker sein.
3
Neun Perlen auf einmal
One, two, three, four, five, six, seven,
All good children go to heaven.
Penny on the water,
Tuppence on the sea,
Thruppence on the railway,
Out goes SHE!
Einen Ort gibt es, an dem ich meine Mutter deutlich vor mir sehe und mir sicher sein kann, dass es ein Bild aus meinem Kopf ist: den Obstgarten. Da sitzt sie unter einem Apfelbaum, im Schatten, der sie scharf konturiert umgibt, wodurch ich weiß, dass es Sommer sein muss. Ihr Küchenstuhl steht dicht an den Baumstamm geschmiegt, und sie hat den rot-goldenen Bastbeutel mit ihrem Nähzeug neben sich. Sie näht Namensschildchen in graue Schuluniformen.
Ich bespitzele sie vom Kräuterbeet aus. Dort wächst eine Art Wolfsmilchpflanze. Die Samenkapseln erwärmen sich in der Sonne, spannen sich und werden zusehends dünner, bis sie schließlich platzen und ihre Samen im Schwall hervorschleudern. Zwischen zweien dieser Kapseln habe ich ein Rennen ausgerufen und wette darauf, dass die gleich neben mir als Erste platzt.
Ganz in der Nähe meiner Mutter liegt eine Decke ausgebreitet, darauf ein paar Teller. Ich habe mir einen Löffel Marmelade mit auf meinen Posten genommen und schlecke ihn ab. Meine Mutter sagt: »Den steckst du aber nicht mehr ins Glas, Marianne, jetzt, wo du ihn abgeleckt hast.« Ich glaubte damals fest daran, dass meine Mutter übermenschliche Seh- und Hörkräfte besaß. Sie bestärkte mich in dem Glauben. Vor allem, wenn ich irgendetwas naschte.
Auf dem Boden stapeln sich graue Trägerkleider, rote Pullis und Schulhemden mit Rundkragen, in die sie bereits meinen Namen eingenäht hat. Wenn ich brav bin, lässt sie mich nachher mit den überzähligen Schildchen spielen: Durch die schwungvolle rote Schreibschrift geben sie beim Krankenhausspielen hervorragende Verbände für meine Puppen ab. Die Lücken lassen sich mit kleinen Filzstiftpunkten auffüllen, und das wirkt richtig schön blutrünstig.
Es kann jeder beliebige Sommer zwischen meinem vierten und achten Geburtstag sein. Ich vermute, es ist das Jahr, in dem ich sieben bin und Harriet, die kleine Detektivin gelesen habe – in dem Sommer habe ich meine Eltern oft vom Wolfsmilchbeet aus bespitzelt. Alle Jahre wieder tauchten die Uniformkleider in einer großen grünen Plastiktüte auf, alle Jahre wieder saß meine Mutter im Garten und nähte meinen Namen hinein, und anschließend wurden sie in den Schrank auf dem Treppenabsatz gehängt, bereit für den kommenden September. Manchmal durfte ich die komplette Uniform anziehen und darin vor meinem Vater herumstolzieren. Aber zur Schule ging ich nie.
Alle Jahre wieder kam dann der Geburtstag meines Vaters Mitte September, und ich war immer noch zu Hause. Einmal fragte ich doch, ob ich nicht zur Schule dürfe. Daraufhin wurde ich zum Spielen zu einer Nachbarsfamilie geschickt, deren Tochter Pippa auf die Dorfschule ging. Sie hatte ein besonderes Zimmer, das sogenannte Spielzimmer, und besaß sechs spindeldürre Puppen mit langen, verfilzten Haaren und endlos vielen Kleidern. Vor allem die Schuhe beeindruckten mich. Keine meiner Puppen hatte Schuhe. Ich fragte Pippa, wie ihre Eltern hießen. Sie fragte: »Wer?«
»Deine Eltern, deine Mum und dein Dad. Wie heißen die?«
Sie sah mich verständnislos an. Dann sagte sie: »Die haben keine Namen. Nur Mummy und Daddy.« Ich lachte laut los.
»Aber was war denn, als sie Kinder waren? Sie müssen doch Namen gehabt haben, auch schon als Babys!« Wieder schaute sie verständnislos.
Als meine Mutter mich abholen kam, war Pippa immer noch sauer auf mich. Im Auto, auf der Fahrt nach Hause, fragte mein Vater, ob ich denn mit Pippa in die Schule wolle. Ich sagte: »Eine gute Gesprächspartnerin ist sie ja nicht, aber ihre Puppen sind wirklich hübsch.« Meine Eltern wechselten einen langen Blick. Ich wusste, das hieß, ich würde nicht in die Schule gehen. Es hatte wohl etwas mit dem Wort »Gesprächspartnerin« zu tun. Als ich am nächsten Tag nachsehen ging, war der Schrank mit den Uniformen wieder leer.
Ich weiß nicht, was mit all den Schulkleidern passiert ist. Sie können sie ja schlecht in den Laden zurückgebracht haben, nachdem überall mein Name eingenäht war. Als ich schließlich doch in die Schule geschickt wurde, zur völlig falschen Jahreszeit und ohne viel Aufhebens, weil kein Mensch wusste, was sonst mit mir anzufangen wäre, konnten wir nirgends auch nur ein weißes Söckchen oder eine rote Strickjacke auftreiben. Der Schrank auf dem Treppenabsatz lag mit Bettwäsche, Handtüchern und aussortierten Babysachen voll. Auch mein Vater war ratlos. Wo hatte sie die Sachen bloß versteckt? Sie hatte doch gar keinen Führerschein. Wie hätte sie sie zum Wohlfahrtsladen bringen sollen? Hatte sie sie etwa verbrannt?
So musste ich hin, wie ich war, mitten in der Woche, mitten im Schulhalbjahr, in meiner knallgrünen Cordhose mit den rosa Herzchenflicken auf den Knien und meinem selbst gestrickten Pulli, an dessen Ärmeln viele Reihen bunter Perlen hingen. Als wir das Büro der Direktorin verließen, wo mein Vater versucht hatte, alle Formulare auszufüllen, während Joe brüllte und dauernd seinen Schnuller ausspuckte, war die Mathestunde schon halb um. Ich ging hinter der Direktorin ins Klassenzimmer und blieb vor dem Lehrerpult stehen. Sofort hörten alle auf zu reden.
Die anderen Kinder starrten mich an. Ich wusste genau, warum sie starrten. Sie fragten sich wohl, was mit mir nicht stimmte. Das fragte ich mich ja selbst. Ich sah ihnen an, dass sie sich diese Frage wegen meiner komischen Kleider stellten und wegen meiner Zöpfe, aus denen sich schon die Strähnen lösten, weil mein Vater sie nicht richtig fest flechten konnte. Auch die Lehrerin sah das. Als sie dann auch noch sagte: »So einen tollen Pulli hätten wir sicher alle gern, Marie«, war ich mir sicher, dass etwas an mir schlecht sein musste. So schlecht, dass man mir sogar den Namen kürzte, und mein Pulli war vollkommen verkehrt. Ich sagte ihr nicht einmal, wie ich richtig hieß.
Sie meinte, nachdem ich schon so viel verpasst hätte, weil ich erst jetzt in die Schule käme, solle ich mich lieber zu den jüngeren Kindern setzen. Ich überragte die anderen Kinder an meinem Tisch, eine linkische Riesin in kunterbunten Klamotten, und stellte fest, dass auch unter ihnen keine guten Gesprächspartner zu finden waren. Ich begriff sofort, dass man hier nur überleben konnte, wenn man unsichtbar war, und wenn man stattdessen mehr als einen Kopf größer war als alle anderen am Tisch, einen so langen Namen hatte, dass die Lehrerin zu faul war, ihn ganz auszusprechen, und Perlen an den Pulloverärmeln, die ständig an die Tischplatte klimperten und klackerten, dann war das einfach nur schlecht, schlecht, schlecht.
Bestimmt hätte ich auch nicht lange an diesem Kleinkindertisch sitzen müssen, an dem ich mir von unten die Knie stieß, wenn ich nicht das Lesen verlernt hätte. Ich erinnerte mich an alles, was ich gelesen hatte, bevor sie fortgegangen war. Das Kindergeschichtsbuch aus der Ladybird-Reihe, das von Elizabeth Fry und den Gefängnissen handelte, konnte ich praktisch auswendig. Auch den Straßenjungen Smith aus dem Buch von Leon Garfield und seine vielen Kleiderschichten, die sich auf seiner Haut abmalten, weil er nichts davon jemals auszog, hätte ich ganz genau beschreiben können. Ich begriff beim besten Willen nicht, warum die Wörter auf den Blättern, die ich in der Schule ausgeteilt bekam, für mich keinerlei Sinn ergaben. War das vielleicht ein Trick?
Ich sagte, ich könne nur Englisch lesen, wie in den Büchern zu Hause. Ob ich stattdessen die mitbringen dürfe? Auch als sich längst gezeigt hatte, dass sie dort in der Schule kein grausames Spiel mit mir trieben, sondern mein eigener Kopf mir das antat, konnte ich das Misstrauen ihnen gegenüber nie wieder ablegen. Ich musterte sie weiterhin argwöhnisch unter meinen viel zu langen Ponyfransen und murmelte Zaubersprüche, um mich vor ihrer Missbilligung zu bewahren.
Zum ersten Mal wurde mir außerdem klar, dass in meiner Familie niemand ein Wort von dem begreifen würde, was ich über all das zu erzählen hatte. Mit der Ankunft in der Schule war ich auf mich selbst gestellt. Ich lernte, achselzuckend zu sagen, es sei schon okay, ja, doch, und dass ich mich nicht erinnern könne, was ich gegessen oder gelesen hatte oder was wir gerade durchnahmen. Das alles überstieg ihren Horizont.
Ich musste lernen aufzuzeigen, wenn ich etwas wollte. Um das zu üben, zeigte ich oft auf, hatte dann aber nichts oder zumindest nichts Konkretes zu sagen. Also sagte ich, ich müsse auf die Toilette. Die Toiletten lagen im Trakt hinter dem Hauptgebäude, den man über zwei Betonstufen erreichte. Alle Kabinen hatten riesige grüne Holztüren und schwere Riegel, in denen ich mir die Finger einklemmte. Ich saß da, bis mein Po vor Kälte ganz taub war, und wartete, bis die Lehrerin »jemand Vernünftiges« schickte, um mich zu holen.
Während ich dort hockte, zerkaute ich die Perlenschnüre an meinen Ärmeln, und sobald ein Faden unter meinen Zähnen riss, schluckte ich die Perlen in Neunergruppen, zählte sie mit der Zunge am Gaumen ab. Manchmal saß ich so lange dort, dass die Perlen vom Vortag am anderen Ende wieder herauskamen, von Kot umhüllt, und ich sah mir an, wie sie weggespült wurden.
Nachdem ich die erste Schnur zerbissen hatte, war ich in Sorge, was meine Mutter wohl sagen würde, wenn sie wieder nach Hause kam und sah, dass ich meinen Pulli kaputt gemacht hatte. Den ganzen letzten Winter über hatte sie ihn für mich gestrickt, damit ich nicht eifersüchtig würde wegen der vielen Sachen, die sie für das Baby nähte. Wir hatten uns zusammen in unsere Lieblingssofaecke gekuschelt, und ich half ihr, die Perlen in einer zur Sortierschachtel umfunktionierten Rice-Krispies-Packung zu Neunergruppen zu ordnen. Dann wieder dachte ich, wenn sie den Pulli sah, würde ihr klar werden, wie schlimm ich es in der Schule fand, und ich müsste nicht mehr hin. Ich würde die Rice-Krispies-Sortierschachtel holen, und wir würden uns zusammen hinsetzen und alles wieder so perfekt annähen, dass keine Spur mehr blieb von der Zeit, die wir getrennt gewesen waren.
Aber dann verschwand die nächste kleine Schlinge aus neun Perlen im Abfluss und danach die nächste, und sie war immer noch nicht zurück, um es zu reparieren. Je mehr vom Bündchen verschwand, desto mehr riffelte sich der ganze Ärmel auf, in langen Streifen, bis zum Ellbogen. Da wusste ich, dass ich eine schlechte Tochter war. Ich hatte den tollen Pulli kaputt gemacht, den sie extra für mich gestrickt hatte, und einen neuen würde es nie wieder geben. Weil sie nie wieder zurück nach Hause käme.
4
Ein trockengekochter Wasserkessel
Oh dear me
Mother caught a flea
Put it in the teapot
To make a cup of tea.
The flea jumped out
And made her shout
In came Daddy
With his shirt hanging out.
Ich kann den Zeitpunkt genau festmachen, von dem an die Polizei nicht mehr nach einer Vermissten suchte, sondern nach einer Toten. Einer Toten, die inzwischen wohl bis zur Unkenntlichkeit entstellt sein musste. Es war der Tag, von dem an sie meinem Vater am Telefon nicht mehr sagten, sie hätten »jemanden« gefunden, sondern stattdessen »etwas«. Etwas im Wald. Etwas im Fluss. Etwas.
Dann begleitete er sie, um sich anzuschauen, was sie da gefunden hatten. Lindsey kam, um auf uns aufzupassen, manchmal kam auch ihre Schwester Mel oder, wenn es schon spät war, beide zusammen, weil sie sich, wie sie sagten, bei uns im Haus gruselten. Sie brachten Kuchen mit oder kunterbunte Kekse aus dem Supermarkt, kochten mir heiße Schokolade und erlaubten mir, lange aufzubleiben und Fernsehserien zu schauen, in denen Ermittler vorkamen. Jahrelang war ich der festen Überzeugung, das wäre Absicht. Edward verschwand mit der Polizei, und ich sollte Serien gucken, in denen ein Ermittler jeden Fall löste. Erst sehr viel später kam ich auf den Gedanken, dass sie so was einfach selbst jeden Abend schauten. Dass solche Sendungen eben im Fernsehen liefen, wenn ich normalerweise schon schlief.
Kam Edward dann nach Hause, schüttelte er nur den Kopf, und alle schwiegen. Heute sagt er, es tue ihm leid um all die vielen Male, die er dort gewesen und mit anderen Angehörigen zusammengetroffen sei, anderen Ehemännern, Ehefrauen, Eltern oder erwachsenen Kindern, die alle kamen, um nachzusehen, ob es sich bei dem Etwas um das handelte, auf das sie warteten. Es tue ihm leid, dass er sie alle wieder ziehen gelassen habe, ohne mit ihnen zu reden, sie nach ihrer Anschrift zu fragen, ihnen zu versprechen, Kontakt zu halten, und dann auch wirklich nachzufragen, haben Sie sie gefunden? Haben Sie ihn gefunden? Eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Sich jedes Jahr zum Picknick zu treffen. Aber das hat er nicht getan. Etwas hielt ihn immer davon ab, ihrem Blick zu begegnen und sie zu fragen: Wer ist es bei Ihnen? Und etwas hielt auch sie davon ab, seinem Blick zu begegnen und ihm dieselbe Frage zu stellen.
Auch ich hätte gern gehabt, dass er mir ihre Geschichten mitbrachte, wenn er wiederkam. Geschichten darüber, warum sie dort waren, nach wem sie suchten, wer in ihrem Leben fehlte. Ich wollte wissen, wie ihnen dieser Mensch abhandengekommen war. Waren sie zusammen zum Einkaufen gefahren und hatten sich auf dem Parkplatz verloren? Waren sie in den Ferien gewesen, und es war am Strand passiert? Oder hatten sie die vermisste Person zu Hause verloren, so wie wir? Trug sie ihren Mantel oder nur einen Pulli? Hatte sie Gepäck mitgenommen? Geld dabei gehabt? Wollte sie vielleicht irgendwohin?
Ich sammelte solche Geschichten über Verlust, Verlassenwerden, Scham. Der Erste, der mir eine ordentliche Geschichte über ein Verschwinden präsentierte, war Susannahs Vater. Soweit ich mich erinnere, war ich längst in ihn verliebt, als er mir vom Verschwinden seiner Mutter erzählte. Vielleicht sandte er ja irgendein Signal aus, für das mein Radar empfänglich war, trug ein Abzeichen des Verlassenseins. Auch seine Mutter war fortgegangen, und als er wissen wollte, wann sie denn wiederkäme, öffnete sein Vater die großen Kleiderschränke im Schlafzimmer. Sie waren leer. »Hier hatte sie ihre ganzen Kleider«, sagte der Vater. »Ich gehe also mal davon aus, sie kommt nicht mehr zurück.« Die große Enthüllung. Die wenigen verbliebenen Kleiderbügel, die leise aneinanderklirrten, während die Türen weit offen standen. Nur noch Holzgeruch, sonst nichts. Er war damals genauso alt gewesen wie ich, als meine Mutter fortging. Er hatte ihr Verschwinden sehr genau in Erinnerung. Zwar nicht den Moment, in dem sie aufbrach, aber doch den, als er davon erfuhr. Ich hatte nichts. Ich muss gestehen, manchmal war ich in Versuchung, mir seine Version auszuborgen. Sie war so viel besser als meine.
Woran erinnere ich mich? Ich weiß noch, wie die Polizei zu uns ins Haus kam. Der ältere Polizist sprach mit Edward, der jüngere saß am Küchentisch und besah sich seine Hände. Am Hals hatte er einen pickligen Streifen, wo der Kragen ihm an der Haut scheuerte. Ich stand hinter seinem Stuhl am Herd und überlegte, wie man wohl Wasser kocht. Ich hatte noch nie Wasser gekocht. Ich durfte gar nicht an den Herd. Aber ich wusste, dass man das machen musste, wenn Besuch kam und am Küchentisch saß, als würde er auf irgendetwas warten.
Joe lag in seinem Tragekorb auf dem Küchenboden und brüllte. Ich durfte ihn nicht allein herausnehmen. Das war eine sehr viel strengere Vorschrift als die mit dem Wasser. Im Grunde hatte mir nie jemand ausdrücklich verboten, Wasser aufzusetzen. Dazu gab es ja auch keinen Anlass. Aber die Regeln rund um das Baby waren sehr klar. Ich durfte ihm das Gesicht streicheln, versuchen, ihn mit einem Spielzeug oder einer Rassel abzulenken. Ich durfte ihm etwas vorsingen, seine Hand halten. Aber hochheben durfte ich ihn nicht.
Der Küchenboden bestand aus riesigen, unebenen Steinplatten. Wenn Joe zu schreien anfing, während meine Mutter gerade im Bad oder irgendwo oben war, im Garten Wäsche aufhängte oder draußen in der Diele telefonierte, dann durfte ich ihn unter gar keinen Umständen auf den Arm nehmen. In seinem Körbchen ist er in Sicherheit. Schreien schadet ihm längst nicht so sehr, wie ihm der Steinboden schaden kann. Gib ihm bloß Küsschen auf die Füße, damit du ihn nicht mit einem Schnupfen ansteckst. Die Wickelmatte kommt immer auf den Boden, nie auf den Tisch. Steck ihm nichts in den Mund, sonst verschluckt er es noch. Wasch dir immer mit Seife die Hände.
Also hockte ich mich neben sein Körbchen, während er brüllte, versuchte, ihm etwas vorzusingen, ihm durch den Strampelanzug Küsschen auf die Füße zu geben und Kuckuck!