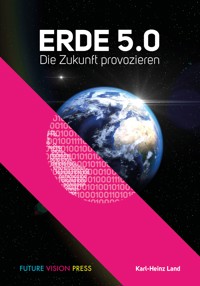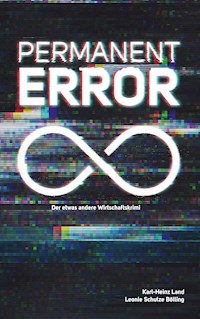
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch erfüllt womöglich die unscharfen Kriterien eines Romans und hat den Spannungsbogen eines Krimis. Doch beide Gattungen kämen dem gewissermaßen zu kurz, wie wir finden. Daher haben wir beschlossen, ein neuartiges Terrain der Literatur zu betreten. Wir bezeichnen diese Geschichte als einen unterhaltsamen und aufklärenden Inspirationskrimi. Die fiktive Geschichte von Michael Baker basiert auf wahren Ereignissen. Er ist Wirtschaftsjournalist und bekannt für seine unbändige Neugierde und unkonventionelle Perspektive auf die Welt. Ein Freund bittet ihn um Hilfe und wird kurz darauf tot in einem Müllcontainer am Wolfsburger Kunstmuseum aufgefunden. Michael steht plötzlich selbst unter Mordverdacht und gerät immer tiefer hinein in die Machenschaften von Konzernen, Politikern und Wirtschaftskriminellen auf internationalem Parkett. Er soll dabei helfen, einen im Zuge des Abgasskandal verurteilten VW-Manager zu rächen. Seine Recherchen führen ihn von Wolfsburg nach Brasilien, in die Gefilde der Regenwald-Mafia, über Amerika bis nach Russland auf die Spuren der Ölindustrie. Er erfährt von den wahren Hintergründen der Diesel-Affäre und versteht nach und nach, wie auch ganz normale Mitarbeiter schnell im Strudel unseres heutigen Wirtschafts- und Anreizsystems mitgerissen werden können. Michael erkennt den permanenten Fehler in unserer gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ordnung. Er versteht, was die Ereignisse und Intrigen, in die er hineingerät, verbindet, und wieso diese zu solch katastrophalen Konsequenzen wie Lügen, Betrug und kriminellen Energien - bis hin zu Mord führen. All dies passiert in der Zeit der ersten großen Corona-Pandemie. Doch Michael urteilt nicht einfach nur über Recht oder Unrecht, über Gesetz oder Moral. Er zeigt mit Scharfsinn einen klaren Ausweg aus dem Dilemma und der großen Krise. Es ist alles eine Frage der Anreizgestaltung, der Unternehmenskultur und ökologisch-sozialer Kreislaufwirtschaft. Wenn Sie in diese Geschichte eintauchen, erleben Sie nicht nur ein aufregendes Abenteuer, Sie werden zwangsläufig anfangen, über die Zukunft nachzudenken - über die Zukunft Ihres eigenen Lebens, Ihrer Arbeit und über die Zukunft der Menschheit. Es könnte sogar passieren, dass Sie die Angst davor überwinden und Lust auf sie bekommen. Lust, die Zukunft zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Hinweis: Bei diesem Werk handelt es sich um einen fiktionalen Roman basierend auf realen Ereignissen. Dennoch sind die Handlung und alle handelnden Personen frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeiten mit lebenden oder realen Personen wären rein zufällig.
Inhalt
Vorwort
Tag 3
Favelas, Rio de Janeiro
Tag 4
Villa Souza, Rio de Janeiro
Tag 1
Wolfsburg
Tag -10.950 (1990)
Grafshorst, bei Wolfsburg
Tag 3
Café Curto Rosario, Rio de Janeiro
Tag 4
Villa Souza, Rio de Janeiro
Tag 4
Favelas Rio de Janeiro
Tag 5
Days Inn Hotel, Washington D.C.
Tag 6
Café Jolly, Washington D.C.
Tag 6
Days Inn Hotelbar, Washington D.C.
Tag 7
Arlington National Cemetery
Tag 8
Days Inn Hotelrezeption, Washington D.C.
Tag 8
Riverside Campus, Headquarter CARB, Kalifornien
Tag 9
Michaels Haus, Düsseldorf
Tag 10
Polizeistation, Wolfsburg
Tag 11
Michaels Haus, Düsseldorf
Tag 12
VW-Zentrale, Wolfsburg
Tag 13
Schirn Kunsthalle, Frankfurt am Main
Tag 14
Polizeistation, Wolfsburg
Tag 17
Michigan, USA
Tag 18
Flughafen Newark, New Jersey
Tag 18
Manhattan, New York
Tag 20
Michaels Haus, Düsseldorf
Tag 21
Neuss, bei Düsseldorf
Tag 22
Eifel, Deutschland
Tag 125
Friedhof Grafshorst bei Wolfsburg
Tag 141
ZDF-Fernsehstudio, Hamburg
Epilog – Tag 7.306 (2040)
Wolfsburg
Über die Autoren
Vorwort
Großartig! Wir bewundern Sie dafür und bedanken uns bei Ihnen, dass Sie sich entschieden haben, den Mut zu fassen, in die folgende Geschichte einzutauchen. Vielleicht ist es Ihnen nicht bewusst, doch Sie halten ein Buch in den Händen, dessen Inhalt keinem kategorischen Genre folgt.
Dieses Buch haben wir geschrieben, um zu unterhalten, um einen Denkanstoß zu provozieren und um einen Perspektivwechsel vorzunehmen, vielleicht sogar, um uns selbst zu hinterfragen.
Die fiktive Geschichte von Michael Baker, einem engagierten Wirtschaftsjournalisten, basiert auf wahren Ereignissen. Um den Plan seines ermordeten Freundes, einem VW-Angestellten, zu Ende zu bringen, mündet seine bedingungslose Suche nach der Wahrheit in einem Kampf um sein eigenes Überleben. Michael Baker erkennt den permanenten Fehler in unserem wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen System. Mit seinen Bestrebungen möchten wir auf die falschen Anreize dieser Systeme aufmerksam machen, ohne über Recht oder Unrecht zu urteilen. Sie verleiten jeden von uns manchmal zu Entscheidungen, auf die wir nicht stolz sind, deren Kontext nicht immer schwarz oder weiß ist und deren Konsequenzen in einer gefährlichen Abwärtsspirale aus Unwahrheiten, Lügen, Intrigen bis hin zu kriminellen Machenschaften und Mord enden können. Falls Sie nun glauben, das könnte Ihnen nicht passieren, stellen Sie sich die Frage am Ende dieser Erzählung noch einmal.
Michaels Geschichte zeigt auf unterhaltsame Art und Weise, welche Auswirkung dies auf unsere Gesellschaft, unseren Planeten, unser Zusammenleben und unsere Zusammenarbeit hat und welchen Ausweg es möglicherweise geben kann. Dabei zeigen wir nicht mit dem Finger auf andere, sondern wollen darlegen, dass wir alle sowohl Teil des Problems als auch Teil der Lösung sind.
Dachte Michael Baker noch zu Beginn, er würde einen Beitrag zur Aufdeckung der wahren Hintergründe des Diesel-Abgasskandals der Automobilbranche leisten, erkennt er schnell, dass es damit nicht getan ist. Er deckt nicht nur die Verzweiflungstaten einiger ins Schwanken geratener Branchen und Machthaber auf, die krampfhaft versuchen, ihre Daseinsberechtigung zu schützen und zu bewahren, anstatt den Tatsachen ins Auge zu blicken und unsere Zukunft zu gestalten. Er erkennt, wie alles mit allem zusammenhängt. Unsere nationalen Probleme leiten sich aus den globalen Krisen unserer Welt ab. Klimakatastrophen, Artensterben, zunehmende Migration, Müllkrisen, Umweltzerstörung, wachsende Ungleichheit, Massentierhaltung und Dieselgate – alles ist die Folge unseres grenzenlosen Strebens nach Wachstum und Wohlstand, nach Sicherheit und Wohlbefinden.
Die Geschehnisse ereignen sich während des Ausbruchs des Coronavirus, das 2020 eine weltweite Pandemie ausgelöst hat. Diese Krise ist anders als andere, die unsere heutige Generation je erlebt hat. Sie betrifft jeden von uns. Diese Krise führt uns schonungslos zu einem Wendepunkt. Es scheint, als wolle sich die Natur gegenüber der Menschheit behaupten und ein Exempel statuieren. Wir sind plötzlich gezwungen, innezuhalten. Innezuhalten, um uns und unser System in Gänze zu hinterfragen. So brutal die Ereignisse und Folgen des Virus für uns sind, ist es dennoch an der Zeit für einen Neuanfang. Eine Chance, uns neu zu sortieren, die Ursachen für unsere Probleme zu erkennen und zu beheben, statt die Symptome zu betäuben. Daher blicken wir auf das, was heute in der Welt passiert, mit der These des Ökonomen Joseph A. Schumpeter, der einst sagte:
»Schöpferische Zerstörung ist die Basis für Innovation, unternehmerisches Wachstum und Wohlstand. Sie ist notwendig, um Systemfehler zu korrigieren und eine neue Ordnung in den etablierten Wirtschaftssystemen herbeizuführen.«
Dieses Buch erfüllt womöglich die unscharfen Kriterien eines Romans und hat den Spannungsbogen eines Krimis. Doch beide Gattungen kämen dabei gewissermaßen zu kurz, wie wir finden. Daher haben wir beschlossen, gemeinsam mit Ihnen ein neuartiges Terrain der Literatur zu betreten. Wir bezeichnen diese Geschichte als einen unterhaltsamen und aufklärenden Inspirationskrimi.
Wenn Sie in diese Geschichte eintauchen, erleben Sie nicht nur ein aufregendes Abenteuer, Sie werden zwangsläufig anfangen, über die Zukunft nachzudenken – über die Zukunft Ihres eigenen Lebens, Ihrer Arbeit und über die Zukunft der Menschheit. Es könnte sogar passieren, dass Sie die Angst davor überwinden und Lust auf sie bekommen. Lust, die Zukunft zu gestalten.
Wir wünschen viel Spaß, Mut und Gedankenspielerei.
Karl-Heinz Land &
Leonie Schulze Bölling
Tag 3
Favelas, Rio de Janeiro
Das darf doch alles nicht wahr sein. Fuck! Wie konnte das passieren?! Wie zur Hölle bin ich in diese Situation geraten?! Ich kauere hier in diesem kleinen, dunklen Raum – Zimmer würde ich das nicht nennen wollen. Die mattblaue Farbe blättert von den offensichtlich feuchten Wänden. In den Ecken Staub und Spinnweben. Ich schaue auf so etwas wie einen Herd, ein Bett mit nicht mehr ganz sauberen, aber dafür bunt gemusterten Bettlaken, ein altes Fernsehgerät und auf ein paar Holzbretter, die zu einem Schrank zusammengenagelt worden sind. In der Ecke dahinter verstecke ich mich nun, mitten in den Favelas von Rio de Janeiro. Wie so eine feige Sau in einem falschen Film. Die Schüsse und das Geballere der Revolver und Schnellfeuergewehre werden jetzt wieder etwas leiser. Mein Gott, was für eine Scheiße! Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist.
Charly hatte mich schon lange gewarnt, ich solle mich nicht so tief einlassen auf diese Geschichte. Ich nähme das viel zu persönlich. So sei die Welt halt, sagte sie immer. Es ginge eben um Wachstum und Profit. Ich solle dies einfach akzeptieren und das Beste daraus machen. »Wer das Geld hat, hat die Macht« , und um diese ginge es nun mal in Wirtschaft und Politik. Ich sei ein Fantast, ein Utopist, ein naiver Optimist! Sie hatte viele Ausdrücke dafür.
Das Geballere kommt wieder näher. Ich höre Schreie. Es sind die Schreie von Menschen, die Angst haben, genau wie ich. Ich kann förmlich ihre Todesangst spüren. Hunde bellen wild durcheinander. Eine Tür wird eingetreten. Ich zucke zusammen. Noch mal Glück gehabt, es ist nicht meine. Es muss nebenan gewesen sein. Ich kann die Vibration geradezu spüren. Werden sie mich finden? Mein Puls ist auf 210. In meinem Kopf pocht es nur so. Meine Gedanken springen wild durcheinander; ich kann sie weder sortieren noch fokussieren. Diese Männer sind hinter mir her, und ich weiß nicht, was ich tun soll, außer mich in diesem schäbigen Raum hinter diesem klapprigen Schrank zu verstecken.
Wenn sie mit ihren Schnellfeuergewehren um sich ballern, werden die Wände die Schüsse mit Sicherheit nicht aufhalten. Wände?! Welche Wände überhaupt?! Was rede ich denn da?! Das ist mehr Holz und Pappe als eine Wand. Ich hoffe nur, sie finden mich nicht. Wieder schreit jemand. Diesmal eine Frau. Vermutlich eine junge Frau – es klingt zumindest so. Ich verstehe nicht, was sie da schreit, ich verstehe kein Portugiesisch. Ich verstehe aber das Weinen eines Kindes. Es hat Angst, so wie ich, scheiß Angst!
Jetzt sind die Frau und das Kind still. Ich höre nichts mehr. Mein Puls schlägt immer noch wie verrückt. Wer waren bloß diese Typen, die auf Robert geschossen haben? Ich schwitze. »Michael, reiß dich zusammen«, murmle ich zu mir selbst. Was ist zu tun? Ich versuche, meine Gedanken zu sortieren. Ich muss hier irgendwie raus. Schweißperlen kullern langsam über meine Stirn und erreichen meine Augenlider. Wieso muss es nur so verdammt heiß hier sein?! Ob ich den Jungs, die mich hierhergebracht und versteckt haben, vertrauen kann, weiß ich nicht. Das weiß man in diesen Ländern nie. Der, der mehr zahlt, bekommt hier, was er möchte. Ja, Charly, du hattest mal wieder recht – wie fast immer, wenn du mir auf deine besonnene Art und Weise mit deinen Lebensweisheiten kommst: »Geld regiert die Welt!«
Plötzlich muss ich an Betti denken. Aber warum ausgerechnet an Betti? Und warum jetzt? Das mit Betti ist mehr als 35 Jahre her. Oh mein Gott, das ist nun wirklich nicht hilfreich. Ich sitze hier in die Ecke gekauert, um mich herum wird geschossen, ich kann keinen klaren Gedanken fassen und ich denke an Betti?! Das kann doch nicht wahr sein! Die Schüsse und das Geballere werden jetzt wieder lauter.
Ich war gerade einmal vierzehn oder fünfzehn Jahre alt. Betti war zwar nicht meine erste Freundin. Eigentlich war sie gar nicht meine Freundin. Um genau zu sein, war sie die Freundin meiner damaligen Freundin Silvi. Ich war glücklich mit Silvi, aber seit ich mit Betti in der Philosophie AG war, suchte sie irgendwie immer meine Nähe. Am Anfang nahm ich das nicht wirklich wahr. Schließlich war sie Silvis beste Freundin. Erst viel später ahnte ich, was da gerade mit uns passierte. Sie war sehr hübsch. Irgendwie auch sehr anziehend. Sie roch immer nach Sandelholz – ich stand extrem auf den Geruch ihres Parfums. Die Mädchen damals benutzten fast alle Sandalwood oder Patschuli. Patschuli roch eher herb, Sandalwood duftete irgendwie süßlich. Ich stand jedenfalls tierisch auf diesen Geruch. Er geht mir bis heute nicht aus dem Kopf. Bei Betti wirkte er aber besonders. Wenn sie neben mir saß, beugte ich mich gern zu ihr herüber, ohne sie zu berühren. Ich wollte nur diesem Duft nahe sein. Ich inhalierte diesen betörenden Dunst. Dieser Geruch – dieser Schrank – jetzt weiß ich, woher der Geruch und die Erinnerung kommen. Es ist der Schrank, der nach Sandalwood riecht. Vor einigen Monaten hatte ich den Vortrag eines Neurowissenschaftlers zum Thema »Geruch und Erinnerung« gehört. Prof. Warren Neidich, der Neurowissenschaftler und Künstler, erklärte, warum sich der Mensch Geruch nicht vorstellen kann. Der Geruchssinn wirkt direkt und ohne Umwege aufs Stammhirn. Das hat die Evolution so bestimmt, damit der Mensch sehr schnell reagieren kann. Das nutzen die Unternehmen und Marketing-Gurus dieser Weltinzwischen vielfältig. Sie beduften Geschäfte, Produkte und ganze Malls, um ihre Verkaufsziele zu erreichen. Der Mensch kann sich nicht dagegen wehren, da er den Duft nach wenigen Minuten gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, dieser sich aber im Unterbewusstsein verankert und mit entsprechenden Emotionen verknüpft wird. Wenn ein gleicher oder ähnlicher Geruch später erneut wahrgenommen wird, sind auch die Erinnerung und die damit verbundenen Emotionen sofort wieder präsent. So war es auch jetzt wieder – fast vierzig Jahre später – »Tempus fugit« – »Die Zeit fliegt!«
Erst jetzt bemerke ich, dass es wieder totenstill um mich herum geworden ist. Das ist kein gutes Zeichen. Das Kind, die schreiende Frau, das Gekläffe der Hunde – alles still. Was ist passiert? Dann ein Knall. Die Tür fliegt auf. Gleißendes Licht dringt in den Raum. Ein großer Schatten macht sich auf dem Fußboden breit und stellt sich zwischen die Welt da draußen und mich. Eine tiefe, schwere Männerstimme brüllt irgendetwas, wieder Portugiesisch. Ich verstehe kein Wort. Der Schatten macht einen weiteren Schritt in den Raum, genau in meine Richtung. Kalter Angstschweiß läuft mir den Rücken herunter. Ich presse meinen Körper noch etwas mehr gegen die Wand. Der Schatten kommt näher. Dann ein kurzes Blitzen, bevor es vollständig dunkel wird. Ich spüre den heftigen, dumpfen Aufschlag eines Gewehrkolbens auf meinem Schädel. Das war’s.
Betti war sechzehn, also etwas älter als ich. Schließlich kam, was kommen musste. Silvi war sauer, aber nicht so sehr auf mich – mehr auf Betti. Sie und ihr Sandalwood hatten mich verführt. Es wurde ein wunderbarer Sommer. Was wohl aus Betti und Silvi geworden ist?
Tag 4
Villa Souza, Rio de Janeiro
Oh Mann, mein Kopf. Wo bin ich? Der Raum, in dem ich mich jetzt befinde, ist noch kleiner. Es ist ein Kofferraum. Mir ist übel und mein Kopf schmerzt fürchterlich. Ich bekomme kaum Luft, mein Mund ist mit einem Streifen Panzerband überklebt, meine Hände sind hinter meinem Rücken zusammengebunden. Auch meine Füße sind gefesselt. Wir fahren. Es ruckelt ganz schön. Autsch! Mein Kopf schlägt an den Deckel des Kofferraums. Es ist stockfinster, ich kann nichts sehen. Es muss sich um eine Oberklassen-Limousine handeln. Der Kofferraum ist mit hochwertigem Teppichboden ausgelegt und der Wagen gut gedämpft, vermutlich Luftfederung. Also eine S-Klasse oder ein Siebener. Es könnte allerdings auch ein Bentley oder Rolls-Royce sein. Es riecht jetzt nicht mehr nach Sandelholz, sondern nach hochwertigem Leder. Jedes verdammte Schlagloch schüttelt meinen ganzen Körper durch, es tut höllisch weh, ich kann mich kaum bewegen, um das Ruckeln abzufangen.
Wohin fahren die mit mir? Wer sind die überhaupt? Eine Schnellstraße ist das nicht, auf der wir uns bewegen, dafür ist die Straße zu uneben. Eher eine geschotterte Straße oder ein Feldweg.
Verdammt. Schon wieder schlage ich an den Kofferraumdeckel. Die Fahrt wird langsamer. Der Wagen bleibt stehen. Ich höre, wie jemand etwas sagt. Wieder verstehe ich nichts. Diesmal liegt es nicht an der Sprache, es ist einfach zu leise. Jetzt geht es weiter.
Der Wagen hält nach wenigen hundert Metern wieder an. Der Kofferraumdeckel öffnet sich für den Bruchteil einer Sekunde einen Spalt. Ich höre zwei Mädchenstimmen; sie lachen und freuen sich offensichtlich über die Ankunft. Durch den Spalt kann ich einen kurzen Augenblick lang ihre türkis- und pinkfarbenen Kleidchen sehen. Doch der Kofferraumdeckel wird sofort wieder geschlossen. Offensichtlich war diese Begegnung weder geplant noch gewünscht. Es dauert nun einige Zeit, dann öffnet sich der Kofferraumdeckel erneut. Jemand zerrt mich aus dem Kofferraum und durchtrennt meine Fußfesseln. Ich schaue mich um. Tatsächlich, es ist ein Bentley. Die Mädchen und ihr Lachen von vorhin sind nicht mehr in der Nähe. Die Sonne blendet. Schweiß läuft mir über die Stirn. Ich atme hektisch durch die Nase, um ausreichend Luft zu bekommen. Zwei dunkelhaarige Männer schubsen mich über einen Hof vor sich her, hinein in einen kleinen Schuppen. Schon wieder so ein kleiner, dreckiger Raum. Es ist ein Geräteschuppen oder ein Gartenhaus. An den Wänden hängen lauter Gerätschaften; Schubkarren, Spaten, Rechen, Harken und ein paar Klappstühle stehen herum.
Einer der Männer zeigt auf einen Stuhl direkt neben den Geräten. Er deutet an, ich solle mich setzen. Der andere Mann zerrt mich zu dem Stuhl und drückt mich auf die Sitzfläche. Er fesselt nun auch wieder meine Füße und verbindet sie mit dem Stuhl. Was haben die mit mir vor? Haben sie tatsächlich etwas mit dem Kartell zu tun, vor dem Robert mich gewarnt hat? Sind es die gleichen Typen, die auch hinter Robert her waren? Wusste er auch etwas über sie, was er nicht wissen sollte? Hat er es wohl geschafft, zu entkommen?
»Halt still!«, brüllt der Mann in akzentreichem Englisch und reißt mich aus meinen Gedanken. Er zieht das Seil um meine Füße noch ein bisschen enger. Ich schwitze am ganzen Körper. Es sind hier drin sicher fünfunddreißig Grad. Es ist feucht und modrig. Der Mann nimmt sich einen weiteren Stuhl, stellt ihn direkt vor mich hin und setzt sich mir gegenüber. Der andere verlässt den Raum. Wir warten. Er scheint Brasilianer zu sein. Mittelgroße Statur, kräftig, dunkle, von der Sonne gegerbte Haut. Er ist gut gekleidet. Er trägt einen grauen Anzug, ein weißes T-Shirt und weiße Turnschuhe von Nike. Die Schuhe sind neu, das sieht man.
Wir warten weiter. Wie lange genau, kann ich nicht sagen. Ich kann ja nicht auf meiner Armbanduhr nachschauen. Nach einiger Zeit kommt der zweite Mann zurück. Sie lösen die Fußfesseln, stülpen mir eine Art Jutesack über den Kopf und bringen mich wieder nach draußen auf den Hof. Ich kann zwar nicht viel sehen, aber ein bisschen lässt sich durch die groben Maschen des Stoffes durchaus erkennen. Unsere Schritte auf dem lauten Kies schallen über den Hof, wo noch immer der Bentley parkt. Wir gehen diesmal an dem Auto vorbei, auf eine große, feudale Villa zu. Ich zähle sechs Treppenstufen, bevor wir über eine kleine Empore den Eingangsbereich des Hauses betreten. Es ist auch von innen großzügig. Nicht mein Geschmack; überladen, viel Brokat, alte Eiche, dunkle Steinböden. Es riecht sehr angenehm. Ich kenne diesen Geruch. Es ist Lavendel. Es riecht wie bei meiner Oma in Washington D.C. Sie hatte diesen Duft überall im ganzen Haus verteilt. In diesen kleinen, bordeauxfarbenen Samtsäckchen. Sie sagte immer, das hilft gegen Insekten. Es schützt vor Stechmücken und vor Motten.
Tag 1
Wolfsburg
Wo bleibt er nur? Q. wollte mich unbedingt heute Abend, hier am Hinterausgang des Wolfsburger Kunstmuseums treffen. Er sprach von wichtigen Unterlagen, die er mir zuspielen wollte. Warum er mich gerade hier am Kunstmuseum treffen wollte, hatte er mir nicht gesagt. Vermutlich hatte er im Museum noch einmal versucht, den Alten zu sprechen und ihn doch noch zu überzeugen, zu intervenieren. Der Alte war hier bei jeder wichtigen Vernissage anzutreffen. Schließlich war das Kunstmuseum wie auch der Konzern sein Lebenswerk. In der Kunstszene jedenfalls hatte er auch heute noch eine Stimme.
Schon lange verfolge ich die Hinweise und Anzeichen der Deutschen Umwelthilfe und der Behörden, die bereits seit September 2007 in vielen Veröffentlichungen vor den Abgastests und vor Verstößen der Automobilhersteller gegen Gesundheits- und Klimaschutz bei den Abgasemissionen und Spritverbräuchen warnen. Nicht nur als Wirtschaftsjournalist interessiere ich mich für das, was da vor unseren Augen von Politik und Wirtschaft getrieben wird. Auch als Staatsbürger kann ich es kaum fassen, wie offensichtlich die Bevölkerung an der Nase herumgeführt wird und Machtverhältnisse ausgenutzt werden. Dabei muss man gar nicht tief graben. Viele der skandalösen Informationen zum Abgasmissbrauch der Automobilindustrie sind für alle Bürger frei zugänglich. Dies scheint die meisten Menschen bloß nicht wirklich zu interessieren. Oder es fehlt einfach eine lückenlose und vollständige Berichterstattung. Auch die Medien sind nicht mehr das, was sie mal waren. Gut recherchierter Journalismus ist teuer und selten geworden. Natürlich hat sich auch die weltpolitische Situation zugespitzt. Ständig gibt es Nachrichten von entführten, verhafteten und zum Tode verurteilten Journalisten und Autoren in der Welt. Über falsche Machtverhältnisse und politische Skandale offen zu berichten, erfordert besonderen Mut und wohl sogar ein wenig Waghalsigkeit.
Ich hatte damals Glück. Eher per Zufall erhielt ich vor einigen Jahren die Chance, für ein internationales Wirtschaftsmagazin zu schreiben. Dort schien man meine unbändige Neugier und meine häufig etwas unkonventionellen Recherchemethoden zu schätzen. Zumindest räumte man mir entsprechende Freiheiten und finanzielle Mittel ein, die es mir ermöglichten, gründlich zu recherchieren und internationale Kontakte aufzubauen.
Q. war immer überpünktlich. Dass ich nun schon mehr als dreißig Minuten auf ihn warten muss, ist kein gutes Zeichen. Hat Q. vielleicht doch kalte Füße bekommen? Das kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Q. ist seit dem Tod und der Beerdigung seiner Frau im letzten Jahr sehr klar gewesen. Er hatte ihr noch auf dem Totenbett versprechen müssen, diese Sache zu klären, bei Gott und seinen drei Kindern. Aber wo war der pünktliche Q. denn jetzt?
Ein paar Meter entfernt kommen zwei Küchenhilfen – zumindest lässt ihre Kleidung darauf schließen – aus einer grauen Stahltür herausgestolpert. Vermutlich der Hintereingang der Küche, die zum Restaurant des Kunstmuseums gehört. Beide tragen eine grau-weiß karierte Stoffhose und eine graue, eng anliegende Jacke mit doppelreihiger Knopfleiste. Einer von ihnen hat einen schwarzen Müllsack in der Hand und lässt diesen neben einem großen Müllcontainer fallen. Er zieht eine Schachtel Zigaretten aus der Brusttasche seines Jacketts, nimmt sich eine heraus und steckt sie sich in den Mund. Sein glatzköpfiger Kollege hält ihm ein Feuerzeug hin und nimmt sich ebenfalls eine Zigarette aus der Schachtel, die ihm im Gegenzug angeboten wird. Ich kann nur Wortfetzen verstehen, aber sie machen sich offensichtlich inbrünstig über die feine Gesellschaft der Kunstszene lustig und haben sichtlich Spaß dabei. Sie äffen eine mondäne Dame nach, wie sie sich an einem Tablett Canapés mit zusammengekniffenen Fingerspitzen bedient, ihren imaginären übergroßen Hut zurechtrückt und den Notausgang mit einem Kunstobjekt verwechselt.
Man muss nicht viele ihrer Worte hören, um zu verstehen, dass sie eher wenig Verständnis für die Kunst und ihre Wirkung haben. Wer soll es ihnen verübeln.
Auch ich konnte lange nichts damit anfangen. Ich habe nie verstanden, wie man das wilde Herumgematsche mit blauer Farbe als Kunst und kreative Superleistung interpretieren kann. Und man muss schon zugeben, dass man in der Kunstszene auch auf wirklich verrückte Freaks trifft. Auch ich bin überzeugt, dass in viele Objekte sehr viel mehr und sehr viel Falsches hineininterpretiert wird, als sich der Künstler eigentlich dabei gedacht hat. Ich hatte immer das Gefühl, dass es bei einer Vernissage mehr um die intellektuelle und finanzielle Selbstdarstellung geht als um die eigentliche Bedeutung irgendwelcher Objekte. Da überbieten sich selbst ernannte Mäzene und Möchtegern-Kunstkenner gegenseitig mit unvorstellbaren Summen, nur um sich ein Bild von einem Maler an die Wand zu hängen, dessen Name lediglich Prestige und Erfolg vermitteln soll. Mit dem eigentlichen Ausdruck des Gemäldes, der Fotografie oder der Installation hat das wenig zu tun. Dennoch muss ich zugeben, dass ich, seit ich Charly kenne, ein anderes Verständnis für Kunst entwickelt habe.
Charly ist Galeristin mit einer eigenen Galerie in der Düsseldorfer Innenstadt. Sie hat ein beeindruckendes Gespür für wirklich ausdrucksstarke und gesellschaftskritische Künstler. Als wir uns kennenlernten, hat sie sich immer über meine völlige Ahnungslosigkeit und Naivität bei der Betrachtung von Bildern lustig gemacht. Das Handwerk und die Bedeutung, die sie in einigen Objekten sah, sind mir lange verborgen gewesen. Ich konnte immer nur Farben und Formen erkennen. Das langweilte mich bloß. Vor allem, weil mir das Wenigste davon optisch wirklich gefiel. Doch ihr Blick und ihre Leidenschaft waren definitiv anders. Sie machte mich neugierig und ich fing an, mich mehr mit den Hintergründen, dem tatsächlichen Handwerk und den Geschichten der Künstler auseinanderzusetzen. Ich erkannte sogar einige Parallelen zu meiner Welt und meinem Beruf. Pieter Hugo zum Beispiel hat mich nachhaltig gefesselt. Seine Videoinstallationen und Fotografien sind mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Sie zeigen Menschen, die in einer Welt leben, in der auf brutale Art und Weise unser heutiges Informationszeitalter auf die afrikanische Wirklichkeit prallt. Unseren europäischen Elektroschrott aus alten Laptops, Smartphones und sonstigen Gadgets schiffen wir containerweise nach Ghana. Tausende Menschen leben dort zusammen mit ihren Kühen auf verseuchten, schwelenden Abfallbergen und suchen ihr Auskommen als Metallsammler in den dortigen Deponien. Sie versuchen, durch das Verbrennen der Geräte an brauchbare Metalle zu kommen. Die Fotos von Pieter zeigen bedrohliche Endzeitbilder, auf denen sich unsere Welt selbst auszulöschen scheint. Sie sind auf eine brutale Art und Weise schön und erschreckend realistisch zugleich. Schon fast dokumentarisch kombiniert er kreative Fotokunst mit der drastischen Realität.
Unsere Gesellschaft ist häufig so verkopft, dass wir uns durchaus einiges von der Perspektive der Freigeister dieser Welt abschauen können. Auch in der Art, wie wir Probleme lösen oder uns Herausforderungen stellen, ist die Kreativität vor allem in der Geschäftswelt, aus meiner Sicht, völlig unterschätzt und ja, leider sogar fast verpönt.
Der Glatzköpfige drückt nun seine Zigarette an dem Müllcontainer aus, packt sich den schwarzen Müllsack und öffnet den Deckel des Containers, um beides darin zu entsorgen. Als er gerade zum Schwung ausholt, um den Müllsack hineinzuwerfen, stockt seine Bewegung abrupt. Er erscheint wie versteinert. Sein Gesicht wird plötzlich aschfahl und seine Augen sind weit aufgerissen. Er lässt den Deckel fallen, den Müllsack hat er immer noch fest in seiner Hand. Sein Kollege schaut ihn verwirrt an und sagt etwas zu ihm, was ich nicht verstehen kann. Nun öffnet auch dieser den Deckel des Containers, verzieht sein Gesicht und lässt den Deckel sprachlos wieder fallen. Ich kann nicht hören, was die beiden murmeln. Der Glatzköpfige lässt den Müllsack fallen und gemeinsam verschwinden die beiden durch die Stahltür, durch die sie gekommen sind.
Da Q. immer noch auf sich warten lässt, gehe ich langsam in Richtung des Containers. Nun will auch ich wissen, was die beiden Jungs so Schockierendes entdeckt haben. Ein unangenehmer, fieser Geruch kommt mir entgegen. Eine Mischung aus Küchenabfällen und verdorbenen Lebensmitteln. Ich öffne vorsichtig den Container. Es ist dunkel, die Wahrnehmung fällt schwer. Plötzlich durchfährt es mich wie ein Blitz durch meinen ganzen Körper. Nein, das darf nicht wahr sein! Es ist Q., eindeutig. Die reglose, blutüberströmte Leiche von Q. liegt dort etwas merkwürdig verknotet im Abfallcontainer. Ich erkenne seinen Schal, ganz sicher!
Q. trägt diesen Schal seit dem Tod seiner Frau ständig. Zumindest immer dann, wenn wir uns getroffen haben. Er sah an ihm immer schon etwas speziell aus, aber irgendwie passte er zu ihm. Seine Frau hatte ihm den Schal zu seinem Geburtstag geschenkt. Es war der letzte Geburtstag, den sie gemeinsam feierten. Wir haben nie darüber gesprochen, aber wahrscheinlich half es ihm, besser mit der Situation fertig zu werden. Zumindest gehe ich davon aus, da er ihn auch in den Sommermonaten trug, ganz egal, wie warm es war. Zugegeben, es ist mehr ein Tuch als ein richtiger Schal, dennoch war es offensichtlich, dass es für ihn eine besondere Bedeutung hatte – es war mehr als nur ein Modeaccessoire.
Wie in Trance lasse ich den Deckel wieder langsam auf den Container sinken und verschwinde um die Ecke Richtung Haupteingang des Museums. Was ist, wenn man mich hier sieht? Das Küchenpersonal wird sicher schnell wieder herauskommen und die Polizei verständigen. Die Situation wird schwierig zu erklären sein. Ein geheimes Treffen am Hintereingang eines Museums zur Übergabe von Dokumenten, von denen ich nicht einmal weiß, welcher Art diese sind?! Q. als meinen Informanten, selbst vor der Polizei, zu enttarnen, kommt nicht infrage. Nicht, bevor ich nicht weiß, was genau er mir geben wollte. Ich mache mich lieber aus dem Staub.
Gedanken schießen wild durcheinander durch mein blutleeres Hirn. Haben sie Q. etwa beseitigt, weil sie Angst haben, dass alles ans Licht kommt? Würden sie wirklich so weit gehen? Einen Mord? Hatte Q. mit seinen Befürchtungen etwa recht? Vieles, worüber er und ich gesprochen haben, hat mittlerweile die Öffentlichkeit längst erreicht. Was wusste Q. noch? Welche Dokumente wollte er mir geben, wozu es dieses geheime Treffen brauchte? Oh mein Gott! Wussten die etwa von unserem Treffen? Wussten sie von mir? Er hatte erwähnt, dass, wenn es so weit wäre, er mich einweihen würde. »Es geht um mehr als nur um den Konzern und um die Betrugssoftware«, hatte Q. bei unserem letzten Gespräch gesagt. Ich ging davon aus, dass er den anstehenden Prozess des Ex-Vorstandes Simon Krüger gemeint hat. Aber langsam kommen Zweifel in mir hoch. Das Treffen, die Dokumente, sein Tod … Das kann doch alles kein Zufall sein.
Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Ich muss wissen, von welchen Unterlagen Q. gesprochen hat. Wut macht sich in mir breit. Wieso jetzt? Was hat das alles zu bedeuten?
Q. ist mir mittlerweile sehr ans Herz gewachsen. Er war mehr als nur ein guter Bekannter oder eine Quelle. Ich nannte ihn immer nur Q. Zum einen, um ihn nicht versehentlich als Informanten zu verraten, und zum anderen, weil er mich an Q. aus den alten James-Bond-Filmen erinnerte. Nicht, weil er wirkte wie ein Professor oder aussah wie Desmond Llewelyn – ganz im Gegenteil. Er war eher unscheinbar und sah zerbrechlich aus, aber er wusste alles über Technologie und die Automobilindustrie. Er war auch verantwortlich für die Anträge der Milliarden Subventionen für die Entwicklung des sogenannten sauberen Diesels. Allein die vier großen deutschen Automobilhersteller hatten sich in den letzten acht Jahren knapp zwanzig Milliarden Euro an staatlichen Subventionen zugeschanzt. Q. wusste um die Schwächen der Technik und die Stärken der Software – kurzum, er kannte den ganzen Betrug. Bereits seit drei Jahren schlief er nicht mehr ruhig, auch wenn er nicht mehr direkt betroffen war. Er hatte sich in den letzten Jahren aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und war nur noch in beratender Funktion tätig. Junge, ehrgeizigere Männer machten ihm seine Position zunehmend streitig. Aber für ihn war das okay. Seine Ambitionen auf eine bedeutende Karriere hatten sich mit zunehmendem Alter relativiert. Er genoss es, dass man ihn für seine Expertenmeinung schätzte und immer wieder auf ihn zurückgriff, er jedoch keinerlei Verantwortung mehr zu tragen hatte. Dies tat auch seiner Gesundheit gut. Doch blieb ihm nicht verborgen, dass die Vorstände seinen Kollegen und Nachfolgern immer mehr zusetzten. Ihnen war egal, wie und was technisch möglich war. Hauptsache, die Zahlen stimmten am Ende.
Q. konnte damit nun aber nicht mehr umgehen. Seine Frau war vor knapp einem Jahr an Krebs gestorben. Es ging relativ schnell. Sie hatte keine Beschwerden. Eines Tages rief sie ihn auf der Arbeit an. Das war ungewöhnlich. Sie hatte ihn sonst nie auf der Arbeit angerufen. Sie hatte an diesem Tag einen Termin beim Arzt – Routine, hatte sie gesagt. Er wusste nicht, dass sie seit einigen Wochen bereits häufig ein Unwohlsein nach dem Essen empfand. Nun sagte sie, er solle doch heute etwas früher nach Hause kommen. Er hatte nicht weiter nachgefragt, verschob einen Termin, der ihm nicht wirklich wichtig war, sagte seiner Assistentin, er hätte noch etwas Privates zu erledigen, und machte sich auf den Weg nach Hause. Seine Assistentin fragte nicht weiter nach, obwohl auch sie es als seltsam empfand, dass er sich so schnell und ohne weitere Begründung verabschiedete. Er verschob sonst nie einen Termin ohne wichtigen Grund – und dann war da noch das kurze Telefonat mit seiner Frau. Als er am Nachmittag die Haustür öffnete, stand sie bereits im Flur. Der Flur war irgendwie fahl. Vielleicht lag es am Licht. Es regnete an diesem Tag, der Himmel war wolkenverhangen. Er schaltete das Licht an und schaute in ihr zart lächelndes Gesicht. Rosemarie, seine Frau schaute ihn seltsam ruhig, fast schon verklärt an. Er wusste sofort, dass etwas Dramatisches auf ihn warten würde.
Nach mehr als dreißig Jahren liebte er sie immer noch. In letzter Zeit hatten sie häufiger heftige Diskussionen, ja, fast schon Auseinandersetzungen. Sie setzte ihm zu wegen seines Jobs. Dabei ging es diesmal nicht um die viele Arbeit, die er für den Konzern aufwendete, sondern um den Inhalt seiner Arbeit und die Werte, die damit verbunden waren. Er hatte sie immer schon in seinen Job einbezogen. Sie war nicht nur seine Ehefrau, sondern auch sein wichtigster Ratgeber in beruflichen Dingen.
Nicht immer war sie seiner Meinung, aber diesmal war es ganz anders. Seit er ihr erklärt hatte, was da mit den Subventionen zur Entwicklung des sauberen Diesels lief und wie unmöglich es anscheinend schien, die gesteckten Ziele zu erreichen, sagte sie: »Das ist falsch, Hermann, du musst das aufklären. So geht das nicht! Es geht nicht nur um den Profit, hier geht es auch um Menschen und deren Gesundheit.« Ihre Haltung war früher anders. Früher machte er seinen Job und sie kümmerte sich um das Haus und die Kinder. Sie beriet ihn und er entschied dann, was zu tun sei, aber diesmal wurde sie immer vehementer. Sie schrie ihn sogar einmal fast an: »Du darfst das nicht einfach laufen lassen. Du machst dich und den Konzern kaputt. Ihr verschaukelt eure Kunden und die Menschen. Alles, wofür ihr jahrzehntelang gestanden habt. Nur wegen dieses Idioten im Vorstand.« Sie sagte, er solle mit dem Alten reden. Mit dem Alten meinte sie den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden und Kunstmäzen, Gert Böhm. Er hatte Volkswagen fast zwei Jahrzehnte gelenkt und zu dem gemacht, was er heute ist – ein Weltkonzern und einer der größten Automobilkonzerne der Welt.
Nun folgte er ihr schweigsam und angespannt ins Wohnzimmer. Sonst gingen sie meist zunächst in die Küche. Hier in der Küche spielte sich ihr privates Leben ab. Seit die Kinder aus dem Haus waren, war das Wohnzimmer etwas für Gäste und eher repräsentative oder wichtige Anlässe. Sie deutete auf seinen Sessel und gab ihm zu verstehen, er solle sich dort hinsetzen. Er folgte wortlos. Er saß gern auf diesem Sessel, denn von hier konnte er sie in der Küche beobachten. Zudem konnte man von hier aus seinen Blick abends zur Entspannung aus dem Fenster in die Ferne schweifen lassen. Dann begann sie mit den Worten:
»Weißt du, mein Schatz, wir haben drei tolle Kinder und sind nun mehr als dreißig Jahre glücklich verheiratet. Nun aber wirst du den letzten Teil der Reise ohne mich gehen müssen.«
Sie war, als sie dies sagte, seltsam gefasst und schob schnell hinterher:
»Ich habe Bauchspeicheldrüsenkrebs. Die Ärzte sagen, für eine Therapie ist es zu spät.«
Erst jetzt sah Q., dass sie Tränen in den Augen hatte, als sie dies zu ihm sagte. Q. begriff erst nicht genau, was sie da zu ihm gesagt hatte. Er stotterte und wollte nachhaken, aber sie kam ihm zuvor.
»Die Ärzte sagen, ich habe vielleicht noch vier bis sechs Wochen, länger auf keinen Fall. Es ist vorbei.«
Q. und ich hatten schon länger Kontakt. Wir lernten uns vor Jahren auf einer Automobilmesse in Detroit kennen. Er war ein guter Typ. Ich mochte ihn. Zu Beginn dachte ich, er sei etwas schwerfällig, da er meine manchmal provozierenden Bemerkungen zur Zukunft des Automobils oder der Automobilindustrie nicht sofort konterte. Ich vertrat oft eine andere Meinung als er. Aber wahrscheinlich war es genau das, was uns beide verbunden hat. Er mochte meine ehrliche, unkonventionelle Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ich schätzte ihn für sein umfangreiches Fachwissen und vor allem für seine Leidenschaft und Überzeugung, mit der er die Dinge anpackte. Wir konnten herrlich offen miteinander diskutieren. Der Umgang war dabei ehrlich und direkt, aber immer respektvoll. Und am Ende waren wir beide schlauer als vorher. Wir ergänzten uns oft in unseren Ansichten. Worüber wir am energischsten diskutieren konnten, waren die Paradigmenwechsel der Automobilbranche, vor dessen Herausforderungen insbesondere die großen deutschen Automobil-Konzerne und damit auch die deutsche Wirtschaft stehen. Einmal sagte ich zu ihm:
»Immer mehr Menschen werden in den Städten leben und auf ein eigenes Automobil verzichten. Es ist viel zu unbequem und auch zu teuer. Die meiste Zeit steht es doch bloß dumm herum, nimmt Platz weg und kostet Geld. Die Menschen in den Städten werden sich die Autos teilen. Ihr müsst euch etwas überlegen. In Zukunft werden deutlich weniger Autos gebraucht werden.«
»In den Städten vielleicht, das mag sein. Aber auf dem Land und selbst in den Vororten werden insbesondere Familien und Berufstätige immer ein Auto benötigen«, erwiderte Q., nicht unbedingt überzeugt.
»Nicht, wenn es autonom fahrende Autos gibt. Dann wird das Auto lediglich zum Transportmittel, zur Fahrgastzelle. Die Zeiten des Autos als Statussymbol sind vorbei. Marketingsprüche wie: Freude am Fahren oder Vorsprung durch Technik werden dann auch nicht mehr funktionieren.« Q. grinste.
»Ja, möglich. Wir müssen uns definitiv neu erfinden. Sonst verkaufen wir in Zukunft tatsächlich nur noch Blech. Nur ist es für uns nicht leicht. Wir wissen heute nicht, welche Antriebe sich in den kommenden Jahren durchsetzen werden. Wir sind also quasi gezwungen, auf alle Trends gleichzeitig reagieren zu müssen: E-Mobilität, Wasserstoff, Autonomes Fahren. Das kann sich selbst ein Konzern wie Volkswagen nicht leisten«, entgegnete Q.
»Oder vielleicht fehlt es nur an einer klaren Vision. Durchsetzen wird sich immer die cleverste Lösung. Elektromobilität ist es nicht. Das steht fest. Das Softwaregeschäft haben sich die deutschen Autobauer im Grunde ja schon aus der Hand nehmen lassen. Das war aus meiner Sicht fatal. Ich denke, es fehlt der Branche einfach an Mut. Der bisherige Erfolg hat bequem gemacht«, provozierte ich Q. Doch er gab nicht auf.
»Die Messe ist noch nicht gelesen. Ich sehe es nicht ganz so schwarz wie du. Sicher stehen wir vor einem Wendepunkt, aber so schnell geht es dann doch wieder nicht, wie die Presse es uns manchmal glauben machen möchte«, antwortete Q. ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen.
»Nun, aus meiner Sicht steuert die deutsche Automobilbranche geradewegs in eine Sackgasse und setzt damit einen erheblichen Wirtschaftszweig für Deutschland und Europa aufs Spiel. Der Abgasskandal zeigt, wie sehr die Konzerne unter Druck stehen. Klimawandel und der CO2-Ausstoß fordern jetzt ihren Tribut. Die E-Mobilität ist nur eine Übergangslösung. Seien wir doch mal ehrlich: Die Branche und die Politik wollen uns weismachen, hiermit eine Lösung für die Umweltfragen zu haben. Der Elektromotor ist genauso Käse wie der Verbrenner«, sagte ich überzeugt.
»Manchmal weiß ich nicht, ob ich deine Visionen begrüßen oder verachten soll, Michael Baker. Sicher ist da etwas dran. Aber unterschätze nicht die Lobby der Ölindustrie. Die spielt ihr eigenes Spiel! Und dies wird auf globaler Ebene gespielt. Da geht es um Weltpolitik, Macht, Ressourcen und Krieg, nicht um Innovation und irgendwelche Abgaswerte«, mahnte Q. Immer wenn er davon anfing, bekam ich fast ein wenig Angst. Für mich als Journalist sind die Einflüsse von Lobby und Politik zwar täglich Brot, aber vor den Mächten der Ölindustrie hatte selbst ich Respekt.
Obwohl Q. und ich nicht immer die gleiche Ansicht teilten, hatte ich bei ihm immer das Gefühl, dass wir uns mit Wertschätzung und Achtung vor der Meinung des jeweils anderen begegneten. So entstand über die Jahre eine vertrauensvolle Beziehung. Er sagte einmal zu mir: »Für einen Journalisten sind Sie ganz okay.« Aus seinem Munde klang dies für mich wie ein großes Kompliment.
… und jetzt liegt er da in diesem Abfall-Container. Seine Beine scheinen seltsam verknotet dazuliegen. Überall diese schwarzen Mülltüten mit Küchenabfällen, sein Kopf blutüberströmt, sein Genick offensichtlich gebrochen. Ich kann es nicht fassen.
Tag -10.950 (1990)
Grafshorst, bei Wolfsburg
»Weißt du, Papa, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann?«, fragt Ole seinen Vater Hermann, während sie im Auto sitzen und vom Fußballspiel nach Hause fahren.
»Nein, woher soll ich das wissen, mein Sohn?«, antwortet Hermann.
»Was haben die Menschen gemacht, als es noch keine Autos gab?«
»Es gab die Eisenbahn. Die Menschen sind zum Beispiel mit der Dampflokomotive gereist. Und es gab Kutschen, Pferdekutschen. Damit haben sich die Leute hauptsächlich fortbewegt«, erklärt Hermann seinem Sohn, während er hinter dem Steuer sitzt.
»Auch bei uns in Grafshorst?«, fragt Ole.
»Ja, na klar. Überall auf der Welt. Wie heute die Autos, sind früher Pferde mit Kutschen durch die Straßen gelaufen, auch bei uns in Grafshorst.«
»Dann brauchte man aber breite Straßen, oder? Und es roch bestimmt überall nach Pferdeäpfeln?«, wundert sich Ole und verzieht sein Gesicht. Sein Vater grinst.
»Ja, vermutlich schon. Aber die Leute in den Städten waren daran gewöhnt«, antwortet er.
»So wie wir heute an den Benzingeruch und an den schwarzen Rauch«, stellt Ole fest. Dann schaut er nachdenklich aus dem Fenster. Ihm fällt eine weitere Frage ein.
»Wer war der erste Mann, der mit einem Auto gefahren ist, Papa?«
»Wieso glaubst du, dass es ein Mann gewesen ist, der das erste Auto gefahren hat?«, fragt Hermann.
»War es nicht? War es etwa eine Frau?« Ole schaut verdutzt zu seinem Vater.
»Ja, in der Tat«, sagt Hermann.
»Aber du sagst doch immer, Frauen können nicht Autofahren, Papa.«
»Pscht. Das sage ich doch nur zum Spaß.« Hermann ist peinlich berührt. Schnell fährt er weiter fort. »Ganz genau weiß man das natürlich nicht. Es gab damals mehrere Männer, die an Alternativen zu den Pferdekutschen, also an den ersten Autos, herumgebastelt haben. Aber Bertha Benz, die Frau von Carl Benz, ist berühmt dafür, dass sie als Erste eine Strecke von über einhundert Kilometern mit einem Auto zurückgelegt hat. Ihr Mann hatte damals das erste Patent auf einen PKW, also einen Personenkraftwagen mit Verbrennungsmotor, erhalten. Es hieß ›Benz Patent-Motorwagen Nummer 1‹.
»Benz? Von Mercedes Benz?«, kombiniert Ole.
»Ja, genau«, bestätigt Hermann.
»Und damit ist Bertha dann gefahren?«
»Fast. Die Fahrt, die sie gemacht hat, hat sie mit der Nummer 3 gemacht. Also mit dem Nachfolger von Carl Benz’ erster Version. Damit ist Bertha von Mannheim nach Pforzheim gefahren. Das war früher eine sehr weite Strecke, für die man viel Zeit brauchte.«
»Wieso war es Bertha? Wieso ist nicht Carl gefahren?«
»Gute Frage. Carl hatte eine Firma gegründet, unter der er die Autos verkaufen wollte. Aber niemand kaufte sie. Der Firma ging irgendwann das Geld aus. Die neue Art der Fortbewegung war damals eine große Innovation und nicht besonders beliebt bei den Menschen. Viele hatten Angst vor einem solchen Auto. Bertha besorgte Geld von ihren Eltern. Sie ließ sich ihr Erbe frühzeitig auszahlen, damit Carl weiter an seiner Erfindung arbeiten konnte. Als er damit aber immer noch nicht erfolgreich war, weil sich niemand traute, mit einem solchen Gefährt zu fahren, hat sie sich heimlich, ohne dass ihr Mann etwas davon wusste, in das Auto gesetzt und ist losgefahren. Das hat so viel Aufmerksamkeit erregt, dass die Firma ihres Mannes endlich anfing, die Autos zu verkaufen. Immer mehr Leute trauten sich, mit einem Auto zu fahren, und Carl Benz hatte endlich Erfolg.«
»Das war aber mutig von Bertha. Und ganz schön clever. Aber wieso hatten die Leute Angst vor Autos?«
»Na ja, im Vergleich zu den Kutschen und Pferden haben Autos einen Riesenkrach gemacht. Sie waren laut und vor allem viel, viel schneller als eine Kutsche. Die Menschen hatten Angst vor der Geschwindigkeit.«
»So wie Mama, wenn du auf der Autobahn Gas gibst.«
»Ja, genau.« Hermann lacht. »Es hat sehr lange gedauert, bis sich Autos überhaupt durchgesetzt haben. In den ersten Jahren galten Autofahrer eher als arrogant und neureich. Autos waren natürlich auch sehr teuer. Nicht jeder konnte sich diese leisten«, ergänzt der Vater.
»Wie schnell konnte das Auto von Bertha fahren?«
»Maximal sechzehn Kilometer pro Stunde.«
»Uhh, das ist aber langsam.«
»Ja, heute schon. Damals war das schnell. Und vor allem brauchte man keine Pferde mehr und keinen Kutscher. Noch bevor es das Auto mit Verbrennungsmotor gab, haben verschiedene Ingenieure andere Antriebe getestet. Es gab zum Beispiel auch Dampf- und Elektrofahrzeuge. Aber durchgesetzt hat sich das Benzin- und Dieselauto. Benzin hat eine höhere Energiedichte als ein elektrischer Speicher. Man kann also mit Benzin länger und vor allem schneller fahren. Außerdem ist der Kraftstoff, der aus Erdöl gewonnen wird, sehr viel günstiger. 1865 gab es in England ein Gesetz, das Straßenunfälle mit den neuen Autos verhindern sollte. Deswegen durften sie maximal vier Meilen, also etwa 6,4 Kilometer pro Stunde, fahren. Und um die Menschen zu warnen, musste immer ein Fußgänger mit einer roten Fahne vor dem Auto hergehen. Das Gesetz haben sie ›Red Flag Act‹ genannt.«
»Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn.«
»Ja, das ist wohl wahr. Aber neue Erfindungen brauchen eben Zeit, damit die Menschen verstehen, was ihre Vorteile sind. Die ersten Autos sahen auch noch gar nicht so aus wie die Autos heute. Sie sahen im Grunde genauso aus wie Kutschen. Es gab sogar lange Zeit noch einen Kutschbock, also die Bank vorne, auf der in einer Kutsche der Kutscher sitzt, obwohl man in einem Auto natürlich gar keinen Kutscher mehr braucht.«
»Ist ja dämlich.« Ole lacht. »Gab es das Gesetz auch noch, als Bertha gefahren ist?«, fragt Ole seinen Vater.
»Ja, schon. Aber nicht in Deutschland. Das Gesetz wurde zum Ende des neunzehnten Jahrhunderts wieder abgeschafft. Berthas Fahrt nach Pforzheim war 1888. Aber die Autobauer forderten andere Gesetze. Es gab viele Veränderungen in der Gesellschaft. Zum Beispiel forderte man, dass die Straßen regelmäßig von all dem Pferdedung befreit werden sollten, damit die Autos nicht darauf ausrutschen. Es mussten weitere Sicherheitsmaßnahmen her wie die Reparatur von Straßen, Begrenzung von Geschwindigkeiten in Gefahrenzonen und so weiter.«
»Also haben wir dank Bertha heute so viele Autos?«
»Unter anderem, ja. Es gab noch mehrere Pioniere, die dazu beigetragen haben. Zum Beispiel entwickelte Gottlieb Dümmler, er nannte sich dann später Gottlieb Daimler, in Cannstatt bei Stuttgart zusammen mit Wilhelm Maybach den ersten Benzinmotor und gründete die Daimler-Motoren-Gesellschaft. Als Bertha mit dem Auto ihres Mannes gefahren ist, musste sie in Wiesloch bei Heidelberg anhalten und Treibstoff nachtanken. Ihr ging sehr schnell das Benzin aus. Sie kaufte dort in einer Apotheke Ligroin. Die Stadt-Apotheke in Wiesloch war deshalb die erste Tankstelle der Welt. Noch heute gibt es dort ein Schild. Ab diesem Zeitpunkt waren Apotheken die damaligen Tankstellen. Wilhelm Otto entwickelte einige Jahre zuvor den ersten Viertaktmotor in Köln. Rudolf Diesel hat den ersten Dieselmotor erfunden. Sie alle und noch einige Menschen mehr haben dazu beigetragen, dass sich das Auto dann um 1900 herum durchgesetzt hat. 1906 gab es in Deutschland etwa zehntausend Autos, etwa achtzigtausend Autos weltweit. Es waren die Willenskraft, der Mut und der Erfindergeist dieser Männer und Frauen, die dafür verantwortlich sind und für einen großen wirtschaftlichen Aufschwung in unserem Land gesorgt haben.«
»Was bedeutet wirtschaftlicher Aufschwung?«
»Nun, Deutschland ist heute die viertgrößte Industrienation der Welt. Die Automobilindustrie ist einer der Gründe dafür. Sie gehört zu unseren wichtigsten Branchen hier in Deutschland.«
»Wie meinst du ›wichtig‹?«
»Wichtig für unseren Wohlstand. Für unsere Arbeitsplätze. Dafür, dass Menschen wie ich zur Arbeit gehen können und unsere Familien von dem Geld leben können. Jeder achte Arbeitsplatz in Deutschland hängt von den Autos ab. Meiner auch.«
»Jeder achte Mensch baut Autos?«
»Nicht ganz. Aber neben den Firmen, die die Autos bauen, gibt es noch eine Menge Zulieferer, die Zubehör und Bauteile herstellen und an die Autobauer liefern. Dann gibt es noch den Maschinen- und Anlagenbau. Die Maschinen, die man braucht, um Autos zu bauen, muss ja auch jemand herstellen. Die gesamte Eisen- und Stahlindustrie, der Bergbau, die großen Kohle-Minen, der Tagebau. Du kennst doch Tante Marianne und Onkel Alois aus Dortmund. Dort haben wir uns den Tagebau doch schon mal angesehen. Erinnerst du dich?« Ole nickt. »Und dann ist da noch der Straßenbau. Auch hier arbeiten eine Menge Leute daran, dass es viele Wege gibt, wo man mit dem Auto hinfahren kann, dass es Straßen und Autobahnen gibt, Leitplanken, Ampeln, Schilder, Parkhäuser und und und. Und es gibt Tankstellen mit Benzin. Dafür braucht man vor allem Erdöl, welches aus dem Boden gewonnen werden muss, um Diesel und Benzin herzustellen. Früher, vor etwa achtzig Jahren, gab es ungefähr zehntausend Autos in Deutschland. Heute bauen die Deutschen knapp fünf Millionen Autos in nur einem einzigen Jahr und verkaufen sie in die ganze Welt. Nur die Japaner und die Amerikaner bauen noch mehr Autos als wir.«
»Fünf Millionen«, wiederholt Ole und staunt nicht schlecht. »Wie viele Nullen sind das?«
»Eine Menge, mein Sohn. Eine Menge.« Ole fängt an, mit seinen Fingern die Anzahl der Nullen zu ermitteln. Er gibt schnell wieder auf.
»Ob Bertha wohl gewusst hat, was sie da angerichtet hat?« Hermann schmunzelt und antwortet:
»Vielleicht geahnt. Sie hat sicher gewusst, was sie für ihren Mann getan hat. Aber dass sie die Geschichte der Automobilindustrie in Deutschland und später auch weltweit beeinflussen würde, war ihr damals sicher noch nicht klar. Im Grunde hat sie zusammen mit den anderen mutigen Unternehmern unser Land, unsere Mobilität, unsere Städte und unsere gesamte Wirtschaft verändert. In keiner anderen Volkswirtschaft der Welt hält die Automobilindustrie einen so großen Anteil an der gesamten Wirtschaftsleistung.«
»Aber was ist dann mit all den Kutschenbauern und Kutschern passiert, wenn Carl Benz auf einmal so viele Autos gebaut hat?«, fragt Ole.
»Das ist das Verrückte an bedeutenden Innovationen wie dem Auto, mein Sohn. Auch wenn sie sich dagegen wehrten, sie mussten irgendwann anfangen, auf eine andere Art und Weise Geld zu verdienen. Denn Kutschen brauchte kaum noch jemand, genauso wie die Pferde, das Futter und die Maschinen, die zum Bau der Kutschen benötigt wurden. Nur noch Nostalgiker und Pferde-Liebhaber haben heute noch Pferde und Kutschen, die sie zur Fortbewegung nutzen. Wer das nicht rechtzeitig verstanden hat, hatte später keine Arbeit mehr«, antwortet Hermann.
»Wieso haben die Kutschenbauer nicht einfach Autos gebaut?«, fragt sich Ole, ohne es laut auszusprechen.
Tag 3
Café Curto Rosario, Rio de Janeiro
Hier müsste es sein.
»Bitte lassen Sie mich hier raus«, fordere ich den Taxifahrer auf. Café Curto Rosario in der Rue do Rosário, Rio de Janeiro. Hier treffe ich mich mit Robert. Gerade einmal eine zehnminütige Autofahrt vom Flughafen entfernt, inmitten der feurigen Metropole und Hochburg des brasilianischen Karnevals. Schon beim Aussteigen aus dem Flugzeug schlug mir die heiße Tropenluft Brasiliens entgegen. Kein Wunder, dass die Stadt für leichte Bekleidung bekannt ist. Auch ich verstaue mein Jackett, für das ich im Flugzeug noch sehr dankbar war, erst einmal in meinem Reisegepäck. Ich habe nicht viel dabei, nur eine kleine Reisetasche mit dem Notwendigsten: zwei Paar Socken, Unterwäsche, eine Jeans, T-Shirt und zwei Hemden zum Wechseln. Eines aus Leinen, um es bei der Hitze erträglich zu machen, und ein kariertes aus Baumwolle für die Rückreise sowie meinen Kulturbeutel und meinen Laptop. Den brauche ich schließlich immer für meine Arbeit.
Meinen Rückflug trete ich bereits übermorgen wieder an. Ich wäre gern noch länger geblieben, aber eigentlich bin ich nur hier, um Robert zu treffen. Außerdem macht der Verlag Druck und sieht lange Reisezeiten nicht gern.
Ich gehe nicht davon aus, dass Robert sein richtiger Name ist. So wie Q. auch nicht Q. heißt, sondern Hermann. Hermann Strunk. Ich weiß im Grunde gar nichts über Robert.
Vor ein paar Wochen, als die ganze Sache angefangen hat, hat Q. mir einen Umschlag gegeben.
»Falls mir etwas zustößt, öffnest du diesen Umschlag. Aber erst dann. Vorher nicht. Ich vertraue nur dir«, sagte er. Das war kurz nach der Beerdigung seiner Frau. Ich dachte damals, er würde etwas dramatisieren, da ihm die Krankheit seiner Frau doch sehr zugesetzt hatte. Erst später wurde mir die Tragweite der Informationen bewusst, die er mir nach und nach zuspielte. Das Risiko, welches er einging, und die Verantwortung, die damit auf meinen Schultern lastete, wird mir in Gänze eigentlich jetzt erst klar. Umso bedeutender erscheint es mir nun, all dem nachzugehen und die Beweise zusammenzutragen, die Q. offensichtlich vorbereitet hatte. Nur so gibt es eine Chance, die kriminellen Machenschaften des Konzerns vollständig offenzulegen. Dann wäre Q. wenigstens für eine gute Sache gestorben.