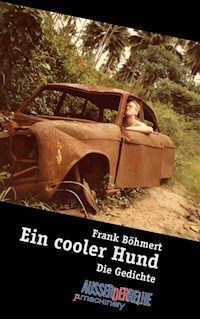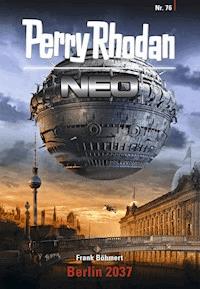
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Jetzt, im November 2037, ist die Erde kaum wiederzuerkennen. Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden. Ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen. Doch sie kommt zu einem jähen Ende, wie Perry Rhodan feststellen muss, als er von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt. Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden. Rund um den Globus sind die Menschen mit den neuen Herrschern konfrontiert - unter anderem in Berlin, das von den Invasoren zum Sektorenkommando für Europa bestimmt wird. Gleichzeitig wittert so mancher Einwohner der Stadt ungeahnte Chancen für sich ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Band 76
Berlin 2037
von Frank Böhmert
Eineinhalb Jahre sind vergangen, seit der Astronaut Perry Rhodan auf dem Mond auf ein havariertes Raumschiff der Arkoniden gestoßen ist. Jetzt, im November 2037, ist die Erde kaum wiederzuerkennen.
Die Erkenntnis, dass die Menschheit nur eine von unzähligen intelligenten Spezies ist, hat ein neues Bewusstsein geschaffen. Die Spaltung in Nationen ist überwunden. Ferne Welten sind in greifbare Nähe gerückt. Eine beispiellose Ära des Friedens und Wohlstands scheint bevorzustehen.
Doch sie kommt zu einem jähen Ende, wie Perry Rhodan feststellen muss, als er von einer beinahe einjährigen Odyssee zwischen den Sternen zurückkehrt. Das Große Imperium hat das irdische Sonnensystem annektiert, die Erde ist zu einem Protektorat Arkons geworden.
Rund um den Globus sind die Menschen mit den neuen Herrschern konfrontiert – unter anderem in Berlin, das von den Invasoren zum Sektorenkommando für Europa bestimmt wird. Gleichzeitig wittert so mancher Einwohner der Stadt ungeahnte Chancen für sich ...
Prolog
Irgendwo in der Wüste Taklamakan
Bai Jun stieg die Stufen in das Gewölbe unterhalb der alten Karawanserei hinab, allein und unbewaffnet. Sand wirbelte bei jedem seiner Schritte auf.
Der Gefangene erwartete ihn.
»Sie wollten mich sprechen?«, sagte Bai Jun.
Er musterte sein Gegenüber. Ein Weißer, hochgewachsen. Aus dem schlanken Mann war in den letzten Monaten ein hagerer geworden. Aber, stellte er mit einem Blick fest, keineswegs ein gebrochener.
»Ja«, sagte der Gefangene. Er ging auf Bai Jun zu, hielt ihm die Hand hin.
Der Ex-General ignorierte sie. »Weshalb?«
Der Arm des Gefangenen senkte sich langsam. »Ich bin wieder ich«, sagte er.
Bai Jun schwieg. Konnte er ihm trauen? War er wieder der aufrechte, zu allem entschlossene Idealist, als den er ihn kennengelernt hatte?
»Bai Jun!« Der Gefangene konnte seine Gedanken nicht lesen, nicht mehr – doch er erriet, was in dem ehemaligen General der Volksbefreiungsarmee vorging. »Hier in diesem Verlies nütze ich niemandem etwas!«
Aber hier schadest du auch niemandem!, entgegnete Bai Jun in Gedanken. Das Bild des zerstörten Lakeside Institute erschien vor seinen Augen. Dessen Vernichtung war maßgeblich das Werk des Gefangenen gewesen. Doch die Frage lautete: Wie lange konnten sie ihn noch halten? Seine neuen Kräfte wuchsen mit jedem Tag. Bald würde er ihn nicht mehr um seine Freilassung bitten, er würde sich die Freiheit nehmen.
»Ich will der Menschheit helfen. Geben Sie mir doch eine Chance!«
Bai Jun kam zu einem Entschluss. Er hatte im Lauf der Jahre gelernt, dass derjenige, der eine unhaltbar gewordene Position nicht rechtzeitig räumte, dafür teuer bezahlte. Man musste klug und wendig sein und Ereignisse vorwegnehmen. Man durfte sich nicht von ihnen überrollen lassen. Auf diese Weise war der Mischling, Sohn eines Han-Chinesen und einer Uigurin, erst zum General aufgestiegen, später zum Bürgermeister Terranias und schließlich zum Anführer des irdischen Widerstandes.
1.
Montag, 31. August 2037
Berlin vor den Arkoniden
Mia
Mia hatte im Hinterhof des Ladens einen Picknicktisch aufgestellt; dort saß sie mit ihren Festkräften in der Pause und rauchte. Es war erst zehn Uhr morgens und schon knallheiß, die Luft stand still zwischen den alten Häusern. Aus einem Fenster drang die Stimme eines Sprechers; jemand hatte einen Stream laufen. Es ging um irgendwelche politischen Vorgänge in Terrania. Mia hörte weg.
»Zu geil, die Mutti gerade wieder!« Kiki lachte.
Mia zog eine Schulter hoch, lächelte schief.
»Wieso? Was denn?«, fragte Doreen.
»Na, die wäre sowieso schon am liebsten rausgerannt, und als Töchterchen gefragt hat, ob sie mal anfassen darf, da hat sie echt Zuckungen gekriegt, so hier.« Kiki machte es vor, gleich beide Kundinnen auf einmal. Zuerst die Tochter: staunendes Lächeln und eine Hand, die sich zögernd der Spitze von Mias einem Katzenohr näherte. Dann die Mutter: Kiki verzog die großen Lippen halbseitig und schüttelte sich.
Sie lachte. »Die kriegt heute Abend bestimmt noch eine Griebe!«
Doreen blies Rauch aus. »Spießer!«
»Na, nicht so ungnädig, Mädels.« Mia stand auf, streckte sich. »Solange die Mütter von unserem Laden Pickel kriegen, kaufen die Töchter gern hier ein. Und finanzieren eure Jobs.« Sie klatschte in die Hände. »Und jetzt auf ins Gewühl mit euch, los! Wir werden nicht fürs Kiffen bezahlt.«
Seufzend erhoben sich die Verkäuferinnen und sammelten ihre Zigarettenschachteln ein. Kaum zog Doreen die Tür auf, blubberten und waberten Space-Rock-Klänge in den Hof.
Das Weltraumstaunen Berlin war keine teure und exklusive Boutique, sondern ein betont schäbiger Klamottenladen, in dem liebevoll ausgewählter Ramsch angeboten wurde, der nur eines sein musste: spacig. Das Geschäft war Goldgrube und Touristenfalle zugleich. Mias Chefin befand sich derzeit in England, wo sie versuchte, mit demselben Konzept das »Space Awe London« zu etablieren; es war der Grund, warum Mia mit ihren 23 Jahren schon eine Filiale leitete.
Man nehme: haufenweise Profilbleche, Röhren von Klimaanlagen, ein oder zwei lackabblätternde Aerotrim-Gyroskope, die es aber noch tun, und jede Menge verrückter Kleidungsstücke, die irgendwie zum Thema Weltraum passen. Ein schlichtes Konzept, doch wenn man eine gute, fleißige Einkäuferin hatte, rollte der Rubel. Und der Clou war es natürlich, Verkaufskräfte anzuheuern, die auf Körpermodifikationen standen.
Doreen sah von den dreien noch am normalsten aus – die klassische platinblonde Sexbombe, nur dass sie ihrem Körper, wann immer sie es sich leisten konnte, in Osteuropa ein bisschen auf die Sprünge helfen ließ. Außerdem war sie an allen möglichen und unmöglichen Stellen schwer beringt und trug am liebsten eng anliegende Kleidung, unter der sich die Piercings deutlich abzeichneten.
Kiki hatte sich dauerhaft enthaaren lassen – komplett, wie sie auf Partys und an Kneipentresen jedem gern erzählte –, und ihren kahlen Schädel zogen sich mehrere Reihen subkutaner Schmuckimplantate entlang; Halbkugeln, die erst größer und dann wieder kleiner wurden. Kiki träumte davon, eines Tages durchgehend blaue Haut zu haben. Es gab Genpiraten, die so etwas bereits hinbekamen, aber vor Untergrund-Genetik hatte sie Angst, und teuer war das auch; also blieb bislang nur der Weg übers Tätowieren.
Und Mia? Mia war schon immer ein Kätzchen gewesen. Mittlerweile sah man ihr das auch dann an, wenn sie sich nicht bewegte.
Die Cyborg-Community, wie die Medien ihre Subkultur getauft hatten, war klein, und die Cycos, wie sie sich selbst gern nannten, galten als »irgendwie gestört« – aber ansehen wollte man sich die schon gern, wenn man auf Berlinurlaub war, und dann kaufte man durchaus auch noch irgendetwas Flippiges, mit dem sich in Stuttgart auf wild machen ließ. Berlin war zwar nicht gerade Terrania, aber auf dem alten Kontinent derzeit das heißeste Ding.
Mia wollte den Mädels gerade folgen, da vibrierte ihr Pod. Sie sah aufs Display.
Abrupt blieb sie stehen.
Das war Paul. Der rief sie nie auf der Arbeit an, textete ihr höchstens was.
Doreen, die immer noch die Tür aufhielt, sah sie fragend an.
»Geh schon mal, ich komm gleich.« Mia wandte sich ab, trat tiefer in den Hinterhof. Sie räusperte sich. Paul um diese Uhrzeit konnte nur eines bedeuten.
Sie bekam ein flaues Gefühl in der Magengegend. »Ja?«
»Ich hab den Termin«, sagte Paul. »Gleich nachher. Wir treffen uns am Frankfurter Tor. Um eins. Kriegst du das hin?«
»Ja«, sagte sie. Ihre Stimme klang piepsig. Sie räusperte sich noch einmal. »Ja. Kein Problem.«
»Super! Ich freu mich! Ich hätt's dir auch texten können, aber ich wollte deine Stimme hören!«
»Wow«, sagte sie. »Ich freu mich auch.«
»Das hört man.« Paul lachte, aber es war liebevoller Spott. »Also, hast du das abgespeichert? Frankfurter Tor, um eins?«
»Hab ich.«
»Gut. Alles Weitere später. Wie wir neulich besprochen haben.«
Sie machten noch ein paar Küsschen-Laute, dann legten sie auf.
Ihr war schwindelig. Alles wirkte unwirklich.
Zum Glück hatte sie ein eingespieltes Team. Vertretertermine standen nicht an, und im Laden nahmen ihr die Festkräfte alles ab. Da konnte sie durchaus mal ein paar Überstunden abbummeln; die meisten schrieb sie ohnehin nicht auf.
»Es geht weiter«, sagte sie nur, als keine Aushilfe in der Nähe war, und Kiki und Doreen rissen kurz die Augen auf und nickten. Sie kommentierten das Ganze mit keinem Wort.
Was Mia sich jetzt machen lassen würde, bekam man nicht mehr im Tattoo-Shop. Es war schlicht illegal.
Die restlichen Arbeitsstunden verbrachte Mia wie auf Stand-by.
Achtzig Jahre alt waren die beiden Turmhochhäuser des Frankfurter Tors inzwischen. Schon zu Bauzeiten nicht die höchsten Häuser der Stadt, wirkten sie dank ihrer mehrstöckigen Kuppelaufbauten immer noch imposant. Riesige Bilder, von Projektoren an die Mauern geworfen, flimmerten über das Grau: Raumschiffe der terranischen Flotte, dann Naats, die monströsen neuen »Freunde« der Menschen. Zwischendurch ein Bild von Perry Rhodan, dem Mann, der die Außerirdischen zur Erde gebracht hatte und der jetzt irgendwo unterwegs war. Beeindruckend. Normalerweise hätte Mia geguckt, aber sie hatte keinen Sinn für so etwas.
Auf seine Art nicht weniger beeindruckend wirkte der Mann, der Mia, als sie aus dem U-Bahnhof stieg, im kaum vorhandenen Schatten des Südturms erwartete.
Als Erstes fiel ihr ins Auge, wie kräftig er gebaut war. 1,90 Meter, stramme Oberschenkel, schmale Hüften und ein unglaublich breites Kreuz. Was er Oberarme nannte, besaßen manche Leute nicht einmal an Schenkelumfang.
Er trug sandfarbene Wüstenboots, eine fleckig gebleichte Jeans mit gekrempelten Beinaufschlägen und ein riesiges weißes T-Shirt mit abgeschnittenen Ärmeln. Von seiner Panzerung war auf den ersten Blick nur der Nackenschild zu sehen, der oben aus dem Shirtkragen ragte.
Sein kahler Schädel mit den drei Hornansätzen glänzte.
Mia ging auf ihn zu und spürte wieder einmal körperlich, welche Anziehungskraft er auf sie ausübte – als würde sie in sein Schwerefeld eintreten. Als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, mittags in einer rumpelnden alten Tram, hätte sie sich am liebsten an ihn geschmiegt und geschnurrt. Und gleichzeitig hatte sie Angst vor ihm gehabt.
Aber, wie sie immer sagte: Wo die Angst war, da ging's lang. Also hatte sie noch in der Tram dafür gesorgt, dass er sie ansprach.
»Hey«, sagte er, nahm ihr Kinn in die kräftigen, warmen Finger und bog ihren Kopf nach hinten. Er war einen halben Kopf größer als sie.
Sie küssten sich. Sein Brustpanzer lag hart unter ihren Fingerspitzen.
Er ging mit dem Kopf zurück und sah sie an aus seinen knallblauen Augen, von denen sie wusste, dass sie künstlich waren. »Nervös?«
»Bisschen.«
»Das wird toll! Wirst schon sehen. Komm.« Er zog sie um die Hausecke herum zum Eingang.
»Hier drin ist eine Untergrundklinik?«
»Aber hallo.« Er hielt plötzlich eine Plastikkarte in der Hand und zog sie durch einen Schlitz. Die Tür öffnete sich. »Lass dich überraschen.«
Der Aufzug brachte sie bis ganz nach oben – so glaubte Mia jedenfalls, bis Paul sie dann noch eine Wendeltreppe hinaufführte. »Ebene 13 – der Rauchsalon«, sagte er mit einer Armbewegung. Ein paar Sitzkuben, flache Tische, draußen vor den Fenstern die Ausdehnung des sommerlichen Berlins. An dem größten Tisch saß ein dunkelhaariger Mittdreißiger in typischer Wachschutzkleidung, aber ohne Firmenkennzeichnung. Vor sich auf dem Tisch hatte er eine Trinkflasche stehen, daneben lagen ein Tablet und einen Pod.
Paul nickte ihm kurz zu. »Bodenpersonal«, erklärte er Mia leise. »Kümmert sich um eventuelle Störungen.« Und weiter ging es die Wendeltreppe hinauf. Von oben drang Reggaemusik herunter, karg und luftig produziert. »Ebene 14 – die Bar. Heute leider geschlossen.« Flaschenreihen gleißten im Mittagslicht.
»Wofür ist das alles?«, fragte Mia und stellte zu ihrer Verblüffung fest, dass sie flüsterte.
»Hier finden normalerweise die richtig edlen Hochzeiten und Empfänge und Konferenzen statt, wenn du's gern traditionell und urban hast«, sagte Paul. »Ich hatte hier schon öfters Einsätze. Komm!«
Oben machte er eine ausholende Armbewegung: »Ebene 15 – der Kuppelraum.«
»Wow«, hauchte Mia. Sie bekam vage mit, dass der Bodenmann ihnen dezent gefolgt war; er verweilte einige Meter hinter ihnen auf der Treppe.
Bestimmt sechs Meter hohe, bodentiefe Fenster boten einen unglaublich guten Blick auf die Stadt. In vielleicht zwei Kilometern Entfernung glitzerte die Kugel des Fernsehturms am Alexanderplatz in der Sonne.
Der Kuppelraum war von einem ringförmigen Balkon umgeben; draußen vor den Fenstern zog sich sein weißes, kunstvolles Stahlgeländer entlang.
In der Raummitte jedoch blähte sich etwas, das die klassisch-elegante Atmosphäre störte: In diesem Ambiente hielt Mia es zunächst für eine Kunstinstallation – einen Atemzug später begriff sie, dass es sich um eine Art überdimensioniertes Sauerstoffzelt handelte. Leitungsbündel führten hinein. Hinter den halb transparenten, konvexen Planen waren die Umrisse von Geräten zu sehen. Eine Person bewegte sich dort drinnen. Irgendetwas wie ein Generator oder ein Gebläse lief; Mia konnte es zwischen den karibischen Klängen nicht richtig heraushören.
»Der Doc ist noch nicht ganz fertig«, sagte Paul. »Gehen wir raus, eine rauchen.«
Er hatte die Balkontür kaum hinter ihnen geschlossen, da fauchte Mia ihn an: »Das soll eine Untergrundklinik sein? Das ist ja kaum mehr als ein Notlazarett! Kein OP-Saal, keine Schwestern, was soll das denn werden? Da lege ich mich auf keinen Fall unters Messer! Auf gar keinen Fall.«
Paul rauchte zwei Zigaretten an und hielt ihr eine hin. Er sagte nichts.
Sie zog so fest an ihrer Zigarette, dass es knisterte. »Ich lasse doch niemanden in so einer ... so einer Campingküche an meinen Augen rumschnippeln. Da fange ich mir ja gleich mehrere Infektionen auf einmal ein, und am Ende bin ich blind. Tolle Augmentation!«
»Komm mal wieder runter«, sagte Paul ruhig. »Der Doc ist ein Freak, aber er macht schon alles richtig. Etwas anderes kann er sich auch gar nicht leisten. Er operiert total viele Russen und Han-Chinesen. Also keine Angst.«
Mia atmete zitternd aus. »Und die OP-Schwester? Der kann das doch nicht alles alleine machen. Wenn da was schiefgeht?«
Paul schüttelte den Kopf und lachte. »Ich bin deine OP-Schwester, Baby. Das hab ich dir doch alles schon vor Wochen erzählt. Hast du das echt komplett verdrängt?«
»Scheint so«, sagte sie bestürzt und gab sich einen Ruck. »Halte mich. Halt mich ganz fest.«
Er schloss sie in seine Arme. Sie spürte die beruhigende Härte seines Brustpanzers, atmete sein Parfüm, die Wüstendüfte, auf die er so sehr stand. »Sag mir, dass alles gut wird«, flüsterte sie.
»Alles wird gut«, brummte er. »Wirst schon sehen.« Er lachte leise. »Im wahrsten Sinne des Wortes. Stell dir das nur mal vor: Heute Nacht schon wirst du Katzenaugen haben – richtig auf Katze designte bionische Augen mit erweiterter Funktionalität. Nachtsicht, größeres Wahrnehmungsspektrum. Nicht bloß diese Kontaktlinsen mit Schlitzpupille ... sondern was Reelles.«
»Was Reelles«, flüsterte sie und schnupperte an seinem Hals.
Aber das schlechte Gefühl blieb.
Das schlechte Gefühl wollte auch nicht weichen, während der Doc ihren Eingriff vorbereitete.
Er redete viel, wie aufgedreht, aber Mia nahm kaum etwas anderes wahr als seinen Kopf.
Da war zum einen sein Gesicht. Die rechte Augenpartie betonte ihre Künstlichkeit; die sauber eingefügten Rundungen bestanden aus Messing mit orangem Finish, und der Augapfel erinnerte an ein Kleinod der Uhrmacherkunst. Pausenlos verschoben sich konzentrische Ringe darin.
»Rhabdomyosarkom«, erklärte der Arzt auf Mias Blicke hin. »Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde. Schlicht gesagt, Augenhöhlenkrebs. Rezidiviert, als ich Anfang zwanzig war. Meine Kumpels haben sich Schmucknarben gesetzt; ich habe hierfür gespart.« Er tippte sich mit dem Datenstift an die Augenpartie, es gab ein klackendes Geräusch. »Fand ich cooler. Finde ich immer noch cooler.«
Dergleichen hatte Mia schon öfter gesehen – überstandene schwere Erkrankungen nicht durch Schönheits-OPs zu verstecken, sondern im Gegenteil als wichtige Lebenserfahrung herauszustreichen, war durchaus ein Trend in der Cyco-Szene.
Aber dann war da ja noch Docs Schädel unter der hellgrünen OP-Haube.
Irgendwelche Wülste spannten den dünnen Stoff, und sie bewegten sich träge. Es erinnerte Mia vage an den Bauch einer Hochschwangeren, an die straff gespannte Haut, die sich von den Kindsbewegungen ausbeulte; nur war es ungleich gruseliger.
Mia konnte kaum ihren Blick davon wenden, während sie auf einer, wie der Doc das nannte, »komplett autonomen Diagnoseliege« lag. »Ein teurer Spaß, aber für Leute wie uns, die gern allein und ungestört arbeiten, genau das Richtige. Die Elektroden im Kopfteil nehmen ein Terabyte an Biodaten auf. Der integrierte Scanner erstellt dir Realbilder von Querschnitten durch den gesamten Körper. Die eingebaute Apotheke ist allerdings eine abgespeckte Version; die meisten Mittel brauchen wir für unsere Zwecke ja eh nicht.«
Hinzu kam, dass Operationen der Cyber-Community weitgehend ohne Betäubung durchgeführt wurden. Wer Schmerzen und verstörende Eingriffe nicht aushielt, sollte seinen Körper lieber nicht modifizieren lassen.
Aus diesem Grund lief gerade ein Screening auf psychoaktive Substanzen.
»Hm. Du hast erstaunlich wenig konsumiert für eine Cyco.«
»Ich kann Halluzinogene nicht ausstehen«, sagte Mia. »Da komme ich nur auf den Horror.«
»Aha. Ist dir das öfter passiert, ja?«
Ihre Wangen prickelten. »Ich hab da immer die Finger von gelassen.«
»Fast immer«, korrigierte sie der Doc. »Ich sehe hier noch einen Hauch von Hero/3.«
Mia sagte nichts. Das war in einem anderen Leben gewesen. Sie hatte einen bekloppten Freund gehabt, einen Junkie, und sie war so bekloppt gewesen, die Droge, mit der er sich am liebsten abschoss, selbst einmal auszuprobieren. Um sich besser in ihn hineinversetzen zu können. Bekloppt eben.
»Wie auch immer«, fuhr der Doc fort, als von ihr nichts kam. »Auf die innere Stimme zu hören, ist nie verkehrt. Also solange sie nichts Pathologisches rauskorkt.« Er lachte meckernd; erstaunlich, wie das zu seinem Ziegenbart passte. »Die Ergebnisse jedenfalls: regelmäßiger THC-Konsum in niedriger Dosierung; gelegentlich größere Mengen Alkohol; hm, und mit Oxytocin hast du anscheinend auch ein bisschen experimentiert – hat's Spaß gemacht?« Er wackelte mit den Augenbrauen.
Mia grinste nur. Das Kuschelhormon war nicht schlecht. Aber wirklich gut war es auch nicht. Viele ordneten die aphrodisische Wirkung des Nasensprays rein dem Placeboeffekt zu.
»So«, sagte der Arzt, »dann wollen wir mal kurz checken, was du dir bisher hast machen lassen.« Er zog ein paar Bilddateien groß. Obwohl Mia vor dem Anlegen des OP-Kittels weder ihr Top noch ihre Shorts abgelegt hatte und sogar ihre weich fallenden Stulpenstiefel noch trug, war ihr Körper vollständig nackt zu sehen. »Nahezu abgeschlossene Ganzkörpertätowierung einer Fellzeichnung ... Die Tasthaare oberhalb der Mundwinkel sind nur Piercings, dafür aber sehr sauber gesetzt; Respekt ...« Er zoomte an ihr rechtes Ohr heran, blätterte in Schichtdarstellungen. »Die spitzen Ohren sind aber klassisch selbst gemacht, hm? Keil herausgeschnitten und geklebt ... Eine Freundin? ... Als du siebzehn warst?«
»Neunzehn«, sagte Mia.
»Braves Mädchen. Wolltest mit deinen Eltern nicht in den Clinch gehen, hm?«
Wieder prickelten ihre Wangen.
»Jedenfalls«, sagte der Arzt, »kannst du dir da bei Gelegenheit noch glatten Knorpel einsetzen lassen, wenn du willst. Dann bekommst du richtige Katzenohren ...«
Sie zog die Schultern hoch. Auch wenn ihre Spitzohren eher nach Elfe als nach Katze aussahen; sie hing an ihnen. Es war ihre erste ernsthafte Modifikation gewesen.
»Okay, weiter im Text ... Die Krallen sind reine Maniküre ... Dann noch der spitz nach vorn in die Stirn gezogene Haaransatz und die Katzennase ... also bis an diesen Punkt keine Augmentationen, sondern reine Schönheitsgeschichten ... Wobei die Nase echt ein kleines Meisterwerk ist. Da tut auch nichts weh, oder? Bei Wetterwechseln und Ähnlichem?«
Mia verneinte.
»Gut. Ihr werdet nicht glauben, wie oft bei so etwas Nerven zerstört werden.«
»Und ob«, sagte Paul, der noch dabei war, sich an der mobilen Wascheinheit die Hände und Arme zu desinfizieren. »Ich kannte mal jemanden, der hat sich Sporne an die Ellbogen machen lassen, und dann ist ihm am einen Unterarm die halbe Muskulatur weggefault. Das wieder aufbauen zu lassen, hat ihn sein Auto gekostet.«
Der Doc machte ein skeptisches Gesicht. »Das hat dann aber sicher eher an einer falsch gesetzten Narkosespritze gelegen.«
»Wie ich immer sage – mach's besser ohne.« Paul grinste. »Narkose gibt Nekrose.«
Mia hatte den Drang, sich zu bewegen. Sie schlug die Beine andersherum übereinander und strich sich über die kurzen Haare.
Der Arzt legte ihr eine Hand auf die Stirn. Die Hand war warm und trocken. »So, Schätzchen. Dann zu deinen Augen. Einmal schön offen lassen, bitte.« Er führte einen Hohlsauger an ihre Augäpfel heran und entfernte nacheinander die Kontaktlinsen, die sie trug, um Schlitzpupillen vorzutäuschen.
Dann richtete er sich auf und musterte sie. »Interessant. Du trägst fast dieselbe Augenfarbe, die du ohnehin hast.«
»Ich mag es halt nicht, wenn Leute ihren Typ verändern«, sagte Mia. »Man sollte schon zu dem stehen, was man ist.«
Der Arzt ging nicht darauf ein, sondern sah sie unverwandt an; sein Blick sprang zwischen ihren Augen hin und her.
»Was?«, fragte Mia.
»Du hast wirklich die Augen einer großen Raubkatze, auch ohne Schlitzpupille. Aufmerksam, klug und ohne Gnade – die Augen eines Jaguars. Bist du dir sicher, dass du die augmentieren lassen willst?«
»Doch. Ja.« Sie musste schlucken und schaute kurz zu Paul hinüber. Er zwinkerte ihr zu.
Der Doc betrachtete sie noch einen Moment länger, dann kehrte er ihr den Rücken zu und machte sich an einem Metallkoffer zu schaffen. Mia beobachtete mit Grausen, wie sich unter seiner beuligen grünen Haarhaube erneut etwas bewegte. Eine Schlange? Trug er ein Schlangennest auf dem Kopf? Hatte er sich ein Medusenhaupt augmentieren lassen? Ging so etwas denn?
Als er sich wieder zurückdrehte, hielt er einen durchsichtigen Kunststoffbehälter in der behandschuhten Hand. Darin schwebten zwei helle, annähernd halbkugelförmige Gebilde. »Et voilà – deine bionischen Augen.« Er hielt sie Mia hin, und sie sah an den winzigen Lufteinschlüssen, dass die beiden Halbkugeln in einem klaren Gel schwammen.
Mia wusste, dass es sich dabei nur um die Vorderseite ihrer Augmentationen handelte. Früher hatte sie wie so viele Menschen geglaubt, dass man ein Auge aus seiner Höhle herausholen und dann operieren oder ersetzen konnte – aber das war Unfug aus dem Reich der urbanen Legenden und der Horrorfilme. Ein Augapfel hing in einem festen Gespann von sechs Muskeln, und der Sehnerv war von harter Hirnhaut umgeben. Da war kein Spielraum für ein Herausholen.
Das native Auge musste unwiederbringlich zerstört werden. Anschließend wurde das bionische Auge aufgebaut: zunächst das Implantat, die hintere Halbkugel, die mit den Augenmuskeln vernäht wurde; und dann galt es, den hineinführenden Sehnerv mit der vorderen Halbkugel zu koppeln, auf eine Weise, die im Netz nirgendwo richtig erklärt wurde und die Mia darum fast schon magisch vorkam. Und dann konnte man wieder sehen. Mit neuen, verbesserten Augen.
Wenn alles klappte.
Mia musste schlucken. Reine Routine, hatte Paul gesagt. Weltweit zehntausendfach durchgeführt bei Sicherheitskräften und Personenschützern. Paul hatte sich eine ähnliche Augmentation längst machen lassen.
Sie räusperte sich. »Was ist denn mit der Iris? Die ist ja kaum zu sehen.«
»Die stelle ich gleich noch auf deine Wunschfarbe ein; das dauert Sekunden, einfach per Balkenkode mit dem Pod. Das Programm schiebe ich dir noch rüber; die Farbe lässt sich also später jederzeit ändern. Auch noch ein paar andere Parameter lassen sich anpassen, aber das würde jetzt zu weit führen.«
Tatsächlich brauchte es nur wenige Handgriffe, und Mias zukünftige bionische Augen erstrahlten im Braungrün ihrer nativen Sehorgane.
Dann ging es an den eigentlichen Eingriff, der auf drei Stunden angesetzt war, neunzig Minuten für jedes Auge, dazwischen mit der Möglichkeit einer Pause, falls Mia diese brauchen würde.
Der Doc fing mit ihrem linken Auge an. Er nahm eine Leitungsanästhesie vor, die den Schutzreflex des Auges unterdrückte. Als es völlig bewegungslos war, klammerte er die Augenlider. Mia spürte die Klammern, aber es war eine völlig schmerzfreie Empfindung. Der mental schlimmste Moment war, als der Doc mit dem Skalpell kam und der Sehnerv plötzlich nur noch Wabern meldete, weil Doc die Linse entfernt hatte. Mia sah die vagen Lichter, die linksseitig ihr Gesichtsfeld einschränkten, und richtete den Blick an die niedrige Decke aus weißlichen Planen. Sie bildete sich ein, etwas zu riechen, etwas Organisches.
Als sie sich immer wieder räuspern musste, fragte der Doc, ob sie ihr anderes Auge lieber abgedeckt haben wollte. »Manche finden das angenehmer.«
»Bloß nicht! Ich komme schon klar.«
Auch Paul räusperte sich, ein Echo der Solidarität.
»Multimedia«, sagte der Doc betont deutlich. »Auswahl Rocksteady vier. Modus Shuffle.«
Archaisch klingender Reggae erfüllte den Kuppelraum.
»Lautstärke plus zwei.«
Mia atmete tief durch. Die Musik half. Sehr.
Sie hörte die Geräusche nicht mehr, die ihr über die Knochen ins Ohr drangen, spürte nur noch Bewegungen in der Augenhöhle, Kälte vielleicht. Docs Knöchel oder Fingerspitzen an ihrer Wange.
Manchmal schlug ihr Herz schneller.
Ich halte das aus, dachte sie dann. Drei Stunden sind gar nichts. Da habe ich schon doppelt so lange Tattoo-Sessions gehabt. Und die haben wehgetan.
Dann bewegten sich diese Wülste unter seiner grünen OP-Haube besonders stark. Irgendetwas drohte herauszufallen oder sich unter dem Gummi hervorzuschieben.
Ihr Herz wollte sich gar nicht wieder beruhigen.
»Alles okay?«, fragte der Doc.
»Doch. Wieso?«
»Deine Hände«, sagte Paul. »Und du hältst die Luft an.« Er deutete auf eine Anzeige.
Sie begriff, dass sie sich an den Rändern der Liege festklammerte. Mit Mühe lockerte sie ihre Finger. Atmete durch.
»Ich komm schon klar«, sagte sie. »Alles okay. Geht die Musik noch ein bisschen lauter?«
Ich frag ihn erst, wenn wir Pause machen, beschloss sie. Dann soll er mir seine Schlangen zeigen! Aber jetzt bin ich ruhig. Total ruhig.
Ihr Herz glaubte ihr das nicht, dennoch kriegte es sich allmählich wieder ein.
Kurz darauf kündigte der Doc das Abschließen der Enukleation an. »Jetzt geht's an die extraokulären Muskeln; die werden mit absorbierbarer Naht gekennzeichnet, dann räume ich noch ein bisschen auf, und dann suchen wir die passende Implantatgröße heraus. Wir liegen übrigens eins a in der Zeit.«
Und zwei der kurzen Songs später: »Paul, jetzt die Schale, auf der Messung steht. Ja, die mit den beiden Kugelhälften. Danke. Das Implantat muss genau so tief in die Augenhöhle eingesetzt werden, dass es keine Spannungen im darüberliegenden Gewebe verursacht ... Könnte man anhand der Scans machen, aber manchmal ist die gute alte Handmessung doch überlegen ... Fingerspitzengefühl ... Okay, Paul ...« Der Doc sagte eine Größe an. »Jetzt in die Lösung damit; die ist antibiotisch und lokal anästhetisierend.«
Nach einem Moment des Wartens spürte Mia wieder Docs Finger und tief in ihrem Kopf, hinter ihrem Gesicht, eine Manipulation. »Fein. Sitzt perfekt«, sagte der Doc. »Ich vernähe jetzt die äußeren Augenmuskeln mit dem Polymer. Aber vorher lege ich sämtliche Nähte durch die Perforation; dann geht's einfacher.«
»Ich glaube, ich will das alles gar nicht so genau wissen«, sagte Mia. »Und vielleicht deckt ihr mir doch mein anderes Auge ab?«
Gnädige Dunkelheit senkte sich auf sie herab. Vielleicht-Dunkelheit voller Schlieren und Schemen.
Ich halte das aus, dachte sie. Drei Stunden sind gar nichts.
Wie ein Mantra sagte sie sich das, immer und immer wieder, konzentrierte sich auf die Musik und zählte für jeden Song, der aus Docs Anlage kam, drei Minuten OP-Zeit weiter.
2.
Nahor
»Hab keine Angst, Ingisi!«, flüsterte Nahor. »Diese Menschen können uns nichts anhaben.«
Unwillkürlich beugte sich der Orbton vor. Die junge Soldatin, sie war keine zwanzig, ging ihm nicht einmal bis zur Brust – doch dafür hatte sie die breiteren Schultern.
»Unarkonidisch«, wie Honoss bei jeder Gelegenheit betonte. »Und unästhetisch.«
»Ich habe keine Angst!« Ingisis Finger klammerten sich noch fester um den Kombistrahler, straften ihre Worte Lügen.
»Dann ist es ja gut.« Nahor trat einen Schritt zurück, als er erkannte, dass er die Soldatin vor ihren Kameraden bloßzustellen drohte. »Wieso auch?«
Der Orbton wandte den Blick von der stämmigen Ingisi ab, ließ ihn über seinen Zug wandern. Ein Dutzend Soldaten in Kampfanzügen, ihm als Offizier unterstellt. Einer von mehreren Hundert Zügen, die sich in diesem Augenblick in den Hangars der ENDRIR auf den Angriff vorbereiteten. Eine durchaus beachtliche Streitmacht, doch in den riesigen, verlassenen Hallen – der Schlachtkreuzer hatte sämtliche Beiboote ausgeschleust – wirkte das Häuflein der Soldaten verloren.
Die Männer und Frauen warteten, versuchten ihre Nervosität zu überspielen. Manche mit demonstrativer Ruhe, andere mit ebenso demonstrativen, beiläufigen Gesprächen. Der Einsatz, hatte Reekha Chetzkel ihnen vor einigen Minuten in einer kurzen Ansprache mitgeteilt, war Routine, ein besserer Spaziergang für die ruhmreiche Flotte des Großen Imperiums.