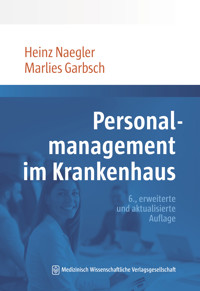
Personalmanagement im Krankenhaus E-Book
89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Health Care Management
- Sprache: Deutsch
Fachkräftemangel, steigende Ansprüche an die Attraktivität des Arbeitsplatzes und der weiter zunehmende Wettbewerb um die besten Talente erfordern neue und bessere Strategien seitens der Führungskräfte und Personalmanager in Krankenhäusern. Sie sind gefordert, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die sowohl an den Bedürfnissen der Belegschaft nach einer bestmöglichen Behandlung der Patienten als auch an der Berücksichtigung von persönlichen Bedürfnissen der Mitarbeitenden orientiert sind, um so eine positive Arbeitgebermarke zu entwickeln. Work-Life-Balance, veränderte Altersstrukturen der Belegschaften, steigende Anforderungen an Qualifikation, Motivation und Effizienz, eine zunehmende Digitalisierung, Nachhaltigkeit der Personalarbeit sowie soziale und gesundheitliche Vorsorge am Arbeitsplatz sind weitere vitale Herausforderungen für das Personalmanagement im Krankenhaus. Das Standardwerk bietet einen kompakten Überblick über die Grundlagen und Felder des Personalmanagements im Krankenhaus sowie aktuelle Fallbeispiele. Die 6. Auflage wurde umfangreich aktualisiert und um neue Themen erweitert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 759
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Health Care Management
Heinz Naegler und Marlies Garbsch
Personalmanagement im Krankenhaus
6., erweiterte und aktualisierte Auflage
mit Beiträgen von
Sebastian Dienst | Carla Eysel | Gabriele Fuchs-Hlinka | Julia Herrmann | Lars Herrmann | Jana Jelenski | Irene Kloimüller | Hagen Kühn | Marcel Länger | Darije Lazovic | Anja Mumbauer | Viktor Oubaid | Joachim Prölß | Astrid Sadlak
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Prof. Dr. Heinz Naegler
Preußenallee 31
14052 Berlin
Mag. Dr. Marlies Garbsch
Breitenseerstraße 20-22/11
1140 Wien
Österreich
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstraße 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-991-2 (eBook: PDF)
ISBN 978-3-95466-987-5 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationabibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2025
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen nutzen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden.
Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Produkt-/Projektmanagement: Charlyn Triebel, Berlin
Lektorat: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout, Satz und Herstellung: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
Coverbild: © AdobeStock/NDABCREATIVITY
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Vorwort zur 6. Auflage
Seit dem Erscheinen der 5. Auflage des Buches „Personalmanagement im Krankenhaus“ im Jahr 2021 haben sich einige der Bedingungen für die Personalarbeit in den Krankenhäusern grundlegend geändert:
Der Mangel an Ärzten und Pflegefachkräften wächst weiterhin. Immer häufiger müssen Krankenhäuser Stationen zeitweise schließen, weil für die sichere Versorgung der Patienten nicht genügend Ärzte und/oder Pflegefachkräfte zur Verfügung stehen.
Der Anteil der Mitarbeiter, die aus unterschiedlichen Gründen eine Teilzeitbeschäftigung bevorzugen, und der Wunsch nach einem besseren Ausgleich zwischen Familie und Beruf nehmen zu.
Der finanzielle Druck auf die Krankenhäuser und das Insolvenzrisiko werden größer.
Neue Rechtsnormen für die Finanzierung der Krankenhäuser und damit deren Personalausstattung sind bereits wirksam bzw. werden demnächst in Kraft treten.
Die Digitalisierung auch der Personalarbeit spielt zunehmend eine größere Rolle.
Nachhaltigkeit der Personalarbeit gewinnt an Bedeutung. Nachhaltigkeit bedeutet dabei unter anderem, in den Erhalt der physischen und psychischen Gesundheit sowie in die berufliche Förderung der Mitarbeiter zu investieren und Mitarbeiter möglichst lange an das Krankenhaus zu binden, weil krankenhausspezifisches Wissen sonst verloren geht.
Mit der neuen Auflage werden die erwähnten Probleme aufgegriffen. Die zu deren Lösung notwendigen Instrumente werden in umfassend überarbeiteten und in neu eingefügten Kapiteln beschrieben.
Der Mangel an qualifizierten und motivierten Pflegefachkräften und parallel dazu die Verpflichtung, Pflegepersonaluntergrenzen für mehrere klinische Bereiche einzuhalten, ist eine der großen Herausforderungen für die Personalarbeit in den Krankenhäusern. Wenn es den Verantwortlichen nicht gelingt, für bestimmte pflegeintensive Krankenhausbereiche eine jeweils ausreichend hohe Zahl von Pflegefachkräften zu verpflichten, um damit die Pflegepersonaluntergrenzen einhalten zu können, muss die Zahl der in diesen Bereichen stationär zu behandelnden Patienten reduziert werden. Die bedarfsgerechte medizinische Versorgung könnte damit nicht mehr überall und jederzeit gewährleistet werden.
Für den ärztlichen Dienst gibt es Personaluntergrenzen nicht. Aber auch für diese Beschäftigtengruppe zeichnet sich ab, dass die vakant oder zusätzlich notwendig gewordenen Stellen vielfach nur mit erheblicher zeitlicher Verzögerung oder gar nicht besetzt werden können. Die Arbeitsverdichtung für Ärztinnen und Ärzte nimmt zu. Deren Sorge, aus Zeitmangel Patienten nicht immer sachgerecht behandeln zu können, ist nicht mehr zu überhören.
Um die skizzierten Probleme lösen zu können, ist es wichtig, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die
an dem Bedürfnis von Pflegefachkräften, Ärzten und Therapeuten, Patienten bestmöglich behandeln zu können, die aber auch an deren persönlichen Bedürfnissen – dem Wunsch nach mehr Freizeit zum Beispiel – orientiert sind, und die deshalb
dazu beitragen, Mitarbeiter möglichst lange an den Arbeitsplatz zu binden, die besten, auf dem Arbeitsmarkt aktuell zur Verfügung stehenden Mitarbeiter zu gewinnen und junge Menschen für die Ausbildung zur Pflegefachkraft oder für ein Studium der Medizin zu begeistern.
Joachim Prölß zeigt mit seinem Essay „Beschäftigtenorientierte Personalpolitik – Erfolgsfaktor Nr. 1. – Erfolgreiche Personalpolitik in einer Uniklinik“, wie es gelingen kann, eine für die Mitarbeiter überzeugende Unternehmenskultur zu gestalten und zu leben, wie die Mitarbeiter dazu motiviert werden, sich auch unter schwierigen Bedingungen mit allen ihren Fähigkeiten konstruktiv für eine bestmögliche Behandlung der Patienten zu engagieren.
Wenn in diesem Buch auf Beispiele aus anderen Wirtschaftszweigen verwiesen wird (wie zum Beispiel mit dem Essay „Psychologische Auswahl von Spitzenpersonal – Eignung von Piloten und Pilotinnen für das Cockpit von Verkehrsflugzeugen, Übertragbarkeit auf die Medizin“ von Viktor Oubaid), dann liegt dem die Überzeugung zugrunde, dass die Personalarbeit im Krankenhaus von Best-Practice-Beispielen aus der Wirtschaft profitieren kann. Was die Krankenhäuser von den Unternehmen anderer Wirtschaftszweige unterscheidet, sind deren jeweiligen kulturellen und strukturellen Spezifika. Diesen Besonderheiten wird ausführlich Rechnung getragen durch Kapitel 2 – „Die Sorge um die Patienten: Grundlage der Personalarbeit im Krankenhaus“ (Hagen Kühn) – und Kapitel 7 – „Kulturelle Bedingungen für die Leitungstätigkeit in Krankenhäusern“.
Das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) hat neue Regeln für das Bestimmen des Pflegepersonalbedarfs festgelegt. Mit dem Inkrafttreten des Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetzes (KHVVG) sind weitere neue Normen zu erwarten. Nicht mehr der Leistungserlös allein ist die bestimmende Größe für die Obergrenze der Personalkosten und damit für die Zahl der zu beschäftigenden Mitarbeiter.
Hinzu kommen für den Pflegedienst der volle Ersatz der durch den Pflegedienst verursachten Personalkosten sowie für alle Berufsgruppen die Vorhaltepauschale als weitere Quelle für die Finanzierung der Personalkosten. Die Kapitel 8.5.3 und 8.5.4 mussten deshalb grundlegend überarbeitet beziehungsweise neu geschrieben werden. Sebastian Dienst, Darije Lazovic, Marcel Länger und Anja Mumbauer haben diese Aufgabe dankenswerterweise übernommen. Sie zeigen mit ihren Beiträgen sehr anschaulich, wie in den von ihnen vertretenen Unternehmen Personalbedarfsbestimmung praktiziert wird. Sebastian Dienst und Darije Lazovic stellen in Kapitel 8.5.3 vor, wie im Deutschen Herzzentrum der Charité der Personalbedarf für den Pflegedienst ermittelt wird. Marcel Länger und Anja Mumbauer skizzieren in Kapitel 8.5.4 – als Ergebnis der durch die Krankenhaus-Reform geänderten Vorschriften – die Methoden, anhand derer für die BG Kliniken (Klinikverbund der gesetzlichen Unfallversicherung gGmbH) der Personalbedarf für den Ärztlichen Dienst bestimmt wird.
Für das langfristige Binden vorhandener Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz ist die Personalentwicklung von essentieller Bedeutung. Dieses belegt Gabriele Fuchs-Hlinka mit ihrem Essay (s. Kap. 10.4). Sie zeigt, wie die Personalentwicklung im Wiener Gesundheitsverbund umgesetzt wird mit (unter anderem) dem Ziel, die interdisziplinäre und multiprofessionelle Zusammenarbeit aller Berufsgruppen zu professionalisieren.
Angesichts – auch alternsbedingt – sich ändernder Bedürfnisse der Krankenhausmitarbeiter und neuer rechtlicher Normen war es notwendig geworden, die Kapitel 17 „Arbeitsfähigkeit und längeres Arbeitsleben“ (Irene Kloimüller) und Kapitel 18 „Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Zeitgemäße Dienstplangestaltung: bedarfs- und mitarbeitergerecht zugleich“ (Lars Herrmann, Julia Herrmann und Jana Jelenski) zu überarbeiten und zu aktualisieren.
Der Gesundheitssektor ist für 4,4% der globalen Nettoemissionen verantwortlich (Health Care Without Harm, 2019, S. 10). Zu diesen Emissionen trägt nicht nur der medizinische Bereich des Krankenhauses bei, sondern auch – wenngleich in deutlich geringerem Umfang – die Personalarbeit. Auch das Personalmanagement ist deshalb aufgefordert zu überlegen, wie die verschiedenen Aktivitäten der Personalarbeit so gestaltet werden können, dass der Ressourceneinsatz minimiert wird. Dazu zählt zum Beispiel auch, die Mitarbeiter möglichst lange an das Krankenhaus zu binden, um die Ressourcen, die im Zusammenhang mit der neuen Besetzung einer vakant gewordenen Stelle eingesetzt werden müssen, tunlichst zu schonen. Astrid Sadlak belegt (in Kap. 19), welche Maßnahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie durch die Niels-Stensen-Kliniken bereits umgesetzt worden bzw. noch geplant sind.
Carla Eysel beschreibt mit ihrem Beitrag (Kap. 20), welche Instrumente die Charité Universitätsmedizin Berlin einsetzt und geplant hat einzusetzen, um die Führungskräfte der Charité dafür zu gewinnen, Personalführung angesichts der Herausforderungen unter anderem auf dem Arbeitsmarkt neu zu denken. Sie präsentiert diverse Instrumente, die die Führungskräfte dabei unterstützen, die neue Führungsaufgabe anzunehmen und zu bewältigen. Die Digitalisierung diverser Prozesse und des Lernens sowie der Einsatz KI-basierter Systeme unter anderem zur Personalplanung und zur Personaleinsatzsteuerung sind dabei eine große Hilfe.
Die 6. Auflage des Buches „Personalmanagement im Krankenhaus“ konnte nur deshalb in der vorliegenden Form, angereichert mit vielen Beispielen aus der Praxis der Personalarbeit im Krankenhaus, entstehen, weil Anja Mumbauer, Sebastian Dienst, Carla Eysel, Gabriele Fuchs-Hlinka, Lars Herrmann, Julia Herrmann, Jana Jelenski, Irene Kloimüller, Hagen Kühn, Marcel Länger, Darije Lazovic, Viktor Oubaid, Joachim Prölß und Astrid Sadlak bereit waren, mitzuwirken. Auf der Grundlage ihrer unterschiedlichen praktischen Erfahrungen als Führungskräfte oder als Experten in Krankenhäusern zeigen sie mit ihren Beiträgen unseren Lesern, wie aktuelle Probleme der Personalarbeit an anderer Stelle bereits erfolgreich gelöst worden sind und regen damit zur Nachahmung an. Für dieses Engagement sind wir unseren Autorinnen und Autoren sehr dankbar.
Dank sagen möchten wir schließlich dem Verleger Thomas Hopfe, der die Veröffentlichung dieser 6. Auflage ermöglicht hat, der Projektmanagerin Charlyn Triebel und der Lektorin Monika Laut-Zimmermann für ihre erneut professionelle und umfassende Unterstützung bei der Herstellung und Veröffentlichung der 6. Auflage dieses Buches.
Berlin, Wien im Mai 2025
Heinz Naegler, Marlies Garbsch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
IGrundlagen
1Zur Ausgangssituation
1.1Ziele und Aufgaben des Personalmanagements
Essay:„Beschäftigtenorientierte Personalpolitik“ – Erfolgsfaktor Nr. 1. – Erfolgreiche Personalarbeit in einer UniklinikJoachim Prölß
1.2Akteure der Personalarbeit und deren Rollen
1.3Herausforderungen
1.4Finanzielle Rahmenbedingungen
1.5Zusammenfassung
2Die Sorge um die Patienten: Grundlage der Personalarbeit im KrankenhausHagen Kühn
2.1Einführung
2.2Kranksein und Sorgesituation
2.3Umrisse der sozialen Verantwortung
2.4Notwendigkeit, vertrauen zu können
2.5Persönliches Vertrauen
2.6Soziales Vertrauen
2.7Sorgebeziehung, Wirtschaftlichkeit und ‚moral economy‘
2.8Bürokratisch-technischer Eigensinn und Ökonomisierung
2.9Bürokratischer Eigensinn
2.10Ökonomisierungstendenz
2.11Patientenorientierung
2.12Interessenkonflikt und moralische Dissonanz
2.13Moralischer Verfall oder struktureller Interessenkonflikt?
3Grundpostulate der Personalarbeit
3.1Charakterisierung und Überblick
3.2Erfolgsorientierung
3.3Flexibilisierung
3.4Individualisierung
3.5Kundenorientierung
3.6Qualitätsorientierung
3.7Sicherung der Akzeptanz
3.8Professionalisierung
3.9Nachhaltigkeit
3.10Stimmigkeit
4Felder des Personalmanagements – ein Überblick
4.1Einführung
4.2Personalbedarfsbestimmung
4.3Personalbestandsanalyse
4.4Personalveränderung
4.5Personaleinsatz
4.6Personalkostenmanagement
4.7Personalcontrolling
4.8Personalführung
5Ebenen des Personalmanagements
5.1Einführung
5.2Strategische Positionierung des Krankenhauses
5.3Strategisches Personalmanagement
5.4Taktisches Personalmanagement
5.5Operatives Personalmanagement
5.6Zusammenfassung
6Personalmanagement als Bestandteil des Krankenhausprozesses
6.1Von der Personaladministration zum Personalmanagement – oder: das Personalmanagement als Querschnittsfunktion
6.2Die Personalstrategie als Teil der Unternehmensstrategie
6.3Die prozessorientierte Gliederung des Krankenhauses
6.4Verflechtungen des Personalmanagements
6.5Zusammenfassung
7Kulturelle Bedingungen für die Leitungstätigkeit in Krankenhäusern
7.1Einführung
7.2Das uno-actu-Prinzip
7.3Grenzen der Planbarkeit und Unwägbarkeiten als Merkmale der Pflegearbeit
7.4Die so genannte Ko-Produktionsthese
7.5Reserviertheit gegenüber Leitungs- und Organisationsarbeit
7.6Interprofessionalität organisieren
7.7Autonomie der Leistungsbereiche
7.8Informelle Prozesse dominieren
7.9Personenbezogenes Organisationsverständnis
7.10Abhängigkeit vom Trägermanagement
IIFelder des Personalmanagements
8Personalbedarfsbestimmung
8.1Ziele der Personalbedarfsbestimmung und Ziel-Dimensionen
8.2Positionierung innerhalb des Personalmanagements
8.3Formen der Personalbedarfsbestimmung
8.4Personalbedarfsbestimmung auf der strategischen Ebene
8.5Personalbedarfsbestimmung auf der taktischen Ebene
8.6Personalbedarfsbestimmung auf der operativen Ebene
8.7Organisation der Personalbedarfsbestimmung
9Personalbestandsanalyse
9.1Einführung
9.2Ziele, Aufgaben, Informationsbeziehungen
9.3Instrumente für die Ermittlung des Personalbestands
9.4Personalbestandsanalyse auf der strategischen Ebene
9.5Personalbestandsanalyse auf der taktischen Ebene
9.6Personalbestandsanalyse auf der operativen Ebene
10Personalveränderung
10.1Charakterisierung
10.2Personalmarketing
10.3Personalbeschaffung
Essay:Psychologische Auswahl von Spitzenpersonal – Eignung von Piloten und Pilotinnen für das Cockpit von Verkehrsflugzeugen, Übertragbarkeit auf die MedizinViktor Oubaid
10.4Personalentwicklung
Essay:Personalentwicklung und Personalbindung in Gesundheitsberufen – Best Practice im Wiener GesundheitsverbundGabriele Fuchs-Hlinka
10.5Personalfreisetzung
11Personaleinsatz
11.1Ziele und Aufgaben
11.2Ebenen des Personaleinsatzes
11.3Gestaltung der Arbeitsinhalte
12Personalkostenmanagement
12.1Ziele und Aufgaben
12.2Definition und Systematik der Personalkosten
12.3Ebenen des Personalkostenmanagements
12.4Dimensionen des Personalkostenmanagements
12.5Strukturierung und Beeinflussbarkeit der Personalkosten
12.6Personalkostenbudgetierung
12.7Gesetzlich und tariflich vereinbarte Entgelte und deren Anwendung
13Personalcontrolling
13.1Einführung in das Controlling im Allgemeinen
13.2Ziele und Aufgaben des Personalcontrolling
13.3Gegenstände des Personal controlling
13.4Personalcontrolling-Leitbild
13.5Zur Organisation des Personalcontrolling
13.6Anforderungen an den Personalcontroller
14Personalführung
14.1Ziele und Aufgaben der Personalführung
14.2Menschenbilder als Grundlage der Personalführung
14.3Personalführungsethik
14.4Führungskonzept
14.5Führungsgrundsätze
14.6Die Führungskraft als kooperativer Coach
14.7Instrumente der Personalführung
15Organisation der Personalarbeit
15.1Einführung
15.2Ordnungsprinzipien als Basis für die Organisation der Personalarbeit
15.3Organisationsformen der Personalarbeit
15.4Organisation der Personalabteilung
15.5Outsourcing des Personalmanagements
IIISchwerpunkte attraktiver Arbeitsplatzgestaltung
16Führungs(kräfte)entwicklung als zentraler Hebel für die Entwicklung von KrankenhäusernMarlies Garbsch
16.1Krankenhäuser im Spannungsfeld widersprüchlicher Erwartungen
16.2Verändertes Verständnis von individuellem Lernen
16.3Verknüpfung von individuellem und organisationalem Lernen
16.4Gestaltung von Führungsentwicklungsprogrammen
16.5Methodisch didaktische Gestaltung der „Lernsettings“
16.6Planung und Durchführung von Realprojekten im Rahmen des „Veränderungssettings“
16.7Fazit
17Arbeitsfähigkeit und längeres ArbeitslebenIrene Kloimüller
17.1Der demografische Wandel im 21. Jahrhundert
17.2Erhalt von Arbeitsfähigkeit
17.3„Return to Work“ – wenn Arbeitsfähigkeit wiederhergestellt werden soll
17.4Wie stabil ist das Haus der Arbeitsfähigkeit? – Analyse von Arbeitsfähigkeit
17.5Ein kurzes Resümee – 10 Empfehlungen
18Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Zeitgemäße Dienstplangestaltung: bedarfs- und mitarbeitergerecht zugleichLars Herrmann, Julia Herrmann und Jana Jelenski
18.1Ausgangsüberlegung: Kombination von Besetzungs- und Mitarbeiterorientierung
18.2Team-Modelle: Eigenverantwortliche Spielräume bei der Abdeckung des Besetzungsbedarfs
18.3Vorstrukturierungs-Modelle: Grunddienstpläne und Dienstmodule
18.4Verlässlichkeits-Instrumente: Flexibilitätsanforderungen mitarbeiterseits planbar machen
18.5Dienstdauer-Varianten
18.6Lebensphasenorientierte Arbeitszeit-Modelle
18.74-Tage-Woche auf Vollzeitbasis
19Nachhaltigkeit im Personalmanagement am Beispiel der Niels-Stensen-KlinikenAstrid Sadlak
19.1Definition des Begriffs „Nachhaltigkeit“
19.2Ansatzpunkte von Krankenhäusern zur Auseinandersetzung mit Themen der Nachhaltigkeit
19.3Optionen zum Einbezug von Mitarbeitenden in Themen der Nachhaltigkeit
19.4Umsetzung von Projekten im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie
19.5Chancen und Herausforderungen
19.6Fazit
20Wenn Ressourcen knapp sind. Organisation neu denken – der große Wandel und die Rolle der Digitalisierung im KrankenhausCarla Eysel
20.1Einleitung
20.2Herausforderungen und Lösungen für Leitungspersonen im Krankenhaus
20.3Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
Sachwortregister
Die Autorinnen und Autoren
IGrundlagen
1Zur Ausgangssituation
1.1Ziele und Aufgaben des Personalmanagements
Die Ziele des Krankenhausmanagements sind die Sicherstellung des Angebots einer evidenzbasierten Medizin – es schafft die dafür geeigneten Arbeitsbedingungen, die langfristige finanzielle Sicherung des Krankenhauses sowie den Erhalt der in ihm vorgehaltenen Arbeitsplätze. Damit wird das Krankenhaus in die Lage versetzt, seinem Versorgungsauftrag auf Dauer nachzukommen. Diese Ziele sind dann realisierbar, wenn gewährleistet ist, dass die Patienten1 und die einweisenden Ärzte mit den Leistungen des Krankenhauses zufrieden sind, und auf diese Weise mit einer dauerhaft ausreichenden Inanspruchnahme mit ausreichend hohen Erlösen gerechnet werden kann. Zufriedenheit der Patienten und der einweisenden Ärzte setzt eine auf eine entsprechende Struktur- und Prozessqualität gestützte hohe Behandlungs- und Servicequalität sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis voraus.
Die zuletzt genannten Ziele lassen sich verwirklichen, wenn das Personalmanagement bedarfsgerecht qualifizierte und motivierte Mitarbeiter gewinnen, an das Krankenhaus binden und wirtschaftlich einsetzen kann, wenn es Arbeitsbedingungen schafft, die als Anreize für die Krankenhaus-Führungskräfte und -Mitarbeiter dafür sorgen, dass diese ihre Fähigkeiten effektiv und effizient im Sinne der genannten Ziele mobilisieren und umsetzen. Das Personalmanagement leistet auf diese Weise einen positiven Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Krankenhauses.
Die den Personalbereich betreffenden Ziele lassen sich mit Blick auf die Maßnahmen, die zu deren Realisierung umzusetzen sind, in zwei Gruppen einteilen (s. Tab. 1).2
Tab. 1 Ziele und Maßnahmen des Personalmanagements sowie deren Zusammenhang mit den Feldern des Personalmanagements
Unter Berücksichtigung der unternehmerischen Verantwortung des Personalmanagements lassen sich dessen Ziele auch wie folgt charakterisieren (von Eiff 2000, S. 168):
Das Personalmanagement leistet einen Beitrag zur Wertschöpfung, indem es dabei hilft, dass die Führungskräfte des Krankenhauses und deren Mitarbeiter die Patientenversorgung qualifiziert und effizient realisieren können.
Dies leistet das Personalmanagement dadurch, dass die Kompetenz der Mitarbeiter und des Unternehmens weiter entwickelt werden.
Das Personalmanagement entwickelt und implementiert Personalführungs-Instrumente, damit die Führungskräfte des Krankenhauses zur Wahrnehmung ihrer Führungsaufgaben entsprechende Unterstützung erfahren können.
Eine zentrale Aufgabe des Personalmanagements ist die Personal- und Organisationsentwicklung mit dem Ziel, die Innovationsfähigkeit und die Fähigkeit des Krankenhauses zu stärken, mit sich ändernden Herausforderungen und Rahmenbedingungen erfolgreich und möglichst antizipativ umzugehen.
Die Ziele des Personalmanagements haben nicht nur eine inhaltliche, sondern auch eine zeitliche Dimension:
Korrekturen im Personalbestand können vor allem dann, wenn für deren Realisierung nicht viel Zeit zur Verfügung steht, sehr kostenintensiv werden. Entweder müssen Mitarbeiter kurzfristig und überhastet rekrutiert werden, wenn die erforderlichen Qualifikationen im Unternehmen nicht zur Verfügung stehen. Für eine sorgfältige Personalauswahl steht dann nicht die notwendige Zeit zur Verfügung; Fehlentscheidungen können die Folgen sein. Oder es werden die zusätzlich notwendigen Mitarbeiter über Personalleasing beschafft – mit gegenüber den im Unternehmen angestellten Mitarbeitern möglicherweise höheren Kosten. Wenn sich das Unternehmen kurzfristig von Personal trennen muss, entstehen hohe Kosten durch Abfindungen oder andere Arten von Trennungsentschädigungen.
Die Antizipation der die Personalarbeit beeinflussenden Entwicklungen ist die effizientere Strategie. Sie ermöglicht die Substitution der kostenintensiven Freisetzung der Mitarbeiter, die aufgrund geänderter Anforderungen nicht mehr eingesetzt werden können, und die ebenfalls mit zusätzlichen Kosten verbundene Rekrutierung neuer Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten durch die möglicherweise weniger kostenintensive, in jedem Falle aber sozial verträglichere Personalentwicklung und damit die Befähigung vorhandener Mitarbeiter für die Übernahme der Aufgaben mit geänderten Anforderungen.
Die Herausforderungen, die an späterer Stelle (s. Kap. 1.3) beschrieben werden, sind im Regelfall über einen längeren Zeitraum vorhersehbar. Das Personalmanagement hat deshalb meist genügend Zeit und benötigt diese auch, sich auf die daraus zu ziehenden Konsequenzen vorzubereiten. Überstürzte und kostenintensive Reaktionen lassen sich vielfach vermeiden.
Essay:„Beschäftigtenorientierte Personalpolitik“ – Erfolgsfaktor Nr. 1. – Erfolgreiche Personalarbeit in einer UniklinikJoachim Prölß
Beschäftigtenorientierte Personalpolitik im Kontext
Personalarbeit im Krankenhaus hat es nicht einfach, und das hat ganz unterschiedliche Ursachen. Zunächst einmal steht in einer sozialen Organisation zwar der humane Aspekt stark im Vordergrund, aber es steht in erster Linie (und so muss es natürlich auch sein) der Patient im Mittelpunkt und zunächst nicht der Beschäftigte. Es wird wahrscheinlich kein Leitbild eines Krankenhauses geben, in dem dies nicht pointiert und mit aller Klarheit formuliert ist. Dort heißt es dann beispielsweise „Unser Erfolg ist die Patientenzufriedenheit“ oder „Jeder Patient wird in seiner Individualität respektiert“. Die Organisation Krankenhaus agiert heute in einem viel größeren Wettbewerb, als noch vor 20 Jahren. Daher hat die patientenorientierte oder patientenzentrierte Organisation eine große Bedeutung erlangt, die auch stark dienstleistungsorientierte Ansprüche erfüllen muss. Der Patient wird zum Kunden und Klienten mit klar formulierten Ansprüchen und Wünschen. Da diese Dienstleistung im Krankenhaus im Wesentlichen von Menschen erbracht werden muss, steht und fällt der Erfolg im Unternehmen Krankenhaus mit den Dienstleistern, den Mitarbeitenden. Ob die Mitarbeitenden sich auch tatsächlich als Dienstleister sehen, steht dabei noch einmal auf einem anderen Blatt. Es wird aber deutlich, dass dem Mitarbeitenden eine große Bedeutung zugesprochen werden muss, wenn man zufriedene und professionell versorgte Patienten (Kunden!) quasi als Ziel seines unternehmerischen Wirkens erreichen möchte.
Wenn der Mensch „Patient“ – wörtlich gesprochen – im Mittelpunkt des Handelns steht, kann eine beschäftigtenorientierte Personalpolitik natürlich nicht den Mensch „Mitarbeiter“ auch in diesen Mittelpunkt stellen. Dort ist dann kein Platz mehr und es würde zu einem Verdrängungswettbewerb kommen. Neben diesen beiden Aspekten Patient und Mitarbeiter gibt es vor allem einen weiteren sehr relevanten Faktor im Krankenhaus: die Wirtschaftlichkeit. Der enorme Druck auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein, führt zu einem weiteren Wettbewerb um den beschriebenen Mittelpunkt. Jeder von uns kann genügend Beispiele anführen, warum ein Krankenhaus weder patientenorientiert noch mitarbeiterorientiert wirken kann, weil wirtschaftliche Zwänge und Rahmenbedingungen, zu geringe Investitionsquoten oder ungerechte Vergütungssysteme vom Management bearbeitet werden müssen. Diese Spannung zwischen Patienten, Mitarbeitenden und Wirtschaftlichkeit, haben aber nun alle Krankenhäuser auszuhalten und zu gestalten.
Darüber hinaus gibt es aber auch einen sehr positiven Zusammenhang. Zufriedene Mitarbeitende und eine exzellente Versorgung bedingen und fördern sich häufig wechselseitig. Und ökonomisches Handeln kann auch sehr patientenorientiert sein, wenn beispielsweise stringente Prozesse nicht nur Geld sparen, sondern auch Wartezeiten verkürzen. Bildlich gesprochen muss ein zeitgemäßes Management diese Spannungsfelder eher wie ein guter Jongleur mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln spielerisch in der Luft und in Bewegung halten. Erfolgreiche Krankenhäuser stellen sich ganz einfach dieser Herausforderung. Sie erklären beispielsweise in ihren Unternehmensleitbildern nach intern und extern, dass es diese Spannungen gibt, beschreiben ehrlich die Chancen und Grenzen und haben gerade so Erfolg mit ihrer Personalpolitik, die genau im Fokus dieses Essays stehen soll.
Was ist beschäftigtenorientierte Personalpolitik?
Die personalpolitische Ausrichtung eines Unternehmens orientiert sich an der grundsätzlichen Unternehmenspolitik. Das klare Bekenntnis zu einer Personalpolitik, die den besonderen Wert der Mitarbeitenden für das Krankenhaus sieht, muss also unternehmerisch verankert und auch gewollt sein. Hierbei gibt es zahlreiche Einflussfaktoren, beispielsweise durch Zielausrichtung, Trägerstruktur, ob es sich um ein Profit- oder Non-Profit-Unternehmen handelt und im besonderen Maße auch durch die Akteure auf der Top-Management-Ebene. Die gesellschaftlichen Erwartungen an die Organisation Krankenhaus spielen dabei ebenfalls eine Rolle. Beim Produkt Krankenhausbehandlung – oder klarer ausgedrückt Heilen – gibt es für den Patienten und Angehörigen eindeutige Erwartungen an die Dienstleistung und der mit ihr verbundenen Beziehungsgestaltung, insbesondere durch Ärzte und Pflegende. Hierbei hat das Management die Verantwortung, betriebliche und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit die Mitarbeitenden in die Lage versetzt werden, die Behandlungs- und Beziehungsarbeit überhaupt leisten zu können.
Die externen Einflussfaktoren auf die Personalarbeit ändern sich aktuell rasant. Im Vordergrund steht eine, zumindest in Teilen Deutschlands, dramatische Verknappung auf dem Arbeitsmarkt durch die demographische Entwicklung. Der Blick auf die Bevölkerungsstatistiken und die damit verbundenen Zukunftsprognosen machen uns schwindelig. Die Institute und Berater überbieten sich dabei mit dramatischen Zahlen von hunderttausenden fehlenden Arbeitnehmern, ganz vorne weg Pflegepersonal und Ärzte. Und als wäre das nicht genug, ändern sich auch die Menschen und damit die Bedeutung von Arbeit und Karriere in unserer Gesellschaft. Sprach man bis vor kurzen nur von einer „Work-Life-Balance“, beschreibt der umfassendere Begriff „Life-Domain-Balance“, dass es neben Arbeit und Privatleben mehr Lebensbereiche und viel komplexere Zusammenhänge gibt, wie Partnerschaft, Familie, Hobbys, gemeinnützige Arbeit oder die Gesundheit. Darüber hinaus muss Personalpolitik auch berücksichtigen, dass sich noch nie so viele Generationen auf dem Arbeitsmarkt gleichzeitig bewegt haben, wie in diesen Jahren. Die Bandbreite ist enorm: Eine Nachkriegsgeneration (!) bereitet sich gerade auf den Sprung in die Rente vor, während die Generation Z dabei ist, den Arbeitsalltag aufzumischen. Generationengerechtes Führen wird heute intensiv diskutiert. Einstellungen, Erwartungen und Wünsche der Generationen an die Life-Domain-Balance werden unterschiedlich beschrieben. Diese Zuschreibungen zu den einzelnen Generationen sind zwar teilweise plakativ, aber sie beschreiben sehr gut, dass es nicht eine Personalpolitik geben kann. Beschäftigtenorientierung bedeutet auch immer, sich am Individuum auszurichten.
Die beschäftigtenorientierte Personalpolitik im Unternehmen muss aber vor allem einigen Grundprinzipien folgen:
Sie benötigt einen Top-down-Ansatz, im Sinne „von oben ehrlich gewollt“ und mit maximaler Unterstützung von Vorstand bzw. Geschäftsführung.Die Personalpolitik muss Teil der gesamten Unternehmenspolitik sein. Dies ist ein Prozess der nicht einfach vom Himmel fällt.Alle Aktivitäten müssen in einem Konzept systematisch gebündelt werden.Personalpolitik ist immer dynamisch und entwickelt sich kontinuierlich weiter.Erfolg und Wirksamkeit müssen u.a. anhand von Personalkennzahlen gemessen werden.Beschäftigte und besonders die relevanten Gruppen müssen konkret beteiligt werden.Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf haben wir auf dieser Basis einen systematischen und konzeptionellen Ansatz verfolgt, von dem hier berichtet werden soll. Dargestellt wird keine „Blaupause“, aber beschrieben werden einige Erfolgsfaktoren und Leitplanken für eine erfolgreiche Personalarbeit.
Wie wird man zum attraktivsten Arbeitgeber?
Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) beschäftigt insgesamt mehr als 15.000 Mitarbeitende in Forschung, Lehre, Krankenversorgung, Administration und tertiärer Dienstleistung. Neben den zwei Hauptberufsgruppen Pflegedienst und Ärztlicher Dienst gibt es nahezu 200 verschiedene Berufe im Unternehmen. Vor einigen Jahren wurde von der Vorstandsebene mit den Beschäftigten ein Leitbildprozess initiiert. Bei der eigentlichen Zielsetzung kursierten Begriffe wie Selbstverständnis, Vision, Mission, Orientierung und Grundprinzipien. Methodisch sehr vielfältig und unter großer Beteiligung der unterschiedlichen Hierarchieebenen und Gruppierungen konnte nach einigen Monaten das neue UKE-Leitbild-Haus vorgestellt werden (s. Abb. 1).
Abb. 1 Leitbildhaus Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf
Die Entscheidung für ein eher tradiertes Modell eines „Hauses“ hatte methodische Vorteile. Das plakative Bild war leicht verständlich und konnte sehr gut an die zahlreichen und sehr unterschiedlichen Gruppierungen im Unternehmen kommuniziert werden: Ein Haus benötigt gute und stabile Fundamente (u.a. Wirtschaftlichkeit, Zusammenarbeit und Führung). Auf dieser Basis kann das Bauwerk UKE mit den fünf Säulen wachsen und wissenschaftlich und ökonomisch prosperieren. Die fünf Säulen stellen keine Hierarchisierung dar, sondern sie halten das „Dach“ mit dem Auftrag der „vernetzten Kompetenz“ mit einer ausgeglichenen Ausbalancierung. Das UKE-Leitbild durchläuft nach 8 Jahren aktuell einen Revisionsprozess. Nach den ersten Diskussionen wurde schnell deutlich, dass das Modell mit den Begrifflichkeiten nicht an Aktualität verloren hat, aber es sprachlich und bildlich in den nächsten Monaten modernisiert werden muss.
Über den Namen der Säule „Attraktivster Arbeitgeber“ gab es im Prozess zahlreiche Diskussionen. Hier verbirgt sich natürlich die Mitarbeiterorientierung und -zufriedenheit gemeinsam mit dem Fundament der Zusammenarbeit und Führung. Aus der Namensgebung leitet sich aber eine klare unternehmerische Mission ab, die sich insbesondere in einer beschäftigtenorientierten Personalpolitik darstellen lässt, aber auch in Form eines Employer Branding Prozesses der mehr nach außen gerichtet ist. Die oben dargestellten Einflussfaktoren zwingen uns als großen Arbeitgeber in einer Metropolregion, ein klares Profil zu zeigen und unseren Mitarbeitenden und zukünftigen Beschäftigten die Unterscheidungsmerkmale als attraktivster Arbeitgeber zu verdeutlichen. Die wesentlichen Eckpunkte einer zeitgemäßen Führungskonzeption spielen hierbei eine besondere Rolle:
Entwicklung der Führungs- und Unternehmenskultur ist Führungsaufgabe.Wir brauchen zukünftig ein inspirierendes Führungsklima.Wir brauchen mehr horizontale Führungsformen.Mit diesem klaren Auftrag im Rücken galt es nun, die Personalpolitik auf eine neue Stufe zu heben. An dieser Stelle sei angemerkt, dass es hier nicht um Marketing und Scheininhalte gehen darf. Für die Glaubwürdigkeit nach innen und außen müssen Inhalte, Konzepte und die Grundhaltung authentisch sein. Es gilt immer der Leitsatz, dass erst die Inhalte entwickelt und gefestigt werden, bevor etwas kommuniziert und „verkauft“ werden darf. Das Ganze geht daher nicht mit einem „Big Bang“, sondern lässt sich nur evolutionär entwickeln. Die Verankerung im Leitbild schützt dabei den Prozess vor sprunghaften Veränderungen im Management.
Attraktive Personalpolitik: Von der Vision zum Konzept
In jedem Unternehmen gibt es natürlich schon irgendeine Art von Personalpolitik. Eine neue, stärker beschäftigtenorientierte Herangehensweise muss darauf aufbauen. Entscheidend für die Verfolgung der beschäftigtenorientierten Personalpolitik in einem Krankenhaus ist die zu schaffende Struktur und Organisation, die sich nachhaltig der Beobachtung der Handlungsfelder und der resultierenden Maßnahmen annimmt. Typischerweise wird in den Krankenhäusern, die die Bedeutung des Themas ansatzweise erkennen, der Versuch unternommen, die personalpolitischen Handlungsfelder in vorhandenen Strukturen zu verorten. So kann man beispielsweise ohne vermeintliche Zusatzaufwände Themen in Richtung der Personalabteilung, einer betriebsärztlichen Untersuchungsstelle oder einer für Personalentwicklung vorgehaltenen Ressource zuweisen. Zumeist mit dem Ergebnis, dass es die entsprechenden Stellen überfordern und nicht zu einer nachhaltigen Verfolgung führen wird. Andererseits aber ist mancherorts eine Art Übereifer zu beobachten, wenn beispielsweise für jede vermeintlich kritisch zu betrachtende Entwicklung Spezialisten eingestellt werden. Viele dieser Funktionen gibt es im Betrieb auf Grundlage gesetzlicher oder organisatorischer Rahmenbedingungen. Jede Funktion bzw. Abteilung arbeitet für sich, es findet keine Abstimmung statt. Es wird mit Scheuklappen gearbeitet, es fehlt eine gegenseitige Akzeptanz und es fehlt die Bereitschaft, sich innerhalb des Unternehmens zu vernetzen und einen gemeinsamen Konsens für eine beschäftigtenorientierte Personalpolitik zu entwickeln. Darüber hinaus werden vielerorts sogenannte Querschnittsmanager für Spezialthemen etabliert, nicht selten entsprechen sie auch „vermeintlich modernen“ Zeitgeistgedanken: z.B. Demografiemanager, Gesundheitsmanager, Inklusionsbeauftragte, etc. Der Vorteil ist, dass diese Funktionen bzw. Personen breiter aufgestellte Spezialisten sind und vor allem besser als Netzwerkende agieren könnten. Aber da sie häufig „allein“ und nicht „ganzheitlich“ aufgestellt sind, fehlt auch hier eine organisationale Durchschlagskraft, und es entstehen gutgemeinte, aber isolierte Arbeitsbereiche.
Im UKE hatten wir uns daher konsequent entschlossen, die beschäftigtenorientierte Personalpolitik als dauerhaftes Projekt zu betrachten. Das Modell der Einzelkämpfer hat vor allem zwei wesentliche Nachteile: mangelnde Vernetzung und mangelhafte Beteiligung der Beschäftigten, der Führungsebenen und der Schlüsselgremien (u.a. Personal- und Betriebsräte). Das Projektmodell versucht hier Vor- und Nachteile zusammenzubringen, indem alle „Player“, die Spezialisten, die Beschäftigten selber und die Verantwortlichen in eine schlagkräftige Organisation gebracht werden.
Schon in der Mitte der 2000er-Jahre entwickelte im UKE der damalige Vorstand gemeinsam mit den Mitarbeitenden erste Ansätze für eine Form von Personalpolitik, vor allem auf Basis des Themas Sucht am Arbeitsplatz und Mitarbeitergesundheit. Ein konkreter systematischer Einstieg war eine erste strukturierte Mitarbeiterbefragung, in der es um die Bedürfnisse der Mitarbeitenden in Bezug auf Gesundheitsförderungs- und Betriebssportangebote ging. Auf Basis der Ergebnisse wurden Programme, auch berufsgruppen-spezifisch, entwickelt. Parallel wurde ein Arbeitskreis Sucht gegründet, in dem schon damals sehr stark die Mitarbeiterpartizipation eingefordert und verankert war. Etwas später wurde der Arbeitskreis in die Struktur einer formelleren Arbeitsgruppe (AG) mit einer klareren Zielsetzung weiterentwickelt. Das besondere Prinzip „top-down“ und „bottom-up“ wurde konsequent umgesetzt, u.a. auch durch die aktive Beteiligung aller Führungsebenen (einschl. Vorstand) und aller relevanten Beschäftigtengruppen (Mitarbeitende, Personalvertretung, Experten, etc.). Inhaltlich wurde die AG Gesundheit um die Themen „Führung- und Qualifizierung“ und „Balance von Beruf-Familie-Freizeit“ (als Synonym für die sogenannte Life-Domain- Balance) erweitert. Auch für diese Themen wurde die Struktur der Arbeitsgruppe gewählt. Um den sperrigen Begriff der beschäftigtenorientierten Personalpolitik besser in das Unternehmen zu transportieren, wurde mit dem Geschäftsbereich Unternehmenskommunikation eine interne Arbeitgebermarke (s. Abb. 2) entwickelt.
Abb. 2 Logo UKE INside
Mit dieser Entwicklung hat die beschäftigtenorientierte Personalpolitik im UKE einen Namen, ein Logo, einen Leitsatz und damit für die Mitarbeitenden ein eindeutig erkennbares Profil bekommen. Entscheidend für die Wirksamkeit und die Akzeptanz bei den Beschäftigten ist selbstverständlich der Inhalt und nicht die Marke. Es macht überhaupt keinen Sinn, ohne ein vorhandenes ernsthaftes Bekenntnis für eine konsequente Mitarbeiterperspektive und vor allem ohne konkrete inhaltliche Ausgestaltung, eine Marke zu etablieren.
„UKE Inside“ steht für Mitarbeiterorientierung, für partizipative Führungskultur, für Unterstützung in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Karriereplanung und nicht zuletzt für attraktive Angebote im Rahmen der Gesundheitsförderung. Die Ausrichtung der Personalpolitik wird sichtbar, ist transparent und sieht die Bedürfnisse der Beschäftigten. Sie ist beeinflussbar und beeinflusst die Unternehmenskultur. „Unser Arbeitsleben gestalten“ spiegelt die Arbeitskultur von UKE INside. Die Strategie und Weiterentwicklung der beschäftigtenorientierten Personalpolitik ist dabei fest in den strategischen Zielen des Vorstands etabliert.
Struktur einer beschäftigtenorientierten Personalpolitik und Erfolgsfaktoren
Für die Etablierung und Weiterentwicklung des Konzeptes gibt es eine Reihe von Erfolgsfaktoren. Besonders sticht hierbei eine konsequente Strukturierung heraus, die auch finanzielle und personelle Ressourcen benötigt. Eine Geschäftsordnung von UKE INside ist im QM Handbuch hinterlegt. Klar strukturierte Prozesse, die Formulierung der Arbeitsgruppenstruktur und Entscheidungsabläufe erfassen die normative Grundlage der beschäftigtenorientierten Personalpolitik. In Abbildung 3 ist die Organisationsstruktur von UKE INside dargestellt.
Abb. 3 Struktur Personalpolitik UKE INside
Eine ganz besondere Funktion wird durch die UKE Inside-Koordinatorin erfüllt und ist somit ein weiterer Erfolgsfaktor. Hier hinter verbirgt sich eine konkrete Person mit ausgeprägten methodischen und kommunikativen Kompetenzen, die mit Unterstützung von Werkstudierenden und Freelancern der Motor für die sehr dynamische Entwicklung war und ist. Die Funktion bzw. Stelle ist als Stabsstelle des Vorstandes verortet und sorgt hierdurch für eine unmittelbare und sehr zielgerichtete Kommunikation von oben nach unten und natürlich umgekehrt.
Die Arbeitsgruppen erhalten ihre „Power“ aus der Tatsache, dass interessierte Mitarbeitende, Schlüsselpersonen, Meinungsbildner und Interessengruppen (besonders seien hier die Mitbestimmungsorgane erwähnt) mit viel Engagement und der „Sicht von unten“ sich aktiv einbringen dürfen. Wichtig sind hierbei neben sogenannten Quick-Wins natürlich auch die Transparenz bei der Entscheidungsfindung und der Grenzen, die manchmal auch aufgezeigt werden müssen. Ein Beispiel sei hierfür genannt: In der AG Balance Beruf-Familie-Freizeit wurde ein Konzept für einen innerbetrieblichen Betreuungszuschuss erarbeitet und mit Zustimmung des Vorstandes auch pilothaft eingeführt. Aufgrund der hohen finanziellen Belastungen und einer akuten wirtschaftlichen Belastung musste das Projekt erst einmal wieder vom Netz genommen werden. Dies wurde offen und ohne Ausreden in das Unternehmen kommuniziert.
Die Arbeitsgruppen sind darüber hinaus aufgefordert, weitere Ziele für die strategische Ausrichtung des Managements zu formulieren, und sind ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik des UKE. In der AG Balance zwischen Beruf, Familie und Freizeit werden Konzepte und Maßnahmen zur Optimierung und Weiterentwicklung von Themen wie zum Beispiel Kinderbetreuung, alternierende Telearbeit und Home-Office, Kontakthalteprogramm, Unterstützung von Mitarbeitenden mit pflegebedürftigen Angehörigen und Serviceangebote erarbeitet. Die AG Gesundheit entwickelt individuelle, wie systemische Konzepte, um die Mitarbeitenden zu stärken und um die Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern. Die nachhaltige Umsetzung einer familienbewussten Personalpolitik ist ebenso ein Ziel der AG Führung und Qualifizierung. Die Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung sowie die Kontrolle der Maßnahmenumsetzung analysiert den aktuellen Zustand. Onlinebefragungen zu speziellen Themen vertiefen die Informationen. Herausgestellt werden muss die Entwicklung und Evaluation von Programmen zur Führungskräfteentwicklung, die auch ein zentrales Instrument sind, um ein gemeinsames familienbewusstes Führungsverständnis zu etablieren. Die Implementierung eines Konfliktmanagementsystems und Entwicklung einer Feedbackkultur unterstützt die Arbeit der Führungskräfte.
Fazit und Ausblick
Mit UKE INside, der beschäftigtenorientierten Personalpolitik am UKE, hat das Klinikum eine Marke etabliert, die das Ziel verfolgt eine lebensphasenorientierte, familienbewusste und gesundheitsfördernde Personalpolitik übergreifend weiterzuentwickeln, zu optimieren und deren Wirksamkeit zu evaluieren. Im UKE beweisen viele Kennzahlen, dass der eingeschlagene Weg erfolgversprechend ist. Diese reichen von Fluktuation, über Bewerberzahlen, der Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit bis hin zu einigen externen Erfolgen. Beispielsweise erhielt das UKE 2016 und 2024 den anspruchsvollen Gesundheitspreis der Freien und Hansestadt Hamburg. Darüber hinaus hat das UKE in den letzten Jahren weitere Preise erhalten, zum Beispiel die Auszeichnung als „Familienfreundlichstes Großunternehmen“ durch die Bundesministerin für Familie, Frauen, Senioren und Jugend im Rahmen des Wettbewerbs Erfolgsfaktor Familie.
Besonders herauszustellen sind drei wesentliche Erfolgsfaktoren, die auch bei Übertragung des Ansatzes in anderen Krankenhausunternehmen unbedingt berücksichtigt werden sollten:
Eine beschäftigtenorientierte Personalpolitik muss im Unternehmensleitbild verankert sein und von der obersten Hierarchie-Ebene aktiv getragen werden.Die Mitarbeitenden müssen aktiv, ehrlich und nachhaltig an der Personalarbeit beteiligt werden.Notwendig sind strukturelle Rahmenbedingungen und das Zur-Verfügung-Stellen von Ressourcen. Mitarbeiterorientierung kostet auch Geld, zahlt sich aber immer aus.Das alles ist kein Selbstzweck. Im Zeitalter von Fachpersonalmangel und dem vielbeschworenen „War for Talents“ ist eine konsequente Ausrichtung der Personalpolitik und zeitgemäße Führung eine Überlebensstrategie für Krankenhausunternehmen. Neben dem Wettbewerb um die beste Patientenversorgung wird gutes, motiviertes und qualifiziertes Personal zum Wettbewerbsfaktor Nr. 1. In diesem Beitrag wurde der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterorientierung und Patient und vor allem der Qualität der Patientenversorgung nicht näher beleuchtet. Hierzu zählen besonders auch Aspekte der Qualifizierung und Personalentwicklung, die selbstverständlich einen unmittelbaren Einfluss auf die Qualität haben. Beide Themen, Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, ergänzen sich wunderbar: Der Zusammenhang zwischen zufriedenen Patienten und zufriedenen Mitarbeitenden ist hinlänglich bekannt und bewiesen.
1.2Akteure der Personalarbeit und deren Rollen
Fragt man Krankenhaus-Mitarbeiter – unabhängig davon, welcher Hierarchieebene sie angehören – danach, wer für die Personalarbeit zuständig ist, hört man im Regelfall immer noch die Antwort: die Personalabteilung. Diese Antwort ist der Spiegel der Realität. Die Personalabteilung dominiert nach wie vor die Personalarbeit, unter anderem auch deshalb, weil andere Akteure, damit sind vor allem die Führungskräfte gemeint, die von ihnen wahrzunehmenden Rollen nicht oder nur teilweise ausfüllen.
Die in Kapitel 1.1 skizzierten Ziele und Aufgaben des Personalmanagements zeigen, dass die Personalarbeit in alle Leistungsbereiche des Krankenhauses hin einwirkt und mit der Patientenbehandlung eng verflochten ist (Lattmann, S. 192). Diese höchst komplexe Aufgabe „Personalarbeit“ kann deshalb auch nicht von einer Instanz des Krankenhauses allein wahrgenommen werden, und schon gar nicht allein von der Personalabteilung, die im Übrigen von dem Leistungsgeschehen im Regelfall weit entfernt ist. Es bedarf vielmehr des zielgerichteten und koordinierten Einsatzes mehrerer Akteure (s. nachfolgend), damit die Personalarbeit den weiter oben skizzierten Beitrag zum Erfolg des Unternehmens erbringen kann (von Eiff 2000, S. 167):
Die Geschäftsführung/Krankenhausleitung
legt die personalpolitischen Grundsätze auf Vorschlag der Personalabteilung fest. Sie gestaltet die Arbeitsbedingungen auf der Meso- und der Mikro-Ebene des Krankenhauses so, dass die personalpolitischen Grundsätze umgesetzt werden können.
Die Führungskräfte
aller Leitungsebenen sind dafür verantwortlich, dass die Krankenhaus-Mitarbeiter den mit ihnen vereinbarten Beitrag zur Realisierung der Unternehmensziele leisten. Die Grundlage dafür ist eine spezifische Führungsleistung, die in der Integration der Unternehmensziele, der individuellen Ziele der Krankenhaus-Mitarbeiter und der individuellen Ziele der Führungskräfte besteht. Die Führungskräfte befinden sich in einer schwierigen Sandwich-Position: Sie sind einerseits Agenten, die Entscheidungen im Sinne der Krankenhaus-Eigentümer zu treffen und dabei die Interessen auch anderer Stakeholder – wie zum Beispiel die der Krankenkassen und der einweisenden Ärzte – in Betracht zu ziehen haben. Sie sind zum anderen Vorgesetzte, die dafür zu sorgen haben, dass die Krankenhaus-Mitarbeiter im Sinne der Patienten-Bedürfnisse, der Eigentümer-Interessen und gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Anliegen anderer Stakeholder handeln (Holtbrügge, S. 45). Die Führungskräfte entwickeln sich zu eigenständigen personalpolitischen Akteuren, die Gestaltungsaufgaben, bezogen auf die Personalarbeit, wahrnehmen. Sie realisieren die Personalführung so, dass die aktuellen Mitarbeiter möglichst lange an das Krankenhaus gebunden und dort möglichst effektiv und effizient eingesetzt werden und dass vakante Stellen mit den besten Bewerbern aus dem internen oder dem externen Arbeitsmarkt besetzt werden können.
Die Aufgabe
der Personalvertretung
ist es, darauf zu achten, dass der erwähnte Interessenausgleich nicht zu Lasten der Krankenhaus-Mitarbeiter erfolgt. Neben dieser Kontrollfunktion sind den Personalvertretungen gestaltende Aufgaben übertragen worden. So bedarf die Geschäftsführung/Krankenhausleitung der Zustimmung der Personalvertretung, wenn sie Richtlinien für die Auswahl geeigneter Bewerber für die Besetzung vakanter Stellen erlassen möchte (§ 95 Abs. 1 Betriebsverfassungsgesetz [BVG]). In Berlin können vakante Stellen nur mit der Zustimmung der Personalvertretung besetzt werden (§ 87 Personalvertretungsgesetz Berlin [PersVG Berlin]). Die Personalvertretung kann ihre Zustimmung zu der Einstellung eines neuen Mitarbeiters aber nur dann verweigern, wenn die Voraussetzungen, die in § 99 Abs. 2 Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) genannt sind, nicht erfüllt werden, und wenn die Fähigkeiten des Bewerbers den Anforderungen der Stelle nicht entsprechen; insofern leistet sie für die – gemessen an den Zielen des Krankenhauses – Eignung der Belegschaft einen nicht unwesentlichen Beitrag.
Die Personalabteilung
entwirft die Personalpolitik und schlägt diese zur Beschlussfassung der Geschäftsführung / Krankenhausleitung vor. Sie entwickelt die Führungs-Instrumente, führt diese ein und schult die Führungskräfte in deren Handhabung. Sie verwaltet das Personal und berät die übrigen Akteure in Personalangelegenheiten.
Die Krankenhaus-Mitarbeiter
werden als Arbeitnehmer auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages tätig. Sie schulden dem Arbeitgeber die in diesem Vertrag konkret bezeichnete Arbeitsleistung und erhalten dafür ein Entgelt. Sie sind an die Weisungen des Arbeitgebers hinsichtlich der Zeit und des Ortes der Ausführung der vereinbarten Leistung sowie der Eingliederung in den Betrieb gebunden. Zu den Krankenhaus-Mitarbeitern zählen auch die
Auszubildenden und die Praktikanten
, die mit dem Arbeitgeber einen Ausbildungs- bzw. Praktikantenvertrag abgeschlossen haben. Arbeitsleistungen werden auch durch Leihbzw. Zeitarbeitnehmer erbracht. Dabei handelt es sich um Arbeitnehmer einer Zeitarbeitsfirma. Diese verleiht ihre Mitarbeiter dem Krankenhaus gegen eine Leihgebühr für das Erbringen einer in dem Leihvertrag inhaltlich und zeitlich konkretisierten Leistung. Je nach dem in einem Krankenhaus oder auch in einem Leistungsbereich des Krankenhauses gelebten Führungsstil ist die Rolle des Mitarbeiters eine höchst unterschiedliche. Der Mitarbeiter wird als austauschbarer Funktionsträger, als Untergebener, als Mit-Arbeiter oder auch als Individualist gesehen und jeweils auch entsprechend behandelt.
Die Rollen der Akteure haben sich in den letzten Jahren verändert. Personalfunktionen wurden von der Personalabteilung zu den Führungskräften verlagert. Dabei spielte die zunehmende Akzeptanz der engen Verflechtung der Personalarbeit-Funktionen mit den Funktionen der Patientenbehandlung eine Rolle (Lattmann, S. 192).
Am deutlichsten wird dieses am Beispiel der Personalentwicklung. Während noch vor dreißig Jahren die Personalabteilung alleine darüber befand, welche Entwicklungsmaßnahme für welchen Mitarbeiter notwendig ist und realisiert werden soll, hat diese Aufgabe danach zunächst der Vorgesetzte übernommen. In der jüngeren Vergangenheit waren es – begünstigt durch die Höhe der dafür vor einiger Zeit noch zur Verfügung stehenden Mittel – die Krankenhaus-Mitarbeiter, die ihre Entwicklung selbst gestalten. Viele von ihnen organisieren ihre Weiterentwicklung selbst, um sich mit den erworbenen Kompetenzen auf dem internen wie auch auf dem externen Arbeitsmarkt zwecks Wahrung ihrer Interessen nachhaltig positionieren zu können.
Ob diese Rollenveränderungen von Dauer sein werden, bleibt abzuwarten. Es scheint so, dass – in Folge der Ressourcen-Verknappung – die Personalabteilung in vielen Krankenhäusern das Heft wieder in die Hand genommen hat; sie entscheidet wieder darüber, welche Entwicklungsmaßnahmen für welche Krankenhaus-Mitarbeiter realisiert werden.
1.3Herausforderungen
1.3.1Einführung
Das Krankenhausmanagement und auch das Personalmanagement sehen sich mit einer großen Zahl von Entwicklungen konfrontiert, die einerseits als Datum die Grundlage unternehmerischer und personalpolitischer Entscheidungen sein werden und die Personalarbeit auf vielfältige Weise prägen; sie können zum anderen durch diese beeinflusst werden.
Die rasante medizintechnische sowie informations- und kommunikationstechnische Entwicklung wird von den Krankenhäusern eine Entscheidung darüber verlangen, ob und in welchem Umfang sie sich dieser Entwicklung durch entsprechende Investitionen – auch in einschlägig spezialisierte Mitarbeiter – anschließen und sie sogar fördern wollen. Die Alternative ist, auf die Entwicklung eigener High-Tech-Leistungsbereiche zu verzichten und gewisse medizin-technische Leistungen – zum Beispiel die diagnostischen Leistungen bildgebender Verfahren –, die nur mit einem sehr hohen technischen Aufwand realisiert werden können, von den dafür spezialisierten Krankenhäusern einzukaufen. Diese strategische Entscheidung hat Auswirkungen auf die Finanzierung des Krankenhauses, auf dessen Struktur und die Arbeitsabläufe, vor allem aber auf die Qualifikation der benötigten Mitarbeiter.
Hinsichtlich organisatorischer Veränderungen hat das Krakenhausmanagement diese Wahlfreiheit häufig nicht. Die Verbesserung der Arbeitsprozesse ist einer der Schlüsselfaktoren zur Verbesserung der Ergebnisqualität sowie der Effizienz der Versorgungsprozesse. Sie trägt zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und damit zur langfristigen finanziellen Sicherung des Unternehmens bei. Sie setzt möglicherweise anders qualifizierte Mitarbeiter voraus.
Das in einem Krankenhaus gelebte Wertesystem steuert sowohl das Verhalten der Krankenhaus-Mitarbeiter gegenüber den Patienten als auch den Umgang der Krankenhaus-Mitarbeiter untereinander. Der zu beobachtenden Veränderung des Wertesystems kommt eine zentrale, die Personalarbeit bestimmende Rolle zu: Die Krankenhaus-Mitarbeiter werden künftig noch mehr als bisher von der Geschäftsführung/Krankenhausleitung die Befriedigung ihrer veränderten Bedürfnisse – zum Beispiel nach mehr Wertschätzung und Selbstverwirklichung – verlangen. Die Geschäftsführung / Krankenhausleitung wird sich – insbesondere angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt – diesem Wunsch nicht verschließen können. Tut sie es doch, wird sie künftig nicht mehr über ausreichend motivierte Mitarbeiter und / oder den bedarfsgerechten Personalbestand verfügen können.
Andererseits steuert die Personalarbeit die Entwicklung des krankenhausspezifischen Wertesystem durch die Entwicklung und die Implementierung entsprechender Instrumente sowie durch eine dem gewünschten Wertesystem verpflichtete Personalentwicklung und Personalauswahl.
Der Arbeitsmarkt ist zu einem Arbeitnehmermarkt geworden – das gilt nicht nur für Führungskräfte sowie für Ärzte und Pflegefachkräfte – mit großen Herausforderungen für das Gewinnen neuer Mitarbeiter und das Binden der vorhandenen Mitarbeiter an ihren Arbeitsplatz.
Der Krankenhaus-„Markt“ ist aktuell dadurch gekennzeichnet, dass
Teile der medizinischen und/oder nicht-medizinischen Dienstleistungen Fremdfirmen übertragen werden, die die Krankenhäuser immer häufiger zu diesem Zweck mit einschlägig ausgewiesenen Partnern gegründet haben, sowie, dass
Krankenhäuser verkauft werden oder mit anderen fusionieren.
Die von diesen Entwicklungen betroffenen Mitarbeiter werden in höchstem Maße verunsichert, weil sie nicht wissen, welche Anforderungen künftig an sie gestellt werden und ob sie diesen gerecht werden können. Sie werden mit anderen Unternehmenskulturen konfrontiert und müssen möglicherweise mit ihrer Kündigung rechnen.
In den folgenden Kapiteln wird dargestellt, welche Personalmanagement-Probleme aus Anlass der skizzierten Herausforderungen gelöst und in welchen Feldern des Personalmanagements die Lösungen erarbeitet werden müssen. Die Beschreibungen der Lösungsansätze sind Gegenstände der Kapitel 8 bis 15.
1.3.2Technologischer Wandel
Immer leistungsfähigere medizin-technische Geräte sowie informations- und kommunikationstechnische Systeme ermöglichen eine präzisere Diagnostik und einen größeren therapeutischen Nutzen, und dies vor allem auch für immer ältere Patienten. Die medizin-technische und die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie sind auf der anderen Seite einige der Ursachen für die explosionsartige Entwicklung des Ausmaßes der erbrachten Leistungen sowie die der Betriebs- und Investitionskosten – letzteres unter anderem deshalb, weil die effektive Nutzungsdauer medizin- sowie informations- und kommunikationstechnischer Produkte wegen der immer kürzer werdenden Zeitspanne bis zum Erscheinen technischer Neuerungen sinkt.
Der zu erwartende technologische Wandel ist für das Personalmanagement in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung:
Um die Anforderungsprofile der Stellen des Krankenhauses auf die technologische Entwicklung ausrichten und um Mitarbeiter mit entsprechenden Fähigkeitsprofilen gewinnen zu können, ist eine Entscheidung darüber erforderlich, welche Bedeutung der technologische Wandel künftig haben soll. Die Personalbedarfsbestimmung, die Personalbestandsanalyse sowie die eventuell notwendigen Personalveränderungen basieren auf dieser strategischen Entscheidung.
Das Personalmanagement wird die Geschäftsführung / Krankenhausleitung als Grundlage für deren Entscheidung darüber informieren müssen, wie viele der eventuell erforderlichen, hoch qualifizierten Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt zu welchen Kosten und wann zu haben sein werden. Die sorgfältige Analyse des Arbeitsmarktes und dessen zu erwartende Entwicklung ist dafür die Grundlage.
Das Personalkostenmanagement wird sich mit der Frage befassen, wie sich die Höhe und die Struktur der Personalkosten in Folge der strategischen Entscheidung ändern werden und ob, um die Fixkosten mindern zu können, die erwähnten Spezialisten als fest angestellte oder als freie Mitarbeiter beschäftigt werden sollen.
Als Folge der Positionierung des Krankenhauses als „Technologie-Führer“ wird es künftig möglicherweise zwei Gruppen von Mitarbeitern geben: Die einen engagieren sich vor allem für die Entwicklung und Implementierung neuer medizin-technischer Geräte und der darauf aufbauenden Behandlungsmethoden; für die andere Gruppe von Mitarbeitern steht die situativ, stark emotional geprägte Interaktion zwischen den Mitgliedern des therapeutischen Teams und den Patienten im Mittelpunkt ihres Handelns. Der Ausgleich der Spannungen, die durch das Zusammenwirken sehr unterschiedlicher Persönlichkeitsstrukturen entstehen können, stellt die Personal führung vor besondere Herausforderungen und verlangt den Einsatz geeigneter Führungsinstrumente
3
.
Der technologische Wandel hat bereits dazu geführt und wird weiter dazu beitragen, dass zusätzlich zu den traditionell im Krankenhaus beschäftigten Berufsgruppen dort weitere tätig sind (Physiker, Ingenieure, Informatiker u. a.) und dass möglicherweise neue Berufe kreiert werden (wie zum Beispiel organisations-, chemisch- und anästhesietechnische Assistenten sowie Casemanager). Er führt zu einer weiteren Spezialisierung der verschiedenen Leistungsbereiche und der darin arbeitenden Mitarbeiter. Das Zusammenwirken hoch spezialisierter Know-how-Träger verlangt eine spezifische Art von Teamarbeit bei zunehmender Koordinations- und Kommunikationsintensität (von Eiff 2000, S. 52).
Der technologische Wandel verlangt nicht selten Änderungen der Strukturen und Prozesse, um die neuen Produkte effizient nutzen können. Neue Schnittstellenprobleme entstehen. Die Mitarbeiter der Krankenhäuser müssen motiviert werden, sich diesen Herausforderungen zu stellen und zu lernen, mit den vielen Neuerungen – technischer, struktureller, organisatorischer und kultureller Art – umzugehen.
Die Ausrichtung des Personalbestandes auf die neuen Anforderungen nimmt – wenn sie mit Hilfe angestellter Mitarbeiter umgesetzt werden soll – längere Zeit in Anspruch. Frühzeitige strategische personalpolitische Entscheidungen sind deshalb erforderlich.
1.3.3Organisatorischer Wandel
Formen organisatorischen Wandels
Organisatorische Veränderungen sind in mehrfacher Hinsicht zu beobachten:
Innerhalb des Krankenhauses findet eine allmähliche Umorientierung von der funktionalen zu einer mehr an den Behandlungsprozessen ausgerichteten Organisation statt.
Die strikte Trennung der Patientenversorgung in einerseits stationäre und andererseits ambulante Versorgung wird allmählich überwunden.
Die neue Arbeitszeitordnung für Ärzte hat beträchtliche Auswirkungen auf die Strukturen des Krankenhauses und die Arbeitsabläufe in diesem sowie auf die Gestaltung der Arbeitszeiten. Der Wunsch der Mitarbeiter nach einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie der zunehmende Anteil von Frauen im Arztberuf prägen zusätzlich die Arbeitszeit-Arrangements (Herrmann 2013, S. 373 ff. und vor allem
Kapitel 18
in diesem Buch).
Krankenhausinterne Veränderungen
Die Patientenbehandlung findet im Regelfall immer noch in Leistungsbereichen statt, die in personeller, finanzieller, struktureller und organisatorischer Hinsicht von den jeweils anderen Leistungsbereichen eines Krankenhauses eindeutig abgegrenzt sind. Für jeden Leistungsbereich ist jeweils eine Person verantwortlich. Der Patient wird innerhalb eines derart organisierten Systems durch die an der Behandlung beteiligten Leistungsbereiche nicht selten nur als eine Summe verschiedener, zu erledigender Aufgaben wahrgenommen. Das Behandlungsziel ist in jenen Leistungsbereichen, von denen der behandelnde Leistungsbereich medizinische und nicht-medizinische Serviceleistungen erhält, nicht selten nur vage bekannt.
Krankenhausinterne Kunden-Lieferanten-Beziehungen, in deren Rahmen der Kunde – zum Beispiel die behandelnde Fachabteilung – die von einem Lieferanten – zum Beispiel von der Röntgenabteilung – gewünschte Leistung inhaltlich und zeitlich eindeutig und im Detail unter Angabe von Qualitätskriterien definiert und abnimmt, gibt es nur ansatzweise. Die Frage, auf welche Weise die Bedürfnisse der internen Kunden am besten befriedigt werden können, spielt für die internen Lieferanten nicht in dem gewünschten Ausmaß eine Rolle4. Die Folge davon ist, dass zwar für jeweils die einzelnen Leistungsbereiche in der Regel optimale, für den gesamten Behandlungsprozess dagegen häufig nur suboptimale Ergebnisse, vor allem auch in zeitlicher Hinsicht, realisiert werden.
Eine bessere Qualität und eine höhere Effizienz der Behandlungs-, Service- und Betriebsführungsprozesse sind die Ergebnisse aus Prozessen und Strukturen, in deren Mittelpunkt der Patient steht. Prozesse und Strukturen werden künftig Berufsgruppen, Hierarchieebenen und Leistungsbereiche übergreifend gestaltet, um eine bessere Ergebnisqualität sicherstellen zu können.
Das kann dazu führen, dass u. a.
einzelne Funktionen und Akteure möglicherweise an Macht verlieren,
gewohnte Rollen sich verändern,
mehrere Aufgaben mitunter gleichzeitig bewältigt werden müssen und
Netze, deren Strukturen sich schnell verändern können, zunehmend an Bedeutung gewinnen.
Der zu erwartende organisatorische Wandel stellt das Personalmanagement in mehreren Feldern vor größere Herausforderungen:
Die prozessorientierte Ausrichtung der Patientenbehandlung und des dafür erforderlichen Service wird dazu beitragen, dass bei der Bemessung des Personaleinsatzes die Zufriedenheit der Patienten und/oder die Behandlungssicherheit stärker als bisher berücksichtigt werden. Die Leistungsbereiche, die einen höheren Beitrag als andere zur Patientenzufriedenheit und/oder zur Behandlungssicherheit leisten, werden personell besser ausgestattet als es die Kennzahlen, die ausschließlich von der Arbeitsproduktivität ausgehen, zulassen.
Die Anforderungsprofile der Krankenhaus-Mitarbeiter werden sich – wenn die Geschäftsführung/Krankenhausleitung eine Entscheidung zu Gunsten des skizzierten organisatorischen Wandels fällt – ändern. Es werden Mitarbeiter benötigt, die Veränderungen nicht nur als Bedrohung wahrnehmen, sondern sich mit den Veränderungen positiv auseinandersetzen und diese mitgestalten können. Es werden neue Berufe entstehen (zum Beispiel der Casemanager) und es wird zu Verschiebungen hinsichtlich der Personalausstattung innerhalb des Krankenhauses kommen. Die Personalbedarfsbestimmung, die Personalbestandsanalyse und das Personalveränderungsmanagement benötigen die Ergebnisse dieser strategischen Entscheidung als Vorgaben.
Die skizzierten Veränderungen lösen Skepsis und Angst aus und führen zur Verunsicherung von Mitarbeitern, die sich bisher in einer auf größere Dauer angelegten Organisationseinheit geborgen fühlen konnten. Insbesondere die Personalführung ist gefordert, um die Folgen organisatorischer Veränderungen auffangen und möglicherweise entstehende Leistungsdefizite der Mitarbeiter vermeiden zu können.
Das Personalmanagement wird die Geschäftsführung/Krankenhausleitung als Grundlage für deren Entscheidung darüber informieren müssen, wann die als Voraussetzung für die organisatorische Neuorientierung erforderlichen Personalveränderungen – vor allem auf der Ebene der leitenden Mitarbeiter – umgesetzt, wann auf dem internen und/oder externen Arbeitsmarkt Mitarbeiter mit den entsprechenden Fähigkeitsprofilen gewonnen werden können.
Die Umstellung der Krankenhaus-Struktur im Sinne einer stärkeren Orientierung an den Behandlungs- und Serviceprozessen mit dem Patienten im Mittelpunkt verlangt insbesondere von den Verantwortlichen in den medizinischen Leistungsbereichen eine Neuorientierung hinsichtlich ihrer Rollen. Bisher verstanden sich nur die verschiedenen medizinischen und nicht-medizinischen Supportbereiche als Dienstleistungsbereiche im Krankenhaus, während sich die Kliniken als die Bereiche gesehen haben, die anderen Leistungsbereiche Aufträge gegeben und Leistungen in Empfang genommen haben. Künftig ist der Patient der Empfänger der Leistungen, auch jener, die in den klinischen Bereichen erbracht werden (Diagnostizieren, Behandeln, Pflegen). Es wird einen Agenten des Patienten geben, den Casemanager, der dafür verantwortlich ist, dass alle für die Realisierung des Behandlungszieles notwendigen Leistungen sach- und zeitgerecht erbracht werden
5
. Das Personalmanagement unterstützt die Führungskräfte in den klinischen Abteilungen und deren Mitarbeiter bei dem Entwickeln neuer Rollen, wenn sie denn unumgänglich sind, und bei deren Akzeptanz.
Leistungsanbieter übergreifend
Vor allem der Druck, der seitens veränderter finanzieller Rahmenbedingungen ausgeht, führt dazu, dass Krankenhäuser unterschiedliche Koalitionen eingehen (Heinzer et al., S. 151):
Krankenhäuser, aber auch andere Leistungsanbieter suchen Partner, mit denen sie zusammen Leistungen über die gesamte Versorgungskette hinweg – nämlich von der Vorsorge über die ambulante und die stationäre Behandlung bis hin zur Rehabilitation, gegebenenfalls auch unter Einschluss der stationären und ambulanten Pflege – anbieten können.
Krankenhäuser begründen mit anderen Krankenhäusern strategische Allianzen, indem sie Leistungsbereiche des medizinischen und nicht-medizinischen Supports zusammenlegen (so betreiben zum Beispiel die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH seit 2013 gemeinsam die Labor Berlin – Charité Vivantes GmbH); auf diese Weise erhofft man sich eine Steigerung der Qualität und der Effizienz der Leistungserbringung.
Krankenhäuser gründen zusammen mit Fachfirmen verschiedener Dienstleistungsbereiche (wie zum Beispiel Reinigung, Catering oder Facility Management) Tochterfirmen und kaufen von diesen Tochterfirmen Dienstleistungen, die sie vorher in eigenen Leistungsbereichen zu im Regelfall weniger günstigen Konditionen selbst erbracht haben.
Strategische unternehmerische Entscheidungen der skizzierten Art sind für das Personalmanagement große Herausforderungen:
Viele dieser Veränderungen führen dazu, dass die Zahl der Stellen in den Krankenhäusern abnimmt. Und es betrifft vor allem jene Stellen, die mit weniger qualifizierten Mitarbeitern besetzt sind. Diese haben es auf dem internen oder dem externen Arbeitsmarkt besonders schwer, eine neue Beschäftigung zu finden. Personalbedarfsbestimmung, Personalbestandsanalyse, Personalveränderung sowie Personalführung sind deshalb in erster Linie gefordert.
Es werden neue Berufsgruppen entwickelt und implementiert – so zum Beispiel für den Einkauf jener Produkte und Dienstleistungen, die das Unternehmen bisher selbst produziert hat.
Die Veränderungen führen häufig auch dazu, dass Krankenhaus-Mitarbeiter entweder an das Partner-Krankenhaus oder an die neue Tochterfirma „ausgeliehen“ werden. Zwar verlieren die davon betroffenen Krankenhaus-Mitarbeiter nicht ihren Arbeitsvertrag und die damit erworbenen Rechte. Verunsicherung und Ängste werden ausgelöst mit möglicherweise der Folge von Leistungseinschränkungen. Die Führungskräfte sind deshalb in besonderem Maße gefordert, durch geeignete Führungsleistungen dem entgegen zu wirken.
Die skizzierten Veränderungen führen häufig zur Verunsicherung auch der nicht unmittelbar betroffenen Krankenhaus-Mitarbeiter. Nicht selten nimmt deshalb die Fluktuation, und zwar insbesondere bei den jüngeren und leistungsfähigeren Mitarbeitern, zu mit der Folge, dass das Leistungspotenzial des Krankenhauses insgesamt abnimmt. Auch in diesem Zusammenhang sind die Führungskräfte des Krankenhauses aufgerufen, diese Entwicklung durch spezifische Führungsleistungen möglichst zu verhindern.
Arbeitszeitregelungen
Die Anrechnung des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit und die Begrenzung der arbeitstäglichen und wöchentlichen Arbeitszeit auf 10 bzw. 48 Stunden (Ausnahmeregelungen sind möglich) verlangen den Einsatz von mehr ärztlichen Mitarbeitern (Ob und in welchem Umfang dadurch auch höhere Kosten verursacht werden – die Bereitschaftsdienstvergütung entfällt und wird durch das Entgelt für die Regelarbeitszeit ersetzt –, soll hier zunächst nicht untersucht werden.). Begleitet wird diese Entwicklung von einem zunehmenden Mangel an Ärzten.
Die Entwicklung und Implementierung neuer Arbeitszeitmodelle ist unausweichlich. Dabei sind die Interessen nicht nur der betroffenen Mitarbeiter, sondern auch die Anliegen der Patienten, die des Krankenhaus-Eigentümers und vielleicht auch weiterer Stakeholder zu berücksichtigen.
Das Personalmanagement ist in Folge geänderter Arbeitszeitregelungen in mehreren seiner Felder gefordert:
Das Personaleinsatzmanagement führt als Grundlage für die Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle eine Belastungsanalyse durch. Dabei geht es nicht nur darum festzustellen, wann welche Arbeiten üblicherweise durchgeführt werden. Es wird vielmehr auch geprüft, ob die Arbeiten nicht entfallen können und ob sie nicht von Vertretern anderer Berufsgruppen und/ oder zu anderen Zeit wahrgenommen werden können. Es entwickelt Arbeitszeitmodelle, die den neuen gesetzlichen Regelungen Rechnung tragen, die zur Entlastung vor allem der Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes beitragen und die der Effizienzsteigerung dienen.
Wenn das neue Arbeitszeitkonzept feststeht, ist zu ermitteln, welches Personal künftig mit welcher Qualifikation benötigt wird. Es muss im Rahmen einer Personalbestandsanalyse festgestellt werden, ob die Zahl der gegenwärtigen Krankenhaus-Mitarbeiter mit ihrer Qualifikation dem Bedarf entspricht oder Maßnahmen der Personalveränderung notwendig werden.
Das Personalkostenmanagement klärt die Auswirkungen auf die Höhe der Kosten und deren Zusammensetzung. Es meldet das Ergebnis seiner Recherche sowohl an das Personaleinsatzmanagement als auch an die Personalbedarfsbestimmung, weil dort gegebenenfalls Korrekturen erforderlich sind.
Die größte Herausforderung wartet auf die Führungskräfte, weil sich einige der Arbeitsbedingungen ändern (unter anderem der Wegfall bzw. die Einschränkung der Bereitschaftsdienste und damit der Bereitschaftsdienst-Vergütung) mit negativen Wirkungen auf die Motivation der Krankenhaus-Mitarbeiter. Diese müssen durch geeignete Personalführungs-Leistungen ausgeglichen werden.
1.3.4Wertewandel
Werte sind kognitive Präferenzstrukturen, die als Entscheidungsregeln das Verhalten steuern; Werte sind nicht aktuelle gesellschaftliche Strömungen, die schon nach kurzer Zeit wieder verschwunden sind (Scholz, S. 21). Die große Herausforderung für das Krankenhausmanagement besteht darin, Arbeitbedingungen zu entwickeln und zu implementieren, die sowohl die krankenhausspezifische Unternehmenskultur als auch Trends berücksichtigt, die schon längere Zeit zu beobachten sind und die wohl auch noch längere Zeit Gültigkeit haben werden. Zu diesen Trends zählen vor allem der Wunsch der Mitarbeiter nach Selbstentfaltung, nach mehr Sicherheit und Demokratie in der Arbeitswelt, nach Karriereorientierung und Selbständigkeit.
Auch in diesem Zusammenhang sind grundlegende Weichenstellungen der Geschäftsführung / Krankenhausleitung als Voraussetzung für die Befriedigung der skizzierten Mitarbeiter-Bedürfnisse und als Basis für Entscheidungen des Personalmanagements erforderlich. So muss unter anderem festgelegt werden, ob die Leitungsstruktur des Krankenhauses zentral oder dezentral ausgerichtet sein soll und ob Entscheidungsbefugnisse in der Spitze des Unternehmens gebündelt oder möglichst weit an die Basis delegiert werden sollen. Es sind Führungsgrundsätze zu formulieren als Basis für die Art der Beteiligung der Mitarbeiter an Entscheidungen, die ihre Vorgesetzte zu fällen haben. Schließlich gilt es zu bestimmen, welche Bedeutung die Förderung von Mitarbeitern haben soll.
Auch hinsichtlich des Wertewandels wird das Personalmanagement in mehreren seiner Felder mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert:
Der Anteil der Krankenhaus- Mitarbeiter, deren Einsatzfreude und Motivation davon abhängt, dass ihren Bedürfnissen als Ergebnis einer spezifischen Personalarbeit entsprochen wird, wird zunehmen. Personalarbeit bedeutet in diesem Sinne einerseits, dass die Voraussetzungen für die Übernahme eines höheren Maßes an Gestaltungsmöglichkeiten und an Verantwortung geschaffen werden. Zum an deren müssen nicht wenige der Mitarbeiter durch eine adäquate Personalentwicklung erst befähigt werden, die von ihnen gewünschten Maßnahmen – also zum Beispiel die Delegation von Verantwortung – zu akzeptieren und umzusetzen.
Wenn sich die Geschäftsführung / Krankenhausleitung für die dezentrale Leitungsstruktur entscheidet, macht dies einen höheren Anteil an Mitarbeitern mit einem höheren Maß an Methoden- und an sozialer Kompetenz erforderlich. Die Personalbedarfsbestimmung, die Personalbestandsanalyse und das Personalveränderungsmanagement benötigen als Vorgabe die Ergebnisse dieser strategischen Entscheidung.
Die Personalabteilung entwickelt Führungsinstrumente, die den geänderten Bedürfnissen der Mitarbeiter entsprechen (Führen mit Zielvereinbarungen, Mitarbeiterorientierungsgespräch). Sie schult die Führungskräfte, damit diese in die Lage versetzt werden, die neuen Führungsinstrumente erfolgreich einzusetzen.
Eine der Schlüsselfunktionen einer werteorientierten Personalarbeit ist die Personalauswahl. Bei der Verpflichtung von Mitarbeitern sowohl aus dem internen wie auch aus dem externen Arbeitsmarkt kommt es darauf an, Persönlichkeiten zu finden, die mit dem (angestrebten) Wertesystem des Unternehmens und/oder des Leistungsbereichs, in dem sie tätig werden sollen, harmonieren.
1.3.5Marktdynamik
Wenn Krankenhäuser ihre Rechtsform ändern, Leistungsbereiche auslagern, verkauft werden oder mit anderen Krankenhäusern fusionieren, dann hat dieses nicht selten Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis der Krankenhaus-Mitarbeiter, das in seinem Bestand gefährdet ist. Wenn ein kommunales Krankenhaus an einen privaten Träger veräußert wird, kommt hinzu, dass zwei sehr unterschiedliche Kulturen aufeinander treffen. Das kommunale Krankenhaus ist – was für alle Krankenhäuser typisch ist – bedarfswirtschaftlich ausgerichtet. Bei einem Krankenhaus in privater Trägerschaft kommt ein erwerbswirtschaftliches Element – die Gewinnerzielungsabsicht – hinzu.
Die Hauptlast zur Lösung der sich ergebenden Personalmanagement-Probleme liegt sicher bei den Führungskräften. Sie müssen die wegen vermeintlich schlechter werdender Arbeitsbedingungen entstehenden Motivations-Defizite durch geeignete Führungsleistungen ausgleichen; sie sind gefordert, dazu beizutragen, die Einstellungen ihrer Mitarbeiter hinsichtlich ausschließlich bedarfswirtschaftlicher versus auch erwerbswirtschaftlicher Orientierung zu ändern.
1.4Finanzielle Rahmenbedingungen
Die Kosten, die durch die stationäre Behandlung verursacht werden, wurden bis zum Jahr 2018 allein durch die Leistungserlöse gedeckt, die das Krankenhaus von den Krankenkassen für die stationäre Behandlung seiner Patienten erhalten hat. Die Grundlage für die Abrechnung der erbrachten Leistungen waren der jeweils aktuelle Fallpauschalenkatalog mit den dort ausgewiesenen diagnoseabhängigen Fallpauschalen sowie die bundesländerspezifischen Landesbasisfallwerte.
Diese rein leistungsorientierte Abrechnungslogik wurde mit dem am 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) geändert: in einem ersten Schritt führt dieses zu einer teilweisen Wiedereinführung des bis 2003 praktizierten Kostendeckungsprinzips. Die Pflegepersonalkosten werden aus den Fallpauschalen des Fallpauschalenkatalogs ausgegliedert; sie werden dem Krankenhaus unabhängig von der Art und der Anzahl der erbrachten Leistungen vollständig finanziert.
Mit der am 15. Mai 2024 vom Bundeskabinett beschlossenen Krankenhausreform wird ein Teil der Betriebskosten der Krankenhäuser durch sogenannte Vorhaltepauschalen gedeckt. Wie die Pflegepersonalkosten werden die Vorhaltepauschalen aus den Fallpauschalen ausgegliedert; ein weiterer Teil der Betriebskosten des Krankenhauses wird unabhängig von der Art und der Anzahl der erbrachten Leistungen abgegolten.
Mit der Abkehr von der rein leistungsorientierten Finanzierung der Krankenhausbetriebskosten werden zwei Ziele verfolgt:
Finanzielle Restriktionen für die Beschäftigung von Pflegefachkräften entfallen; es wird erwartet, dass die Zahl der in Krankenhäusern beschäftigten Pflegefachkräfte zunehmen wird (tatsächlich ist die Zahl der Pflegefachkräfte im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen).
Es soll – auch in strukturschwachen Gebieten – Anreize nicht mehr geben für die Aufnahme von Patienten, die aus medizinischer Sicht nicht behandlungsbedürftig sind, in die stationäre Behandlung. Die Existenz der Krankenhäuser wird damit gesichert, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen erbringen.
Wie der Personalbedarf für den Pflegedienst zum einen und für die übrigen Berufsgruppen zum anderen auf der Grundlage der aktuellen Normen bestimmt wird, ist Gegenstand der Kapitel 8.5.3 und 8.5.4. Welche Folgen das Inkrafttreten der Krankenhausreform für die Bestimmung des Personalbedarfs haben wird, bleibt abzuwarten.
1.5Zusammenfassung
Neue Herausforderungen und veränderte Rahmenbedingungen werden dazu beitragen, dass sich die praktische Bedeutung einzelner Felder des Personalmanagements ändern wird (Wunderer; Dick, S. 214 ff.). Es wird damit gerechnet, dass die Relevanz von Personalentwicklung und Personalauswahl zunehmen werden; damit wird zum Ausdruck gebracht, dass die Mobilisierung des Wissens auch der älteren Krankenhaus-Mitarbeiter für den Erfolg des Krankenhauses zunehmend wichtiger wird. Die Entgelt- und die Arbeitszeitgestaltung werden als Grundlage für die Befriedigung individueller Bedürfnisse der Krankenhaus-Mitarbeiter und -Führungskräfte an Bedeutung zunehmen. Angesichts der geänderten Normen für die Finanzierung der Krankenhaus-Betriebskosten wird die Bestimmung des Personalbedarfs künftig anderen Regeln folgen müssen.





























