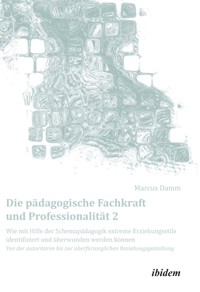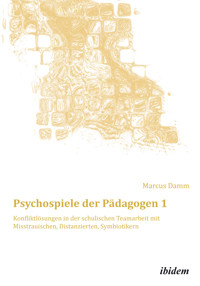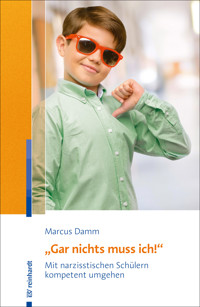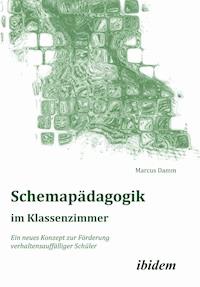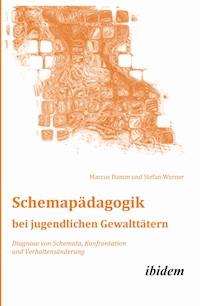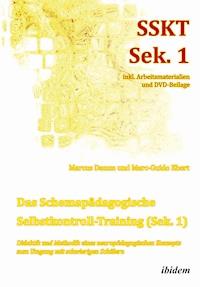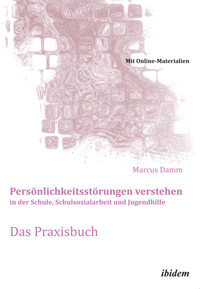
Persönlichkeitsstörungen verstehen in der Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe. Das Praxisbuch E-Book
Marcus Damm
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ibidem
- Kategorie: Bildung
- Serie: Schemapädagogik kompakt
- Sprache: Deutsch
Marcus Damms Praxisbuch stellt eine nützliche praktische Ergänzung zu den Theoriebänden Persönlichkeitsstörungen verstehen in der Schule, Schulsozialarbeit und Jugendhilfe 1-3 dar. Thematisiert werden Methoden und Interventionen zum Umgang mit Jugendlichen, die herausfordernde Persönlichkeitsstile offenbaren. Es geht entsprechend um antisoziale, narzisstische, paranoide, sadistische, selbstschädigende, passiv-aggressive und zwanghafte Teenager sowie um die Borderline-Struktur. Schemapädagogik® ist ein neuropädagogisches Konzept, das auf den schemafokussierten Psychotherapien basiert (Schematherapie, Klärungsorientierte Psychotherapie, Kognitive Therapie). Die ausführlichen Online-Materialien zum Buch umfassen zusätzliche Dateien zu den dargestellten Methoden zum Download und zum Ausdrucken für den Eigengebrauch (u.a. Fragebögen, Textblätter, Besinnungstexte). Außerdem werden wichtige Grundlagentexte zu den Konzepten Schemapädagogik und Persönlichkeitsstörungen bereitgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 121
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ibidem-Verlag, Stuttgart
Inhalt
Vorwort
Dieses Praxisbuch ergänztdieBuch-TrilogiePersönlichkeitsstörungenverstehen in der Schule, Schulsoziarbeit und Jugendhilfe verstehen 1-3, die im letzten Jahr im Ibidem-Verlag erschienen ist (DAMM 2012a; 2012b; 2012c).
Aufbau des Buchs
ImEinleitungskapitelwerden die theoretischen Grundlagendes Schemapädagogik- und des Persönlichkeitsstörungskonzeptsdargestellt. Ebenso finden Sie eine Zusammenfassung der wesentlichen Grundbegriffe wie Schema und Schemamodus vor. Die theoretischen Ausführungen werden durch ein Praxisbeispiel transparent gemacht.
Daserste Kapitelzieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Buch. Hierin werden Teenager mit herausfordernden Persönlichkeitsstilen beschrieben. Thematisiert werdendann insbesondereMethoden und Interventionen zum Umgang mit Jugendlichen, die herausfordernde Persönlichkeitsstile offenbaren. Es geht entsprechend um antisoziale, narzisstische, paranoide, sadistische, selbstschädigende, passiv-aggressive und zwanghafte Teenager sowie um die Borderline-Struktur.
Im Abschnittweiterführende Literatursind alle bisherveröffentlichtenSchemapädagogik-Bände mit einer kurzen Beschreibung aufgeführt.
Hinweise zu den Online-Materialien
Das Online-Angebot, das mit der vorliegenden Veröffentlichung einhergeht, steht für Sie unter www.ibidem-verlag.de/downloads/9783838205403.zip bereit.Sie können alle Fragebögen, Textblätter und Besinnungstexte downloaden und für eigene Zwecke verwenden.Drei Ordner beinhalten die Materialien sowie weitere Dateien.
Im ersten Ordner (Arbeitsmaterial) findendie oben schon erwähnten Arbeitsmaterialien. Der Fragebogen kann mit einem Jugendlichen unter vier Augen bearbeitet werden. Vorher sollten natürlich schon entsprechende Verhaltensweisen beobachtet werden, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Persönlichkeitsstil hindeuten. Der Fragebogen kann dann mehr „Licht ins Dunkel“ bringen. Mithilfe eines Schemamodusgesprächs kann man gemeinsam ein Problembewusstsein erarbeiten. Die Textblätter helfen ebenfalls bei der Psychoedukation. Vielleicht kommt auch beim Bearbeiten dieser Materialien heraus – man war diagnosetechnisch auf dem falschen Dampfer (kann passieren).Auch die Stühlearbeit unddie Besinnungstextesind effiziente Methoden in der Problemklärungsphase.
Der zweite Ordner (Grundlagen) beinhaltetDateien, die zahlreiche Informationen über die Schemapädagogik offenbaren.
Im dritten Ordner (Sonstiges) finden Sie einen aktuellen Flyer sowie die Beschreibung eines Franchise-Angebots (Schemapädagogik-Trainerin/-Trainer).
Um zum Download zu gelangen, müssen Sie lediglich die Homepage des Ibidem-Verlags aufrufen (http://www.ibidem-verlag.de). Danachgeben Sie einfach den Buchtitel in das Recherche-Feld ein. Klicken Sie den Titel an und befolgen Sie die Download-Anweisungen.Das erste Wortauf Seite 11in diesem Buch ist gleichzeitig das Passwort.
Ich hoffe, dass Ihnen die beschriebenenMethoden im Umgang mit Ihren herausfordernden Fällen hilfreich sind.Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie mich einfach an (siehe unten).
Mein Dank geht an Luisa Martinez, die für die ansprechenden Zeichnungen verantwortlich ist.
Worms, imSommer 2013
Dr. Marcus Damm
Kontakt
Institut für Schemapädagogik
Dr. Marcus Damm
Höhenstr. 56
67550 Worms
E-Mail:[email protected]
Internet:http://www.schemapädagogik.de
Einleitung:Schemapädagogik® – ein neuropädagogisches Konzept entwickelt sich
Lernziele
In diesem Beitrag werden verschiedene Ziele verfolgt. Er beinhaltet zum einen die pädagogischen und psychotherapeutischen Grundlagender Schemapädagogik® (vgl. DAMM2010a, 2010b, 2010c). Namentlich handelt es sich hierbei besonders um die Schematherapie (YOUNG et al.2008) und Klärungsorientierte Psychotherapie (SACHSE 2003;2006;SACHSE et al., 2009).
Zum anderen wird auf das Konzept der Persönlichkeitsstörungen (FIEDLER 2007; NISSEN2000) sowie auf neuere Interventionen der Schemapädagogik (vgl. DAMM2013) eingegangen.
1 Schemapädagogik – ein neues Konzept entwickelt sich
Das Projekt Schemapädagogik nahm 2009 langsam Gestalt an. In einer Weiterbildung von BF 1-Fachpraxislehrerinnen und -lehrern, an der – Achtung: narzisstische Tendenz! –ichin Speyer als Dozent mitwirkte, stand bereits im 1. Modul das Thema „Umgang mit interaktionsschwierigen Schülern“ auf dem Programm.
Während meiner Vorbereitungen stieß ich auf die Schematherapie. Hier fand ich ein schlüssiges integratives Konzept zum Umgang mit verhaltensauffälligen Klienten im Psychotherapiebereich. Testweise habe – Entschuldigung: wieder die narzisstische Tendenz – ich wesentliche schematheoretische Konzepte wie die Schematheorie und das Modusmodell auf den Schulbereich (Sek. 2) übertragen. Weiter befruchtet wurde die Vorbereitung von der sogenannten Klärungsorientierten Psychotherapie (SACHSE2003), in der u.a. provozierende Kommunikationsstrategien von interaktionsschwierigen Klienten transparent gemacht und gemeinsam bearbeitet werden (sog. Images, Tests, Psychospiele und Appelle).
Ebenfalls wurden auch die Transaktionsanalyse (BERNE1964) und die Konfrontative Pädagogik (KILB, WEIDNER & GALL2003) bei der Planung als sinnvoll erachtet. D.h., verschiedene Elemente wurden in das oben genannte Seminar integriert. Das Konglomerat wurde schließlich mit dem Begriff „Schemapädagogik“ etikettiert. Dann fing die eigentliche Konzeption und Ausarbeitung des neuen Ansatzes erst richtig an.
Seit der publikationstechnischen Grundlegung des Konzeptsvor wenigen Jahren (DAMM 2010a) wurden mehr als 500 pädagogische Fachkräfte aus den unterschiedlichsten Praxisfeldern im Rahmen von Seminaren und Fortbildungen schemapädagogischgecoacht. Eine erste Evaluation im Schulbereich fiel sehr positiv aus (DAMM2012a, S. 226ff.). Fazit bisher: Schemapädagogik fördert die pädagogische Fach- und Sozialkompetenz! Zahlreiche Publikationen erschienen bis dato (siehe weiterführende Literatur). Erfreulicherweise tut sich heuer auch was in Hinsicht auf das Projekt „bundesweite Fort- und Weiterbildung“. In Kooperation mit dem Trainerkollektiv AWOLON wird derzeit in Nordrhein-Westfalen eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Schemapädagogin/zum Schemapädagogen konzipiert. Im Frühjahr 2014 soll es losgehen (nähere Informationen unter folgender Adresse:http://www.awolon.de).
1.1 Anwendungsbereiche
Mittlerweile liegen ausgearbeitete Methoden, Einheiten und Materialien für verschiedene sozialpädagogische Praxisfelder vor: für den Kita- und Hortbereich (Damm 2010d), ebensofür die Bereiche Schule (DAMM2010b;DAMM & EBERT2012) und soziale Arbeit (DAMM & WERNER2011). Der Transfer des Konzepts der Persönlichkeitsstörungen in das Praxisfeld Erziehung und Bildung gestaltete sich als recht umfangreich: Letztes Jahr erschien die Buch-TrilogiePersönlichkeitsstörungen verstehen in der Schule, Schulsoziarbeit und Jugendhilfe verstehen 1-3(DAMM2012a, 2012b, 2012c).
2 Grundlagen
Im Folgenden werden die Grundlagen der Schemapädagogik ausgeführt.
2.1 Schemabasierte Psychotherapien
Die sogenannten schemabasierten Psychotherapien, etwa Schematherapie und Klärungsorientierte Psychotherapie, gehören zur „dritten Welle“ in der Verhaltenstherapie.
Rainer Sachse entwickelte die Klärungsorientierte Psychotherapie (2003). Zunächst an der klassischen Gesprächspsychotherapie angelehnt, wurde sie später weiter modifiziert. Sie vereinigt nunmehr in sich Aspekte der sogenanntenZielorientiertenGesprächspsychotherapie,process-experiental psychotherapy, und sie wird ergänzt durch kognitiv-behaviorale Methoden.
Im Unterschied zur Vorgehensweise in der (nicht-direktiven) Gesprächspsychotherapie, deren Elemente in die Sozialpädagogik transferiert wurden, übernimmt der Therapeut die Verantwortung für den Prozess. Klärungsorientierte Psychotherapie ist im hohen Maß prozessorientiert aufgebaut (und nicht non-direktiv).
Klärungsorientierte Psychotherapie ist kein rein kognitives Verfahren, sondern – wie auch die Schematherapie – ein integratives. Hier wird vor allem dem motivationspsychologischen Befund Rechnung getragen, dass es, verkürzt gesagt, zwei innerpsychische Motivationssysteme gibt, die in der Therapie berücksichtigt werden müssen: (a) ein explizites (dem Klienten bewusst) und (b) ein implizites (dem Klienten nicht bewusst) (ROTH2007).
In diesem Ansatz versteht man entsprechend auch Schemata als Muster mit kognitivenundaffektiven Anteilen; sie laufen automatisiert ab und steuern das Verhalten. Die Schema-Aktivierungen und die damit verbundenen kostenintensiven Auswirkungen sind dem Betreffenden nicht präsent, weil dysfunktionale Schemata vor allem im impliziten Gedächtnis verortetsind (ROTH2003).
Theoretische Fundierungen dieses Ansatzes sind unter anderem die Bindungstheorie, Transaktionsanalyse, selbstverständlich das Schema-Modell und, wie schon angedeutet, die Motivationspsychologie. Zur Anwendung kommt das Konzept vor allem bei Persönlichkeitsstörungen, Angststörungen, Depression, Abhängigkeitserkrankungen und psychosomatischen Störungen.
Wie auch in der Kognitiven Therapie und Schematherapie der Fall, so wird auch im Rahmen der Klärungsorientierten Psychotherapie davon ausgegangen, dass dysfunktionale Schemata persönliche und soziale Probleme verursachen. Diese Schemata werden von Klienten nicht objektiv wahrgenommen, da bereits die Wahrnehmung schemaspezifisch eingefärbt sein kann. Von sich aus, so die therapeutische Erfahrung, führen Klienten selbst so gut wie keine Klärungsprozesse aus.
Der US-amerikanische Psychotherapeut Jeffrey E. Young ist der Begründer der Schematherapie. Sie stellt eine Erweiterung der Kognitiven Verhaltenstherapie dar (Young wurde am Forschungsinstitut für Kognitive Therapie von Beck ausgebildet).
Die Schematherapie ist eine schulenübergreifende Konzeption und wird, wie oben schon erwähnt, zur dritten Welle der Verhaltenstherapie gezählt (wie auch die Klärungsorientierte Psychotherapie). Youngs Ansatz bezieht Aspekte der Verhaltenstherapie, Neurobiologie, Kognitiven Therapie, Bindungstheorie, Gestalttherapie und der psychodynamischen Therapie mit ein. In Deutschland erfährt der Ansatz immer mehr Popularität, was sicherlich auch mit der in Fachkreisen bekannten Forderung von GRAWE(2004) zusammenhängt, den Schema-Begriff in die von ihm angeregte Allgemeine Psychotherapie mit einzubeziehen. Der Psychiater Eckhard Roediger (2009) unterstützt die Verbreitung im deutschsprachigen Raum sehr intensiv. Er veröffentlichte hierzulande den ersten Beitrag zur Schematherapie und bereicherte sie um einige Erweiterungen. Ferner bezog er die Schematherapie auf das von Grawe entwickelte integrative Therapieverständnis.
2.2 Neurobiologische und schematheoretische Grundlagen der Entwicklung
Die Persönlichkeit eines Menschen reift in Form einer Wechselwirkung zwischen Anlage- und Umwelteinflüsse bereits in den ersten sechs Jahren zu einem Großteil heran. Dies ist kein Zufall, als sich in dieser Zeitspanne das Gehirn so fundamental entwickelt, wie zu keinem Zeitpunkt mehr danach. Zwar hat ein zweijähriges Kind bereits in etwa so viele Gehirnzellen wie ein Erwachsener (etwa 100 Milliarden) – aber eines hat noch nicht stattgefunden: Die Feinverdrahtungzwischenden Zellen. Überwiegend „vernetzt“ ist das Gehirn bereits im Alter von 4 bis 7 Jahren (ROTH2007). Eine gewisse Plastizität bleibt jedoch ein Leben lang bestehen. Das heißt, es können in bestimmten Situationen neue Bahnungen und Verbindungen erfolgreich angelegt werden, auch und gerade in sozialpädagogischen Einrichtungen! (Hierzu muss aber die Beziehung zwischen den Beteiligten stimmen, da sie der „Motor“ von jeglichen Umbaumaßnahmen im Gehirn darstellt: Ohne Beziehung geht, lapidar gesagt, nichts!).
Schaut man sich die Ausformung des Gehirns in den ersten Lebensjahren genauer an, so fällt auf, dass das Wachstum vonunten nach obenverläuft. Bereits im Mutterleib, genauer gesagt, etwa ab der sechsten Schwangerschaftswoche, sind „niedere“ Strukturen des sogenannten limbischen Systems nachweisbar – dieses Hirnareal wird mit Emotionen und Motivationen in Zusammenhang gebracht –, und es kommt ab diesem Zeitpunkt schon zu gefühlsspezifischen Konditionierungsprozessen, die durch die hauptsächlichen Bezugspersonen inszeniert werden (SPITZER2009). Der Fötus wird also bereits im Bauch der Mutter (emotional) sozialisiert.
Nachweislich korreliert eine Schwangerschaft, die viele Risikofaktoren aufweist, etwa Substanzmittelmissbrauch der Mutter, traumatische Erfahrungen, Gewalterfahrungen, ein „stressender Lebensstil“ usw., mit einem extrovertierten, stresssensiblen (vulnerablen) Temperament seitens des Neugeborenen (ROTH2007).
Die Entwicklung des sogenannten Neocortex (Großhirnrinde) andererseits, der für die höheren, sprich vernünftigen Leistungen zeitlebens verantwortlich ist, findet erstnachgeburtlichstatt, und zwar maßgeblich in den ersten Lebensjahren. Das Gehirn verdrahtet sich entsprechend so, wie es das soziale Umfeld des Betreffenden vorgibt.
Konkret gesagt: Die soziale Umwelt mitsamt ihren Eigenarten und Ritualen wird wie ein „Schwamm“ aufgesogen. – Die jeweils erlebte Realität wandert „nach innen“, wird entsprechend Bestandteil des eigenen Selbst, des Subjektiven. Psychoanalytiker nennen diesen Prozess Verinnerlichung von Objekt-Imagines. Und weiter: Spezifische Einstellungen der Bezugspersonen über den Heranwachsenden werden schrittweise zu seinen(!) Meinungen (Schemata), zu Ansichten über sich selbst, die Welt (und andere).
Individuelle Erlebens- und reaktive Verhaltensmuster zementieren sich nach und nach, insbesondere wenn die äußeren sozialen Verhältnisse dies geradezu erfordern. Je öfter das soziale Umfeld ein bestimmtes Feedback gibt („Deine Meinung zählt nicht!“), desto eher werden die psychisch notwendigen Reaktionen, beispielsweise die Tendenz zur Unterordnung beziehungsweise zur Kompensation, zu einem festen innerpsychischen Bestandteil der eigenen Persönlichkeit. Die Reaktionen werden entsprechend zu festen Schemata, die später in Situationen, die an die ursprünglichen Verhältnisse erinnern, stets wieder automatisch ausgelöst werden.
Weil nun vernunftfähige Teile der Großhirnrinde sowie die Areale, die das Ich-Bewusstsein konstruieren, erst Jahre nach der Geburt fertig ausgeprägt sind, werden automatisierte (eventuell negative) soziale Verhaltensmuster, die in den ersten Lebensjahren erlernt wurden, später hinaus nicht reflektiert und sind somit auch nicht veränderbar. Denn sie laufen im Hier und Jetzt nach neurowissenschaftlicher Argumentation unbewusst ab (ROTH2003).
2.3 Konzept der Persönlichkeitsstörungen
Das Konzept der Persönlichkeitsstile/-störungen ist im Praxisfeld Erziehung in der Regel völlig unbekannt. Dies ist kein Zufall, sondern bildungspolitisch bedingt. PädagogInnen durchlaufen eine andere Ausbildung als PsychologInnen (die das genannte Konzept daher in der Regel kennen). Meines Erachtens stellt dies heutzutage ein – von uns Fachkräften unbemerktes – Manko dar. Das Wissen um das Konzept der Persönlichkeitsstile kann dabei helfen, diejenigen Beziehungsstörungen in pädagogischen Praxisfeldern zu erkennen und zu begreifen, die mit dem üblichen „pädagogischen Handwerkskoffer“ gar nicht in den Griff zu bekommen sind.
Der Persönlichkeitsstil, ein Bündel aus spezifischen Denk- und Verhaltensweisen, beeinflusst maßgeblich in emotionaler und rationaler Weise die relevanten Lebensbereiche einer Person (OLDHAM & MORRIS2007, S. 9): die Beziehungen, das Arbeitsverhalten, das Selbstbild, die Gefühle und Impulse im Alltag usw. Ebenfalls der Umgang mit den Kindern, den KollegInnen wird vom eigenen Persönlichkeitsstil beeinflusst.
Charakterisiert sich ein Persönlichkeitsstil als sehr extrem, erfüllt er manchmal die Kriterien einer sogenannten Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörungen charakterisieren sich durch folgendeFaktoren und Phänomene (TRESS et al.2002):
a)Der/die Betreffende zeigt andauernde, unflexible, unangepasste und vor allem auffällige Verhaltensmuster.
b)Es liegt ein tief verwurzeltes Fehlverhalten vor, welches in den meisten sozialen und persönlichen Situationen unpassend ist.
c)Eine schwerwiegende Einschränkung folgender Funktionsbereiche ist erkennbar: Antrieb/Motivation, Impulskontrolle, Reflexionsfähigkeit und Wahrnehmung.
d)Die Störung istfesterBestandteil der Persönlichkeit.
e)Die beruflich-sozialeLeistungsfähigkeitist stark eingeschränkt.
Persönlichkeitsstörungen kommen relativ häufig vor. Man geht davon aus, dass circa 10–15 % der Allgemeinbevölkerung von (mindestens) einer solchen psychischen Beeinträchtigung betroffen sind (NISSEN 2000; FIEDLER2007). Meistens offenbaren die Betreffenden mehr als nur eine Störung. Dieser Wert ist schon ziemlich bemerkenswert. Aber: Hinzu kommt noch eine Personengruppe, die etwa 15 % der Allgemeinbevölkerung ausmacht. Diese Gruppe offenbart „nur“ eine auffällige Ausprägung mindestens eines Persönlichkeitsstils (quasi die Vorstufe einer Persönlichkeitsstörung) (LELORD & ANDRÈ2005).
3 Schemapädagogische Interventionen und Methoden in pädagogischen Praxisfeldern
Die alltägliche Praxis mit Kindern und Jugendlichen wird nun von SchemapädagogInnen um zwei Dimensionen erweitert: um eine schema- und persönlichkeitsspezifische Perspektive. Im Folgenden wird darauf eingegangen.
3.1 Diagnostik (Beobachtungsphase)
Im Rahmen der Schemapädagogik werden innerpsychische Muster der Klienten diagnostiziert, sogenannte Schemata, und thematisiert.
Ein solches Schema führt im Falle einer Aktivierung zu bestimmten Erinnerungen, Ge