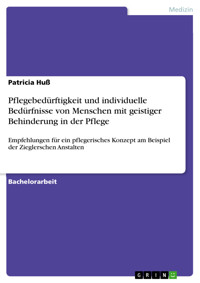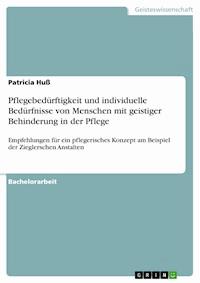
Pflegebedürftigkeit und individuelle Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung in der Pflege E-Book
Patricia Huß
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Soziale Arbeit / Sozialarbeit, Note: 1.3, Hochschule Ravensburg-Weingarten, Sprache: Deutsch, Abstract: Menschen mit geistiger Behinderung, die in Institutionen der Behindertenhilfe leben, sind häufig auf pflegerische Unterstützung angewiesen. Die Relevanz pflegerischer Versorgung in diesem Bereich wird in Zukunft weiterhin zunehmen. Die Entwicklungen im Gesundheitssektor, höhere Lebensqualität und ein besseres Bildungssystem haben zur Folge, dass die Lebenserwartung der Menschen kontinuierlich steigt. Ein weiterer Grund ist in den strukturellen Versorgungsbedingungen zu finden. In Zukunft werden neben älteren Menschen vor allem Menschen mit schweren Behinderungen und erhöhtem pflegerischem Bedarf in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe versorgt. Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen stehen hier vor der Aufgabe, die betroffene Personengruppe nicht nur aufgrund der Pflegebedürftigkeit, sondern ebenso unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der entsprechenden Lebenssituation zu pflegen. Dabei werden die Pflegenden mit speziellen Herausforderungen konfrontiert, denn die Lebensbegleitung von Menschen mit geistiger Behinderung beinhaltet pflegerische Problemstellungen, die in besonderer Weise berücksichtigt werden müssen. In der Praxis stellt sich täglich die Frage: Welche Pflege brauchen Menschen mit geistiger Behinderung? Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, das Spezifische der pflegerischen Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung zu erfassen. Es wird durchleuchtet, welche Formen der Pflegebedürftigkeit und welche individuellen Bedürfnisse die Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung umfasst. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen als Ausgangslage für die Entwicklung eines angemessenen Versorgungskonzeptes dienen, um die pflegerische Begleitung dieser Personengruppe zu optimieren und somit ihre Lebensqualität zu erhöhen. Im ersten Teil der Arbeit wird der theoretische und konzeptionelle Rahmen skizziert. Zunächst werden einige wesentliche Aspekte der Bedürfnistheorie nach Maslow vorgestellt sowie die Grundlagen und Grundbegriffe der geistigen Behinderung, der Pflegebedürftigkeit, des Pflegebedarfs und der individuellen Bedürfnisse geklärt. Des Weiteren werden die wesentlichen Aspekte der Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung erläutert sowie das Verhältnis von Pflege und Pädagogik näher beleuchtet. Der zweite Teil widmet sich der Vorstellung der Studie: Pflegebedarf und individuelle Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Page 2
Danksagung:
Die vorliegende Arbeit entstand im Rahmen des Studiengangs Pflegepädagogik an der Hochschule in Ravensburg-Weingarten. Ich bedanke mich bei allen, die mich bei ihrer Entstehung unterstützt haben.
Prof. Dr. Birgit Vosseler danke ich dafür, dass sie mit ihren Ideen und unermüdlichem Einsatz meine Bachelorarbeit betreut hat und mir dennoch die Freiheit gelassen hat, sie nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln. Prof. Dr. Axel Olaf Kern danke ich für die konstruktive Kritik und seine Tätigkeit als Zweitkorrektor.
Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Ludger Baum für die freundliche Unterstützung bedanken.
Ich danke Herrn Manfred Blank, der mich ermutigt hat, mich diesem Thema zu widmen.
Bei Herrn Werner Dudichum möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken.
Mein Dank gilt ferner der Geschäftsführung der Behindertenhilfe der Zieglerschen, deren Büroräume ich für die Anfertigung dieser Arbeit nutzen durfte.
Bedanken möchte ich mich auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen Haslachmühle und Rotachheim, die sich an der Untersuchung beteiligt haben, besonders beim Herrn Clemens Graf. Ich danke Hans-Joachim Huß für den Crashkurs in Excel. Stefan Huß danke ich für die Lösung mancher technischer Probleme.
Großer Dank gebührt auch meinem Mann, Torsten Huß, der mich unermüdlich darin unterstützte, Studium und Familie erfolgreich zu kombinieren. Mein besonderer Dank gilt den Menschen mit geistiger Behinderung, ohne die es diese Arbeit gar nicht gäbe.
Patricia Huß Ravensburg, im April 2009
Page 4
1 Einleitung: gesellschaftliche und professionelle Relevanz 1
_____________________________________________________________
1 Einleitung: gesellschaftliche und
professionelle Relevanz
Menschen mit geistiger Behinderung, die in Institutionen der Behindertenhilfe leben, sind häufig auf pflegerische Unterstützung angewiesen. Die Relevanz pflegerischer Versorgung in diesem Bereich wird in Zukunft weiterhin zunehmen. Die Entwicklungen im Gesundheitssektor, höhere Lebensqualität und ein besseres Bildungssystem haben zur Folge, dass die Lebenserwartung der Menschen kontinuierlich steigt. Der demografische Wandel macht sich nun, etwas verspätet, auch im Bereich der Behindertenhilfe bemerkbar. Der Grund ist im Euthanasieprogramm des Dritten Reiches zu finden. In den Jahren 1941 bis 1945 fielen die meisten Menschen mit geistiger Behinderung und psychischer Erkrankung dem Nazi-Regime zum Opfer (vgl. Kreuzer, 1996). Ein weiterer Grund ist in den strukturellen Versorgungsbedingungen zu finden. In Zukunft werden neben älteren Menschen vor allem Menschen mit schweren Behinderungen und erhöhtem pflegerischem Bedarf in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe versorgt. Zuletzt gilt es noch die organisatorischen Veränderungen in der Krankenhausversorgung zu erwähnen, die mit der Einführung der G-DRGs1unter anderem auch frühere Entlassungen mit sich brachten und eine entsprechende pflegerische Versorgung „zu Hause“ notwendig machten (vgl. BEB 2008).
In der Behindertenhilfe der Zieglerschen Anstalten werden in Rotachheim, Haslachmühle und den Offenen Hilfen rund 450 Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen - vor allem mit geistiger und Hör-Sprach-Behinderung begleitet. Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen stehen hier vor der Aufgabe, die betroffene Personengruppe nicht nur aufgrund der Pflegebedürftigkeit, sondern ebenso unter Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und der entsprechenden Lebenssituation zu pflegen.
1G-DRGs (German Diagnosis Related Groups) sind ein Patientenklassifikationssystem, mit dem einzelne stationäre Behandlungsfälle anhand bestimmter Kriterien (Diagnosen,
Schweregrad, Alter usw.) zu Fallgruppen zusammengefasst werden (Wienand, M. 2003).Huß, Bachelorarbeit im WS 2008/2009
Page 5
1 Einleitung: gesellschaftliche und professionelle Relevanz 2
_____________________________________________________________ Dabei werden die Pflegenden mit speziellen Herausforderungen konfrontiert, denn die Lebensbegleitung von Menschen mit geistiger Behinderung beinhaltet pflegerische Problemstellungen, die in besonderer Weise berücksichtigt werden müssen. In der Praxis stellt sich täglich die Frage: „Welche Pflege brauchen Menschen mit geistiger Behinderung?“
Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, das Spezifische der pflegerischen Begleitung von Menschen mit geistiger Behinderung zu erfassen. Es wird durchleuchtet, welche Formen der Pflegebedürftigkeit und welche individuellen Bedürfnisse die Pflege von Menschen mit geistiger Behinderung umfasst. Die Ergebnisse der Untersuchung sollen als Ausgangslage für die Entwicklung eines angemessenen Versorgungskonzeptes dienen, um die pflegerische Begleitung dieser Personengruppe zu optimieren und somit ihre Lebensqualität zu erhöhen. Angesichts der demografischen Entwicklung wird das Thema Pflege häufig auf die alt werdenden Menschen mit geistiger Behinderung eingegrenzt. In der Behindertenhilfe werden jedoch Menschen aller Altersgruppen gepflegt. Die Fragen zur pflegerischen Versorgung müssen sich deshalb auf die gesamte Lebensspanne beziehen.
Im ersten Teil der Arbeit wird der theoretische und konzeptionelle Rahmen skizziert. Zunächst werden einige wesentliche Aspekte der Bedürfnistheorie nach Maslow vorgestellt sowie die Grundlagen und Grundbegriffe der geistigen Behinderung, der Pflegebedürftigkeit, des Pflegebedarfs und der individuellen Bedürfnisse geklärt. Des Weiteren werden die wesentlichen Aspekte der Pflege
von Menschen mit geistiger Behinderung erläutert sowie das Verhältnis von Pflege und Pädagogik näher beleuchtet.
Der zweite Teil widmet sich der Vorstellung der Studie „Pflegebedarf und individuelle Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung“. Im dritten Teil schließt sich eine Darstellung der Ergebnisse der Arbeit sowie eine Diskussion im Hinblick auf die Konsequenzen für die Praxis an. Abschließend werden einige Empfehlungen für ein pflegerisches Konzept für die Behindertenhilfe ausgesprochen.
Huß, Bachelorarbeit im WS 2008/2009
Page 6
2 Theoretischer und konzeptioneller Rahmen 3
_____________________________________________________________
2 Theoretischer und konzeptioneller Rahmen
2.1 Maslowsche Bedürfnispyramide
In der vorliegenden Arbeit geht es primär darum, die individuellen Bedürfnisse der Menschen mit geistiger Behinderung zu erfassen. Als konzeptioneller Bezugsrahmen wurde hier die Motivationstheorie gewählt, die 1954 von Abraham Maslow entwickelt wurde. Die Grundlage für Maslows Motivationstheorie bildet eine in fünf Bedürfnisklassen unterteilte Bedürfnispyramide. „Maslow geht von einer Hierarchie der Bedürfnisse aus. Zuerst müssen die Grundbedürfnisse (Hunger, Durst) erfüllt werden, bevor andere Bedürfnisse befriedigt werden können“ (Arets & Obex & Vaessen & Wagner 2000).
Die unterste Stufe gilt als Ausgangspunkt der Motivationstheorie. Sie beinhaltet die grundlegenden Bedürfnisse, welche das physiologische Gleichgewicht, die sogenannte Homöostase, erhalten sollen. Dies sind unter anderem das Bedürfnis nach Nahrung, das Bedürfnis nach Kleidung, das Bedürfnis nach Schlaf und das Bedürfnis nach Sexualität. „Ohne Zweifel sind diese physiologischen Bedürfnisse die mächtigsten unter allen (...) Jemand, dem es an Nahrung, Sicherheit, Liebe und Wertschätzung mangelt, würde wahrscheinlich nach Nahrung mehr als nach etwas anderem hungern“ (Maslow 2008, S. 63).
Sobald die physiologischen Bedürfnisse im Wesentlichen befriedigt sind, kommt die nächste Stufe, die grob als Sicherheitsbedürfnisse des Menschen bezeichnet werden kann. Diese umfasst unter anderem „Sicherheit; Stabilität; Geborgenheit; Schutz; Angstfreiheit; Bedürfnis nach Struktur; Ordnung; Gesetz; Grenzen; Schutzkraft; und so fort“ (Maslow 2008, S. 66). Die dritte Stufe bildet die Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Liebe. Sie werden im Allgemeinen auch als die sozialen Bedürfnisse bezeichnet. Der Mensch strebt danach, in einer Gemeinschaft zu leben und soziale Beziehungen aufzubauen. „Jede gute Gesellschaft muß dieses Bedürfnis befriedigen, auf die eine oder andere Art und Weise, wenn sie überleben und gesund bleiben will“ (Maslow 2008, S. 72).
Huß, Bachelorarbeit im WS 2008/2009
Page 7
2 Theoretischer und konzeptioneller Rahmen 4
_____________________________________________________________ Auf der vierten Stufe befinden sich die Bedürfnisse nach Achtung. „Alle Menschen in unserer Gesellschaft (mit einigen pathologischen Ausnahmen) haben das Bedürfnis oder den Wunsch nach einer festen, gewöhnlich recht hohen Wertschätzung ihrer Person, nach Selbstachtung und der Achtung seitens anderer“ (Maslow 2008, S. 72).
Selbst wenn alle bereits genannten Bedürfnisse befriedigt sind, wird der Mensch vermutlich noch nicht zufrieden sein. Es ist eher wahrscheinlich, dass eine „neue Unzufriedenheit und Unruhe entsteht, wenn der einzelne nicht das tut, wofürer,als Individuum, geeignet ist (vgl. Maslow 2008, S. 73). Somit finden sich auf der fünften Stufe der Pyramide die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung. Jeder Mensch versucht demnach die eigenen Möglichkeiten zu realisieren. So strebt er nach Unabhängigkeit und nach Entfaltung seiner Persönlichkeit.
Die hierarchische Darstellung der Bedürfnispyramide zeigt in den ersten vier Stufen die sogenannten Defizit- bzw. Mangelbedürfnisse. Die fünfte Stufe, das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, wird auch Wachstumsbedürfnis genannt. Nach Maslow entsteht ein Mangelbedürfnis nur aus einem Mangelzustand heraus. Erst wenn die Mangelbedürfnisse befriedigt sind, tritt das Wachstumsbedürfnis auf. Demnach liegen der Theorie von Maslow zwei Prinzipien zugrunde: das Defizit-Prinzip und das Progressions-Prinzip. Das Defizit-Prinzip beschreibt das Streben des Menschen nach der Befriedigung seiner bis dato unbefriedigten Bedürfnisse. Das heißt der Mensch hat die Motivation nur beim Vorhandensein eines unbefriedigten Bedürfnisses. Hat er dieses Bedürfnis befriedigt, wird es bei ihm zu keiner Motivationskraft mehr führen. Das Progressions-Prinzip meint die Motivation des Menschen durch das hierarchisch niedrigste unbefriedigte Bedürfnis (vgl. Schreyögg 2007). Somit ist er zunächst um die Befriedigung der physiologischen Bedürfnisse bestrebt. „Und wenn diese ihrerseits befriedigt sind, kommen neue (und wiederum höhere) Bedürfnisse zum Vorschein, und so weiter“ (Maslow 2008, S. 65). Die Bedürfnisse treten bei allen Menschen, unabhängig von ihrer Kultur, auf. Unterschiede gibt es nur in der Art, wie sie befriedigt werden: „Sicherlich wird in jeder gegebenen Kultur die bewusste Motivation einer Person extrem vom bewussten Motivationsinhalt einer Person in einer anderen Gesellschaft verschieden sein“ (Maslow 2008, S. 82).
Huß, Bachelorarbeit im WS 2008/2009
Page 8
2 Theoretischer und konzeptioneller Rahmen 5
_____________________________________________________________ Alle Menschen haben also Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Die Voraussetzungen dafür sind „Selbständigkeit“ und „Kommunikation“ (Kane & Klauß 2003, S. 28). Menschen mit geistiger Behinderung benötigen bei der Befriedigung ihrer Bedürfnisse häufig Unterstützung. Insbesondere diejenigen mit eingeschränkter Kommunikationsfähigkeit können ihren Bedürfnissen nicht in geeigneter Weise Ausdruck verleihen. Sie sind auf die Interpretationen anderer Personen angewiesen. Auch bei ihrer Erfüllung benötigen sie Hilfe und Assistenz. Dabei besteht stets die Gefahr, dass Bedürfnisse nicht erkannt, gedeutet und dementsprechend befriedigt werden. „Sie haben wenig Einfluss darauf, welche ihrer Bedürfnisse befriedigt werden und ob ihnen von denen, die Pflege finanzieren oder ausführen, das zugestanden wird, was sie im Zusammenhang mit ihren körperlichen Bedürfnissen benötigen“ (Kane & Klauß 2003).
Unabhängig davon, ob ein Mensch seine Bedürfnisse selbständig oder mit Unterstützung anderer befriedigt, sollte er die Möglichkeit haben, dies selbstbestimmt zu tun. Das Recht auf Selbstbestimmung wird im Artikel 1 des Grundgesetzes festgehalten: „Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“ (Grundgesetz, Art. 2, Abs. 1). Demnach sollte sich pflegerisches Handeln nach den Wünschen und Bedürfnissen des Empfängers richten. Sie „hat partnerschaftlichen Charakter, der vom Respekt gegenüber dem Patienten und letztendlich von dessen Selbstbestimmungsrecht ausgeht“ (Arets & Obex & Vaessen & Wagner 2000, S. 157).
2.2 Definition der Schlüsselbegriffe
Um eine gemeinsame Ausgangsbasis zum besseren Verständnis der vorliegenden Arbeit zu schaffen, werden im Folgenden die Begriffe der geistigen Behinderung, der Pflegebedürftigkeit und der individuellen Bedürfnisse geklärt.
Geistige Behinderung
Der Begriff „Geistige Behinderung“ lehnt sich an das englische Wort „mental retardation“ an. Er wurde in Deutschland 1958 durch eine Elterninitiative der Lebenshilfe eingeführt.
Huß, Bachelorarbeit im WS 2008/2009
Page 9
2 Theoretischer und konzeptioneller Rahmen 6
_____________________________________________________________ Im Bemühen um mehr Integration sollte von bis dato etablierten diskriminierenden Bezeichnungen wie „Schwachsinn“, „Idiotie“ und „Blödsinn“ Abstand genommen werden.