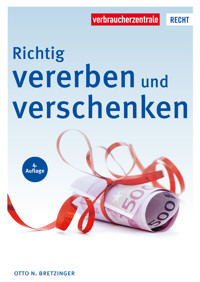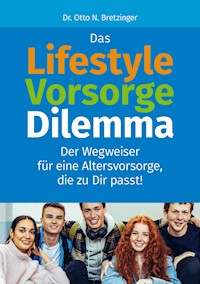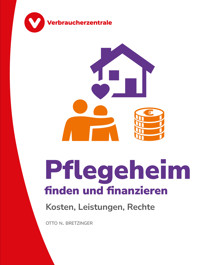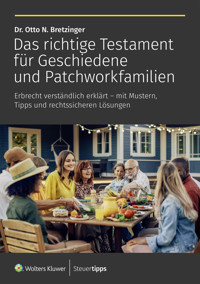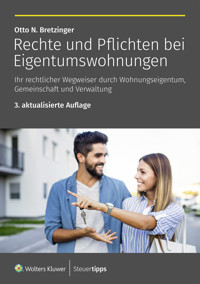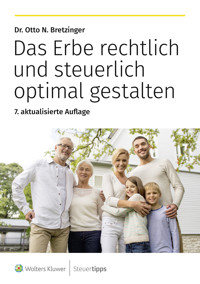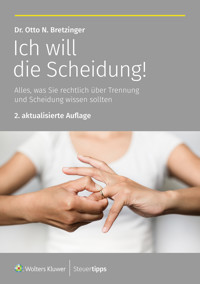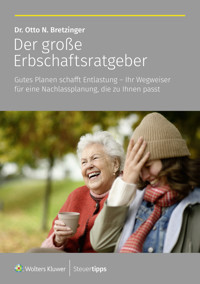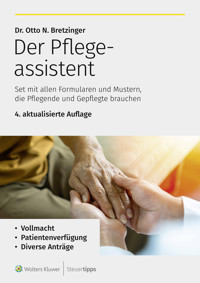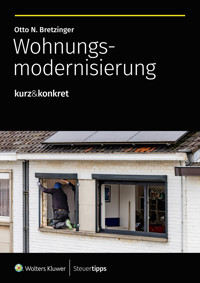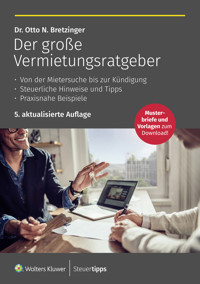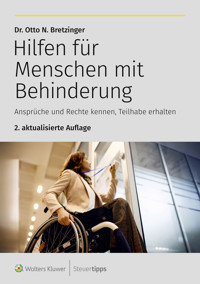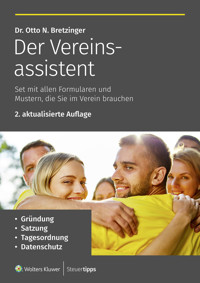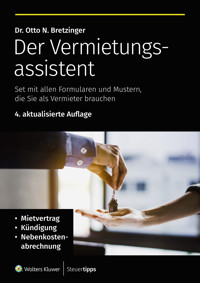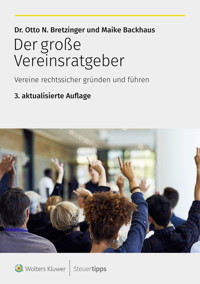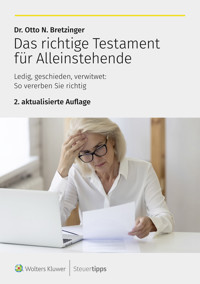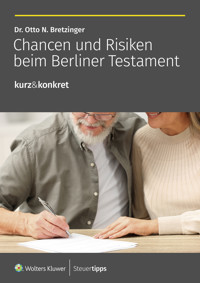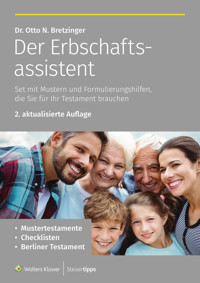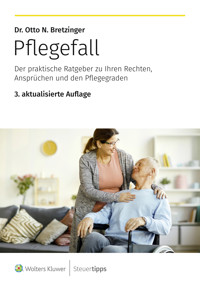
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wolters Kluwer Steuertipps GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Fast fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die meisten werden zuhause durch Angehörige oder einen ambulanten Pflegedienst gepflegt. Durch die gesetzliche Pflegeversicherung wird das allgemeine Lebensrisiko, pflegebedürftig zu werden und die Kosten der Pflege nicht tragen zu können, abgesichert. Die Pflegeversicherung ist allerdings keine Vollversicherung, weil die gedeckelten Leistungen oft nur einen Teil der anfallenden Kosten der Pflege abdecken. Für den Pflegenden ist die Pflege eines Menschen nicht nur mit hohem persönlichem Einsatz, sondern unter Umständen auch mit finanziellen Einbußen verbunden, die durch die Pflegeversicherung nur bedingt ausgeglichen werden. Oft stehen Betroffene ratlos vor der Fülle an Fragen, Formalitäten und Möglichkeiten und verlieren den Überblick über alles, was es zu tun und zu beachten gibt. Dieser Ratgeber will allen Beteiligten, dem Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen, bei diesen täglichen Herausforderungen der Pflege helfen, indem alle Themen rund um die Pflege umfassend und verständlich vorgestellt und erläutert werden. Sie erfahren u.a., - wie Sie sich auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung und der Ermittlung des Pflegegrades vorbereiten können, - welche Leistungen der sozialen Pflegeversicherung Ihnen bei der häuslichen Pflege oder bei der Pflege im Heim zustehen, - wie das Pflegerisiko ergänzend durch Leistungen der Sozialhilfe abgesichert ist, - auf was Sie achten müssen, wenn Sie Unterstützung durch eine ausländische Haushalts- und Betreuungskraft einholen wollen, - wie pflegende Angehörige im Rahmen der Sozialversicherung unterstützt und wie sie Pflege und Beruf durch verschiedene Freistellungsmöglichkeit miteinander vereinbaren können.Die 3. Auflage berücksichtigt die mit dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz verbundenen Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 by Wolters Kluwer Steuertipps GmbHPostfach 10 01 61 · 68001 MannheimTelefon 0621/[email protected]
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Angaben wurden nach genauen Recherchen sorgfältig verfasst; eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen.
Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verwenden wir allgemein die grammatisch männliche Form. Selbstverständlich meinen wir aber bei Personenbezeichnungen immer alle Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen geschlechtlichen Identität.
Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wolters Kluwer ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Inhaltsübersicht
1 Vorwort
2 Schritt für Schritt zur guten Pflege
2.1 Alles zu seiner Zeit
2.2 Rechtzeitig Hilfe einholen
2.2.1 Sozialdienst des Krankenhauses
2.2.2 Übergangspflege der Krankenversicherung
2.2.3 Individuelle Pflegeberatung der Pflegekasse
2.2.4 Rat und Hilfe durch Pflegestützpunkte als Anlaufstellen vor Ort
2.2.5 Weitere Hilfen und Beratungsangebote
2.3 Frühzeitig Antrag auf Pflegeleistungen stellen
2.3.1 Vorversicherungszeit des Pflegebedürftigen
2.3.2 Antrag bei der Pflegekasse
2.3.3 Zeitpunkt der Antragstellung
2.3.4 Fristen
2.4 Auf Begutachtung durch den Medizinischen Dienst vorbereiten
2.4.1 Was der Gutachter im Einzelnen prüft und bewertet
2.4.2 Ermittlung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrads
2.4.3 Wie das Begutachtungsverfahren abläuft
2.4.4 Pflegebescheid der Pflegekasse
2.4.5 Wie Sie sich auf das Begutachtungsverfahren vorbereiten sollten
2.5 Rechtzeitig rechtlich vorsorgen
2.5.1 Patientenverfügung
2.5.2 Vorsorgevollmacht
2.5.3 Pflegevollmacht
3 Überblick über die Absicherung des Pflegerisikos
3.1 Gesetzliche Pflegeversicherung als Teilkaskoversicherung
3.1.1 Vorrang der häuslichen Pflege
3.1.2 Träger der sozialen Pflegeversicherung
3.1.3 Leistungen der Pflegeversicherung
3.2 Private Absicherung durch Pflegezusatzversicherung
3.2.1 Pflegetagegeldversicherung
3.2.2 Pflegekostenversicherung
3.2.3 Pflegerentenversicherung
3.3 Hilfe zur Pflege durch Sozialhilfe
4 Welche Leistungen die soziale Pflegeversicherung für den Pflegebedürftigen erbringt
4.1 Überblick über die Leistungen
4.1.1 Leistungen bei häuslicher Pflege
4.1.2 Leistungen bei stationärer Pflege
4.1.3 Leistungen an Pflegebedürftige mit Pflegegrad 1
4.2 Leistungen bei häuslicher Pflege
4.2.1 Pflegesachleistung
4.2.2 Pflegegeld für selbst beschaffte Pflegehilfe
4.2.3 Kombination von Geldleistung und Sachleistung (Kombinationsleistung)
4.2.4 Häusliche Pflege bei Verhinderung der Pflegeperson
4.2.5 Wohngruppenzuschlag für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen
4.2.6 Pflegehilfsmittel
4.2.7 Zuschüsse zur Verbesserung des Wohnumfelds
4.3 Leistungen bei Pflege im Heim
4.3.1 Vorrang der häuslichen Pflege
4.3.2 Teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tagespflege und Nachtpflege
4.3.3 Kurzzeitpflege
4.3.4 Vollstationäre Pflege
4.4 Angebote zur Unterstützung im Alltag, Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbeitrags
4.4.1 Art der Angebote
4.4.2 Verwendung des Pflegesachleistungsbetrags für Angebote zur Unterstützung im Alltag
4.5 Entlastungsbetrag
4.5.1 Leistungsvoraussetzungen
4.5.2 Höhe des Entlastungsbetrags
4.5.3 Zweckgebundene Verwendung
4.6 Leistungen bei Pflegegrad 1
4.7 Versorgung Pflegebedürftiger bei Inanspruchnahme von Vorsorge- oder Rehabilitationsleistungen durch die Pflegeperson
4.7.1 Voraussetzungen
4.7.2 Umfang des Anspruchs
4.7.3 Ruhen des Anspruchs auf Leistungen bei häuslicher Pflege
4.8 Übersicht über die Pflegeleistungen für Pflegebedürftige
5 Wie das Pflegerisiko durch Leistungen der Sozialhilfe abgesichert ist
5.1 Leistungsvoraussetzungen
5.1.1 Pflegebedürftigkeit
5.1.2 Nachrang der Hilfe zur Pflege
5.1.3 Finanzielle Bedürftigkeit
5.2 Ermittlung der Pflegebedürftigkeit bzw. der Pflegegrade
5.2.1 Pflegegrade
5.2.2 Begutachtungsverfahren
5.3 Überblick über die Leistungen der Hilfe zur Pflege
5.3.1 Häusliche Pflege
5.3.2 Teilstationäre Pflege
5.3.3 Kurzzeitpflege
5.3.4 Entlastungsbetrag bei den Pflegegraden 2 bis 5
5.3.5 Stationäre Pflege
5.3.6 Leistungen für Pflegebedürftige des Pflegegrads 1
6 Einsatz von ausländischen Haushalts- und Betreuungskräften in Privathaushalten
6.1 Einsatzmöglichkeiten ausländischer Haushalts- und Betreuungskräfte
6.1.1 Tätigkeiten der Haushalts- und Betreuungshilfe
6.1.2 Medizinische Behandlungspflege
6.1.3 Beschäftigung einer ausländischen Pflege- und Betreuungskraft: ja oder nein?
6.2 Organisation und Kosten der Beschäftigung
6.2.1 Anstellung einer ausländischen Haushalts- und Betreuungskraft (Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Modell)
6.2.2 Von ausländischen Arbeitgebern entsandtes Haushalts- und Betreuungspersonal (Entsendemodell)
6.2.3 Selbstständige Haushalts- und Betreuungshilfe
6.3 Finanzierung der Kosten
6.3.1 Leistungen der Pflegeversicherung
6.3.2 Steuervorteile
7 Wie pflegende Angehörige bei der Pflege unterstützt werden
7.1 Soziale Absicherung in der Rentenversicherung
7.1.1 Voraussetzungen für die Rentenversicherungspflicht
7.1.2 Pflege durch mehrere Personen
7.1.3 Beginn der Versicherungspflicht
7.1.4 Höhe der Beiträge
7.1.5 Ende der Versicherungspflicht
7.2 Gesetzliche Unfallversicherung
7.2.1 Versicherte Pflegepersonen
7.2.2 Versicherte Tätigkeiten
7.2.3 Versicherungsfälle
7.2.4 Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung
7.3 Arbeitslosenversicherung
7.3.1 Voraussetzungen der Versicherungspflicht
7.3.2 Höhe der Beiträge
7.4 Kranken- und Pflegeversicherung
7.5 Steuererleichterungen für Pflegepersonen bei der Einkommensteuer
7.5.1 Pflege-Pauschbetrag bei der Einkommensteuer
7.5.2 Außergewöhnliche Belastungen als Alternative zum Pflege-Pauschbetrag
7.5.3 Pflegeaufwendungen als haushaltsnahe Dienstleistungen
7.6 Berücksichtigung von Pflegeleistungen im Erbrecht und im Erbschaftsteuerrecht
7.6.1 Ausgleichungspflicht bei Pflegeleistungen eines Abkömmlings
7.6.2 Steuerfreibetrag bei der Schenkung- und Erbschaftsteuer
8 Vereinbarung von Pflege und Beruf
8.1 Überblick über Freistellungsmöglichkeiten
8.1.1 Besondere Freistellungsansprüche
8.1.2 Allgemeiner Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit
8.2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung
8.2.1 Arbeitsverhinderung bis zu zehn Arbeitstagen pro Kalenderjahr
8.2.2 Pflegeunterstützungsgeld
8.2.3 Soziale Absicherung des Arbeitnehmers
8.3 Pflegezeit
8.3.1 Vollständige oder teilweise Freistellung von bis zu sechs Monaten
8.3.2 Soziale Absicherung des Arbeitnehmers
8.3.3 Förderung durch zinsloses Darlehen
8.4 Familienpflegezeit
8.4.1 Teilweise Freistellung von bis zu 24 Monaten
8.4.2 Finanzielle Absicherung der Familienpflegezeit durch zinsloses Darlehen
8.4.3 Finanzielle Absicherung der Familienpflegezeit durch Wertguthaben
8.4.4 Soziale Absicherung des Arbeitnehmers
8.5 Freistellung für die Betreuung eines minderjährigen pflegebedürftigen nahen Angehörigen
8.6 Freistellung für die Begleitung eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen in der letzten Lebensphase
8.7 Kombination der Freistellungsansprüche
8.8 Anspruch auf Teilzeitarbeit nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz
8.8.1 Anspruchsberechtigte Personen
8.8.2 Wartezeit
8.8.3 Mindestbeschäftigtenzahl
8.8.4 Antrag des Arbeitnehmers
8.8.5 Verhandlungspflicht des Arbeitgebers
8.8.6 Entscheidung des Arbeitgebers
8.8.7 Änderung der Verteilung der Arbeitszeit durch den Arbeitgeber
8.8.8 Erneute Verringerung der Arbeitszeit
8.9 Abschluss eines Teilzeitarbeitsvertrags
8.9.1 Zustandekommen des Teilzeitarbeitsvertrags
8.9.2 Beteiligung des Betriebsrats
8.9.3 Form des Teilzeitarbeitsvertrags
8.10 Teilzeitmodelle für Pflegepersonen
8.10.1 Teilzeitmodelle
8.10.2 Arbeitsplatzteilung (Jobsharing)
8.10.3 Arbeit auf Abruf
8.10.4 Geringfügige Beschäftigung
Pflegefall: Der praktische Ratgeber zu Ihren Rechten, Ansprüchen und den Pflegegraden
1 Vorwort
Fast fünf Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig. Die meisten von ihnen werden zu Hause durch Angehörige oder einen ambulanten Pflegedienst gepflegt. Das Risiko, pflegebedürftig zu werden, wird zunehmend größer. Je älter die Bevölkerung, desto höher wird die Zahl von Menschen, die auf Pflege angewiesen sind. Denn ein höheres Lebensalter geht vielfach mit Krankheit und Gebrechlichkeit einher. Aber auch durch einen Unfall oder eine Krankheit kann aus heiterem Himmel die Situation eintreten, dass man auf fremde Hilfe angewiesen ist, weil man den Alltag alleine nicht mehr bewältigen kann.
Durch die gesetzliche Pflegeversicherung wird das allgemeine Lebensrisiko, pflegebedürftig zu werden und die Kosten der erforderlichen Pflege nicht tragen zu können, abgesichert. Die Pflegeversicherung ist allerdings keine Vollversicherung, weil die gedeckelten Leistungen häufig nur einen Teil der Pflegekosten abdecken. Die Differenz zu den Leistungen der Pflegeversicherung muss der Pflegebedürftige aus eigener Tasche bezahlen. Das kann schnell das Einkommen übersteigen und die Ersparnisse aufbrauchen. Für den Pflegenden ist die Pflege eines Menschen nicht nur mit einem hohen persönlichen Einsatz, sondern unter Umständen auch mit finanziellen Einbußen verbunden, die durch die Pflegeversicherung nur bedingt ausgeglichen werden.
Umso wichtiger ist es, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die die finanzielle Situation der Beteiligten verbessern. Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang Ansprüche auf Sozialleistungen. Allerdings besteht das Problem, sich im Dickicht der verschiedenen Ansprüche und Hilfearten und in der verwirrenden Zuständigkeit der verschiedenen Behördenapparate und Institutionen zurechtzufinden.
Dieser Ratgeber will allen Beteiligten, dem Pflegebedürftigen und den pflegenden Angehörigen, bei den täglichen Herausforderungen helfen. Die Darstellung beschränkt sich nicht darauf, die dem Pflegebedürftigen zustehenden Leistungen der sozialen Pflegeversicherung und unter Umständen auch der Sozialhilfe aufzuzeigen. Vielmehr will dieses Buch die Beteiligten von dem Zeitpunkt an begleiten, mit dem sich das Problem der notwendigen Pflege stellt. Ein Schwerpunkt der Ausführungen ist deshalb auch die Vorbereitung des Pflegebedürftigen und der pflegenden Angehörigen auf die Begutachtung des Medizinischen Dienstes. Ebenso wird auf die Probleme der Pflegepersonen eingegangen, insbesondere auf die Vereinbarung von Pflege und Beruf, die soziale Absicherung der Pflegeperson, steuerliche Vergünstigungen und die Unterstützung bei der Pflege durch ehrenamtliche Helfer. Auch die verschiedenen Möglichkeiten, ausländische Haushalts- und Betreuungskräfte einzusetzen, wird dargestellt.
Insgesamt will Ihnen dieser Ratgeber in einer schwierigen Lebenssituation helfen und Sie bei der Bewältigung der vielfältigen Probleme durch praktische Ratschläge mit vielen Beispielen unterstützen.
Die 3. Auflage berücksichtigt die ab 2025 geltenden Leistungsverbesserungen für Pflegebedürftige.
Dr. Otto N. Bretzinger
2 Schritt für Schritt zur guten Pflege
Egal, ob es sich bei einer Krankheit über einen längeren Zeitraum ankündigt oder ob man plötzlich damit konfrontiert wird: Ein Familienmitglied braucht nicht nur gelegentliche Hilfe, sondern eine dauerhafte Pflege. Pflegebedürftigkeit kann nach einer schweren Krankheit oder einem Unfall nach der Entlassung aus dem Krankenhaus eintreten oder weil sich der Gesundheitszustand eines Angehörigen zu Hause allmählich verschlechtert. Plötzlich ist man mit Problemen konfrontiert, auf die man sich nicht oder nur bedingt vorbereiten konnte und die unter Umständen einer schnellen Klärung bedürfen. Und in kurzer Zeit müssen dann trotz emotionaler Belastung viele Entscheidungen getroffen werden, die unter Umständen mit weitreichenden Folgen verbunden sind. Denn plötzlich wird man mit Begriffen wie »Pflegegutachten«, »Pflegegrad« oder »Pflegezeit« konfrontiert, man muss sich neu organisieren, vielleicht Pflege und Beruf unter einen Hut bringen, und man muss sich nicht zuletzt mit finanziellen Fragen befassen, die zwangsläufig im Zusammenhang mit der Pflege eines Menschen auftreten.
2.1 Alles zu seiner Zeit
Trotz aller Fragen und Probleme, mit denen Sie konfrontiert sind: Lassen Sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie müssen auch nicht alle Entscheidungen auf einmal treffen. Es gibt besonders Wichtiges, Wichtiges und erst mal weniger Wichtiges.
1. Schritt
Schalten Sie den Sozialdienst ein, wenn der Angehörige im Krankenhaus liegt, und nutzen Sie die Möglichkeit der sogenannten Übergangspflege der gesetzlichen Krankenversicherung.
2. Schritt
Wenn Sie berufstätig sind: Nutzen Sie die Möglichkeit, sich anfangs für zehn Tage von der Arbeit freistellen zu lassen, wenn ein naher Angehöriger akut pflegebedürftig wird. So haben Sie Gelegenheit, die kurzfristig anstehenden Angelegenheiten zu organisieren.
3. Schritt
Stellen Sie möglichst frühzeitig den Antrag auf Pflegeleistungen. Nach der Antragstellung wird die Pflegekasse tätig und veranlasst das Begutachtungsverfahren zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrads.
4. Schritt
Nehmen Sie die Pflegeberatung der Pflegekasse in Anspruch und nehmen Sie Kontakt mit einem Pflegestützpunkt auf.
5. Schritt
Machen Sie sich mit den Grundsätzen des Begutachtungsverfahrens des Medizinischen Dienstes (MD) vertraut und bereiten Sie sich auf die Begutachtung vor.
6. Schritt
Besprechen Sie mit dem Pflegebedürftigen dessen Wünsche und Vorstellungen bei der Pflege und erörtern Sie im Familienkreis die organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten.
7. Schritt
Entscheiden Sie sich, ob die pflegebedürftige Person zu Hause gepflegt werden oder in einem Heim untergebracht werden soll, und treffen Sie die notwendigen Vorbereitungen.
8. Schritt
Solange und soweit die pflegebedürftige Person dazu in der Lage ist, sollten die notwendigen Vorsorgeverfügungen verfasst werden. So ist gewährleistet, dass die Wünsche und Vorstellungen bei der Pflege und der medizinischen Behandlung berücksichtigt werden.
2.2 Rechtzeitig Hilfe einholen
Wichtig ist zunächst einmal, dass Ihnen bewusst ist, dass Sie gerade im Bereich der Pflege mit Unterstützung und Hilfen von vielen Seiten rechnen können. Nutzen Sie diese Hilfs- und Beratungsangebote und nehmen Sie rechtzeitig Kontakt zu Sozialdiensten, zur Pflegeberatung der Pflegekasse oder zum Pflegestützpunkt vor Ort auf. Dort wird man Sie schon von Beginn an mit Beratung und konkreten Hilfen begleiten. Darüber hinaus bestehen Beratungsangebote der Sozialverbände, der Verbraucherzentralen, von Selbsthilfegruppen und Betreuungsvereinen. Insgesamt betreffen die Beratungs- und Hilfsangebote nicht nur die Formalitäten beim Umgang mit der Pflegekasse und Behörden (z.B. Sozialversicherungsträger, Sozialamt), Beratung und Hilfe können Sie insbesondere auch bei der organisatorischen Bewältigung der anstehenden Pflegeaufgaben erwarten.
2.2.1 Sozialdienst des Krankenhauses
Wenn Patienten im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts erfahren, dass sie sich künftig nicht mehr alleine versorgen können und auf Pflege angewiesen sind, ist der Sozialdienst des Krankenhauses der erste Ansprechpartner. Jedes Krankenhaus hat für die soziale Betreuung und Beratung einen Sozialdienst eingerichtet, der auch den nahtlosen Übergang von der Krankenhausbehandlung zur Rehabilitation oder Pflege sicherstellen soll. Der Sozialdienst kann unterschiedliche Bezeichnungen (z.B. Entlassungsmanagement, Überleitungsmanagement, Pflegeüberleitung) und unterschiedliche Schwerpunkte aufgrund der Spezialisierung des Krankenhauses haben.
Die Mitarbeiter des Sozialdienstes helfen dabei, die Entlassung des Patienten so gut wie möglich vorzubereiten. Im Regelfall wird der Sozialdienst Kontakt mit dem Patienten und den Angehörigen aufnehmen. Andernfalls sollten Sie möglichst frühzeitig die Mitarbeiter des Sozialdienstes ansprechen, spätestens, wenn der Entlassungstermin feststeht.
Der Sozialdienst arbeitet eng und vertrauensvoll mit dem ärztlichen und pflegerischen Dienst zusammen. Er hat die Aufgabe, die ärztliche und pflegerische Versorgung des Patienten im Krankenhaus zu ergänzen und ihn sowie gegebenenfalls seine Angehörigen in sozialen Fragen zu beraten. Insbesondere soll ein möglichst nahtloser und reibungsloser Übergang vom stationären Aufenthalt in die Weiterversorgung gewährleistet werden. Zu den Aufgaben des Sozialdienstes gehören insbesondere
die Planung der weiteren Versorgung des Patienten im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt (z.B. Einleitung von notwendigen Anschlussheilbehandlungen oder Rehabilitationsmaßnahmen),
die Beratung des Pflegebedürftigen bzw. der Angehörigen beim Antrag auf Pflegeleistungen und bei den einzelnen Leistungsarten der Pflegeversicherung,
die Beratung bei weiteren finanziellen Fragen (z.B. Sozialhilfe),
die Unterstützung bei der Organisation der häuslichen Pflege (z.B. durch Vermittlung eines ambulanten Pflegedienstes oder bei der Beschaffung von Pflegehilfsmitteln wie beispielsweise eines Pflegebetts oder Gehhilfen),
Hilfen bei der Organisation der Pflege in einem Heim (z.B. Beratung bei der Auswahl eines Pflegeheims bei Kurzzeit- oder Dauerpflege),
die Beratung zu ergänzenden Angeboten (z.B. Vermittlung von Selbsthilfegruppen),
die Beratung bei betreuungsrechtlichen Fragen (z.B. Kontakt zu Beratern für die Errichtung einer Vorsorgevollmacht).
2.2.2 Übergangspflege der Krankenversicherung
Auch die Krankenversicherung kümmert sich unter Umständen um eine Pflege. Das ist insbesondere für Menschen wichtig, bei denen (noch) keine Pflegebedürftigkeit festgestellt wurde und die deshalb keine Leistungen der Pflegeversicherung erhalten.
Häusliche Krankenpflege
Eine häusliche Krankenpflege wird von der Krankenkasse grundsätzlich für bis zu vier Wochen je Krankheitsfall gezahlt, wenn ein Patient zwar das Krankenhaus verlassen hat, aber noch nicht auskuriert ist und noch Pflege benötigt. Da die Krankenhäuser angehalten sind, die Liegezeiten möglichst kurz zu halten, sind diese Fälle nicht selten. Durch häusliche Krankenpflege kann dann die erste Versorgung des Patienten weiterhin sichergestellt werden. Anspruch auf häusliche Krankenpflege besteht allerdings nur, soweit eine im Haushalt lebende Person den Kranken im erforderlichen Umfang nicht pflegen und versorgen kann.
!
Tipp: Die häusliche Krankenpflege umfasst die Behandlungspflege (z.B. Wundversorgung), die Grundpflege (z.B. Hilfe beim Waschen), die hauswirtschaftliche Versorgung (z.B. Einkaufen) und die Palliativversorgung (z.B. Schmerzbehandlung).
Haushaltshilfe
In einigen Fällen zahlt die Krankenkasse auch eine Haushaltshilfe. Voraussetzung ist, dass sich eine Person wegen einer Krankenhausbehandlung, einer schweren Krankheit oder der akuten Verschlimmerung einer Krankheit nicht um den Haushalt kümmern und keine andere mit ihr zusammenlebende Person diese Aufgaben übernehmen kann. Die Haushaltshilfe wird in der Regel für maximal vier Wochen im Jahr bezahlt. Lebt ein Kind im Haushalt, das unter zwölf Jahre alt oder behindert oder auf Hilfe angewiesen ist, verlängert sich der Anspruch auf längstens 26 Wochen.
Kurzzeitpflege
Reicht die häusliche Krankenpflege, also die Behandlungspflege, Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung, nicht aus, um den Patienten zu versorgen, zahlt die Krankenkasse auch für eine Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung. Das kommt Menschen zugute, die aus dem Krankenhaus entlassen werden, auf Hilfe angewiesen sind, aber noch keinen Pflegegrad zugesprochen bekommen haben. Der Anspruch besteht für maximal acht Wochen. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten bis zu einem Höchstsatz von 1.774,– € im Jahr.
2.2.3 Individuelle Pflegeberatung der Pflegekasse
Besonders wichtig bei einem Pflegefall ist eine kompetente Beratung. Zu den Leistungen der Pflegekassen gehören deshalb nicht nur reine Sachleistungen oder die Übernahme bestimmter Pflegekosten. Alle Personen, die Leistungen von der Pflegeversicherung erhalten oder die Leistungen beantragt und erkennbar einen Hilfe- und Beratungsbedarf haben, haben einen einklagbaren, individuellen Rechtsanspruch auf umfassende Beratung und Hilfestellung.
Anspruchsberechtigte Personen
Anspruch auf individuelle Beratung und Hilfestellung haben alle Personen, die pflegebedürftig sind und ohne Einschränkungen die Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erfüllen. Anspruch auf Beratung und Hilfestellung haben darüber hinaus alle Personen, die einen Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung gestellt haben, und bei denen erkennbar ein Hilfs- und Beratungsbedarf besteht.
!
Tipp: Nicht anspruchsberechtigt sind Angehörige oder die Ehepartner und Lebenspartner des Pflegebedürftigen. Auf Wunsch einer anspruchsberechtigten Person erfolgt die Pflegeberatung jedoch auch gegenüber ihren Angehörigen oder weiteren Personen oder unter deren Einbeziehung.
Beratungsangebote
Die Pflegekasse ist verpflichtet, den Antragsteller konkret auf das Beratungsangebot hinzuweisen. Sie hat dem Antragsteller unmittelbar nach Eingang des Antrags auf Leistungen sowie weiterer Anträge auf Leistungen entweder einen konkreten Beratungstermin anzubieten oder einen Beratungsgutschein auszustellen, der bei einer Beratungsstelle eingelöst werden kann.
Will die Pflegekasse das Beratungsangebot selbst umsetzen, hat sie dem Antragsteller die Durchführung der Beratung unter Angabe einer konkreten Kontaktperson innerhalb einer Frist von zwei Wochen anzubieten. Die Pflegeberatung kann in der Geschäftsstelle der Pflegekasse oder telefonisch erfolgen. Auf Wunsch des Pflegebedürftigen erfolgt die Pflegeberatung in der häuslichen Umgebung oder in der Einrichtung, in der diese Person lebt. Unter der häuslichen Umgebung ist der Ort zu verstehen, an dem der Pflegebedürftige sich in der Regel aufhält und seinen Lebensmittelpunkt hat. Einrichtungen, in denen der Pflegebedürftige lebt, sind in der Regel stationäre Einrichtungen, unabhängig davon, welchem Zweck der stationäre Aufenthalt dient (z.B. stationäre Einrichtungen der Altenhilfe, der Rehabilitation oder der Eingliederungshilfe).
Die Beratung erfolgt durch speziell geschulte Pflegeberater mit besonderer Fachkenntnis, insbesondere im Sozial- und Sozialversicherungsrecht. Die Pflegeberater sind regelmäßig bei den Pflegekassen beschäftigt.
Die Pflegekasse hat auch die Möglichkeit, einen Beratungsgutschein auszustellen, der bei einer Beratungsstelle innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang eingelöst werden kann. Die Beratungsstellen, die der Antragsteller zulasten der Pflegekasse in Anspruch nehmen kann, sind im Beratungsgutschein zu nennen. Auch bei einer Beratung durch Beratungsstellen auf der Grundlage eines Beratungsgutscheins ist, wie bei der Beratung durch die Pflegekasse selbst, sicherzustellen, dass die Beratung in der häuslichen Umgebung des Antragstellers oder in der Einrichtung, in der er lebt, innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang erfolgen kann.
Aufgaben der Pflegeberatung
Der Anspruch auf Pflegeberatung umfasst die individuelle Beratung und Hilfestellung durch einen Pflegeberater bei der Inanspruchnahme von bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangeboten, die auf Unterstützung von Menschen mit Pflege-, Versorgungs- oder Betreuungsbedarf ausgerichtet sind. Zu den Aufgaben des Pflegeberaters gehört es auch, über Leistungen zur Entlastung von Pflegepersonen zu informieren.
Zu den Aufgaben der Pflegeberatung zählen insbesondere
die Erteilung von Informationen und Auskünften über die verschiedenen Leistungen der Pflegeversicherung,
die Ermittlung des individuellen Hilfebedarfs anhand des Ergebnisses des Gutachtens des Medizinischen Dienstes,
die Erteilung von Informationen zu den Angeboten zur Unterstützung im Alltag und zu Entlastungsangeboten zur Unterstützung bei Verhinderung der Pflegeperson,
die Erstellung eines individuellen Vorsorgeplans,
Auskünfte zu den Möglichkeiten der (vorübergehenden) Unterbringung des Pflegebedürftigen im Heim.
!
Tipp: Auf Wunsch hilft der Pflegeberater auch dabei, Anträge bei der Pflegekasse zu stellen. Solche Anträge auf Leistungen können auch gegenüber der Pflegeberatung gestellt werden. Der Pflegeberater muss dann den Antrag unverzüglich der zuständigen Pflege- oder Krankenkasse übermitteln.
2.2.4 Rat und Hilfe durch Pflegestützpunkte als Anlaufstellen vor Ort
Eine unabhängige Anlaufstelle für Pflegebedürftige und deren Angehörige für alle Fragen rund um die Pflege sind Pflegestützpunkte, die zur wohnortnahen Beratung, Versorgung und Betreuung von Pflegebedürftigen von den Pflegekassen und Krankenkassen eingerichtet sind.
Aufgaben
Ein Pflegestützpunkt erteilt umfassende und unabhängige Auskunft und Beratung zu den Rechten und Pflichten nach dem Sozialgesetzbuch und zur Auswahl und Inanspruchnahme der bundes- oder landesrechtlich vorgesehenen Sozialleistungen und sonstigen Hilfsangebote. Sie erhalten Auskunft zu allen Leistungsfragen und erfahren dort insbesondere, welche Kosten die Pflegekasse übernimmt und in welchen Fällen das Sozialamt einspringt. Ebenso informieren die Mitarbeiter des Pflegestützpunktes über mögliche Zuschüsse, wenn der Pflegebedürftige oder seine Angehörigen eine Wohnung altengerecht umbauen möchte.
Die Fachkräfte der Pflegestützpunkte machen sich ein Bild über den Hilfe- und Pflegebedarf sowie über die Wohnsituation der pflegebedürftigen Person. Gemeinsam mit den pflegenden Angehörigen wird nach Lösungen gesucht, wie der Pflegebedürftige möglichst lange zu Hause wohnen bleiben kann, etwa mit der Unterstützung eines Pflegedienstes. Die Mitarbeiter der Pflegestützpunkte kennen die ambulanten Pflegedienste, Betreuungsangebote und ehrenamtlichen Strukturen vor Ort, deren Angebote und Preise. Ist die Pflege zu Hause nicht mehr möglich, unterstützen sie bei der Suche nach weiteren Alternativen.
Bei folgenden Problemen und Fragen sind Pflegestützpunkte eine gute Anlaufstelle:
Information, Auskunft und Beratung zu Hilfs- und Unterstützungsangeboten,
Unterstützung bei der Organisation der Pflege,
Hilfe bei Formalitäten wie dem Ausfüllen eines Antrages,
Unterstützung bei der Suche nach externer Hilfe,
Anpassung der Versorgung, wenn sich der Bedarf des Pflegebedürftigen geändert hat.
!
Tipp: Wo der nächste Pflegestützpunkt liegt, erfahren Sie bei Ihrer Pflegekasse. Eine Übersicht über Pflegestützpunkte in Deutschland finden Sie auf der Internetseite des Zentrums Qualität in der Pflege (www.zqp.de). In einer Datenbank können Sie über Postleitzahl oder Wohnort einen Pflegestützpunkt in Ihrer Nähe suchen.
2.2.5 Weitere Hilfen und Beratungsangebote
Die Pflegeberatung der Pflegekasse und der Pflegestützpunkt vor Ort sind zwar bei Themen rund um die Pflege die ersten Anlaufstellen, Hilfen bieten daneben aber auch viele andere Organisationen an.
Sozialamt
Pflegebedürftige Personen können unter Umständen vom Sozialamt Hilfe zur Pflege als eine bedarfsorientierte Sozialleistung erhalten, wenn sie den notwendigen Pflegeaufwand nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Die soziale Pflegeversicherung deckt in der Regel nur einen Teil der anfallenden Kosten ab. Den Rest müssen die Betroffenen selbst tragen. Wenn der Pflegebedürftige diesen Eigenanteil nicht selbst tragen kann, übernimmt unter bestimmten Voraussetzungen das Sozialamt die anfallenden Pflegekosten.
Sozialverbände
Sozialverbände wie beispielsweise der Sozialverband Deutschland (SoVD) und der Sozialverband VdK Deutschland bieten ihren Mitgliedern Beratung in sozialrechtlichen Angelegenheiten an, unter anderem in Angelegenheiten der sozialen Pflegeversicherung. Sie helfen bei Anträgen auf Pflegeleistungen und gegebenenfalls bei einem Widerspruchs- und sozialgerichtlichen Verfahren.
Wohnberatungsstellen
Wohnberatungsstellen helfen bei der Frage, wie die Wohnung an das Alter, an eine Behinderung oder eine Pflegesituation angepasst und wie die Maßnahme finanziert werden kann. Auf der Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. (www.wohnungsanpassung-bag.de) finden Sie Adressen von Beratungsstellen in Ihrer Nähe.
Hospiz- und Palliativdienste
Menschen mit schweren Erkrankungen, bei denen eine Heilung nicht mehr möglich ist, bedürfen einer palliativen Versorgung, bei der nicht mehr die Heilung und Lebensverlängerung im Vordergrund steht, sondern der bestmögliche Erhalt der Lebensqualität, Nähe, Zuwendung und die Linderung von Schmerzen und anderen Symptomen. Angeboten werden eine stationäre und eine ambulante Hospizversorgung. Adressen von ambulanten und stationären Hospizdiensten finden Sie auf der Internetseite des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes e.V. (www.dhpv.de).
Selbsthilfegruppen
Selbsthilfegruppen bieten einen Ort für intensive Gespräche oder einen Erfahrungsaustausch an. In vielen Städten bieten Beratungsstellen, Wohlfahrtsverbände oder Pflegedienste Gesprächskreise an, in denen sich pflegende Angehörige austauschen können.
Pflegetelefon
Das Pflegetelefon des Bundesfamilienministeriums bietet unter der Rufnummer 030-20179131 pflegenden Angehörigen telefonische Beratung und schnelle Hilfe rund um das Thema Pflege. Die telefonischen Beratungsgespräche sind anonym und vertraulich und bieten Angehörigen konkrete Hilfestellung für ihre individuelle Situation. Außerdem informieren die Fachleute über weitere Beratungs- und Hilfsangebote in der Umgebung des Pflegebedürftigen.
2.3 Frühzeitig Antrag auf Pflegeleistungen stellen
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden nur auf Antrag gewährt. Es ist wichtig, den Antrag so früh wie möglich zu stellen. Andernfalls verschenkt man unter Umständen Geld. Sobald der Eindruck entsteht, dass regelmäßige Hilfe im Alltag erforderlich ist, sollte unverzüglich der Antrag auf Pflegeleistungen gestellt werden.
2.3.1 Vorversicherungszeit des Pflegebedürftigen
Anspruch auf Leistungen hat nur, wer einige Zeit bereits Mitglied der gesetzlichen Pflegeversicherung war. Nur, wer also über einen bestimmten Zeitraum Beiträge in die Pflegeversicherung gezahlt hat, kann später auch Leistungen beziehen. Diese Zeit der Versicherung vor Eintritt der Pflegebedürftigkeit und der Antragstellung wird als Vorversicherungszeit bezeichnet.
Anspruch auf Leistungen der sozialen Pflegeversicherung besteht, wenn der Versicherte in den letzten zehn Jahren vor der Antragstellung mindestens zwei Jahre als Mitglied versichert oder familienversichert war. Für versicherte Kinder gilt die Vorversicherungszeit als erfüllt, wenn ein Elternteil sie erfüllt.
2.3.2 Antrag bei der Pflegekasse
Leistungen der sozialen Pflegeversicherung werden nur auf Antrag gewährt. Der Antrag auf Pflegeleistungen muss vom Pflegebedürftigen gestellt werden. Pflegende Angehörige sind nur dann antragsberechtigt, wenn ihnen der Pflegebedürftige eine Vollmacht erteilt hat. Im Falle einer rechtlichen Betreuung des Pflegebedürftigen kann der Antrag vom Betreuer gestellt werden.
Einen wirksamen Antrag können auch nicht voll geschäftsfähige Personen stellen. Anträge auf Sozialleistungen können Personen stellen und verfolgen, die das 15. Lebensjahr vollendet haben. Ab diesem Alter können auch Sozialleistungen entgegengenommen werden.
Der Antrag auf Pflegeleistungen muss bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person gestellt werden. Die Pflegekasse ist grundsätzlich bei der Krankenkasse (z.B. der AOK) angesiedelt, bei der die pflegebedürftige Person krankenversichert ist. Der Antrag auf Pflegeleistungen wird aber auch von allen anderen Leistungsträgern, von allen Gemeinden und bei Personen, die sich im Ausland aufhalten, auch von amtlichen Vertretungen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland entgegengenommen. Privatversicherte müssen sich an die private Pflegeversicherung wenden.
Der Antrag bedarf keiner Form. Auch die Meldung der Pflegebedürftigkeit durch Dritte (z.B. einen Angehörigen, den behandelnden Arzt, das Krankenhaus, die Reha-Einrichtung) ist als Antrag anzusehen, wenn die Mitteilung mit Einwilligung des Pflegebedürftigen erfolgt.
!
Tipp: Stellen Sie zunächst einen formlosen Antrag. Diesen können Sie formlos schriftlich, telefonisch oder persönlich bei Ihrer Pflegekasse einreichen. Anschließend werden Ihnen die nötigen Formulare von der Pflegekasse zugesandt. Wenn Sie Hilfe beim Ausfüllen der Formulare benötigen, können Sie sich an eine Pflegeberatungsstelle oder einen Pflegestützpunkt wenden.
2.3.3 Zeitpunkt der Antragstellung
Grundsätzlich werden die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erst ab Antragstellung, frühestens jedoch von dem Zeitpunkt an gewährt, in dem die Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. War der Versicherte bereits vor der Antragstellung pflegebedürftig und wird der Antrag erst später als einen Monat nach dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit gestellt, so beginnen die Leistungen am Anfang des Antragsmonats. Diese Grundsätze gelten auch dann, wenn ein höherer Pflegegrad beantragt wird.
»
Beispiel
Pflegegeld wurde am 25. April beantragt. Der Medizinische Dienst hat am 22. Mai festgestellt, dass seit dem 7. April Pflegebedürftigkeit vorliegt. Anspruch auf Pflegegeld besteht ab 25. April.
Pflegegeld wurde am 5. Juni beantragt. Der Medizinische Dienst hat am 17. Juli festgestellt, dass seit dem 1. Juli Pflegebedürftigkeit vorliegt. Anspruch auf Pflegegeld besteht ab 1. Juli.
2.3.4 Fristen
Mit der Antragstellung beginnen wichtige Fristen zu laufen. So hat die Pflegekasse unmittelbar nach Eingang des Antrags auf Leistungen entweder
unter Angabe einer Kontaktperson einen konkreten Beratungstermin anzubieten, der spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang durchzuführen ist, oder
einen Beratungsgutschein auszustellen, in dem Beratungsstellen benannt sind, bei denen der Gutschein zulasten der Pflegekasse innerhalb von zwei Wochen nach Antragseingang eingelöst werden kann.
Die Pflegekasse muss innerhalb von drei Tagen nach Eingang des Antrags auf Pflegeleistungen den Medizinischen Dienst oder andere unabhängige Gutachter mit der Begutachtung beauftragen.
Innerhalb von 20 Arbeitstagen muss die Pflegekasse einen Termin für eine Begutachtung ermöglichen.
2.4 Auf Begutachtung durch den Medizinischen Dienst vorbereiten
Leistungen der Pflegeversicherung gibt es nur, wenn Pflegebedürftigkeit besteht. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der sogenannte Pflegegrad. Sobald der Pflegekasse der Antrag auf Pflegeleistungen vorliegt, beauftragt diese den Medizinischen Dienst (MD) mit der Begutachtung der zu pflegenden Person. Zentrale Aufgabe des Medizinischen Dienstes ist die Prüfung, ob die Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit erfüllt sind und welcher Grad der Pflegebedürftigkeit vorliegt. Der Gutachter hat durch eine Untersuchung der antragstellenden Person die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten und die voraussichtliche Dauer der Pflegebedürftigkeit zu ermitteln. Grundlagen der Begutachtung sind die »Richtlinien des GKV-Spitzenverbands zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit«.
!
Tipp: Sie sollten sich unbedingt in groben Zügen damit vertraut machen, wann eine Pflegebedürftigkeit im Sinne der Pflegeversicherung vorliegt, wie der Pflegegrad ermittelt wird und wie das Begutachtungsverfahren abläuft. Denn einerseits hängen die Leistungen der Pflegeversicherung vom Grad der Pflegebedürftigkeit ab, andererseits sollten Sie wissen, was Sie im Begutachtungsverfahren des Medizinischen Dienstes erwartet. Mit der richtigen Vorbereitung auf die Begutachtung können Sie sicherstellen, dass der Pflegebedarf vom Gutachter richtig erfasst und die dem Pflegebedürftigen und der Pflegeperson zustehenden gesetzlichen Leistungen tatsächlich bewilligt werden.
2.4.1 Was der Gutachter im Einzelnen prüft und bewertet
Leistungen der Pflegeversicherung erhält, wer pflegebedürftig ist. Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbstständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens der gesetzlich festgelegten Schwere bestehen.
Achtung: Bei der Begutachtung wird nicht die Schwere der Erkrankung oder Behinderung berücksichtigt, sondern allein die Schwere der gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten. Deshalb begründet beispielsweise eine Blindheit oder eine Lähmung der unteren Extremitäten allein noch nicht die Pflegebedürftigkeit im Sinne der sozialen Pflegeversicherung.
Maßgeblich für das Vorliegen von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten sind die in den folgenden Bereichen begründeten Kriterien:
Modul 1:
Mobilität,
Modul 2:
Kognitive und kommunikative Fähigkeiten,
Modul 3:
Verhaltensweisen und psychische Problemlagen,
Modul 4:
Selbstversorgung,
Modul 5:
Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen,
Modul 6:
Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte.
Im Folgenden erhalten Sie einen Überblick über die Kriterien, die im Rahmen der Begutachtung zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit und des Pflegegrads nach den Begutachtungsrichtlinien des GKV-Spitzenverbands konkret überprüft werden. Auf dieser Grundlage können Sie als pflegebedürftige Person oder als pflegender Angehöriger selbst eigene Beobachtungen anstellen und sich ein Bild von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und der Fähigkeiten machen.
Mobilität (Modul 1)
Der Gutachter prüft, ob die Person in der Lage ist, ohne personelle Unterstützung eine Körperhaltung einzunehmen bzw. zu wechseln und sich fortzubewegen. Beurteilt werden Aspekte wie Körperkraft, Balance, Bewegungskoordination usw. Konkret geht es um folgende Kriterien:
Im Bett Positionen wechseln:
Es geht darum, verschiedene Positionen im Bett einzunehmen, sich um die Längsachse zu drehen oder sich aus dem Liegen aufzurichten.
Eine stabile Sitzposition halten:
Gemeint ist die Fähigkeit, sich auf einem Bett, Stuhl oder Sessel aufrecht zu halten.
Umsetzen:
Geprüft wird, ob der Betroffene in der Lage ist, von einer erhöhten Sitzfläche, Bettkante, Stuhl, Sessel, Bank, Toilette usw. aufzustehen und sich auf einen Rollstuhl, Toilettenstuhl, Sessel oder Ähnliches umzusetzen.
Innerhalb des Wohnbereichs fortbewegen:
Konkret geht es darum, sich innerhalb einer Wohnung oder im Wohnbereich einer Einrichtung zwischen den Zimmern sicher zu bewegen.
Treppensteigen:
Gemeint ist die Fähigkeit, Treppen zwischen zwei Etagen in aufrechter Sitzposition zu überwinden. Die Bewertung erfolgt unabhängig von der individuellen Wohnsituation.
Kognitive und kommunikative Fähigkeiten (Modul 2)
Der Gutachter prüft, wie gut sich der Betroffene in seinem Alltag orientieren und beteiligen sowie Entscheidungen treffen und steuern kann. Konkret geht es um folgende Kriterien:
Personen aus dem näheren Umfeld erkennen:
Gemeint ist die Fähigkeit, Personen aus dem näheren Umfeld (z.B. Familienmitglieder, Bekannte, Nachbarn oder Pflegekräfte eines ambulanten Pflegedienstes) wiederzuerkennen, also Menschen, zu denen im Alltag regelmäßig ein direkter Kontakt besteht.
Örtliche Orientierung:
Sie betrifft die Fähigkeit, sich in der räumlichen Umgebung zurechtzufinden, andere Orte gezielt anzusteuern und zu wissen, wo man sich befindet.
Zeitliche Orientierung:
Hier geht es um die Fähigkeit, zeitliche Strukturen zu erkennen. Aufschluss über die Fähigkeit zur zeitlichen Orientierung geben Antworten auf die Fragen nach der Jahreszeit, dem Jahr, dem Wochentag, dem Monat oder der Tageszeit.
An wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen erinnern:
Gemeint ist die Fähigkeit, sich an kurz und auch länger zurückliegende Ereignisse oder Beobachtungen zu erinnern. Es geht zum Beispiel darum, dass die Person weiß, was sie zum Frühstück gegessen hat oder mit welchen Tätigkeiten sie den Vormittag verbracht hat.
Mehrschrittige Alltagshandlungen steuern:
In diesem Zusammenhang geht es um die Fähigkeit, zielgerichtete Handlungen des Lebensalltags, die eine Abfolge von Teilschritten umfassen, zu steuern. Gemeint sind zielgerichtete Handlungen, die die Person täglich oder nahezu täglich im Lebensalltag durchführt oder durchgeführt hat (z.B. das komplette Ankleiden, Kaffeekochen oder Tischdecken).
Entscheidungen im Alltagsleben treffen:
Hier geht es darum, folgerichtige und geeignete Entscheidungen im Alltag zu treffen. Dazu gehört zum Beispiel die dem Wetter angepasste Auswahl von Kleidung, die Entscheidung über die Durchführung von Aktivitäten wie Einkaufen, Familienangehörige oder Freunde anrufen, einer Freizeitbeschäftigung nachgehen.
Sachverhalte und Informationen verstehen:
Gemeint ist die Fähigkeit, Sachverhalte zu verstehen und Informationen inhaltlich einordnen zu können (z.B. Informationen zum Tagesgeschehen aus den Medien aufzunehmen und inhaltlich zu verstehen).
Risiken und Gefahren erkennen:
Geprüft wird, ob der Betroffene in der Lage ist, Risiken und Gefahren zu erkennen (z.B. Gefahren wie Strom- und Feuerquellen oder Barrieren auf dem Fußboden oder auf Fußwegen).
Elementare Bedürfnisse mitteilen:
Gemeint ist die Fähigkeit, elementare Bedürfnisse (z.B. Hunger, Durst, Schmerzen, Frieren) verbal oder nonverbal (z.B. durch Gestik oder Mimik) mitzuteilen.
Aufforderungen verstehen:
Hierbei geht es um die Fähigkeit, Aufforderungen im Hinblick auf alltägliche Grundbedürfnisse (z.B. Essen, Trinken, sich kleiden) zu verstehen.
An einem Gespräch beteiligen:
Gemeint ist die Fähigkeit, in einem Gespräch Gesprächsinhalte aufzunehmen, sinngerecht zu antworten und zur Weiterführung des Gesprächs Inhalte einzubringen.
Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (Modul 3)
Der Gutachter prüft, inwieweit die Person ihr Verhalten ohne personelle Unterstützung steuern kann. Konkret geht es um folgende Kriterien:
Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten:
Dieses Kriterium fasst verschiedene Verhaltensweisen zusammen. Dazu gehören vor allem das (scheinbar) ziellose Umhergehen in der Wohnung oder der Einrichtung und der Versuch desorientierter Personen, ohne Begleitung die Wohnung oder die Einrichtung zu verlassen oder Orte aufzusuchen, die für diese Person unzugänglich sein sollten (z.B. Treppenhaus).
Nächtliche Unruhe:
Gemeint ist das nächtliche Umherirren oder nächtliche Unruhephasen bis hin zur Umkehr des Tag-Nacht-Rhythmus im Sinne von aktiv sein in der Nacht und schlafen während des Tages.
Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten:
Das Verhalten kann zum Beispiel darin bestehen, sich selbst durch Gegenstände zu verletzen, ungenießbare Substanzen zu essen und zu trinken, sich selbst zu schlagen und sich selbst mit den Fingernägeln oder Zähnen zu verletzen.
Beschädigen von Gegenständen:
Gemeint sind aggressive, auf Gegenstände gerichtete Handlungen wie Gegenstände wegstoßen oder wegschieben, gegen Gegenstände schlagen, treten nach Gegenständen.
Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen:
Hierzu gehören beispielsweise nach Personen schlagen oder treten, andere mit Zähnen oder Fingernägeln verletzen, andere zu stoßen oder wegzudrängen.
Verbale Aggression:
Sie kann zum Beispiel durch verbale Beschimpfungen oder Bedrohung anderer Personen zum Ausdruck kommen.
Andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten:
Andere pflegerelevante vokale (= stimmliche) Auffälligkeiten können lautes Rufen, Schreien, Klagen ohne nachvollziehbaren Grund, Vor-sich-hin-schimpfen, Fluchen, Seltsame-Laute-von-sich-Geben, ständiges Wiederholen von Sätzen und Fragen sein.
Abwehr pflegerischer und anderer unterstützender Maßnahmen:
Gemeint ist die Abwehr von Unterstützung, zum Beispiel bei der Körperpflege, die Verweigerung der Nahrungsaufnahme, der Medikamenteneinnahme oder anderer notwendiger Verrichtungen sowie die Manipulation an Vorrichtungen wie zum Beispiel an Kathetern, Infusionen oder Sondenernährung.
Wahnvorstellungen:
Diese beziehen sich beispielsweise auf die Vorstellung, mit Verstorbenen oder imaginären Personen in Kontakt zu stehen, oder auf die Vorstellung, verfolgt, bedroht oder bestohlen zu werden.
Ängste:
In Betracht kommen starke Ängste oder Sorgen, Angstattacken unabhängig von der Ursache. Die Person hat keine Möglichkeit/Strategie zur Bewältigung und Überwindung der Angst.
Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage:
Sie zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Person kaum Interesse an der Umgebung hat, kaum Eigeninitiative aufbringt und Motivierung durch andere benötigt, um etwas zu tun, die Person wirkt traurig oder apathisch, möchte am liebsten das Bett nicht verlassen.
Sozial inadäquate Verhaltensweisen:
Gemeint sind zum Beispiel distanzloses Verhalten, auffälliges Einfordern von Aufmerksamkeit, sich vor anderen in unpassenden Situationen auszukleiden, unangemessenes Greifen nach Personen oder unangemessene körperliche oder verbale sexuelle Annäherungsversuche.
Sonstige pflegerelevante inadäquate Handlungen:
In Betracht kommen unter anderem Nesteln an der Kleidung, ständiges Wiederholen der gleichen Handlung, planlose Aktivitäten, Verstecken oder Horten von Gegenständen, Urinieren in die Wohnung.
Selbstversorgung (Modul 4)
In diesem Bereich geht es um Themen der Grundpflege: Waschen, An- und Auskleiden, Zur-Toilette-Gehen, Essen und Trinken. Daneben geht es um Besonderheiten wie die künstliche Ernährung über eine Sonde oder Infusion und um die Folgen einer Inkontinenz. Konkret geht es um folgende Kriterien:
Blasenkontrolle, Harnkontinenz:
Gemeint ist hier, Harndrang zu verspüren und so rechtzeitig zu äußern, dass die Blasenentleerung geregelt werden kann. Jegliche Art von unwillkürlichem Harnabgang ist zu berücksichtigen, unabhängig von der Ursache.
Darmkontrolle, Stuhlkontinenz:
Gemeint ist, Stuhldrang zu verspüren und so rechtzeitig zu äußern, dass die Darmentleerung geregelt werden kann. Zu bewerten ist hier die Vermeidung unwillkürlicher Stuhlabgänge, gegebenenfalls mit personeller Hilfe.
Vorderen Oberkörper waschen:
Bewertet wird, ob sich die Person die Hände, das Gesicht, den Hals, die Arme, die Achselhöhlen und den vorderen Brustbereich waschen und abtrocknen kann.
Körperpflege im Bereich des Kopfes:
In Betracht kommen Kämmen, Zahnpflege, Prothesenreinigung, Rasieren.
Intimbereich waschen:
Geprüft wird, ob die Person imstande ist, den Intimbereich zu waschen und abzutrocknen.
Duschen und Baden einschließlich Haarewaschen:
Gemeint ist die Durchführung des Dusch- oder Wannenbades einschließlich des Waschens der Haare.
Oberkörper an- und auskleiden:
Gemeint ist, ob der Betroffene bereitliegende Kleidungsstücke (z.B. Unterhemd, T-Shirt, Hemd, Bluse, Pullover, Jacke, BH, Schlafanzugoberteil oder Nachthemd) an- und ausziehen kann.
Unterkörper an- und auskleiden:
Bewertet wird die Fähigkeit, bereitliegende Kleidungsstücke (z.B. Unterwäsche, Hose, Rock, Strümpfe und Schuhe) an- und auszuziehen.
Nahrung mundgerecht zubereiten und Getränke eingießen: