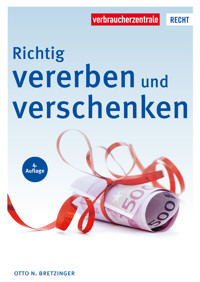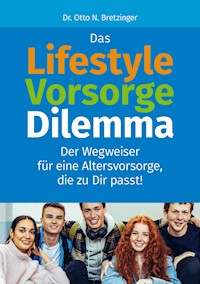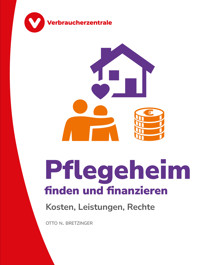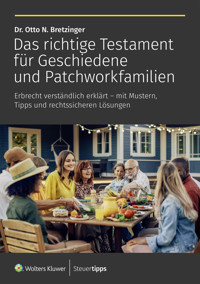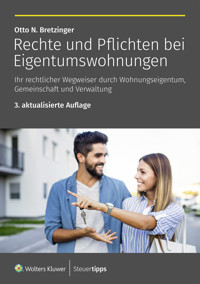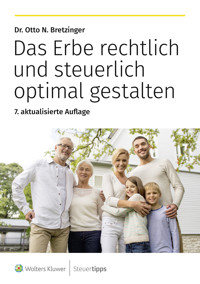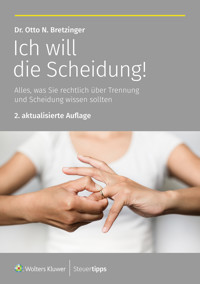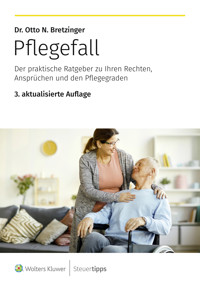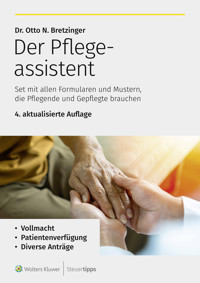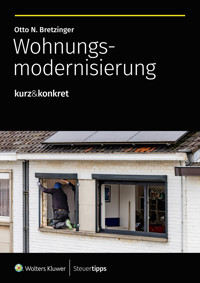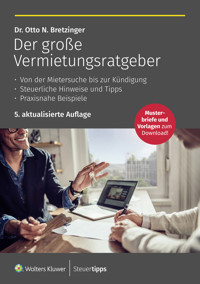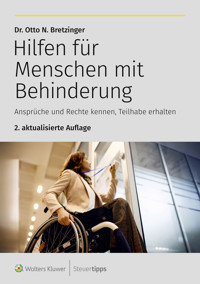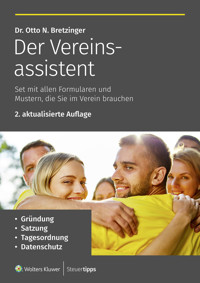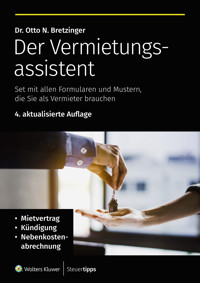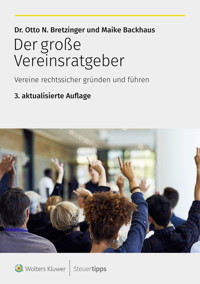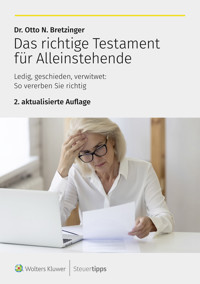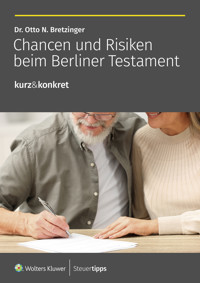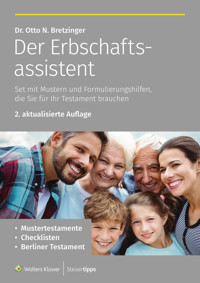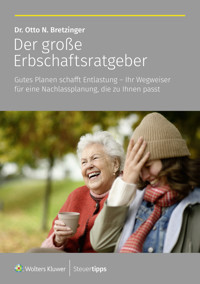
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wolters Kluwer Steuertipps GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
»Der große Erbschaftsratgeber« bietet umfassende Informationen und praktische Anleitungen zur Nachlassplanung und Vermögensnachfolge. Das Buch behandelt die Planung der Vermögensnachfolge vor und nach dem Erbfall und hilft dabei, rechtliche und steuerliche Fehlplanungen zu vermeiden. Der Ratgeber ist besonders geeignet für Personen, die sich mit der Erbschaftsplanung und Nachlassplanung auseinandersetzen möchten. Er richtet sich an Erben und potenzielle Erblasser, die detaillierte Informationen über Erbrecht und die damit verbundenen rechtlichen und finanziellen Aspekte benötigen. Inhaltliche Schwerpunkte: - Vorüberlegungen für die richtige Vermögensnachfolge: Analyse der persönlichen Lebensumstände und der aktuellen Vermögenssituation. - Möglichkeiten und Instrumente der Vermögensnachfolge: Schenkungen, gemischte Schenkungen, Schenkungen unter Auflagen, erbrechtliche Konsequenzen, Vermögensübertragung im Wege der Erbfolge, gesetzliche Erbfolge, Rechtsgeschäfte auf den Todesfall. - Vorweggenommene Erbfolge: Motive, Vor- und Nachteile, finanzielle Prognose. - Gemeinschaftskonten: Oder-Konto, Und-Konto, schenkungsteuerliche Konsequenzen, Vertrag zugunsten Dritter. - Schenkungen auf den Todesfall: Schenkungsversprechen, notarielle Beurkundung, Rückfall des geschenkten Vermögens. - Übergabevertrag: Regelung der Vermögensübertragung, notarielle Beurkundung, Erb- und Pflichtteilsverzicht, Ausgleichszahlungen, Sicherung der Lebensstellung. - Rechtliche und wirtschaftliche Gestaltungsgrenzen: Testierfähigkeit, Geschäftsfähigkeit, persönliche Errichtung der Verfügung, Zuwendungsverbote, Pflichtteil, Zugewinnausgleich. Besondere Merkmale: - Downloadbare Musterformulierungen: Hilfreiche Vorlagen für rechtliche Dokumente. - Konkrete Beispiele: Verdeutlichung der Problematik anhand realer Szenarien. - Checklisten: Mit detailierten Checklisten keinen wichtigen Schritt vergessen. - Detaillierte Erläuterungen: Rechtliche Rahmenbedingungen und Gestaltungsmöglichkeiten. Mit »Der große Erbschaftsratgeber« erhalten Sie eine detaillierte und praxisnahe Anleitung zur Nachlassplanung, um Ihre Vermögensnachfolge optimal zu gestalten und rechtliche sowie steuerliche Fallstricke zu vermeiden. Profitieren Sie von den umfassenden Informationen und praktischen Tipps dieses Ratgebers - Umfassende Beratung: Das Buch hilft, rechtliche und steuerliche Fehlplanungen zu vermeiden. - Praktische Tipps: Unterstützung bei der individuellen Nachlassplanung. - Schutz vor Risiken: Aufzeigen von Fallstricken und rechtlichen sowie finanziellen Nachteilen. - Steuerliche Vorteile: Optimierung der Steuerfreibeträge und Reduzierung der Pflichtteilsansprüche. - Rechtssichere Gestaltung: Klare Anleitungen und rechtssichere Musterformulierungen erleichtern die Umsetzung der erbrechtlichen Regelungen. Beginnen Sie mit Ihrer rechtssicheren Erbschaftsplanung und sichern Sie sich Ihr Exemplar noch heute! Autor: Dr. iur. Otto N. Bretzinger ist ein Experte im Erbrecht. Mit seiner langjährigen Erfahrung und umfangreichen Publikationserfahrung bietet er praxisnahe und rechtssichere Lösungen für die Nachlassplanung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 by Wolters Kluwer Steuertipps GmbHPostfach 10 01 61 · 68001 MannheimTelefon 0621/[email protected]
Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Angaben wurden nach genauen Recherchen sorgfältig verfasst; eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist jedoch ausgeschlossen.
Zum Zwecke der besseren Lesbarkeit verwenden wir allgemein die grammatisch männliche Form. Selbstverständlich meinen wir aber bei Personenbezeichnungen immer alle Menschen unabhängig von ihrer jeweiligen geschlechtlichen Identität.
Alternative Streitbeilegung (Online-Streitbeilegung und Verbraucherschlichtungsstelle)Die Europäische Kommission hat eine Plattform zur Online-Streitbeilegung eingerichtet, die unter folgendem Link abgerufen werden kann: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wolters Kluwer ist nicht bereit und nicht verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Inhaltsübersicht
1 Vorwort
2 Vorüberlegungen für die richtige Vermögensnachfolge
2.1 Persönliche Lebensumstände als Grundlage der Planung der Vermögensnachfolge
2.1.1 Familienstand
2.1.2 Kinder
2.1.3 Ehekrise und bevorstehende Scheidung
2.1.4 Komplizierte Beziehungen unter den Familienangehörigen
2.1.5 Verschuldete Erben
2.1.6 Behinderte oder pflegebedürftige Erben
2.2 Zusammenstellung der aktuellen Vermögenswerte
2.3 Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen
2.4 Berücksichtigung Ihrer persönlichen Interessen und Vorstellungen
3 Möglichkeiten und Instrumente der Vermögensnachfolge
3.1 Vermögensübertragung zu Lebzeiten
3.1.1 Schenkung
3.1.2 Gemischte Schenkung
3.1.3 Schenkung unter Auflage
3.1.4 Erbrechtliche Konsequenzen bei lebzeitigen Vermögensübertragungen
3.2 Vermögensübertragung im Wege der Erbfolge
3.2.1 Vermögensnachfolge durch Verfügung von Todes wegen
3.2.2 Vermögensnachfolge durch gesetzliche Erbfolge
3.3 Vermögensübertragung unter Lebenden auf den Todesfall
3.3.1 Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall
3.3.2 Schenkung auf den Todesfall
4 Vorweggenommene Erbfolge als Form der Vermögensnachfolge
4.1 Motive
4.2 Vor- und Nachteile
4.2.1 Vorteile
4.2.2 Nachteile
4.2.3 Finanzielle Prognose für die Zukunft
4.3 Übergabevertrag
4.3.1 Vorweggenommene Erbfolge gegen Erb- und Pflichtteilsverzicht
4.3.2 Vorweggenommene Erbfolge gegen Abfindungs- und Ausgleichszahlungen
4.3.3 Vorweggenommene Erbfolge gegen Übernahme von Verbindlichkeiten und Grundschulden
4.3.4 Sicherung der Lebensstellung bei vorweggenommener Erbfolge
4.3.5 Vorweggenommene Erbfolge gegen Vorbehalt von Rückforderungsansprüchen
5 Überblick über die Instrumente der Nachlassplanung
5.1 Kleines Lexikon der Nachlassplanung
5.2 Testierfreiheit
5.3 Formen von Verfügung von Todes wegen
5.3.1 Ordentliche Testamentsformen
5.3.2 Außerordentliche Testamentsformen
5.3.3 Erbvertrag
5.4 Rechtliche und wirtschaftliche Gestaltungsgrenzen bei der Nachlassplanung
5.4.1 Gesetzliche Beschränkungen
5.4.2 Beschränkungen durch Selbstbindung des Erblassers an frühere erbrechtliche Verfügungen
6 Eigenhändiges Testament
6.1 Testierwille des Erblassers
6.2 Testierfähigkeit des Erblassers
6.3 Errichtung des Testaments
6.3.1 Eigenhändige Erklärung
6.3.2 Eigenhändige Unterschrift
6.3.3 Zeit- und Ortsangaben
6.4 Aufbewahrung
6.5 Änderung
6.6 Widerruf
6.6.1 Errichtung eines Widerrufstestaments
6.6.2 Vernichtung oder Veränderung der Testamentsurkunde
6.6.3 Errichtung eines inhaltlich widersprechenden Testaments
6.6.4 Rechtswirkungen des Widerrufs
6.6.5 Beseitigung des Widerrufs
7 Notarielles Testament
7.1 Testierfähigkeit des Erblassers
7.2 Errichtung des Testaments
7.2.1 Notarielles Testament durch mündliche Erklärung
7.2.2 Notarielles Testament durch Übergabe einer offenen Schrift
7.2.3 Notarielles Testament durch Übergabe einer verschlossenen Schrift
7.3 Amtliche Verwahrung des Testaments
7.4 Notarkosten
7.5 Widerruf
8 Gemeinschaftliches Testament von Eheleuten
8.1 Testierfähigkeit der Ehegatten
8.2 Gültige Ehe
8.3 Form
8.3.1 Eigenhändiges gemeinschaftliches Testament
8.3.2 Notarielles gemeinschaftliches Testament
8.4 Inhalt
8.4.1 Wechselbezügliche Verfügungen
8.4.2 Eheleute entscheiden über Wechselbezüglichkeit
8.4.3 Auslegungsregeln
8.5 Aufbewahrung
8.6 Widerruf
8.6.1 Widerruf einseitiger Verfügungen
8.6.2 Widerruf wechselbezüglicher Verfügungen
8.6.3 Besonderheit beim Widerruf von Verfügungen in einem notariellen gemeinschaftlichen Testament
8.7 Unwirksamkeit bei Beendigung der Ehe
8.8 Berliner Testament
8.8.1 Inhalt
8.8.2 Vorteile des Berliner Testaments
8.8.3 Schwachstellen des Berliner Testaments
8.8.4 Alternativen zum Berliner Testament
9 Erbvertrag
9.1 Motive für den Abschluss eines Erbvertrags
9.2 Voraussetzungen für den Abschluss des Erbvertrags
9.3 Form des Erbvertrags
9.4 Verwahrung des Erbvertrags
9.5 Inhalt des Erbvertrags
9.6 Rechtswirkungen des Erbvertrags
9.6.1 Frühere testamentarische Verfügungen
9.6.2 Spätere erbrechtliche Verfügungen
9.6.3 Auswirkungen des Erbvertrags auf lebzeitige Verfügungen
9.7 Lockerung der Bindung durch Änderungsvorbehalt
9.8 Lösung vom Erbvertrag
9.8.1 Aufhebung des Erbvertrags
9.8.2 Rücktritt vom Erbvertrag
9.8.3 Anfechtung des Erbvertrags durch den Erblasser
10 Erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
10.1 Einsetzung eines oder mehrerer Erben
10.1.1 Verfügung im Testament
10.1.2 Erbeinsetzung unter einer Bedingung
10.1.3 Einsetzung eines Ersatzerben
10.2 Anordnung der Vor- und Nacherbfolge
10.2.1 Trennung des Nachlasses vom Vermögen des Vorerben
10.2.2 Testamentarische Verfügung
10.2.3 Vor- und Nacherbschaft im »Geschiedenentestament«
10.2.4 Vor- und Nacherbschaft bei verschuldeten Erben
10.2.5 Vor- und Nacherbschaft zur Versorgung behinderter oder pflegebedürftiger Personen
10.2.6 Vor- und Nacherbschaft im Ehegattentestament
10.3 Enterbung gesetzlicher Erben
10.3.1 Art und Weise der Enterbung
10.3.2 Folgen der Enterbung
10.4 Zuwendung von Vermächtnissen
10.4.1 Abgrenzung zu anderen testamentarischen Verfügungen
10.4.2 Gegenstände des Vermächtnisses
10.4.3 Begünstigter und Beschwerter des Vermächtnisses
10.4.4 Sicherstellung des Vermächtnisanspruchs
10.4.5 Vermächtnis als flexibles testamentarisches Gestaltungsinstrument
10.5 Anordnung von Auflagen
10.5.1 Abgrenzung zu anderen testamentarischen Verfügungen
10.5.2 Inhalt der Auflage
10.5.3 Beschwerter und Begünstigter
10.5.4 Sicherstellung der Auflagenerfüllung
10.5.5 Auflage als flexibles testamentarisches Gestaltungsinstrument
10.6 Anordnungen für die Auseinandersetzung des Nachlasses
10.6.1 Teilungsanordnung
10.6.2 Teilungsverbot
10.7 Anordnung der Testamentsvollstreckung
10.7.1 Testamentarische Anordnung der Testamentsvollstreckung
10.7.2 Testamentsvollstreckung als testamentarisches Gestaltungsmittel
10.8 Familienrechtliche Anordnungen
10.8.1 Beschränkung der elterlichen Vermögenssorge
10.8.2 Benennung eines Vormunds
10.9 Regelung des »digitalen Nachlasses«
10.9.1 Regelungen über den digitalen Nachlass
10.9.2 Digitale Vorsorgevollmacht
10.10 Rechtswahlbestimmung bei Vermögen im EU-Ausland
11 Individuelle erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten
11.1 Verfügungen von Eheleuten
11.1.1 Ehepartner mit Kindern
11.1.2 Kinderlose Eheleute
11.1.3 Getrennt lebende Ehegatten
11.2 Verfügungen geschiedener Ehegatten mit Kindern
11.3 Verfügungen nichtehelicher Lebenspartner
11.4 Verfügungen Alleinstehender
11.5 Verfügungen von Eltern mit behinderten oder pflegebedürftigen Kindern
11.6 Verfügungen zugunsten verschuldeter Personen
12 Eintritt des Erbfalls
12.1 Kleines Lexikon der Erbfolge
12.2 Gesamtrechtsnachfolge
12.2.1 Folgen für ein Mietverhältnis
12.2.2 Folgen für ein Versicherungsverhältnis des Verstorbenen
12.2.3 Folgen für ein Bankkonto des Verstorbenen
12.3 Erbfähigkeit
12.3.1 Minderjährige Erben
12.3.2 Gezeugte, aber noch nicht geborene Kinder
12.3.3 Gesellschaften
12.3.4 Erbunfähigkeit
12.4 Vererbbares Vermögen
13 Gesetzliche Erbfolge
13.1 Grundsätze des gesetzlichen Erbrechts
13.2 Gesetzliches Erbrecht ehelicher Kinder
13.3 Gesetzliches Erbrecht nichtehelicher Kinder
13.4 Gesetzliches Erbrecht adoptierter Kinder
13.4.1 Adoption eines minderjährigen Kindes
13.4.2 Adoption eines volljährigen Kindes
13.5 Gesetzliches Erbrecht der Eltern und Geschwister
13.6 Gesetzliches Erbrecht der Großeltern
13.7 Gesetzliches Erbrecht der weiteren Verwandten
13.8 Gesetzliches Erbrecht des länger lebenden Ehegatten
13.8.1 Erbteil des Ehegatten bei Zugewinngemeinschaft
13.8.2 Erbteil des Ehegatten bei Gütertrennung
13.8.3 Anspruch des Ehegatten auf den »Voraus«
14 Umstrittenes Testament
14.1 Unklare Bestimmungen im Testament
14.1.1 Grundsätze der Auslegung
14.1.2 Auslegungsregeln
14.2 Anfechtung des Testaments
14.2.1 Anfechtungsgründe
14.2.2 Anfechtungsberechtigter
14.2.3 Erklärung und Form der Anfechtung
14.2.4 Anfechtungsfrist
14.2.5 Folgen der Anfechtung
15 Anfall der Erbschaft
15.1 Testamentseröffnung
15.2 Annahme der Erbschaft
15.2.1 Formen der Annahme
15.2.2 Annahme der Erbschaft durch Erben
15.2.3 Folgen der Annahme
15.2.4 Anfechtung der Annahme
15.3 Sicherung des Nachlasses bei unbekannten Erben
15.3.1 Sicherungsbedürfnis
15.3.2 Sicherungsanlässe
15.3.3 Sicherungsmaßnahmen des Nachlassgerichts
15.3.4 Nachlasspflegschaft
15.4 Ausschlagung der Erbschaft
15.4.1 Motive für die Ausschlagung der Erbschaft
15.4.2 Form der Ausschlagung
15.4.3 Ausschlagungsfrist
15.4.4 Kosten der Ausschlagung
15.4.5 Folgen der Ausschlagung
15.4.6 Anfechtung der Ausschlagung
15.4.7 Vor- und Nachteile der Ausschlagung
15.5 Erbschein
15.5.1 Notwendigkeit des Erbscheins
15.5.2 Antrag
15.5.3 Inhalt
15.5.4 Kosten
15.5.5 Rechtliche Wirkungen des Erbscheins
15.5.6 Unrichtiger Erbschein
15.6 Auskunftsanspruch des Erben
15.6.1 Auskunftspflicht des Erbschaftsbesitzers
15.6.2 Auskunftspflicht des Hausgenossen
15.7 Herausgabeanspruch des Erben
15.7.1 Anspruchsberechtigter
15.7.2 Anspruchsverpflichteter
15.7.3 Inhalt des Herausgabeanspruchs
16 Pflichtteil des Ehegatten und der nächsten Verwandten
16.1 Streit um den Pflichtteil
16.2 Voraussetzungen des Pflichtteilsanspruchs
16.3 Pflichtteilsberechtigte Personen
16.4 Inhalt des Pflichtteilsanspruchs
16.5 Höhe des Pflichtteils
16.5.1 Ermittlung der Pflichtteilsquote
16.5.2 Ermittlung des Nachlasswerts
16.5.3 Pflichtteilsergänzung bei Zuwendungen zu Lebzeiten
16.6 Auskunfts- und Wertermittlungsanspruch des Pflichtteilsberechtigten
16.7 Schuldner des Pflichtteils(ergänzungs-)anspruchs
16.7.1 Schuldner des Pflichtteilsanspruchs
16.7.2 Schuldner des Pflichtteilsergänzungsanspruchs
16.8 Fälligkeit des Anspruchs, Stundung
16.9 Verjährung
17 Erbunwürdige Erben
17.1 Voraussetzungen
17.2 Geltendmachung
17.2.1 Anfechtung des Erbschaftserwerbs durch Klage
17.2.2 Ausschluss der Anfechtung wegen Verzeihung
17.3 Folgen der Erbunwürdigkeit
18 Erbengemeinschaft bei mehreren Erben
18.1 Entstehung der Erbengemeinschaft
18.2 Verwaltung des Nachlasses
18.3 Verkauf des Erbteils durch einen Miterben
18.4 Anspruch des Miterben auf Teilung des Nachlasses
18.4.1 Aufschub der Auseinandersetzung
18.4.2 Ausschluss der Auseinandersetzung
18.5 Grundsätze für die Teilung des Nachlasses
18.5.1 Erfüllung der Nachlassverbindlichkeiten
18.5.2 Ausgleichspflicht bei Ausstattungen
18.5.3 Ausgleichspflicht bei besonderen Leistungen eines Abkömmlings
18.5.4 Teilungsanordnungen des Erblassers
18.6 Formen der Nachlassteilung
18.6.1 Nachlassteilung durch Testamentsvollstrecker
18.6.2 Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen den Miterben
18.6.3 Vermittlung durch das Nachlassgericht
18.6.4 Auseinandersetzungsklage
18.7 Beendigung der Erbengemeinschaft
19 Testamentsvollstreckung
19.1 Aufgaben des Testamentsvollstreckers
19.1.1 Abwicklungsvollstreckung
19.1.2 Verwaltungsvollstreckung
19.2 Rechte der Erben gegenüber dem Testamentsvollstrecker
19.3 Haftung des Testamentsvollstreckers bei Pflichtverletzungen
19.4 Beendigung der Testamentsvollstreckung
19.4.1 Kündigung des Testamentsvollstreckers
19.4.2 Entlassung durch das Nachlassgericht
20 Haftung der Erben
20.1 Grundsatz: Unbeschränkte, aber beschränkbare Haftung
20.2 Überblick über das gesetzliche System der Haftung
20.3 Feststellung der Vermögenssituation
20.3.1 Nachlassverbindlichkeiten und Umfang der Haftung
20.3.2 Aufgebotsverfahren
20.3.3 Inventarerrichtung
20.4 Vorübergehender Schutz des Erben vor Nachlassgläubigern
20.4.1 Dreimonatseinrede nach der Annahme der Erbschaft
20.4.2 Aufgebotseinrede nach Antrag auf Durchführung eines Aufgebotsverfahrens
20.4.3 Wirkung der Einreden
20.5 Endgültige Beschränkung der Haftung des Alleinerben
20.5.1 Endgültige Beschränkung der Haftung gegenüber allen Nachlassgläubigern
20.5.2 Endgültige Beschränkung der Haftung gegenüber einzelnen Nachlassgläubigern
20.6 Unbeschränkte Haftung des Erben für Nachlassverbindlichkeiten
20.6.1 Unbeschränkte Haftung des Alleinerben gegenüber allen Nachlassgläubigern
20.6.2 Unbeschränkte Haftung des Alleinerben gegenüber einzelnen Nachlassgläubigern
20.7 Wie Miterben einer Erbengemeinschaft für Schulden haften
20.7.1 Allgemeine Möglichkeiten zur Haftungsbeschränkung
20.7.2 Haftung des Miterben vor der Teilung des Nachlasses
20.7.3 Haftung des Miterben nach der Teilung des Nachlasses
21 Erbschaft- und Schenkungsteuer
21.1 Steuerpflichtige Zuwendungen
21.1.1 Zuwendungen von Todes wegen
21.1.2 Zuwendungen unter Lebenden
21.2 Steuerfreie Zuwendungen
21.2.1 Steuerbefreiung bei Zuwendung von Hausrat und anderen beweglichen körperlichen Gegenständen
21.2.2 Steuerbefreiung im Zusammenhang mit einem Familienwohnheim
21.2.3 Steuerbefreiung bei Erwerb durch erwerbsunfähige Eltern und Großeltern
21.2.4 Steuerbefreiung bei unentgeltlicher Pflege- und Unterhaltsgewährung
21.2.5 Steuerbefreiung bei Zuwendungen für Unterhalt oder Ausbildung
21.2.6 Steuerbefreiung bei Rückfall geschenkten Vermögens an Eltern oder Voreltern
21.2.7 Steuerbefreiung bei üblichen Gelegenheitsgeschenken
21.2.8 Weitere Steuerbefreiungen
21.3 Bewertung des Nachlasses
21.3.1 Bewertung des Grundbesitzes
21.3.2 Bewertung von Aktien
21.3.3 Bewertung von Hausrat
21.3.4 Bewertung von Kunstgegenständen
21.3.5 Bewertung von Wertpapieren und Anteilen
21.3.6 Bewertung von Kapitalforderungen und Schulden
21.4 Abzug von Nachlassverbindlichkeiten
21.5 Berechnung der Steuer
21.5.1 Steuerpflichtiger Erwerb
21.5.2 Steuersatz
21.6 Erbschaftsteuererklärung
21.6.1 Anzeige des Erwerbs beim Finanzamt
21.6.2 Abgabe der Erbschaftsteuererklärung
21.6.3 Erbschaftsteuerbescheid
21.7 Fälligkeit der Steuer
21.8 Schenkung- und Erbschaftsteuer sparen
21.8.1 Individuelle steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten
21.8.2 Steuern sparen nach dem Erbfall
Der große Erbschaftsratgeber: Gutes Planen schafft Entlastung – Ihr Wegweiser für eine Nachlassplanung, die zu Ihnen passt!
1 Vorwort
Über Geld spricht man nicht. Oder doch? Spätestens wenn eine Person stirbt und der Erbfall eintritt, geht es darum, welches Vermögen der Erblasser hinterlässt und wie es unter den Erben verteilt wird. Erbrechtliche Fragen und Probleme betreffen regelmäßig die Zeit vor und nach dem Erbfall, also vor und nach dem Tod einer Person. Vor dem Erbfall geht es darum, die Vermögensnachfolge zu planen oder bereits Vermögen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge zu übertragen. Nach dem Tod des Erblassers geht es hingegen vor allem um die Abwicklung des Nachlasses.
»Nach mir die Sintflut« – das ist eine weitverbreitete Ansicht, wenn es darum geht, was aus dem mühsam Angesparten werden soll. Fast drei Viertel der Deutschen haben kein Testament errichtet oder einen Erbvertrag abgeschlossen. In diesen Fällen tritt gesetzliche Erbfolge ein. Es bleibt zu hoffen, dass diese den Wünschen des Erblassers entspricht. Wer rechtliche und steuerliche Fehlplanungen vermeiden will, sollte sich rechtzeitig mit seiner Nachlassplanung befassen – insbesondere mit dem richtigen Zeitpunkt, den Gestaltungsmöglichkeiten, den steuerlichen Rahmenbedingungen und den persönlichen Lebensumständen. Die Entscheidung, wem Sie was vererben oder verschenken, kann Ihnen niemand abnehmen. Jeder Fall liegt anders. Grundlage für die richtige Entscheidung sind immer Ihre jeweiligen individuellen Lebensumstände und Ihre persönlichen Wünsche. Fehler bei der Nachlassplanung können nach Eintritt des Erbfalls oft nicht mehr korrigiert werden.
Dieser Ratgeber hilft Ihnen mit Tipps und Musterformulierungen bei der Nachlassplanung. Anhand konkreter Beispiele wird die jeweilige Problematik so verdeutlicht, dass Sie Ihre individuelle Situation erkennen und auf der Grundlage der aufgezeigten Lösungswege die richtige Nachlassplanung vornehmen können.
Wenn der Erbfall eingetreten ist, werden die Erben gleichermaßen mit zahlreichen Fragen und Problemen konfrontiert. Wie bekommt man einen Erbschein und die Nachlassgegenstände? Wie wird der Nachlass abgewickelt, wenn eine Erbengemeinschaft besteht? Worauf muss man achten, wenn Pflichtteilsansprüche, Vermächtnisse oder Auflagen zu erfüllen sind? Was muss man tun, wenn der Nachlass unübersichtlich oder überschuldet ist? Welche Pflichten bestehen gegenüber dem Finanzamt? Wie kann man Erbschaftsteuer sparen? Das sind nur einige von vielen Fragen, die sich stellen. Und der Erbe muss dann unter Umständen eine schnelle Entscheidung treffen, wenn er sich eine günstige Rechtslage verschaffen will.
Dieser Ratgeber hilft den Erben ebenfalls, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich eine günstige Rechtslage zu verschaffen. Es werden Fallstricke und Risiken aufgezeigt, die den Erben vor rechtlichen und finanziellen Nachteilen schützen sollen.
Dr. iur. Otto N. Bretzinger
!
Tipp: Alle Musterformulierungen des Ratgebers können Sie auch herunterladen. Den Link zum Downloadbereich finden Sie am Ende des Ratgebers.
2 Vorüberlegungen für die richtige Vermögensnachfolge
Egal, ob Sie Teile Ihres Vermögens bereits zu Lebzeiten an Ihre künftigen Erben verschenken oder Ihr Vermögen nach Ihrem Tod vererben wollen: Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über Ihre persönlichen Lebensumstände und Ihre aktuelle Vermögenssituation. Danach sollten Sie sich Klarheit über Ihre Wünsche und Interessen verschaffen und sich mit den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen befassen. Grundsätzlich müssen Sie dann entscheiden, ob es sinnvoll ist, sich bereits zu Lebzeiten im Wege der vorweggenommenen Erbfolge von Vermögenswerten zu trennen oder ob Ihr Vermögen erst nach Ihrem Tod an Ihre Erben übergehen soll.
2.1 Persönliche Lebensumstände als Grundlage der Planung der Vermögensnachfolge
Die Planung der Vermögensübertragung auf die nächste Generation sollten Sie als wichtigen Teil Ihrer privaten Finanzplanung betrachten. Deshalb ist bei der Vermögensnachfolge nicht zuletzt Ihre aktuelle Lebenssituation von Bedeutung. Und dabei sind neben rechtlichen insbesondere wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen.
Halten Sie zunächst Ihre aktuellen persönlichen Lebensumstände schriftlich fest. In der nachfolgenden Checkliste finden Sie Fragen, die Sie für sich beantworten sollten und die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen können, wann und an wen Sie Ihr Vermögen übertragen wollen.
Checkliste: Persönliche Lebenssituation
Sind Sie ledig, verheiratet oder geschieden oder leben Sie in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft?
Wenn Sie verheiratet sind: In welchem Güterstand leben Sie mit Ihrem Ehegatten?
Ist Ihre Ehe harmonisch, besteht eine Ehekrise oder sogar der Wunsch nach Scheidung?
Waren Sie bereits verheiratet?
Sind Ihre Familienangehörigen geschäftsfähig?
Sind Ihre Familienangehörigen verschuldet?
Haben Sie (eheliche/nichteheliche) Kinder?
Sind Ihre Kinder noch minderjährig?
Mit welchen Familienangehörigen verstehen Sie sich am besten?
Mit welchen Familienangehörigen haben Sie persönliche Probleme?
Versteht sich Ihr Ehegatte mit den Kindern?
Kommen Ihre Kinder miteinander klar oder gibt es Probleme?
Haben Ihre Kinder Eheprobleme?
Können Ihre Familienangehörigen verantwortungsbewusst mit Vermögen umgehen?
2.1.1 Familienstand
Sind Sie ledig, verheiratet, geschieden oder leben Sie in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft? Der Familienstand ist wichtig, wenn Sie Vermögen auf Ihren Partner übertragen oder diesen von der Erbfolge ausschließen wollen.
Wenn Sie ledig oder verwitwet sind, müssen Sie Ihre Vermögensnachfolge im Falle Ihres Todes durch ein Testament oder einen Erbvertrag regeln, wenn Sie mit der gesetzlichen Erbfolge nicht einverstanden sind. Nach dem Gesetz erben Kinder zu gleichen Teilen. Gibt es keine Kinder, erben Ihre Eltern – und wenn diese bereits verstorben sind, Ihre Geschwister. Wollen Sie eine vom Gesetz abweichende erbrechtliche Verfügung treffen, müssen Sie berücksichtigen, dass Kindern bzw. Eltern Pflichtteilsansprüche zustehen.
Sind Sie verheiratet, steht Ihrem Ehegatten der gesetzliche Erbteil zu. Sind gemeinsame Kinder vorhanden, erbt der länger lebende Ehegatte neben den Kindern. Wollen Sie Ihren Ehegatten oder ein Kind enterben oder andere als die gesetzlich vorgesehenen Erbteile festlegen, müssen Sie die Pflichtteilsansprüche des Ehegatten und der Kinder berücksichtigen.
Das gesetzliche Erbrecht der Eheleute entfällt automatisch, wenn die Ehe geschieden oder ein Scheidungsantrag bei Gericht eingereicht und der Antrag dem anderen Ehegatten zugestellt ist. Grundsätzlich ebefalls unwirksam wird auch ein gemeinschaftliches Testament der geschiedenen Ehepartner. Ausnahmsweise bleiben die gemeinschaftlichen Verfügungen aber wirksam, wenn anzunehmen ist, dass sie auch für den Fall der Auflösung der Ehe getroffen wurden. Entscheidend ist also, was die Eheleute zum Zeitpunkt der Testamentserrichtung wirklich wollten. Lässt sich der wirkliche Wille nicht ermitteln, muss vom Gericht der »hypothetische Wille« festgestellt werden. Es kann also durchaus sein, dass der Ehegatte nach der Scheidung noch testamentarischer Erbe ist. Wer dies auf jeden Fall verhindern will, sollte in einem neuen Testament das gemeinschaftliche Testament mit dem geschiedenen Ehegatten sicherheitshalber ausdrücklich aufheben und für unwirksam erklären.
Achtung: Zwar erlischt mit der Scheidung automatisch das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehepartners und im Zweifel wird eine zugunsten des Partners getroffene Verfügung von Todes wegen unwirksam, allerdings kann der frühere Partner wieder indirekt am Nachlass partizipieren, wenn ein gemeinschaftliches Kind erbt oder Pflichtteilsansprüche erwirbt.
Der nichteheliche Lebenspartner ist nur dann Erbe seines verstorbenen Partners, wenn er durch Testament oder einen Erbvertrag als Erbe eingesetzt ist. Andernfalls geht das Gesetz davon aus, dass der Erblasser sein Vermögen an seine nächsten Verwandten übertragen will. Dem länger lebenden Lebenspartner kann in einer entsprechenden erbrechtlichen Verfügung ein Anspruch auf eine Zuwendung in Form eines Vermächtnisses eingeräumt werden.
Besondere Probleme bestehen bei der Vermögensnachfolge in einer sogenannten Patchworkfamilie, wenn die Partnerschaft durch Tod eines Partners endet. Von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang, ob die Partner verheiratet waren oder nicht und ob gemeinschaftliche Kinder vorhanden sind.
2.1.2 Kinder
Wenn Sie Kinder haben, steht diesen ein gesetzliches Erbrecht zu. Sind mehrere Kinder vorhanden, erben sie zu gleichen Teilen. Wenn Sie ein Kind enterben oder von den gesetzlichen Erbteilen abweichen möchten, müssen Sie ein Testament verfassen. Dabei müssen Sie berücksichtigen, dass einem Kind der sogenannte Pflichtteil zusteht, den Sie nur unter engen Voraussetzungen entziehen können.
Sinnvoll kann es sein, einem Kind bereits im Wege der vorweggenommenen Erbfolge etwas zuzuwenden.
Nichteheliche Kinder gehören zu den gesetzlichen Erben. Für das Erbrecht von Adoptivkindern muss unterschieden werden, ob eine minderjährige oder volljährige Person adoptiert wurde.
Auch ein minderjähriges Kind ist gesetzlicher Erbe. Ebenso kann es testamentarisch bedacht werden, indem es als Erbe eingesetzt oder ihm ein Vermächtnis zugewendet wird. Eltern mit minderjährigen Kindern können im Testament Anordnungen mit familienrechtlichem Bezug und erbrechtlicher Wirkung treffen. In Betracht kommen insbesondere eine Verwaltungsanordnung, der Entzug des elterlichen Vermögensverwaltungsrechts und die Benennung eines Vormunds.
2.1.3 Ehekrise und bevorstehende Scheidung
Wenn eine Ehekrise oder sogar der Wunsch nach Scheidung besteht, sollten Sie davon Abstand nehmen, Vermögenswerte im Wege der vorweggenommenen Erbfolge zu übertragen.
Erbrechtlich ist es ohne Bedeutung, wenn die Eheleute getrennt leben. Das gesetzliche Erbrecht des Ehepartners ist erst dann ausgeschlossen, wenn zur Zeit des Erbfalls die Voraussetzungen für die Scheidung der Ehe gegeben waren und der Erblasser die Scheidung beantragt oder ihr zugestimmt hatte. Ist das nicht der Fall und leben die Eheleute getrennt, müssen Sie Ihren Ehepartner in einem Testament enterben, wenn Sie vermeiden wollen, dass dieser in der Trennungsphase erbt. Allerdings bleibt der Pflichtteilsanspruch des getrennt lebenden Ehepartners bestehen.
Erst mit der Scheidung endet das gesetzliche Erb- und Pflichtteilsrecht des Ehepartners automatisch und es wird im Zweifel eine zugunsten des Partners getroffene Verfügung von Todes wegen unwirksam.
2.1.4 Komplizierte Beziehungen unter den Familienangehörigen
Wenn sich ein Ehegatte mit den Kindern oder Kinder untereinander nicht verstehen, macht es wenig Sinn, dass Ihr Nachlass im Wege der gesetzlichen Erbfolge an mehrere Erben übergeht oder Sie testamentarisch mehrere Erben bestimmen. In beiden Fällen entsteht eine sogenannte Erbengemeinschaft. Und dann sind Konflikte vorprogrammiert. Wer bekommt was und vor allem wie viel von was? Muss verkauft, geteilt oder ausbezahlt werden? Besonders problematisch wird es, wenn unteilbare Nachlassgegenstände wie beispielsweise eine Immobilie an mehrere Miterben vererbt werden. Alle haben dann das gleiche Recht auf die ganze Immobilie, das ganze Auto oder das gesamte Unternehmen. Kein Miterbe darf in einem solchen Fall ohne Zustimmung aller Miterben einzelne Gegenstände an sich nehmen oder veräußern. Bis es zu einer möglichen Teilung des Nachlasses kommt, müssen alle den Nachlass gemeinschaftlich verwalten. Und hier beginnen meist bereits die ersten Probleme. In vielen Fällen bleibt den Beteiligten nur der Gang vor die Gerichte, der viel Geld und noch mehr Nerven kostet und trotzdem nicht zum gewünschten Erfolg führt.
!
Tipp: Eine sorgfältige Planung und rechtzeitige Regelungen können helfen, Konflikte unter den Erben zu vermeiden. Neben Zuwendungen im Wege der vorweggenommenen Erbfolge gegen einen Erb- und Pflichtteilsverzicht helfen erbrechtliche Gestaltungen wie Teilungsanordnungen, die Einsetzung eines Testamentsvollstreckers oder Vermächtnisse, Konflikte unter den Erben zulasten des Nachlasses zu vermeiden.
2.1.5 Verschuldete Erben
Probleme gibt es, wenn einer verschuldeten Person (z.B. dem Ehepartner oder einem Kind) zu Lebzeiten oder durch Testament Vermögen übertragen werden soll. Wenig Sinn macht es nämlich, Vermögen an eine verschuldete Person zu übertragen, wenn dann deren Gläubiger sofort auf dieses Vermögen zugreifen können. Im Wesentlichen geht es also darum, die Zuwendungen auf pfändungsfreie Vermögenswerte zu beschränken und bei Geldzuwendungen die Pfändungsfreigrenzen zu beachten.
Zuwendungen zu Lebzeiten (insbesondere Schenkungen) werden nur dann in Betracht kommen, wenn sie nicht der Pfändung unterworfen sind. Soll Vermögen im Wege der Erbfolge auf eine verschuldete Person übertragen werden, muss in einer Verfügung von Todes wegen einerseits verhindert werden, dass durch die Vermögensübertragung die Gläubiger des Erben, Pflichtteilsberechtigten oder Vermächtnisnehmers auf das Vermögen zugreifen können. Andererseits soll diesen Personen jedoch ein angemessener Unterhalt gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang stehen dem Erblasser verschiedene erbrechtliche Gestaltungen zur Verfügung.
2.1.6 Behinderte oder pflegebedürftige Erben
Für behinderte oder pflegebedürftige Kinder sollten Sie besondere Vorsorge treffen. Trotz Pflegeversicherung sind für Pflegeheim- und Pflegekosten von den Eltern häufig eigene Zuzahlungen zu erbringen. Schutzbedürftig sind vor allem behinderte Kinder, die nach dem Tod der Eltern versorgt werden müssen. Probleme ergeben sich in diesen Fällen dann, wenn die im Rahmen der Pflege- und Betreuungsbedürftigkeit erforderlichen Aufwendungen mangels eigener Einkünfte vom Sozialamt oder der Grundsicherung übernommen werden.
Eine behinderte oder pflegebedürftige Person hat für die Bestreitung der Lebenshaltungskosten, der Betreuungskosten oder der Kosten für eine Heimunterbringung grundsätzlich ihr eigenes Vermögen einzusetzen. Neben dem Einsatz des Einkommens wird von einem Hilfesuchenden verlangt, dass er sein Vermögen verbraucht bzw. veräußert, bevor er Sozialhilfe beanspruchen kann. Alles übrige Vermögen des Kindes, also auch seine Erbschaft, wandert zur Finanzierung seiner Sozialhilfe an den Sozialhilfeträger. Dieser kann, wenn das behinderte oder pflegebedürftige Kind Erbe wird, aus dem Nachlass selbst für zurückliegende Sozialhilfeleistungen Ersatz verlangen. Dies kann dann innerhalb kürzester Zeit zum gesamten Verbrauch der Erbschaft führen.
Besser als Vermögensübertragungen zu Lebzeiten sind erbrechtliche Gestaltungen. Mit dem sogenannten Behindertentestament können Sie als Eltern oder als Elternteil erreichen, dass Ihr Vermögen der Familie erhalten bleibt und ein Zugriff des Sozialhilfeträgers auf dieses Vermögen ausgeschlossen wird. Darüber hinaus können Sie Ihrem behinderten oder pflegebedürftigen Kind im Erbfall eine über die normale Sozialhilfe hinausgehende Lebensqualität gewährleisten, indem Zuwendungen an das Kind erfolgen, die ihm vom Sozialhilfeträger nicht weggenommen werden können.
2.2 Zusammenstellung der aktuellen Vermögenswerte
Überprüfen Sie nach der Bestandsaufnahme Ihrer persönlichen Lebenssituation Ihre aktuelle Vermögenslage. Das funktioniert am besten mit einem Vermögensverzeichnis, in dem Sie Ihre aktuellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufführen. Lassen Sie sich bei der Aufstellung Zeit und gehen Sie sorgfältig vor. Richtig planen können Sie nur mit einer vollständigen und richtigen Aufstellung. Wenn Sie verheiratet sind, sollten Sie jeweils ein Vermögensverzeichnis für jeden Ehepartner anlegen.
Stand: ______________ [Datum eintragen]
Ehemann
Wert in Euro
Ehefrau
Wert in Euro
Aktiva
Bargeld
Guthaben auf Girokonten, Termin- und Festgeldkonten, Sparkonten, Sparverträgen, sonstigen Spareinlagen
Wertpapiere
Forderungen aus Versicherungsverträgen
Forderungen aus Bausparverträgen
Steuererstattungsansprüche
Zahlungsansprüche aus Schadenfällen oder nicht erfüllten Verträgen
Forderungen aus Darlehen
Rechte und Ansprüche aus Erbschaften
Rückständiges Arbeitseinkommen
Aktien, Genussrechte und sonstige Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (z.B. Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Beteiligungen an Personengesellschaften (z.B. offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts)
Beteiligungen als stiller Gesellschafter
Beteiligungen an Genossenschaften
Grundvermögen (Grundstücke, Eigentumswohnungen, Erbbaurechte)
Anteile an geschlossenen und offenen Immobilienfonds
Kraftfahrzeuge
Hausrat, sonstiges Mobiliar oder Wertgegenstände
Rechte oder Ansprüche aus Urheber-, Patent- und Verlagsrechten
Betriebsvermögen
Sonstiges Vermögen
Aktiva Gesamt
Passiva
Verbindlichkeiten auf Girokonten
Langfristige Bankschulden
Verbindlichkeiten aus Bausparverträgen
Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen
Mietschulden
Steuerschulden
Rückständige Prämien aus Versicherungsverträgen
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten
Passiva Gesamt
Nachlasswert (Aktiva ./. Passiva)
Beachten Sie, dass sich der Wert Ihres Gesamtvermögens und einzelner Vermögensgegenstände noch ändern können. Autos verlieren an Wert und Aktien oder Anleihen können schnell wertlos sein. Halten Sie Ihr Vermögensverzeichnis deswegen aktuell.
Vermerken Sie in Ihrer Vermögensübersicht, ob und wann Sie bereits Ihrem Ehegatten oder Ihren Kindern Vermögen übertragen haben. Sogenannte lebzeitige Zuwendungen können erbrechtlich von Bedeutung sein, beispielsweise im Rahmen von Pflichtteilsergänzungsansprüchen.
!
Tipp: Wenn Sie schon dabei sind, Ihr Vermögen und Ihre Verbindlichkeiten aufzulisten, ist es sinnvoll, gleichzeitig zu notieren, welche Unterlagen es dazu jeweils gibt und wo Sie diese verwahrt haben.
Wolters Kluwer Steuertipps bietet hierfür auch einen umfangreichen »VorsorgePlaner« mit zusätzlichem Notfallordner an.
2.3 Prüfung der rechtlichen Rahmenbedingungen
Auf der Grundlage Ihrer Vermögensaufstellung sollten Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen klären. Prüfen Sie insbesondere, ob und inwieweit Sie bereits rechtlich wirksame erbrechtliche Verfügungen getroffen haben und ob Sie in der Vergangenheit bereits Vermögenswerte an einzelne Familienangehörige übertragen haben. Die nachfolgende Checkliste hilft Ihnen, alle wichtigen Fragen im Blick zu behalten:
Checkliste: Rechtliche Rahmenbedingungen
Wenn Sie verheiratet sind: In welchem Güterstand leben Sie?
Haben Sie bereits ein Testament errichtet?
Bestehen rechtliche Bindungen durch ein gemeinschaftliches Testament mit dem Ehegatten?
Bestehen rechtliche Verbindungen durch einen Erbvertrag?
Bestehen längerfristige Verträge?
Haben Sie Unterhalts- oder Versorgungsverpflichtungen?
Haben Sie bereits in der Vergangenheit Vermögenswerte auf Ihre Familienangehörigen übertragen?
Welche Familienangehörigen würden im Wege der gesetzlichen Erbfolge erben, wenn Sie kein Testament errichten?
Welche Familienangehörigen könnten im Falle einer Enterbung Pflichtteilsansprüche geltend machen?
Bestehen Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge?
Haben Sie eine Lebensversicherung? Wen haben Sie als Bezugsberechtigten genannt?
Güterstand:
Der Güterstand, in dem Sie mit Ihrem Ehegatten leben, ist unter anderem für die gesetzliche Erbfolge von Bedeutung. Dabei ist zwischen dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft und dem Vertragsgüterstand der Gütertrennung zu unterscheiden.
Testament:
Prüfen Sie, ob Sie in der Vergangenheit bereits ein Testament errichtet haben. Wenn Sie bereits ein Einzeltestament errichtet haben, sind Sie nicht daran gehindert, andere Verfügungen zu treffen. Sie können jederzeit das Testament widerrufen oder ändern.
Wenn Sie mit Ihrem Ehegatten zusammen ein gemeinschaftliches Testament errichtet haben, sind Sie daran grundsätzlich gebunden.
Haben Sie mit Ihrem verstorbenen Ehegatten ein Berliner Testament errichtet und darin Ihre Kinder als Schlusserben eingesetzt, sind Sie an diese Erbeinsetzung gebunden, wenn Sie beim Tod Ihres Ehegatten die Erbschaft nicht ausgeschlagen haben. Sie können in diesem Fall keine vom Berliner Testament abweichende Erbeinsetzung vornehmen.
Lebt Ihr Partner noch, können Sie Verfügungen im gemeinschaftlichen Testament nur durch eine Erklärung vor einem Notar widerrufen. Der Widerruf wird erst wirksam, wenn er dem anderen Ehegatten zugeht. Es ist also nicht möglich, dass hinter dem Rücken des anderen Ehegatten wechselbezügliche Verfügungen widerrufen werden. Der Widerruf einer gegenseitigen Verfügung (z.B. gegenseitige Erbeinsetzung) hat grundsätzlich die Unwirksamkeit der Verfügung des anderen Ehegatten zur Folge.
Bindung durch Erbvertrag:
Der Erblasser hat ebenfalls die Möglichkeit, erbrechtliche Verfügungen in Form eines Erbvertrags zu treffen. Im Gegensatz zu Verfügungen in einem Testament, die jederzeit widerrufen werden können, ist er bei vertraglichen Verfügungen im Erbvertrag an diese gebunden. Ein einseitiger Widerruf von vertragsmäßigen Verfügungen durch den Erblasser ist nicht zulässig. Deshalb sind testamentarische Verfügungen, die dem Erbvertrag widersprechen, unwirksam.
Längerfristige Verträge:
Wenn Sie längerfristige Verträge über Ihr Vermögen abgeschlossen haben (z.B. langfristige Kapitalanlagen, Mietverträge über Immobilien), sollten Sie die Laufzeiten und die Kündigungsmöglichkeiten im Blick behalten.
Unterhalts- oder Versorgungsverpflichtungen:
Wenn Sie noch gesetzliche Unterhalts- oder Versorgungsverpflichtungen haben, sollten Sie sich nicht zu Lebzeiten von Vermögenswerten trennen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie in finanzielle Schwierigkeiten geraten.
Schenkungen zu Lebzeiten:
Wenn Sie bereits in der Vergangenheit Vermögenswerte auf Familienangehörige übertragen haben, kann das unter Umständen die Pflichtteilsansprüche des Ehegatten oder der Kinder erhöhen. In diesem Fall können unter Umständen sogenannte Pflichtteilsergänzungsansprüche der gesetzlichen Erben bestehen.
Erb- und Pflichtteilsverzichtsverträge:
Der Erbe kann durch einen notariell beurkundeten Vertrag auf sein Erb- und Pflichtteilsrecht verzichten. Häufig werden entsprechende Verträge abgeschlossen, wenn auf Kinder im Wege der vorweggenommenen Erbfolge Vermögen übertragen wird. Prüfen Sie, ob solche Vereinbarungen bestehen. Ist dies der Fall, müssen Sie bei Ihrer Nachlassplanung nicht mehr auf Erb- und Pflichtteilsrechte Rücksicht nehmen.
Lebensversicherung mit Bezugsberechtigung:
Weil das Kapital einer Lebensversicherung nicht in den Nachlass fällt, wenn sie festgelegt haben, dass es an einen von Ihnen benannten Bezugsberechtigten auszuzahlen ist, sollten Sie prüfen, ob Sie diese Person darüber hinaus auch bei Ihrer Nachlassplanung noch berücksichtigen möchten.
2.4 Berücksichtigung Ihrer persönlichen Interessen und Vorstellungen
Im nächsten Schritt sollten Sie sich über Ihre persönlichen Wünsche und Interessen klar werden. Ihre Vermögensnachfolge sollte in erster Linie Sie zufriedenstellen. Deshalb sollten Sie sich über Ihre persönlichen Interessen und Wünsche bewusst werden. Prüfen Sie, welche Motive Sie mit der Vermögensübertragung verfolgen, wen Sie absichern wollen und vor allen Dingen auch, ob Sie selbst finanziell abgesichert sind.
Prüfen Sie, wen Sie mit der Vermögensübertragung absichern wollen – sich selbst, Ihren Ehegatten, Ihre Kinder oder andere Familienangehörige. Entsprechendes gilt für die Frage, wem Sie Priorität bei der Versorgung einräumen wollen. Wenn Sie einzelne Familienangehörige bevorzugen, andere benachteiligen oder sogar enterben wollen oder wenn Sie Ihr Vermögen möglichst innerhalb der Familie gebunden wissen wollen, müssen Sie auf jeden Fall ein Testament errichten oder einen Erbvertrag abschließen.
Befassen Sie sich eingehend mit der Frage, wann Sie Ihr Vermögen übertragen möchten – noch zu Lebzeiten oder erst im Wege der Erbfolge.
Wenn Sie sich von Vermögensteilen zu Lebzeiten trennen wollen, sollten Sie sich über Ihre Beweggründe klar werden. Berücksichtigen Sie ebenfalls Ihre eigene finanzielle und wirtschaftliche Versorgung. Es muss Ihnen bewusst sein, dass das unter anderem Auswirkungen auf etwaige Pflichtteilsansprüche hat. Überlegen Sie, ob Sie die lebzeitige Vermögensübertragung von Gegenleistungen des Zuwendungsempfängers (z.B. Rentenzahlung, Pflegeleistungen) abhängig machen wollen. Prüfen Sie auch, ob Sie sich das Recht vorbehalten wollen, die Zuwendung unter bestimmten Voraussetzungen wieder rückgängig zu machen.
Wenn Ihr Vermögen erst nach Ihrem Tod auf Ihre Familienangehörigen übergehen soll, müssen Sie prüfen, ob die gesetzliche Erbfolge Ihren Wünschen entspricht oder Sie davon abweichen und ein Testament errichten oder einen Erbvertrag abschließen wollen.
!
Tipp: Letztlich liegt die Entscheidung bei Ihnen, wann, wie und an wen Sie Ihr Vermögen übertragen wollen. Möglicherweise werden Sie es nicht schaffen, dass Sie alle Beteiligten zufriedenstellen. Gleichwohl kann es sinnvoll sein, Ihre Wünsche und Interessen mit Ihren nächsten Familienangehörigen, insbesondere mit Ihrem Ehegatten und Ihren Kindern, zu besprechen. Allen Beteiligten sollten Sie offen Ihre Vorstellungen darlegen. Das Gespräch kann Ihnen dann als Orientierung für die richtige Strategie dienen.
3 Möglichkeiten und Instrumente der Vermögensnachfolge
Sie können Vermögen in verschiedenen Formen übertragen. Dabei ist grundsätzlich von Bedeutung, ob Sie sich bereits zu Lebzeiten von Vermögenswerten trennen wollen oder ob die Vermögensnachfolge erst nach Ihrem Tod im Wege der Erbfolge geplant ist. Eine Zwischenform stellt die Vermögensübertragung unter Lebenden auf den Todesfall dar.
3.1 Vermögensübertragung zu Lebzeiten
Zuwendungen zu Lebzeiten können rechtlich unterschiedlich ausgestaltet sein. In Betracht kommen insbesondere die Schenkung, die gemischte Schenkung und die Schenkung unter Auflagen. Neben Schenkungen kommen als Zuwendungsformen zu Lebzeiten die Ausstattung und die ehebedingte Zuwendung in Betracht.
3.1.1 Schenkung
Die Schenkung ist eine unentgeltliche Zuwendung des Schenkers an den Beschenkten. Diese Form der Zuwendung hat als Instrument der vorweggenommenen Erbfolge große Bedeutung.
Arten
Bei der Schenkung ist zwischen der sogenannten Handschenkung und der Vertragsschenkung zu unterscheiden.
Bei der Handschenkung wird die Zuwendung sofort vollzogen, das heißt, das Eigentum am geschenkten Gegenstand wird sofort übertragen. Typische Beispiele sind Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke. Die Handschenkung bedarf keiner besonderen Form.
Von der Handschenkung zu unterscheiden ist die Vertragsschenkung. In diesem Fall verpflichtet sich der Schenkende durch Vertrag, dem Beschenkten eine unentgeltliche Zuwendung zu machen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn sich der Schenker verpflichtet, dem Vertragspartner seine Briefmarkensammlung zu schenken. Ein Schenkungsversprechen in dieser Form bedarf der notariellen Beurkundung. Wenn die Zuwendung allerdings vollzogen, der Schenkungsgegenstand dem Beschenkten also übereignet wurde, ist die Schenkung auch ohne notarielle Beurkundung wirksam. Bei Grundstücksschenkungen ist neben der notariellen Beurkundung zusätzlich die Eintragung im Grundbuch erforderlich.
Achtung: Die Schenkung ist für Sie als Schenker ein recht riskantes Rechtsgeschäft; schließlich verlieren Sie Ihr Vermögen. Sie sollten deshalb gründlich überlegen, ob die Übertragung von Vermögenswerten zu Lebzeiten richtig und vernünftig ist. Denn eine Rückforderung ist nur in Ausnahmefällen möglich (vgl. unten). Bei größeren Vermögensteilen empfiehlt sich in jedem Fall dringend eine Beratung durch einen Notar, einen Anwalt und/oder einen Steuerberater.
Erbrechtliche Beschränkungen
Wenn Sie sich durch einen Erbvertrag oder durch ein gemeinschaftliches Testament zu Lebzeiten in Ihrer Verfügungsfreiheit über Ihr Vermögen zum Zeitpunkt des Todes gebunden haben, können Sie zwar weiterhin über Ihr Vermögen verfügen, verschenken können Sie Ihr Vermögen aber nur mit Einschränkungen. Durch die gesetzlichen Regelungen über böswillige Schenkungen sollen die Erben geschützt werden. Damit Sie als Erblasser nichts verschenken, um die festgelegten Erben zu schädigen, können diese im Erbfall von dem Beschenkten die Herausgabe des Geschenks verlangen. In solchen Fällen können Sie nur Schenkungen aus »eigennützigen Zwecken« vornehmen, wenn Sie sich also dadurch vom Beschenkten einen Vorteil verschaffen. Ein solches Eigeninteresse kann beispielsweise vorliegen, wenn Sie Ihrer jüngeren Frau eine Zuwendung zukommen lassen, um so Ihre eigene Pflege und Betreuung im Alter sicherzustellen.
!
Tipp: Im Schenkungsvertrag sollten Sie Ihr Eigeninteresse an der Schenkung ausdrücklich festhalten, damit die durch Erbvertrag oder gemeinschaftliches Testament eingesetzten Erben die Schenkung nicht zurückfordern können. Die Beweislast für die Benachteiligungsabsicht liegt bei Ihren Erben.
Mängel des Schenkungsgegenstands
Beachten Sie, dass Sie als Schenker unter Umständen auch für Mängel des geschenkten Gegenstands haften und vom Beschenkten haftbar gemacht werden können. Allerdings haften Sie gesetzlich grundsätzlich nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Grob fahrlässig würden Sie handeln, wenn Sie nicht beachten, was im konkreten Fall jedermann einleuchten müsste. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn der Schenker den Beschenkten nicht ausreichend darauf aufmerksam macht, dass das geschenkte Spielzeug nicht schadstofffrei ist und bei bestimmtem Gebrauch Gesundheitsschäden verursachen kann. Weist die verschenkte Sache Mängel auf, so sind Sie gegenüber dem Beschenkten nur dann schadenersatzpflichtig, wenn sie den Mangel gekannt und arglistig verschwiegen haben (»Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul«).
Rückforderung und Widerruf der Schenkung
Soweit Sie als Schenker nach Vollziehung der Schenkung außerstande sind, Ihren angemessenen Unterhalt zu bestreiten oder die Ihren Verwandten, Ihrem Ehegatten, Ihrem Lebenspartner oder Ihrem früheren Ehegatten oder Lebenspartner gegenüber gesetzlich obliegender Unterhaltspflicht zu erfüllen, können Sie die Schenkung zurückfordern. Der Beschenkte kann die Herausgabe allerdings durch die Zahlung des für den Unterhalt erforderlichen Betrags abwenden (§ 528 BGB). Die Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn Sie Ihre Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt haben oder wenn zum Zeitpunkt des Eintritts Ihrer Bedürftigkeit seit der Leistung des geschenkten Gegenstands zehn Jahre verstrichen sind (§ 529 BGB).
Als Schenker können Sie sich durch Widerruf von der Schenkung lösen, wenn sich der Beschenkte durch eine schwere Verfehlung gegen Sie oder einen Ihrer nahen Angehörigen »groben Undanks« schuldig gemacht hat. Im Falle des Widerrufs können Sie die Herausgabe der Schenkung verlangen (§ 530 BGB). Ausgeschlossen ist der Widerruf, wenn Sie dem Beschenkten verziehen haben oder wenn seit dem Zeitpunkt, in welchem Sie von Ihrem Widerrufsrecht Kenntnis erlangt haben, ein Jahr verstrichen ist (§ 532 BGB).
Der Widerruf einer Schenkung setzt objektiv eine Verfehlung des Beschenkten von gewisser Schwere voraus. Darüber hinaus muss die Verfehlung ebenfalls in subjektiver Hinsicht Ausdruck einer Gesinnung des Beschenkten sein, die in erheblichem Maße die Dankbarkeit vermissen lässt, die der Schenker erwarten kann. Grober Undank liegt beispielsweise vor, wenn der beschenkte Sohn die Vorsorgevollmacht seiner Mutter dazu nutzt, um sie dauerhaft – ohne ihren anderslautenden Willen angemessen zu berücksichtigen – in einem Pflegeheim unterzubringen (BGH, Az. X ZR 94/12).
!
Tipp: Mit einer Schenkung verlieren Sie das Eigentum an der Sache. Eine Rückforderung oder ein Widerruf kommt nur in wenigen Ausnahmefällen in Betracht. Deshalb kann es sinnvoll sein, dass Sie sich im Schenkungsvertrag Rückforderungsrechte vorbehalten. Als Rückforderungsgrund kommt beispielsweise in Betracht, dass der Beschenkte Gegenleistungen wie die Gewährung eines Wohnrechts nicht erfüllt oder vereinbarte Pflege- und Betreuungsleistungen nicht erbringt.
Rückforderung der Schenkung durch das Sozialamt
Leistungen der Sozialhilfe und der Grundsicherung erhält nur derjenige, der sich nicht selbst helfen kann. Bevor Leistungen gewährt werden, muss der Betroffene versuchen, alle sonstigen Ansprüche, die ihm gegebenenfalls zustehen, zu realisieren. In diesem Zusammenhang müssen auch Ansprüche gegenüber anderen Personen geltend gemacht werden. Diesem Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe und der Grundsicherung entspricht die Möglichkeit des Hilfeträgers, auf bereits vom Hilfeempfänger früher übertragenes Vermögen oder auf seine gesetzlichen Ansprüche gegen Dritte zurückzugreifen. Der Anspruch kann sich insbesondere gegen den Beschenkten und den Schuldner von Versorgungsansprüchen richten.
Der Träger der Sozialhilfe bzw. der Leistungen der Grundsicherung kann Ansprüche des Hilfeempfängers gegen Dritte auf sich überleiten. Als Ansprüche kommen solche aus Gesetz oder Vertrag in Betracht.
Große praktische Bedeutung hat heute der Rückforderungsanspruch zur Deckung des Notbedarfs des verarmten Schenkers (vgl. oben). Damit soll der Schenker wieder in die Lage versetzt werden, seinen Unterhalt selbst zu bestreiten. Soweit der Hilfeträger diesen Notbedarf deckt, kann er den Anspruch auf Rückforderung der Schenkung auf sich überleiten. Damit wird der Hilfeträger Inhaber des Anspruchs. Der Anspruch auf Rückforderung der Schenkung richtet sich gegen den Beschenkten, nach seinem Tod gegen die Erben. Wenn im Rahmen einer Grundstücksschenkung Geschwister Abfindungs- und Ausgleichszahlungen vom Schenker erhalten haben, haften sie neben dem Beschenkten. Übergeleitet werden können nicht nur Rückforderungsansprüche aus einer reinen Schenkung, sondern auch solche aus gemischten Schenkungen und Schenkungen unter Auflagen.
Der Anspruch ist der Höhe nach beschränkt auf das, was der Schenker zur Deckung seines Notbedarfs benötigt. Ist wie bei einem Grundstück der Schenkungsgegenstand nicht teilbar, so kann der Hilfeträger vom Beschenkten Zahlung von Wertersatz verlangen.
!
Tipp: Der Anspruch auf Rückforderung ist ausgeschlossen, wenn zur Zeit des Eintritts der Bedürftigkeit seit der Leistung des geschenkten Gegenstands zehn Jahre vergangen sind.
Schenkungsteuer
Schenkungen unterliegen der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Steuerpflichtig ist der Beschenkte. Die Höhe der Steuer hängt vom Verwandtschaftsgrad zum Schenker und von der Höhe der Zuwendung ab. Ihren nahen Angehörigen, insbesondere Ihrem Ehegatten und Ihren Kindern, stehen Steuerfreibeträge zu, innerhalb deren Grenzen keine Steuer anfällt. Schenkungsteuerfreibeträge können alle zehn Jahre voll ausgeschöpft werden. Wenn Sie also ein großes Vermögen möglichst steuergünstig weitergeben möchten, sollten Sie sich frühzeitig an die Planung machen.
In der Praxis wird eine steuergünstige Übertragung von Vermögenswerten häufig über Kettenschenkungen versucht. Aufgrund der unterschiedlichen Höhe der Freibeträge und der unterschiedlichen Steuerklassen kann es sinnvoll sein, eine Schenkung mehrfach steuerlich auszunutzen. Eine Kettenschenkung kann vorliegen, wenn die unmittelbare Schenkung vom Schenker an den Beschenkten steuerlich ungünstiger ist als die Einschaltung einer Zwischenperson.
»
Beispiel: Sie wollen Ihrer Enkelin 400.000,– € schenken; bei einem Freibetrag von 200.000,– € und einem Steuersatz von 11 % wäre eine Schenkungsteuer von 22.000,– € fällig. Stattdessen schenken Sie Ihrer Enkelin nur 200.000,– €. Die übrigen 200.000,– € schenken Sie Ihrem Sohn zur Weitergabe an dessen Tochter (Ihrer Enkelin). In diesem Fall ist keine Schenkungsteuer fällig, weil die Schenkungen innerhalb der jeweiligen Freibeträge liegen. Hier könnte aber eine verbotene Kettenschenkung und damit ein steuerlicher Gestaltungsmissbrauch vorliegen.
Die übliche – weil einfachere – Gestaltung wäre die gewesen, dass Sie Ihrer Enkelin die 400.000,– € direkt und ohne Umwege geschenkt hätten.
!
Tipp: Sie sollten in jedem Fall vermeiden, dass mit einer Schenkung ausdrücklich eine Verpflichtung zur Weitergabe verbunden wird. Ferner sollte eine »Anstandsfrist« vor Weitergabe der Schenkung von mindestens einem Jahr abgewartet werden.
3.1.2 Gemischte Schenkung
Eine gemischte Schenkung liegt vor, wenn im Rahmen eines einheitlichen Rechtsgeschäfts (z.B. eines Kaufvertrags) der Wert der Leistung des Zuwendenden der Gegenleistung des Empfängers nur zum Teil entspricht, die Vertragspartner dies wissen und sich einig sind, dass der übersteigende Wert unentgeltlich gegeben wird.
»
Beispiel: Sie übertragen Ihr Hausgrundstück an Ihr Kind gegen Zahlung von 100.000,– €, während der Verkehrswert der Immobilie 300.000,– € beträgt.
Bei einer gemischten Schenkung gibt es immer einen entgeltlichen (Gegenleistung des Beschenkten) und einen unentgeltlichen Teil (Schenkung). Deshalb kann der Schenker den Schenkungsgegenstand wegen Verarmung oder bei grobem Undank des Beschenkten nur zurückfordern, wenn der unentgeltliche Teil des Vertrags überwiegt, das heißt, dass die Zuwendung des Schenkers den doppelten Wert im Vergleich zur Gegenleistung aufweist (wie im obigen Beispiel: Der entgeltliche Teil des Vertrags umfasst 100.000,– €, der unentgeltliche Teil 200.000,– €). Ist dies nicht der Fall, kann nur ein Wertersatz in Höhe der Differenz zwischen dem Geschenk und der Gegenleistung verlangt werden.
3.1.3 Schenkung unter Auflage
Die Schenkung unter Auflage ist eine besondere Form der Schenkung, die dem Schenker ermöglicht, bestimmte Bedingungen festzulegen, deren Erfüllung für die Wirksamkeit der Schenkung von Bedeutung sind. Unter einer Auflage ist die einer Schenkung hinzugefügte Bestimmung zu verstehen, nach der der Beschenkte entweder zu einer Leistung oder einer Unterlassung verpflichtet ist, die auf der Grundlage und aus dem Wert der Schenkung erfolgen soll.
Eine Leistungsauflage liegt beispielsweise vor, wenn der Beschenkte die Pflege des Schenkers übernimmt. Um eine Unterlassungsauflage handelt es sich, wenn der Beschenkte das Geschenk für einen bestimmten Zeitraum nicht veräußern darf.
!
Tipp: Für den Schenker hat die Schenkung unter Auflage den Vorteil, dass er sicherstellen kann, dass der Schenkungsgegenstand vom Beschenkten in der vorgegebenen Art und Weise genutzt wird. Im Gegenzug ist der Beschenkte in der Nutzung des Geschenks eingeschränkt. Und wenn die Erfüllung der Auflage für den Beschenkten mit Kosten verbunden ist, kann der Beschenkte auch wirtschaftlich belastet werden.
Keine Schenkung unter Auflage liegt vor, wenn die Schenkung lediglich mit einer Empfehlung oder einem Rat verbunden ist, beispielsweise wenn eine Geldzuwendung für einen Erholungsaufenthalt erfolgt.
Grundsätzlich ist für die Schenkung unter Auflage keine besondere Form vorgeschrieben. Sofern sich die Schenkung allerdings auf eine Immobilie bezieht, bedarf sie zu ihrer Wirksamkeit der notariellen Beurkundung.
Die mit der Schenkung verbundene Auflage muss hinreichend bestimmt und unmissverständlich formuliert werden. Unmögliche oder unzumutbare Auflagen sind unwirksam. Der Beschenkte darf die Auflage nur dann verweigern, wenn der Wert der Auflage durch die Schenkung nicht gedeckt und nicht anderweitig ersetzt wird. Der Beschenkte darf also nicht mehr leisten müssen, als er vom Schenker erhält.
!
Tipp: Wird vom Beschenkten die Auflage nicht erfüllt, kann der Schenker sie gegebenenfalls auf gerichtlichem Weg durchsetzen. Er kann ebenfalls die Herausgabe des Geschenks verlangen. Der Herausgabeanspruch beschränkt sich allerdings auf den Teil des Geschenks, der vom Beschenkten zum Vollzug der Auflage zu verwenden war.
3.1.4 Erbrechtliche Konsequenzen bei lebzeitigen Vermögensübertragungen
Die Übertragung von Vermögenswerten zu Lebzeiten kann unter erbrechtlichen Gesichtspunkten insbesondere eine Ausgleichung, die Anrechnung auf den Pflichtteil und den Anspruch auf Ergänzung des Pflichtteils zur Folge haben.
Ausgleichung
Ausgleichung heißt, dass der Nachlass unter den gemeinsam erbenden Nachkommen aufzuteilen ist, wobei Zuwendungen zu Lebzeiten wertmäßig zu berücksichtigen sind. Vor dem Tod des Erblassers erfolgte Zuwendungen müssen also nach dem Erbfall ausgeglichen werden. Den Vorschriften zur Ausgleichung liegt der Gedanke zugrunde, dass Abkömmlinge dem Erblasser in aller Regel gleich nahestehen und der Erblasser sie bei der Verteilung des Vermögens gleich behandeln will. Hat ein Abkömmling zu Lebzeiten Zuwendungen erhalten, führt die Ausgleichung dazu, dass er so behandelt wird, als hätte er die Zuwendung erst bei der Auseinandersetzung des Nachlasses erhalten.
Achtung: Die Ausgleichung wirkt sich nur bei Eintritt der gesetzlichen Erbfolge aus. Ist die Erbeinsetzung durch eine Verfügung von Todes wegen erfolgt, besteht eine Ausgleichungspflicht nur dann, wenn Sie Ihren Abkömmling genau mit dem bedacht haben, was dessen gesetzlicher Erbteil wäre. Nur Zuwendungen zu Lebzeiten sind ausgleichungspflichtig, nicht solche von Todes wegen. Ausgleichungspflichtig sind nur Ihre Nachkommen (Kinder, Enkel), nicht der länger lebende Ehegatte.
Sie können die Ausgleichung bei Vornahme der lebzeitigen Zuwendung ausschließen und anordnen, dass die Zuwendung im Erbfall im Verhältnis zu weiteren Kindern nicht ausgeglichen werden muss.
Meiner Tochter _____ [Vor- und Familienname der Tochter einsetzen] habe ich im Rahmen der Finanzierung ihres Studiums und _____ Euro zugewendet. Die Zuwendung ist nicht ausgleichungspflichtig.
!
Tipp: Haben Sie es bei einer Zuwendung zu Lebzeiten versäumt, eine Ausgleichspflicht anzuordnen, können Sie das nachholen, indem Sie Ihren zu Lebzeiten beschenkten Nachkommen im Testament mit einem Vermächtnis zugunsten des anderen Erben in Höhe des Ausgleichsanspruchs beschweren.
Der Ausgleichungspflicht unterliegen nur folgende Zuwendungen:
Ausstattungen, sofern Sie bei der Zuwendung nichts anderes bestimmt haben. Eine Ausstattung ist der Vermögensvorteil, der einem Kind mit Rücksicht auf seine Heirat oder auf die Erlangung oder Erhaltung einer selbstständigen Lebensführung von den Eltern zugewendet wird. Auszugleichen sind unter anderem die Gewährung einer freien Wohnung oder die Deckung von Verbindlichkeiten eines Abkömmlings durch den Erblasser.
Zuschüsse zu den Einkünften, sofern Sie bei der Zuwendung nichts anderes bestimmt haben. Die Zuwendungen sind aber nur dann ausgleichungspflichtig, soweit sie das Ihren Vermögensverhältnissen entsprechende Maß überstiegen haben (§ 2050 Abs. 2 BGB).
Ausbildungsaufwendungen, soweit sie die Aufwendungen für die allgemeine Schulausbildung übersteigen und sofern Sie bei der Zuwendung nichts anderes bestimmt haben.
Sonstige Zuwendungen, wenn Sie die Ausgleichung angeordnet haben (§ 2050 Abs. 3 BGB).
Um Unklarheiten zu vermeiden, sollte die Ausgleichspflicht im Rahmen einer Ausstattung eindeutig geregelt werden. Es kann auch eine Ausgleichungspflicht zu einem niedrigeren Wert angeordnet werden.
Das Gesetz (§ 2057a BGB) ordnet eine Ausgleichungspflicht für besondere Leistungen eines Abkömmlings an. Ein Abkömmling, der durch Mitarbeit im Haushalt, Beruf oder Geschäft des Erblassers während längerer Zeit, durch erhebliche Geldleistungen oder in anderer Weise in besonderem Maße dazu beigetragen hat, dass das Vermögen des Erblassers erhalten oder vermehrt wurde, kann bei der Auseinandersetzung einen finanziellen Ausgleich unter den Abkömmlingen verlangen, die mit ihm als gesetzliche Erben zur Erbfolge gelangen. Dies gilt auch für einen Abkömmling, der den Erblasser während längerer Zeit gepflegt hat. Eine Ausgleichspflicht besteht aber insbesondere dann nicht, wenn für die Leistungen ein angemessenes Entgelt gezahlt wurde.
Bei der Durchführung der Ausgleichung wird jedem Miterben der Wert der Zuwendung, die er ausgleichen soll, auf seinen Erbteil angerechnet. Es wird der Wert sämtlicher Zuwendungen, die auszugleichen sind, dem Nachlass hinzugerechnet. Dabei richtet sich der Wert nach dem Zeitpunkt, zu dem die Zuwendungen gemacht wurden.
Anrechnung der Zuwendung auf den Pflichtteil
Der Pflichtteilsberechtigte hat sich auf den Pflichtteil anrechnen zu lassen, was ihm der Erblasser durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden mit der Bestimmung zugewendet hat, dass es auf den Pflichtteil angerechnet werden soll (§ 2315 Abs. 1 BGB). Gemeint sind alle freiwilligen Zuwendungen wie beispielsweise vollzogene Schenkungen, Schenkungsversprechen und Ausstattungen. Die Zuwendung ist nur dann auf den Pflichtteil anzurechnen, wenn der Erblasser dies vor oder bei der Gewährung angeordnet hat. Die Anordnung kann auch stillschweigend erfolgen. Die Anrechnungsbestimmung kann nachträglich widerrufen werden.
!
Tipp: Bei einer freiwilligen Zuwendung sollten Sie eine eindeutige Regelung über die Pflichtteilsanrechnung treffen, um mögliche Zweifel von vornherein zu vermeiden.
Der Wert der Zuwendung wird bei der Bestimmung des Pflichtteils dem Nachlass hinzugerechnet. Maßgebend für den Wert der Zuwendung ist der Zeitpunkt, zu dem sie erfolgt ist (§ 2315 Abs. 2 BGB). Sie können auch einen niedrigeren Wert bestimmen.
Anspruch auf Ergänzung des Pflichtteils
Sie können den Pflichtteilsanspruch Ihrer nächsten Angehörigen unter anderem dadurch verkürzen, dass Sie zu Lebzeiten Schenkungen an andere Personen vornehmen. Dadurch vermindern sich die Höhe des Nachlasses und mithin der Pflichtteil. Um das zu verhindern, hat der Gesetzgeber Vorkehrungen getroffen: Pflichtteilsberechtigte können vom Erben als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, den der Erblasser einem Dritten als Schenkung zugewendet hat (§ 2325 BGB).
Der Pflichtteilsergänzungsanspruch besteht grundsätzlich bei allen Schenkungen, die zehn Jahre vor dem Erbfall vorgenommen wurden. Unter anderem bestehen aber folgende Ausnahmen:
Kleinere Zuwendungen aus besonderem Anlass, wie beispielsweise Geburtstags-, Weihnachtsgeschenke, zur Taufe oder einem Jubiläum gelten als Anstandsschenkungen und bleiben bei Pflichtteilsergänzungsansprüchen außer Betracht.
Entsprechendes gilt für Pflichtschenkungen. Hier kommen auch größere Zuwendungen in Betracht. Beispiel: Schenkung als Dank für unentgeltliche Pflege.
Bei einer sogenannten gemischten Schenkung ist nur der unentgeltliche Teil als Schenkung anzusehen und nur hieran besteht ein Pflichtteilsergänzungsanspruch.
Der Pflichtteilsergänzungsanspruch ist der Betrag, um den sich der Pflichtteil erhöht, wenn der Wert des Geschenks dem realen Nachlass fiktiv hinzugerechnet wird.
3.2 Vermögensübertragung im Wege der Erbfolge
Die Vermögensübertragung im Wege der Erbfolge erfolgt als sogenannte Gesamtrechtsnachfolge, wenn der Inhaber verstirbt. »Mit dem Tod einer Person (Erbfall) geht deren Vermögen (Erbschaft) als Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) über«, heißt es in § 1922 BGB. Die Erben sind Rechtsnachfolger des Erblassers, weil auf sie bestehende Rechte und Pflichten des Erblassers übergehen. Allerdings treten sie nicht nur in einzelne Rechtspositionen des Erblassers ein, sondern übernehmen (bis auf wenige Ausnahmen) alle Rechte und Pflichten des Erblassers. Sie treten also insgesamt in seine rechtlichen Fußstapfen.
Die Übertragung des Vermögens findet kraft Gesetzes statt. Es bedarf also keiner rechtsgeschäftlichen Vermögensübertragung auf den oder die Erben. Alle vererblichen Rechte und Pflichten gehen unmittelbar mit dem Erbfall auf die Erben über.
An wen das Vermögen übergeht, bestimmt in erster Linie der Erblasser. Andernfalls legt das Gesetz die Erbfolge fest.
3.2.1 Vermögensnachfolge durch Verfügung von Todes wegen
Um die Nachlassplanung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, gibt es verschiedene Instrumente der Vermögensübertragung, die sogenannten Verfügungen von Todes wegen. In Betracht kommen das Testament, mit der Besonderheit des gemeinschaftlichen Testaments, und der Erbvertrag. Andere Möglichkeiten, die Vermögensnachfolge nach dem Tod erbrechtlich zu regeln, bestehen nicht.
Testament
Das Testament ist eine einseitige Verfügung von Todes wegen. Es können darin Anordnungen und Bestimmungen getroffen werden, die nicht des Einvernehmens von anderen Beteiligten bedürfen. Deshalb können das Testament oder einzelne Verfügungen jederzeit widerrufen werden. Gründe dafür müssen nicht angegeben werden .
Erbvertrag
Die Erbfolge kann ebenfalls durch einen Erbvertrag geregelt werden. Dabei trifft entweder eine beide Vertragsparteien eine Verfügung von Todes wegen die vertraglich bindend ist. Während das Testament generell jederzeit widerrufen werden kann, sind die vertragsmäßigen Verfügungen eines Erbvertrags grundsätzlich unwiderruflich.
Gemeinschaftliches Testament der Eheleute
Das gemeinschaftliche Testament ist eine Zwischenform zwischen einem Testament und einem Erbvertrag. Es kann nur von Eheleuten aufgesetzt werden. In einem gemeinschaftlichen Testament können Anordnungen sowohl für den Tod des einen wie für den Tod des anderen getroffen werden. Die sogenannten wechselbezüglichen Anordnungen stehen gewissermaßen in einem Gegenseitigkeitsverhältnis zueinander, sodass im Gegensatz zum Testament besondere Bestimmungen für den Widerruf solcher Verfügungen zu berücksichtigen sind. Ähnliche Bindungen wie das gemeinschaftliche Testament begründet der Erbvertrag, allerdings besteht beim gemeinschaftlichen Testament die grundsätzliche Möglichkeit, sich einseitig von der gemeinsamen Verfügung zu lösen.
Eine besondere Form des gemeinschaftlichen Testament ist das sogenannte Berliner Testament. Darin setzen sich beide Ehegatten wechselseitig zu Alleinerben ein und verfügen, dass nach dem Tod des Längerlebenden der beiderseitige Nachlass an einen Dritten fallen soll, in der Regel an die Kinder. Testamentarisch werden mithin zwei Erbgänge geregelt: Die Erbfolge nach dem Tod des erstversterbenden Ehegatten an den länger lebenden und die nach dem Tod des Längerlebenden an die Kinder.
3.2.2 Vermögensnachfolge durch gesetzliche Erbfolge
Gesetzliche Erbfolge bedeutet, dass beim Tod einer Person unmittelbar das Gesetz deren Erben bestimmt. Sie kann aus mehreren Gründen eintreten, beispielsweise wenn
der Erblasser keine Verfügung von Todes wegen (Testament oder Erbvertrag) errichtet hat,
eine erfolgte Erbeinsetzung unwirksam ist (z.B. weil das errichtete Testament wegen Formmangels nichtig ist),
die vom Erblasser errichtete Verfügung von Todes wegen nur einen Teil seines Nachlasses erfasst,
der durch Verfügung von Todes wegen eingesetzte Erbe die Erbschaft ausschlägt oder
die Erbeinsetzung erfolgreich angefochten wurde.
Wenn der Erblasser kein Testament errichtet oder einen Erbvertrag abgeschlossen hat, geht das Gesetz davon aus, dass er sein Vermögen an seine nächsten Verwandten und gegebenenfalls an seinen Ehegatten übertragen will.
3.3 Vermögensübertragung unter Lebenden auf den Todesfall
Neben der Übertragung von Vermögen zu Lebzeiten des Inhabers des Vermögens (insbesondere durch vollzogene Schenkungen) und im Wege der Erbfolge besteht ebenfalls die Möglichkeit, Vermögen durch Rechtsgeschäfte unter Lebenden zu übertragen, die zwar unter Lebenden abgeschlossen werden, aber erst mit dem Tod des Veräußerers wirksam werden. In Betracht kommen Verträge zugunsten Dritter auf den Tod und Schenkungen auf den Todesfall.
Die Vermögensübertragung unter Lebenden auf den Todesfall ist von den anderen Rechtsgeschäften zur Vermögensnachfolge zu unterscheiden:
Von Vermögensübertragungen zu Lebzeiten unterscheiden sich Rechtsgeschäfte auf den Todesfall dadurch, dass Sie zu Lebzeiten nach wie vor über Ihr Vermögen verfügen können, während Sie bei lebzeitigen Vermögensübertragungen (z.B. bei Schenkungen) Ihr Vermögen verlieren.
Die Übertragung von Vermögen durch Rechtsgeschäfte auf den Todesfall haben mit Zuwendungen durch Verfügung von Todes wegen gemeinsam, dass Sie zu Lebzeiten noch die volle Verfügungsfreiheit über Ihr Vermögen behalten und die Zuwendungen erst mit Ihrem Tod wirksam werden. Im Gegensatz zur erbrechtlichen Vermögensübertragung fallen jedoch die im Wege der Rechtsgeschäfte auf den Todesfall übertragenen Vermögenswerte zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht in den Nachlass. Das entsprechende Vermögen geht also nicht im Wege der Erbfolge auf die Erben über. So werden beispielsweise Pflichtteilsansprüche gemindert, weil diese auf der Grundlage des Werts des Nachlasses zum Zeitpunkt des Erbfalls berechnet werden.
!
Tipp: Durch Rechtsgeschäfte auf den Todesfall können Sie zu Lebzeiten über Ihr Vermögen verfügen, gleichzeitig haben Sie aber die Möglichkeit, Personen Vermögenswerte zukommen zu lassen, die nicht Ihre Erben sind bzw. sein sollen. Selbst wenn diese Verfügungen im Widerspruch zu einem von Ihnen errichteten Testament oder einem abgeschlossenen Erbvertrag stehen, sind sie dennoch wirksam.
3.3.1 Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall
Mit einem Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall haben Sie die Möglichkeit, Personen für den Fall Ihres Todes Vermögen zuzuwenden, ohne dass dieses Vermögen in den Nachlass fällt. Dabei vereinbaren Sie mit Ihrem Schuldner, dass dieser die Leistung an eine von Ihnen benannte dritte Person zu erbringen hat. Der Dritte erwirbt die Zuwendung aber erst zum Zeitpunkt Ihres Todes. Ihre Forderung selbst gehört in diesem Fall nicht zum Nachlass und geht deshalb nicht auf die Erben über. Für Verträge zugunsten Dritter auf den Todesfall kommen insbesondere Bank- und Sparverträge, Lebensversicherungs-, Bauspar- und Depotverträge in Betracht.
»
Beispiel: Sie schließen eine Lebensversicherung ab und benennen als Bezugsberechtigten für die Versicherungsleistung Ihren nichtehelichen Lebenspartner oder Sie weisen Ihre Bank an, nach Ihrem Tod ein Sparguthaben an Ihren Neffen auszuzahlen.
Für Rechtsgeschäfte dieser Art finden nicht die gesetzlichen Regelungen über Verfügungen von Todes wegen Anwendung. Entsprechende Verfügungen können Sie auf vorgedruckten Formularen treffen oder einfach durch einen entsprechenden Brief (z.B. an die Versicherungsgesellschaft; vgl. unten).
Achtung: Im Regelfall liegt einem Vertrag zugunsten Dritter ein Schenkungsversprechen zugrunde. Dieses bedarf zu seiner Wirksamkeit der notariellen Beurkundung (§ 518 Abs. 1 BGB), andernfalls ist es unwirksam. Der Mangel der Form kann allerdings durch die Bewirkung der versprochenen Leistung geheilt werden (z.B. durch Auszahlung des Sparguthabens nach Ihrem Tod). Beachten Sie die gesetzlichen Formvorschriften nicht und erfahren Ihre Erben vor dem Vollzug der Begünstigung (z.B. vor der Auszahlung der Versicherungssumme an den Bezugsberechtigten) von der Zuwendung, können sie diese jederzeit widerrufen und die Bank oder Versicherung anweisen, das Guthaben oder die Versicherungssumme an die Erben auszuzahlen.
Zuwendung einer Lebensversicherung
Zu den Vermögenswerten gehört häufig eine Lebensversicherung, die über eine Bezugsberechtigung an den länger lebenden Ehegatten oder andere Familienangehörige weitergegeben wird, um diesen einen angemessenen Lebensstandard zu gewährleisten. In diesem Fall liegt ein Vertrag zugunsten Dritter vor; die Leistung geht nicht – wie im Normalfall – an den Vertragspartner, sondern an einen Dritten, den Begünstigten. Der als bezugsberechtigt eingesetzte Begünstigte erwirbt den Anspruch gegen die Versicherung mit dem Tod der versicherten Person; deshalb liegt ein Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall vor. Die Versicherungssumme fällt nicht in den Nachlass; das ist auch dann der Fall, wenn die Bezugsberechtigung nicht unwiderruflich ausgestaltet ist. Weil die Versicherungssumme nicht in den Nachlass fällt, wird sie nicht von Pflichtteilsansprüchen erfasst. Nur wenn Sie als Versicherungsnehmer keinen Bezugsberechtigten benennen, der Bezugsberechtigte den Erwerb ablehnt oder vor oder gleichzeitig mit dem Versicherungsnehmer verstorben ist, fällt die Versicherungssumme in den Nachlass.
Als Bezugsberechtigte können Sie Ihre Erben oder andere Personen benennen. Als Versicherungsnehmer können Sie die Bezugsberechtigung jederzeit ändern, es sei denn, dass die Auswechslung des Bezugsberechtigten ausdrücklich ausgeschlossen ist. Sie können also im Falle Ihrer Scheidung Ihren Kindern oder Ihrem neuen Ehegatten die Begünstigung einräumen. Regelmäßig bedarf die Änderung der Bezugsberechtigung nach den allgemeinen Versicherungsbedingungen der schriftlichen Anzeige. Prüfen Sie deshalb in Ihrer Versicherungspolice die entsprechenden Regelungen. Nach dem Erbfall können Ihre Erben die Bezugsberechtigung nicht mehr ändern.
Sehr geehrte Damen und Herren,
am _____ [Datum einsetzen] habe ich bei Ihnen einen Lebensversicherungsvertrag Nr. _____ [Vertragsnummer einsetzen] abgeschlossen. Als Bezugsberechtigten benenne ich _____ [Vor- und Familienname und Wohnsitz des Bezugsberechtigten einsetzen]. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Schreibens.
[Oder]
in dem am _____ [Datum einsetzen] abgeschlossenen Lebensversicherungsvertrag _____ [Vertragsnummer einsetzen] habe ich als Bezugsberechtigten _____ [Vor- und Familienname einsetzen] benannt. Diese Bezugsberichtigung möchte ich hiermit ändern. Bezugsberechtigte Person soll _____ [Vor- und Familienname und Wohnsitz des Bezugsberechtigten einsetzen] sein. Bitte bestätigen Sie mir die Änderung der Bezugsberechtigung.
Mit freundlichen Grüßen
[Unterschrift]
Eine Änderung der Bezugsberechtigung können Sie auch in Ihrem Testament vornehmen. In diesem Fall wird die Änderung aber nur dann wirksam, wenn die Versicherungsgesellschaft vor Auszahlung der Lebensversicherung an den Ihr bekannten Bezugsberechtigten von dieser Änderung erfährt.
Achtung: Problematisch ist der Fall, wenn Sie Ihren Ehegatten als Bezugsberechtigten bezeichnet haben und die Ehe geschieden wird. Beachten Sie, dass in diesem Fall Ihr geschiedener Partner nicht automatisch die Rechte an der Lebensversicherung verliert. Die Bezugsberechtigung müssen Sie vielmehr ausdrücklich gegenüber der Versicherungsgesellschaft widerrufen.
Beachten Sie, dass es zwischen Ihnen und der als bezugsberechtigt benannten Person eines rechtlichen Grundes dafür bedarf, dass der Begünstigte die Versicherungsleistung behalten darf. Andernfalls können nämlich Ihre Erben die Herausgabe der Versicherungssumme verlangen. Als rechtlicher Grund kommt im Regelfall eine Schenkung in Betracht. Für deren Wirksamkeit ist allerdings eine notarielle Beurkundung des Schenkungsversprechens erforderlich. Die Nichtbeachtung dieser Form hat dann keine Bedeutung, wenn die Schenkung vollzogen wurde, das heißt, die Versicherungssumme an den Bezugsberechtigten ausgezahlt wurde und er die Leistung angenommen hat. Die Gefahr für den benannten Bezugsberechtigten besteht in diesem Fall darin, dass die Erben vor Auszahlung der Versicherungssumme von der Lebensversicherung und der Bezugsberechtigung erfahren. Dann können sie nämlich die Schenkung widerrufen und Auszahlung an die Erben verlangen.
!
Tipp: Beachten Sie, dass eine fällige Lebensversicherung, die an den Bezugsberechtigten ausgezahlt wird, der Erbschaft- und Schenkungsteuer unterliegt. Steuerpflichtig ist die ganze Versicherungssumme, nicht nur der Prämienaufwand des Versicherungsnehmers. Keine Erbschaftsteuer fällt an, wenn der Versicherungsnehmer gleichzeitig die bezugsberechtigte Person und der Prämienzahler ist, die versicherte Person jedoch ein Dritter ist. Diese Variante bietet sich insbesondere zur Absicherung des Ehegatten oder des nichtehelichen Lebenspartners an.
Zuwendung eines Bausparvertrags
Wie bei Lebensversicherungen können Sie auch beim Abschluss eines Bausparvertrags Begünstigungen für den Fall Ihres Todes aussprechen. Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall.
Die Zuwendung erstreckt sich auf die Bausparraten, die der Bausparer auf der Grundlage des Bausparvertrags gemacht hat. Ein in Anspruch genommenes Bauspardarlehen fällt allerdings in den Nachlass, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.
!
Tipp: Prüfen Sie in den Bausparbedingungen, ob die Benennung eines Bezugsberechtigten nur zu Lebzeiten möglich ist bzw. widerrufen oder geändert werden darf – oder ob auch eine Verfügung von Todes wegen zulässig ist. Die Bausparbedingungen der verschiedenen Bauspargesellschaften enthalten in diesem Zusammenhang unterschiedliche Regelungen.
Zuwendung von Bankguthaben
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, bei der Einrichtung eines Bankkontos sowohl Ihre Interessen als auch die Interessen von Dritten, die Sie begünstigen wollen, zu berücksichtigen.
Zunächst können Sie ein Bankkonto zusammen mit Ihrem Ehegatten, Ihrem Lebenspartner oder einer dritten Person führen. Dieses gemeinsame Konto kann als Oder-Konto oder als Und-Konto geführt werden.
Ein Oder-Konto liegt vor, wenn jeder der Inhaber allein und unbeschränkt verfügungsberechtigt ist. Im Erbfall bleibt der länger lebende Kontoinhaber allein verfügungsberechtigt. Bei einem Gemeinschaftskonto ist ein solches Konto der Regelfall, wenn Sie mit der Bank nichts anderes vereinbaren.
Bei einem Und-Konto können Abhebungen und Verfügungen nur von beiden Kontoführenden gemeinsam getätigt werden.
!
Tipp: Das Oder-Konto eignet sich grundsätzlich für eine Begünstigung außerhalb des Nachlasses, weil der länger lebende Kontoinhaber im Erbfall weiterhin über das Konto verfügen kann. Dagegen bietet das Und-Konto außerhalb des Nachlasses keine Möglichkeiten, Vermögensübertragungen vorzunehmen. Im Erbfall fällt das Konto in den Nachlass; der länger lebende Kontoinhaber kann dann nur noch mit Zustimmung der Erben über das Konto verfügen.
Zwar kann im Erbfall bei einem Oder-Konto der länger lebende Kontoinhaber weiterhin über das Konto verfügen, gegenüber den Erben besteht für ihn allerdings eine Ausgleichspflicht, es sei denn, dass der länger lebende Kontoinhaber vom verstorbenen Kontoinhaber dahingehend bedacht wird, dass ihm das am Todestag vorhandene Guthaben allein zustehen soll.
Die Einrichtung eines Oder-Kontos hat nicht zwangsläufig schenkungsteuerliche Konsequenzen. Schließlich hat die bloße Einzahlung auf ein Gemeinschaftskonto nicht zwangsläufig eine Bereicherung des anderen Kontoinhabers zur Folge. Nur wenn der andere Kontoinhaber nachweislich den eingezahlten Betrag endgültig behalten und er über den Gesamtbetrag frei verfügen darf, liegt eine Bereicherung vor. Davon ist jedoch im Regelfall nicht auszugehen.
Sie können auch ein Bankkonto auf Ihren Namen mit der Maßgabe einrichten, dass einem zu benennenden Begünstigten zum Zeitpunkt Ihres Todes das Guthaben zur Verfügung stehen soll. Insoweit liegt ein Vertrag zugunsten Dritter auf den Todesfall vor. Die durch Sie begünstigte Person erlangt dann mit dem Tod des Kontoinhabers einen Anspruch gegen die Bank.
Sie können mit Ihrer Bank oder Sparkasse vereinbaren, dass alle Rechte aus einem Bankkonto im Falle Ihres Todes an einen Dritten übergehen sollen. Unproblematisch ist eine entsprechende Vereinbarung jedenfalls dann, wenn Sie alleiniger Kontoinhaber sind.
_____ [Vor- und Familienname des Kontoinhabers einsetzen] und die _____bank [genaue Bezeichnung der Bank] vereinbaren, dass alle Rechte aus dem Konto Nr. _____ [Konto-Nr. einsetzen] von _____ [Vor- und Familienname des Kontoinhabers einsetzen] nach seinem Tod auf _____ [Vor- und Familienname und Wohnsitz des Begünstigten einsetzen] übergehen sollen. Diese Vereinbarung kann von _____ [Vor- und Familienname des Kontoinhabers einsetzen] zu Lebzeiten jederzeit widerrufen werden. Die Bank soll den Begünstigten erst nach dem Tod von _____ [Vor- und Familienname des Kontoinhabers einsetzen] von dieser Vereinbarung unterrichten.
!
Tipp: Ein Vertrag zugunsten Dritter ist auch dann zustande gekommen, wenn Sie Ihre Bank anweisen, Ihr Guthaben nach Ihrem Tod an einen Dritten auszuzahlen.
Möglich ist es ebenfalls, dass Sie ein Konto auf den Namen des Begünstigten einrichten. In diesem Fall liegt ein Vertrag mit der Bank zugunsten Dritter vor. Wenn Sie verhindern wollen, dass der Begünstigte bereits vor Ihrem Ableben über das Konto verfügen kann, sollten Sie einen entsprechenden Sperrvermerk veranlassen.
3.3.2 Schenkung auf den Todesfall