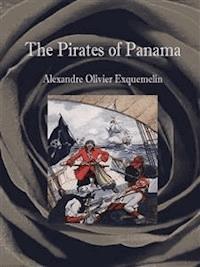2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Alexandre Olivier Exquemelin: Piraten der Karibik - Ein Augenzeugenbericht aus dem 17. Jahrhundert. | Neu editiert, mit einem Vorwort des Herausgebers, Worterklärungen und Fußnoten. | Piraten-Geschichten gibt es viele. Die meisten sind von Landratten, die nie eine Schiffsplanke betreten haben, erfunden. Wäre es nicht faszinierend, einen echten Piraten zu begleiten, auf seinen Kaperzügen in der Karibik? | Im Jahre 1669 beginnt Alexandre Olivier Exquemelin seine Karriere als Pirat. 1666 kommt er als Angestellter der französischen Westindien-Kompagnie nach Tortuga, einer kleinen Karibikinsel vor der Nordküste Haitis. Dort führt er zunächst ein »ordentliches Leben«, soweit dies auf einer berüchtigten Seeräuberinsel möglich ist. 1669 heuert er schließlich auf einem Piratenschiff an und erlebt zahllose Kaperfahrten und Räubereien aus nächster Nähe mit. Dazwischen aber, an ruhigen Tagen, schafft er sein bleibendes Werk: Das vorliegende Buch erschien 1678 in Amsterdam und wurde schnell zum Bestseller, weil es Normalsterblichen zum ersten Mal Einblick in die Welt der Piraten gab. Das Buch zeichnet sich durch klare, schnörkellose Sprache, einen enormen Faktenreichtum und präzise Detailbeschreibung aus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
PIRATEN DER KARIBIK
Vorwort des Herausgebers
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel – Die Abreise des Reisebeschreibers
Zweites Kapitel – Beschreibung der Insel Tortuga
Drittes Kapitel – Beschreibung der Insel Española
Viertes Kapitel – Überfluss
Fünftes Kapitel – Getier und Vogelarten
Sechstes Kapitel – Die Seeräuber
Siebtes Kapitel – Wie die Seeräuber leben
ZWEITER TEIL
Erstes Kapitel – Der Seeräuber François l’Olonnais
Zweites Kapitel – l’Olonnais macht eine Flotte startklar
Drittes Kapitel – Sturm auf die Stadt St. Jago
Viertes Kapitel – Der Engländer John Morgan
Fünftes Kapitel – Morgans Raubzüge
Sechstes Kapitel – Morgan erobert Puerto Belo
Siebtes Kapitel – Maracaibo fällt
DRITTER TEIL
Erstes Kapitel – Morgan rüstet eine neue Flotte aus
Zweites Kapitel – Was in Rio de la Hache geschah
Drittes Kapitel – Santa Catalina ergibt sich
Viertes Kapitel – Das Kastell San Lorenzo de Chagre
Fünftes Kapitel – Neues Ziel: Panama
Sechstes Kapitel – Grausame Raubzüge
Siebtes Kapitel – Der Reisebeschreiber zieht weiter
Achtes Kapitel – Lebensart der Indianer
Neuntes Kapitel – Ein Schiffbruch
PIRATEN DER KARIBIK
EIN AUGENZEUGENBERICHT AUS DEM 17. JAHRHUNDERT
Enthaltend die genaue und wahrhaftige Erzählung aller der vornehmsten Räubereien und unmenschlichen Grausamkeiten, welche die englischen und französischen Räuber wider die Spanier in Amerika verübt haben.
Beschrieben durch A. O. Exquemelin, der selbst allen diesen Räubereien durch Not beigewohnt hat.
Joseph Sabin, amerikanischer Historiker: »Vielleicht war kein Buch, in welcher Sprache auch immer, das Vorbild so vieler Nachahmungen und die Quelle so vieler Erzählungen, wie dieses.«
Vorwort des Herausgebers
Geköpft, gehängt, verehrt: Vom Mythos der Piraten
IM JAHR 2010 werden vor einem Gericht in Norfolk (US-Staat Virginia) fünf somalische Piraten wegen Seeräuberei vor Gericht gestellt. Den Männern drohen lebenslange Haftstrafen. Es ist der erste Piratenprozess auf US-Territorium seit dem amerikanischen Bürgerkrieg (1861–65). Gleichzeitig findet in Hamburg ein Prozess gegen zehn Piraten aus Somalia statt. Hier ist es sogar der erste Piratenprozess seit dem Mittelalter.
Zehn somalische Seeräuber hatten am 5. April, Ostermontag, den deutschen Containerfrachter ›MV Taipan‹ rund 500 Seemeilen vor der Küste ihres Heimatlandes angegriffen und geentert. Wenige Stunden später eilte die niederländische Fregatte ›Tromp‹, die einen Notruf aufgefangen hatte, zu Hilfe. Marinesoldaten befreien nach kurzem Schusswechsel das Schiff und nehmen die zehn Männer gefangen. Als Beweismittel sichern die Holländer fünf Kalaschnikow, zwei Raketenwerfer, große Mengen an Munition und zwei Enterleitern sowie Enterhaken.
Die Piraterie lebt, in der Realität und im Kino, und ist heute, so scheint es, präsent wie schon lange nicht mehr. Der Mythos des Piraten hat interessante und vielschichtige Quellen. Eine davon ist, dass man oft nicht so genau sagen konnte, wer denn nun eigentlich die ›Guten‹ und wer die ›Bösen‹ waren. Bei den Mannschaften war ein Motiv für Meuterei und Seeräuberei oft die Rebellion gegen ausbeuterische Zustände auf den Handels- und Kriegsschiffen, auf denen Matrosen fast wie Sklaven herhalten mussten. Bei den Anführern war es die Sucht nach Ruhm und Geld. Viele begannen als ›normale Seefahrer‹, oder als Freibeuter im Auftrag irgendeiner der auf See rivalisierenden Mächte. Ausgestattet mit offiziellen Kaperbriefen machten sie Jagd auf die Schiffe der gegnerischen Nationen. Sie kaperten, raubten, plünderten – und wurden später nicht selten von ihrem König oder Herrscher dafür mit Orden behängt.
Es war eine Art staatlich sanktionierter Privatkrieg von einigen, die dafür mit einem Freibrief versehen wurden – und es war relativ unabhängig davon, ob auf dem Land zwischen den betreffenden Parteien gerade Frieden herrschte, oder nicht. Auf hoher See hatten schon immer andere Gesetze gegolten – Piraterie, Kaperei und offizieller Seekrieg sind jahrhundertlang nicht klar gegeneinander abzugrenzen – wenn man es genau nimmt, bis heute nicht.
Ziel der Begierden im ›Goldenen Zeitalter der Piraterie‹ (ca. 1680 bis 1730) war die spanische Silberflotte, die, beladen mit reicher Beute aus den Kolonien und Erträgen des Silberabbaus in Bolivien und Mexiko, zwischen dem Isthmus von Panama, Havanna und Spanien unterwegs war. Gierig danach waren die Holländer, die Engländer, die Franzosen und Portugiesen, also alle anderen, die zu jener Zeit versuchten, die Welt zu erobern und über vernünftige Schiffe verfügten.
Viele Piraten begannen also im Bereich des Halb-Legalen. Wie es aber so ist, wenn man auf einer Rasierklinge tänzelt: Der Sprung auf die andere Seite ist allzu reizvoll. Als ›Freier Pirat‹ wartete nämlich noch viel reichere Beute. Denn erstens konnte man sich die Ziele nun nach Belieben aussuchen, und zweitens den Gewinn nach eigenen Piratenregeln aufteilen.
So lassen sich drei Abstufungen der ›Piraterie‹ im weiteren Sinne unterscheiden, festgemacht an den Besitzverhältnissen am Schiff, was einleuchtet:
Freibeuter (Eigner sind der Landesherr und/oder Aktionäre)
Bukaniere (Eigner sind Gouverneure und/oder Aktionäre)
Piraten (Eigner ist der Pirat selbst)
Freibeuter waren damals zunächst einmal Geschäftsmänner. Und dass ihre Unternehmung von reichen Aktionären und Geschäftemachern im Ursprungshafen finanziert wurde, war Normalität. So wie auch heute Menschen ihr Geld in riskante Anlagen stecken – dabei ein Risiko tragen, aber manchmal auch nicht schlecht daran verdienen.
Als etwa der Freibeuter Thomas Tew (um 1645–1695), gesponsert von mehreren Geschäftsleuten der Bermudas, an der Küste Südamerikas schlechte Beute machte, überredete er seine Mannschaft 1693 in den Indischen Ozean zu segeln. In der Straße von Bab el-Mandeb, dem Zugang zum Roten Meer, gelang es ihnen, ein reich beladenes Schiff des Großmoguls von Indien zu entern. Die Piraten erbeuteten Waren im Wert von 100.000 Pfund, darunter Gold, Silber, Elfenbein und Edelsteine. Jeder Mann erhielt einen Beuteanteil zwischen 1.200 und 3.000 Pfund, Tew selber soll 10.000 Pfund erhalten haben. Das waren ungeheure Summen in einer Zeit, als ein normaler Seemann gerade zwei bis drei Pfund Jahreslohn hatte. Aber auch den Sponsoren auf den Bermudas zahlte Tew den zehnfachen Betrag ihres vorgeschossenen Kapitals zurück.
Oder Woodes Rogers (1679–1732): Seine dreijährige Freibeuterfahrt von 1708 bis 1711 führte ihn rund um den Globus. Beute machte er vor allem an der Westküste Südamerikas, wo er zahllose spanische Geleonen kaperte. Die Reise, die 14.000 Pfund gekostet hatte, brachte über 170.000 Pfund Nettoertrag. Rogers wohnte danach gemütlich am Queen Square 19 in Bristol. Doch 1717 wurde er als Kenner der Gegend zum Gouverneur von New Providence und den Bahamas ernannt. Im April 1718 machte er sich auf die Reise, mit dem Ziel, die Region zu befrieden. Anbieten konnte er eine königliche Amnestie für alle Piraten, die sich bis zum 5. September 1718 ergeben würden.
*
Ob die Rückkehr in ein bürgerliches Leben möglich war oder nicht, hing von politischen Konstellationen und winzigen Schmetterlingsschlägen des Schicksals ab. Vielen berühmten Freibeutern gelang es nicht, oft weil sie im Lauf der Zeit schon allzu viel ›Piratenruhm‹ angesammelt hatten: Edward Teach (›Blackbeard‹): im Kampf getötet; ›Calico‹ Jack Rackham: gehängt; Bartholomew Roberts: im Kampf getötet; William Kidd: erschossen und geköpft; Charles Vane: gehängt; John Gow: gehängt; La Buse (Olivier Le Vasseur): geköpft; Edward Low: gehängt.
Und natürlich gab es auch Figuren, die nie etwas mit dem zivilisierten Leben zu tun haben wollten, und sich vor allem durch ihre Foltermethoden und ihre Grausamkeit und Trunksucht einen Ruf erwarben. Dazu gehört Roche Braziliano (1630–1671), der von etwa 1654 an die Meere unsicher machte. Einen Namen machte er sich vor allem durch seine extreme Brutalität. Es ist überliefert, dass er zwei Spanier bei lebendigem Leibe grillen ließ, weil sie ihm ihre Schweine nicht überlassen wollten. Außerdem war er ein großer Säufer und Trunkenbold. Jeden, der nicht mit ihm trinken wollte, so heißt es, ließ er erschießen.
Oder François l’Olonnais (1635–1667), der psychopathische Züge hatte. Es gehörte zu seinen Praktiken, seinen Opfern Stücke aus dem Fleisch zu schneiden oder sie lebendig zu verbrennen. Seine Lieblingsfoltermethode war das ›woolding‹: Dabei wird ein geknotetes Seil um den Kopf des Opfers gewunden und dann mit einem Stock so lange gedreht, bis die Augen heraustreten. Seine Gegner, die Spanier, machten Jagd auf ihn, er wehrte jedoch mehrere ihrer Angriffe ab. Als es ihm gelang, einem Hinterhalt zu entkommen und dabei zwei spanische Gefangene machte, »zog (er) seinen Säbel, und mit diesem schnitt er die Brust eines dieser armen Spanier auf, und zog dessen Herz heraus mit seinen gotteslästerlichen Händen, biss zu und riss daran mit seinen Zähnen, wie ein wilder Wolf«. Sein Ende kam, als er mit seinem Schiff im Golf von Honduras auf eine Sandbank lief. Weil die Mannschaft das Schiff nicht frei bekam, wandten sie sich zu Fuß ins Inland, wo sie in Darién in die Hände der einheimischen Bevölkerung fielen. Exquemelin schreibt, dass sie l’Olonnais »lebendig in Stücke rissen, seinen Körper Glied für Glied ins Feuer warfen und seine Asche in die Luft.«
Der Franzose ist einer der Haupt-Protagonisten in Alexandre O. Exquemelins Buch, der andere ist Henry Morgan (um 1635 – 1688), und das Schicksal beider könnte nicht unterschiedlicher verlaufen sein: Morgan trieb seit 1665 als Freibeuter sein Unwesen in der Karibik, allerdings meist mit Billigung seiner Schutzmacht England. Mitte 1668 überfiel er mit Wissen des englischen Gouverneurs von Jamaika, Thomas Modyford, die Stadt Portobello, wo er reiche Beute machte und sich noch besser für künftige Unternehmungen ausrüstete.
Am 28. Januar 1671 gelang ihm sein größter Coup: Als selbsternannter ›Chefadmiral aller Bukaniersflotten und Generalissimo der vereinigten Freibeuter von Amerika‹ zog er mit 1200 Mann auf 36 Schiffen gegen Panama, damals die reichste Niederlassung Spanisch-Amerikas. Nach einem neuntägigen Fußmarsch über die Landenge von Panama bekämpften und vertrieben die Piraten eine zahlenmäßig überlegene spanische Streitmacht, dann besetzten und plünderten sie die Stadt.
Als reicher Mann kam Morgan nach Jamaika zurück. Sogleich wurde er verhaftet und nach England gebracht, denn inzwischen hatten England und Spanien Frieden geschlossen. Aber im Jahre 1674 begnadigte man Morgan. Er wurde in den Adelsstand erhoben und zum Vizegouverneur von Jamaika ernannt. Später machte er sich als Piratenjäger einen Namen. Er starb am 25. August 1688 in Port Royal auf Jamaika an Tuberkulose, Syphilis oder vielleicht auch Leberversagen in Folge seines übermäßigen Alkoholkonsums. Als Dank für seine »Verdienste für die Englische Krone« bekam er ein Staatsbegräbnis.
*
Beide, l’Ollonais und Morgan, hat Alexandre Exquemelin begleitet, ihre Kaperfahrten mitgemacht und die Erlebnisse in seinem Buch geschildert. Über den Autor selbst ist relativ wenig bekannt. Man weiß, dass er 1666 als Angestellter der französischen Westindien-Kompanie nach Tortuga kam. Diese kleine Karibikinsel vor der Nordküste Haitis war damals Hauptstützpunkt der Piraten. Dort heuerte er 1669 als Freibeuter an und kam schließlich auch in Morgans Truppe.
Gelegentlich wird er auch als ›Leibarzt von Morgan‹ bezeichnet. Wahrscheinlich war er einfach ein Pirat mit einigen medizinischen Kenntnissen. So wenig man über Exquemelin weiß, so sicher ist, dass er das für alle Zeiten prägendste Piratenbuch schrieb. Vermutlich tat er das in einer kurzen, etwas ruhigeren Phase zwischen zwei Beutezügen, denn noch im Jahr 1697, nach einem Piratenüberfall auf die Stadt Cartagena, wird sein Name auf der Musterrolle gelistet.
© Armin Fischer, 2010
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel – Die Abreise des Reisebeschreibers
Abreise des Reisebeschreibers nach dem westlichen Teil von Amerika im Dienste der Französisch-Westindischen Kompanie. Rencontre auf See mit einem englischen Kriegsschiff. Ankunft auf der Insel Tortuga.
IM JAHRE 1666 am 2. Mai verreisten wir aus Havre de Grâce mit dem Schiff St. Johann (gehörig der Französisch-Westindischen Kompanie), montiert mit achtundzwanzig Kanonen, zwanzig Schiffsleuten und zweihundertzwanzig Reisenden, sowohl Angestellte der Kompanie als auch freie Personen mit ihren Dienern. Wir kamen zunächst unter dem Kap von Barfleur zu ankern, um uns dort mit noch sieben anderen der Kompanie gehörigen Schiffen zu konjungieren, die von Dieppe zu uns stoßen sollten, samt einem Kriegsschiff, montiert mit siebenunddreißig Kanonen und zweihundertfünfzig Mann.
Zwei Schiffe waren nach Senegal beordert, fünf nach den Karibischen Inseln, wir aber nach der Insel Tortuga. Auch gesellten sich zu uns noch ungefähr zwanzig Neufundland-Fahrer nebst einigen holländischen Schiffen, die nach Rochelle, Nantes und St. Martin wollten, so dass wir zusammen eine Flotte von an dreißig Schiffen zählten. Und wir machten alle klar zum Gefecht, da wir Nachricht hatten, dass vier englische Fregatten (jede von sechzig Kanonen) bei der Insel Ornay auf uns kreuzten.
Nachdem unser Kommandeur, der Ritter de Sourdis, seine Orders gegeben, gingen wir unter Segel mit gutem Wind und bei nebligem Wetter, das uns wohl zu statten kam, da wir von den Englischen nicht gesehen wurden. Wir segelten, um den Feind zu meiden, dicht unter der französischen Küste und stießen auf ein flämisch Schiff von Ostende, dessen Schiffer unserem Kommandeur klagte, er sei am selbigen Morgen von einem französischen Seeräuber geplündert worden. Sogleich machte das Kriegsschiff auf diesen Jagd, konnte ihn aber nicht einholen. Die französischen Bauern waren die ganze Küste entlang in Alarm, weil sie uns für Englische hielten und besorgten, dass wir landen möchten. Wir ließen zwar unsere Flagge wehen, der sie aber wenig trauten. Hierauf ankerten wir auf der Reede von Conquet in der Bretagne (bei der Insel Quessant) daselbst Erfrischungen und süßes Wasser einzunehmen.
Nachdem wir uns daselbst mit allem Notwendigen versehen, verfolgten wir unsere Reise, gewillt durch das Ras de Fonteneau [Ras: Meerenge; red.] zu passieren, da wir uns den Sorlingues von wegen der englischen Kreuzer nicht zu nahen wagten. Dieses Ras ist ein sehr starker Strom, der durch eine große Menge Klippen hinstreicht. Er wird genannt das Ras und ist gelegen am Eingang des Busens von Frankreich auf 48 Grad 10 Minuten nördlicher Breite. Es ist ein sehr gefährlicher Weg, zumal die Klippen teils unter Wasser stehen, teils darüber hinausragen. Darum sind alle diejenigen, so auf unserem Schiffe waren und diesen Weg noch niemals passiert hatten, getauft worden auf folgende Manier:
Der Oberbootsmann des Schiffes verkleidet sich mit einem langen Rock und einer wunderlichen Mütze auf seinem Haupte, mit einem hölzernen Schwert in der rechten und einen Topf mit Schwärze in der linken Hand. Auch sein Gesicht ist geschwärzt, um den Hals hat er eine große Krause von Pflöcken und anderem Schiffsgerät. Alle, die noch niemals da durchpassiert, müssen vor ihm niederknien, und er macht einem jeden ein Kreuz auf die Stirn, und mit seinem hölzernen Schwert gibt er ihm einen Streich in den Nacken; hierauf werden sie von anderen, die dazu bestellt sind, mit Wasser begossen, und obendrein müssen sie noch eine Flasche Wein oder Branntwein zu dem großen Mast hinbringen. Der aber, so nichts hat, ist davon befreit. Ja auch das Schiff, wenn es noch nicht hier durchpassiert ist, muss bezahlen. Nachdem dies alles geschehen, holt man, was von Wein und Branntwein bei dem Mast sich findet, und teilt es um und um aus.
Die Holländer werden vor diesen Klippen gleichfalls getauft und nicht minder vor den Klippen, die Barlingos genannt sind und dicht an der Küste von Portugal liegen auf 39 Grad 40 Minuten nördlicher Breite. Es sind überaus gefährliche Klippen, denn sie können bei Nacht nicht wohl gesehen werden von wegen des hohen Landes. Die Manier dieses Taufens ist bei den Holländern ganz anders wie bei den Franzosen; denn wenn bei ihnen einer getauft wird, muss er zu dreien Malen von der großen Ras gleichsam wie ein Übeltäter ins Wasser fallen, und so sie ihm auf dem Schiff günstig sind, lassen sie ihn bis zum Achter des Schiffs schleppen. Es ist eine nicht geringe Ehre, seiner Hoheit dem Prinzen von Oranien oder dem Kapitän zu Ehren außer den vorigen drei Malen noch einmal hinabzufallen. Der erste, der fällt, kriegt einen Kanonenschuss zu seinen Ehren und das Wehe der Flagge; die nicht fallen wollen, sind gehalten, zwölf Stüber zu bezahlen; so er aber ein Offizier ist, muss er einen halben Reichstaler geben.
Sind es Passagiere, müssen sie so viel geben, als man von ihnen fordern mag. Wenn das Schiff noch niemals durchpassiert ist, muss der Schiffsherr ein Oxhoft Wein geben, andernfalls dürfen sie die Galionsfigur vom Schiff absägen, ohne dass der Schiffsherr oder Kapitän etwas dawider haben kann. Alles was man gibt, wird dem Oberbootsmann eingehändigt, der es in Verwahrung hält, bis er in einen Hafen kommt, wo er Wein dafür kauft und dem sämtlichen Schiffsvolk austeilt. Niemand von beiden Nationen kann Rede stehen, warum sie dieses tun, als dass sie sagen, es sei ein alter Brauch bei den Seeleuten. Einige sagen, es haben Kaiser Karl V so verordnet, allein in seinen Verordnungen ist nirgends etwas davon zu finden. Dieses habe ich beiläufig und nur um der Seeleute Zeremonien zu gedenken hier aufgeschrieben, nunmehr aber wollen wir unsere Reise verfolgen.
Nachdem wir das Ras passiert hatten, bekamen wir einen sehr günstigen Wind bis an das Kap Finis Terrae, wo wir einen schweren Sturm erlitten und voneinander gerieten. Dieser Sturm währte acht Tage. Es war ein unglaubliches Elend zu sehen, wie auf unserem Schiff die Menschen durch die See von Steuerbord an Backbord gespült wurden, und hatten die Kraft nicht sich aufzurichten, so seekrank waren sie. Die Matrosen mussten bei ihrer Arbeit mit Füßen auf sie treten. Danach bekamen wir wieder gut und bequem Wetter und verfolgten unseren Kurs so glücklich, dass wir unter den Zirkel, genannt Tropicus Cancri, gelangten. Dies ist ein von den Sternguckern imaginierter Zirkel, welcher gleichsam eine Grenzscheide der Sonne auf ihrem Wege nach dem Norden hin ist, und liegt in der Höhe von 23 Grad 30 Minuten nördlich der Linie. Wir wurden da wieder getauft auf die Manier, die ich oben erzählt habe, dieweil die Franzosen allzeit unter der Linie unter dem Tropico Cancri und unter dem Tropico Capricorni [Wendekreis des Krebses und Wendekreis des Steinbocks; red.] zu taufen pflegen. Hier hatten wir nun sehr guten Wind, der uns auch hochnötig war, weil wir Mangel an Wasser hatten, und des Tages auf die Person nicht mehr als zwei Trinkgläslein kamen.
Wir bekamen (ungefähr auf der Höhe von Barbados) ein englisch Königsschiff in Sicht, das jagte uns nach mit vierundzwanzig Stücken. Als es aber sah, dass es keinen Vorteil über uns hatte, lief es von uns ab. Wir jedoch folgten ihm, und schossen nach ihm mit unseren Achtpfündern. Weil es aber besser besegelt war als wir, mussten wir es endlich lassen.
Hierauf nahmen wir unseren Kurs fort und bekamen die Insel Martinique in Sicht. Wir taten alles was wir konnten, um auf die Rede von St. Peter zu kommen, wurden aber durch einen schweren Sturm daran gehindert, daher wir nach Guadeloupe zu steuern gewillt waren, jedoch der Sturm widerstand uns so heftig, dass wir auch dahin nicht kommen konnten; mussten deswegen endlich allein nach der Insel Tortuga, wohin wir eigentlich beordert waren. Wir liefen längs der Küste von Puerto Rico hin, welches eine sehr schöne und lustige Insel ist, bedeckt mit schönen Bäumen bis zu den höchsten Gipfeln der Berge hinauf. Danach bekamen wir die Insel Española in Sicht, die wir nachgehend beschreiben wollen. Wir segelten ebenmäßig an der Küste hin, bis wir endlich die Insel Tortuga, just auf den 7. Juli selbigen Jahres erreichten und auf der ganzen Reise nicht einen einzigen Mann verloren hatten. Die Güter der Kompanie wurden hier ausgeladen und bald darauf das Schiff mit einigen Passagieren nach Cul de Sac geführt.
Zweites Kapitel – Beschreibung der Insel Tortuga
Beschreibung der Insel Tortuga. Derselben Gewächse und Früchte. Wie die Franzosen dahin gekommen und zweimal durch die Spanier wieder ausgetrieben worden sind. Und wie der Reisebeschreiber dort dreimal verkauft wurde.
DIE INSEL TORTUGA liegt an der Nordseite der großen und berühmten Insel Española ungefähr zwei Meilen von ihr auf der Höhe von 20 Graden 30 Minuten nördlicher Breite und hat ungefähr sechzehn Meilen in der Runde. Sie hat den Namen Tortuga bekommen, dieweil sie an Gestalt einer Schildkröte gleicht, die von den Spaniern Tortuga genannt wird. Sie ist voller Felsenspitzen, doch gleichwohl bedeckt mit großen Bäumen, die aus den Felsen hervorwachsen, da doch ganz und gar keine Erde zu sehen ist und die Wurzeln auf dem Steine bloßliegen. Die Nordseite ist unbewohnt und sehr unwirtlich, zumal weder Hafen noch Strand da ist, ausgenommen einige geringe Plätze zwischen den Klippen. Also ist die Südseite allein bewohnt und hat nur einen Hafen, wo die Schiffe ankommen können. Das Land, so es bewohnt ist, ist in Quartiere geteilt, die werden also benannt: La Basse Terre ist das vornehmste von wegen des Hafens, der Ort heißt Cayone, und hier leben die reichsten Pflanzer der Insel. Le Mil-Plantage ist noch neu und sehr fruchtbar an Tabak, desgleichen Le Ringot, diese Plätze liegen am Westende der Insel. In La Montagne sind die ersten Plantagen, die auf der Insel Tortuga angelegt sind. Der Hafen ist sehr gut, von einem Riff geschützt, es sind zwei Eingänge dahinein zu segeln. Darinnen können Schiffe mit siebzig Stücken liegen, und ist ein sehr schöner Sandgrund da.
Was die Gewächse der Insel Tortuga anbelangt, so wächst viel schönes Holz dort, als Stockfischholz [Brasilholz], Sandelholz, rot, weiß und gelb. Das gelbe Sandelholz wird von den Einwohnern Bois de Chandelle, das ist Kerzenholz, genannt, weil es so hell brennt als eine Kerze und ihnen zu Fackeln dient, wenn sie des Nachts fischen gehen. Da wächst auch Lignum Sanctum, welches in diesen Landen Pockholz genannt wird. Die Bäume, die das Gummi Elemi tragen, werden hier in großer Menge gefunden, desgleichen auch die Chinawurzel, doch ist sie so gut nicht als die ostindische; sie ist ganz weich und weiß und die wilden Schweine finden da nichts anderes zu fressen als diese Chinawurzel. Man findet dort auch das Kraut, Aloe genannt, und viele andere Arzneikräuter und Holzgewächse mehr, wie auch überaus taugliches Holz, Schiffe und Häuser daraus zu bauen.
Man findet hier allerlei Früchte, wie man sie auch auf den Karibischen Inseln hat, als Magniot, Patates, Igniamos, Wassermelonen, spanische Melonen, Goyaves [Früchte des Gojavebaums], Bananen, Bacovens [vermutlich eine Bananenart], Papayas, Carosoles, Mamains, Ananas, Acajou-Äpfel [Früchte des Elefantenlausbaums] und mancherlei anderer Früchte in großer Menge, die ich aber alle zu nennen und den Leser damit aufzuhalten, unnötig erachte. Auch gibt es da eine sehr große Menge Palmenbäumen, aus denen man Wein macht und mit deren Blättern man Häuser deckt.
Dies Land hat viel wilde Schweine, aber das Jagen mit Hunden ist verboten, um sie nicht auszurotten. Der Grund ist, weil die Insel klein ist, und, so man unvermutet von einem Feind überfallen würde, man sich in den Busch retirieren und von der Jagd leben soll. Jedoch ist die Jagd daselbst sehr gefährlich wegen der allzu vielen Klippen, welche alle mit kleinem Gebüsch überwachsen sind, also dass man ehe man sich’s versieht hinabstürzt; wie denn auf dergleichen Weise viele Personen verloren gegangen. Man hat auch viele Totengerippe gefunden, jedoch daraus nicht urteilen können, ob sie längst oder neulich umgekommen.
Zu einer gewissen Zeit des Jahres kommen wilde Tauben in solch großer Menge, dass die Einwohner reichlich davon leben können und gar kein anderes Fleisch brauchen. Nachdem aber diese zeit verlaufen ist, sind sie nicht mehr gut zu Nahrung, weil sie von einem gewissen sehr bittern Samen, den sie fressen, ganz mager und bitter werden. Am Gestade findet man eine große Menge von See- und Landkrabben, die sehr groß und gut zu essen sind. Die Sklaven und Bedienten essen sie unmäßig, sie sind von sehr gutem Geschmack, dabei aber dem Gesicht sehr schädlich; denn wer beides öfters isst, wird schwindelig, so dass alles sich mit ihm umdreht, und er ungefähr eine Viertelstunde nichts sehen kann.
Die Franzosen, nachdem sie eine Kolonie auf der Insel St. Christoph gepflanzt (1625) und dort ziemlich stark geworden waren, haben einige Schiffe ausgerüstet, welche sie westwärts sandten, etwas neues zu entdecken. Die liefen also an der Küste der Insel Española an. Allda an Land gekommen, haben sie dieselbe sehr fruchtbar befunden und sehr reich an allerhand wilden Tieren und Stieren, Kühen, Schweinen und Pferden. Da sie aber sahen, dass sie ohne einen gewissen und sichern Zufluchtsort dort wenig Nutzen haben würden (zumal die Insel Española von der spanischen Nation wohl bewohnt war) hielten sie es für ratsam die Insel Tortuga einzunehmen.
Das taten sie denn auch, die zehn oder zwölf Spanier die darauf waren, verjagten sie, und blieben dort ungefähr ein halbes Jahr, ohne dass jemand sie störte. Inzwischen fuhren sie mit ihren Kanus über nach dem großen Land und holten viel Volks herüber und begannen schließlich auf der Insel Tortuga den Feldbau. Weil aber die Spanier dies endlich inne wurden, rüsteten sie einige Fahrzeuge aus und kamen, um Tortuga wieder einzunehmen, was ihnen auch sehr wohl glückte; denn sobald die Franzosen sahen, flohen sie mit ihrer Habe in den Busch und fuhren die darauf folgende Nacht mit ihren Kanus nach der Insel Española. Und sie hatten den Vorteil, dass sie nicht beschwert waren mit Weib und Kind, sodass ein jeder buschwärts laufen und sich Nahrung suchen konnte; auch gab ein jeder Bescheid an seine Genossen, um den Spaniern ja keine Zeit zu lassen, auf der Insel einige Fortificationes [Befestigungen, Forts] zu bauen.
Indessen setzten die Spanier sogleich über in der Absicht, die Franzosen aus den Wäldern zu vertreiben oder sie darinnen Hungers sterben zu lassen, wie sie es mit den Indianern getan. Allein es wollte ihnen nicht glücken, weil die Franzosen mit Kraut und Lot [= Pulver und Blei], auch mit guten Feuerrohren allzu wohl versehen waren. Ja diese nahmen zu einer Zeit die Gelegenheit inne, da die Mehrzahl der Spanier nach der großen Insel übergefahren war, mit ihrem Gewehr und Volk die Franzosen aufzusuchen, kehrten mit ihren Kanus wieder nach Tortuga zurück, jagten alle Spanier, so sie noch da waren, wieder davon, verhinderten auch die anderen wiederzukommen und blieben so der Insel Meister.
Nachdem nun so die Franzosen wiederum der Insel Meister waren, schickten sie zum Gouverneur oder General von St. Christoph um Hilfe und baten, ihnen einen Gouverneur zu senden, um das Volk besser unter Gehorsam zu bringen, und dort eine Kolonie zu pflanzen. Der General, dem solches gefiel, gab von Stund an Order ein Schiff, das auf der Reede lag, klar zu machen und sandte ihnen als Gouverneur von Tortuga Monsieur Levasseur mit viel Volk und allerhand Notdurft. Sobald dieser Gouverneur angekommen, ließ er oben auf einen Felsen ein Fort aufwerfen, wodurch er den Hafen vor feindlichen Schiffen sicherte. Dieses Fort ist uneinnehmbar, oder so gelegen, dass man nicht dazu kommen kann, außer von einer Seite, wo jedoch nicht mehr als zwei Personen nebeneinander gehen können. Mitten in demselben ist eine Höhle in dem Felsen, die zu einem Munitionshaus dient und überdies ist da eine bequeme Gelegenheit eine Batterie anzulegen.
Der Gouverneur ließ auf das Fort ein Haus bauen, pflanzte zwei metallne Stücke darauf und gebrauchte eine Leiter, um hinaufzusteigen. In dem Fort ist ein Quell süßen Wassers, genug, täglich tausend Menschen zu tränken, es kann auch nicht abgeschnitten werden, denn es kommt aus dem Felsen, rund um das Fort sind Plantagen, die sind sehr fruchtbar an Tabak und anderen Früchten. Nachdem die Franzosen hier ihre Kolonie gepflanzt hatten und ziemlich stark geworden waren, begann ein jeder, sein Heil zu versuchen. Einige fuhren hinüber nach der großen Insel, um zu jagen und Häute zu bekommen; andere, die solches zu tun nicht Lust oder Neigung hatten, begaben sich auf den Raub und fuhren nach den Küsten der Spanier zum Kapern aus, wie sie noch heutigen Tages tun; die übrigen, so sie Weiber hatten, blieben auf der Insel: Einige legten Pflanzungen an und pflanzten Tabak, andere taten anderes, also dass jedweder Gelegenheit zu seinem Unterhalt fand.
Inzwischen konnten die Spanier alles dieses unmöglich mit guten Augen ansehen, weil sie wohl vermuteten, es möchten die Franzosen daselbst immer mächtiger werden, und endlich kommen und sie auch von der großen Insel vertreiben. Sie nahmen daher die Gelegenheit wahr, da eben viele Franzosen auf See und nicht wenige auf der Jagd waren, rüsteten ihre Kanus aus und landeten zum zweiten Mal auf Tortuga mit Hilfe einiger französischer Gefangener, die sie bei sich hatten. Die Spanier waren achthundert Mann stark; die Franzosen konnten ihnen das Landen nicht verwehren und begaben sich deswegen in das Fort. Der Gouverneur ließ alle Bäume um das Fort niederhauen, um den Feind desto besser zu sehen.
Weil nun die Spanier merkten, dass sie ohne Geschütz nichts ausrichten konnten, beratschlagten sie, wie sie ihre Sache aufs beste angreifen möchten. Sie sahen, dass alle die hohen Bäume, die das Fort gedeckt hatten, abgehauen waren, und dieses daher von einem gegenüberliegenden Berg beschlossen werden konnte. So machten sie einen Weg, das Geschütz da hinauf zu bringen. Dieser Berg ist ziemlich hoch und man kann, wenn man droben ist, das ganze Eiland übersehen; oben ist er flach und ringsum felsig, so dass es sehr beschwerlich fällt hinauf zu gelangen, außer auf dem Weg, den die Spanier damals gemacht haben, wie ich im folgenden erzählen will.
Die Spanier hatten viele Sklaven und Arbeitsleute bei sich, sowohl Matates oder Halbblut als Indianer, diese sollten einen Weg durch die Felsen brechen, das Geschütz auf den Berg bringen, und eine Batterie dort aufpflanzen, um das Fort, darin die Franzosen waren, zu beschießen und zur Übergabe zu zwingen. Während die Spanier nun hiermit beschäftigt waren, fanden die Franzosen Mittel, ihren Gefährten solches kundzutun, und um Hilfe anzusuchen, welche sie denn auch erhielten. Die Jäger samt denjenigen, die auf der Kaper waren, schlugen sich zusammen und begannen, nachdem sie zur Nachtzeit gelandet, von der Nordseite her den Berg zu erklimmen, dieweil sie darin sehr wohl geübt waren. Inzwischen hatten die Spanier mit großer Mühe zwei Stücke Geschütz auf den Berg hinaufgezogen, um des anderen Tags das Fort zu kanonieren und wussten von der Franzosen Ankunft nichts. Aber am Morgen, als sie dabei, waren ihr Geschütz in Ordnung zu stellen, kamen die Franzosen hinter ihnen her, und ließen die meisten den Sprung in die Tiefe tun und Hals und Bein brechen; nicht einer ist davongekommen, denn die Übrigen schlugen sie tot, ohne Pardon zu geben. Die anderen Spanier, die unten waren und das Geschrei hörten, merkten, dass es um die oben auf dem Berg nicht wohl stand, liefen an das Gestade und fuhren unverzüglich davon, an der Eroberung der Insel verzweifelnd.
Die Gouverneure der Insel Tortuga sind allezeit auch deren Eigentümer und Herren gewesen bis zum Jahr 1664, wo die Französisch-Westindische Kompanie sie in Besitz genommen und Monsieur Ogeron zum Gouverneur über sie gesetzt hat. Sie haben eine Kolonie gepflanzt mit Faktoren und Dienern, in der Absicht, mit den Spaniern einen beträchtlichen Handel zu treiben, wie es die Holländer in Curacao tun. Doch ist ihnen solches nicht geglückt. Sie wollten mit fremden Nationen handeln, konnten es doch nicht mit ihrer eigenen. Denn als die Kompanie ihren Beginn nahm, kaufte ein jeder, sowohl Kaper als Jäger oder Pflanzer, von der Kompanie, die alles auf Kredit gab, aber wenn es ans Bezahlen ging, ward niemand gefunden. So wurde die Kompanie genötigt, ihre Faktoren wieder abzuberufen, und gab ihnen Befehl, alles, was sie nur könnten, zu verkaufen; und so sind sie aus der Sache geschieden. Alle Diener der Kompanie wurden verkauft, einige für zwanzig, andere für dreißig Stück von Achten. [›Ein Stück von Achten‹: Spanischer Piaster, entspricht acht Silber-Realen.]
Mir, der ich auch der Kompanie Diener war, ging es gleichfalls nicht besser, und ich hatte just das Unglück, zum ärgsten Schelm der ganzen Insel zu kommen. Der war damals Untergouverneur oder Generalleutnant und tat mir alles Übel, so er nur erdenken konnte, an, er ließ mich Hunger leiden und wollte mich zwingen, dass ich mich für dreihundert Stück von Achten loskaufen sollte, wo ich doch nicht einmal eines besaß. Endlich fiel ich durch all das erlittene Ungemach in schwere Krankheit, und mein Meister, fürchtend, dass ich sterben möchte, verkaufte mich um den Preis von siebzig Stück von Achten an einen Wunderarzt. Als ich aber wieder gesund ward, hatte ich mich zu bekleiden nichts als ein altes Hemd und ein Paar Unterhosen. Jedoch mein neuer Herr war um vieles besser als der erste, denn er gab mir Kleider und alles was ich von Nöten hatte und, nachdem ich ihm ein Jahr gedient, erbot er sich, mich für hundertfünfzig Stück von Achten freizulassen und solang mit der Bezahlung zu warten, bis ich das Geld gewonnen.
Als ich nun frei war, war ich wie Adam, da er aus den Händen seines Schöpfers kam. Ich hatte nichts. So beschloss ich denn, mich unter die Kaper und Räuber zu begeben, unter welchen ich auch verblieben bin bis zum Jahr 1672. Ich habe mit ihnen verschiedenen Zügen beigewohnt und viele der vornehmsten Raubstücke ausüben helfen, wie es hiernach beschrieben werden soll. Zuvor aber will ich etwas von der Insel Española erzählen, um dem neugierigen Leser in allem, was in diesem Teil Amerikas Merkwürdiges vorgefallen, genugzutun.
Drittes Kapitel – Beschreibung der Insel Española
Beschreibung der großen und berühmten Insel Española.
DIE INSEL ESPAÑOLA erstreckt sich meistenteils von Osten nach Westen auf der Höhe von 17 ½ bis 20 Grad nördlicher Breite. Sie hat ungefähr dreihundert Meilen im Umkreis, einhundertzwanzig in der Länge und ungefähr fünfzig in der Breite, an einigen Stellen auch etwas schmaler. Mit Erzählung der Entdeckung dieser berühmten Insel will ich dem günstigen Leser nicht beschwerlich fallen, weil fast jedermann weiß, dass im Jahr 1492 Christophorus Columbus, von Don Fernando, König von Spanien, ausgesandt, diese Insel entdeckt hat, von welcher Zeit an bis auf die gegenwärtige die Spanier sie besessen haben. Auf dieser Insel sind verschiedene Städte, desgleichen viele schöne Dörfer, alles von den Spaniern erbaut.
Die Hauptstadt ist St. Dominik zugeeignet und nach seinem Namen in spanischer Sprache Santo Domingo genannt. Diese Stadt ist an der Südseite der Insel auf der Höhe von 18 Graden und 13 Minuten nördlicher Breite und liegt ungefähr vierzig Meilen Wegs von der Ostseite dieser Insel, genannt Punta de Espada. Die Stadt ist rings ummauert und hat ein starkes Kastell, welches den Hafen beherrscht. Das ist ein schöner Hafen, worin eine große Menge Schiffe liegen können; sie sind da vor allen Winden geschützt außer einem südlichen. Rund um die Stadt sieht man die schönsten Pflanzungen, wo allerhand Früchte nach der Art des Landes wachsen. Der Gouverneur der Insel, welchen sie den Präsidenten nennen, hält sich da auf. Von dieser Stadt aus werden alle Landstädte und Dörfer verproviantiert und unterhalten, denn die Spanier treiben in keinem anderen Seehafen der Insel Handel außer in diesem; der größte Teil des Volks, das dort wohnt, sind Kaufleute und Krämer.
Die Stadt S. Jago Cavallero ist St. Jakob dem Ritter zugeeignet und nach seinem Namen genannt. Sie liegt im Lande offen ohne Mauern ungefähr auf der Höhe von 19 Grad nördlicher Breite. Die Leute, die da wohnen, sind meist Jäger und Pflanzer, zu welchen Beschäftigungen das Land sich sehr wohl eignet, es hat rundum viel schöne Weiden, darauf sowohl zahmes als wildes Vieh sich in großer Menge aufhält, daher dieser Platz sehr viele und schöne Häute liefert.
An der Südseite der Stadt S. Jago liegt ein überaus schönes Dorf, genannt El Cotui oder Nuestra Senora de Alta Gracia, das ist Unsere Liebe Frau vom hohen Segen. Um dieses Dorf sind schöne Landschaften, woher viel Cacao oder Chocolate, Ingwer, Tabak und Talk kommt.
Die Spanier fahren mit ihren Kanus nach der Insel Savona, um dort zu fischen und Schildkröten zu fangen, die an den Strand kommen, ihre Eier zu legen. Auf dieser Insel ist nichts Beschreibenswürdiges. Sie sind sehr sandig und es gibt viel Franzosen- oder Pockenholz. Die Spanier haben Kühe und Stiere dahin gebracht, um sie zu züchten, nachdem aber die Kaper gekommen, haben diese alle vertilgt.
Westwärts von der Stadt S. Domingo ist noch ein anderes großes Dorf, genannt El Pueblo de Asso. Die Einwohner dieses Dorfes treiben einen großen Handel mit denen eines anderen Dorfes, das gerade inmitten der Insel liegt und San Juan de Goave heißt. Es liegt am Ende einer sehr großen Weide, die sich in der Runde wohl auf zwanzig Meilen Wegs erstreckt und voll wilder Kühe und Stiere ist. An diesem Orte wohnen keine anderen Menschen als Viehhändler und Jäger. Der größte Teil ist von gemischtem Geblüt: nämlich Menschen, die von Negern und Weißen gezeugt sind, Mulatos genannt; die gleicherweise von Indianern und Weißen gezeugt sind, Mestices genannt; und die von Negern und Indianern kommen, werden Alcatraces genannt; und was für andere Bastardgeschlechter mehr dort zu finden sind, denn die Spanier haben mehr Neigung zu den Mohrinnen als zu ihren eigenen Weibern. Von diesem Dorf kommen Talg und Häute in großer Menge, es wird auch nichts anderes da geschafft, da die Erde nicht bebaut werden kann, von wegen der großen Dürre, die da ist. Und dies ist alles, was die Spanier besitzen auf dieser Insel, vom Cabo de Lobso nach San Juan de Goave bis zum Cap Samana auf der Nordseite, und an der Küsten von Ostende genannt Punta de Espada bis Cabo de Lobos. Der Rest der Insel wird besessen von den französischen Buschläufern und Pflanzern.
Die Insel ist auch versehen mit sehr schönen Häfen vom Cabo de Lobos bis zum Cabo del Tibron, welches das Westende der Insel ist. Es sind vier oder fünf sehr schöne Häfen, welche die von England weit übertreffen, mit überaus schönen Landschaften, Tälern und Strömen voll von dem schönsten Wasser, das in der ganzen Welt gefunden werden mag. Auch ist da ein schöner Strand, wo die Schildkröten hinkommen, um ihre Eier zu legen. Vom Cabo del Tibron bis zum Cabo Dona Maria sind zwei schöne Häfen, vom Cabo Dona Maria bis zum Cabo San Nicolas sind wohl zwölf schöner Häfen, und vom Cabo San Nicolas bis zur Punta de Espada sind wohl zwanzig schöner Häfen, und in jeden dieser Häfen gehen zwei oder drei schöne Ströme, darin Überfluss an Fischen ist. An der Nordseite dieser Insel sind verschiedene Städte und Dörfer gewesen, die aber durch die Holländer verwüstet und von den Spaniern verlassen worden sind.
Spanisch-Amerika nach zeitgenössischem Kupferstich.
Viertes Kapitel – Überfluss
Von den Früchten, Bäumen und Tieren, die auf der Insel Española gefunden werden.
DIE INSEL ESPAÑOLA ist sehr fruchtbar an allerhand Gewächsen und Früchten. Man findet dort große Flächen von fünf bis sechs Meilen in der Runde, deren einige ganz mit süßen, andere aber mit sauren Pomeranzenbäumen besetzt sind, gleichermaßen auch mit Limonenbäumen, doch sind diese derart nicht wie die, die aus Spanien gebracht werden, denn die größte ist nicht größer als ein Hühnerei und sie sind saurer. Man findet da auch sehr große Ebenen, bedeckt mit Palmenbäumen, die sind sehr hoch und eine Lust anzuschauen. Diese Bäume sind ungefähr hundertfünfzig bis zweihundert Fuß hoch, ohne Äste, und oben haben sie einen Strunk von Materie und Geschmack wie ein Weißkohl, woraus dann die Blätter und der Same wachsen. Jeder Baum hat nicht mehr als zwölf Blätter und alle Monate fällt ein Blatt ab, und in eines Monats Zeit grünt ein neues an seinem Platz. Der Same wächst einmal des Jahres aus dem Strauch, der, wie ich gesagt, wie Kohl von Geschmack und sehr gut zu essen ist. Wenn man ihn unter Fleisch kocht, schmeckt er wie weißer Käsekohl. Der Same ist dienlich zur Mast der wilden Schweine.
Die Stiele der Blätter sind ungefähr drei oder vier Fuß breit und sieben oder acht Fuß lang. Diese sind auch wohl die größten und werden gebraucht, die Häuser damit zu decken wie auch geräuchert Fleisch darein zu packen (wie ich nachgehendes erzählen will). Die Stiele dieser Blätter sind von außen grün, von innen aber sehr weiß, so dass man von dem Innersten ein Fell oder Haut abschälen kann in der Dicke eines Pergaments, darauf es sich so wohl schreiben lässt als auf Papier. Wenn man bei Regenwetter über das Feld geht und von diesen Blättern bei sich hat, kann man sich vor allem Regen damit behüten. Dann dienen sie auch, Trinkwasser damit aufzufangen zu Zeiten der Not, zumal man Eimer daraus machen und Wasser darin tragen kann, doch halten sie nicht länger als sieben oder acht Tage. Diese Bäume sind sehr hart, aber ganz innen ist eine gewisse Materie, die man mit dem Messer schneiden kann, das eigentliche Holz ist nicht über drei oder vier Zoll dick, aber der ganze Stamm ist so dick, dass ihn oft nicht zwei Männer umfassen können. Es wachsen diese Bäume gern in flachem Land und sonst unfruchtbaren Gründen. Man kann auch von diesen Bäumen Wein machen und zwar auf folgende Weise. Wenn der Baum abgehauen ist, ungefähr drei oder vier Fuß hoch über der Wurzel, wird oben in dem Strunk ein viereckiges Loch gemacht, worin mit der Zeit der Wein allmählich zusammen rinnt und so stark wird, dass man einen guten Rausch davon bekommen kann.
Diese Palmenbäume werden von den Franzosen Palmiste franc genannt. Neben diesen Palmenbäumen gibt es noch viererlei. Sie werden genannt: Latanier, Palmiste épiné, Palmiste à vin, Palmiste à chapelet, oder Palmiste de montagne. Der Palmiste, Latanier genannt, wächst so hoch nicht als der Palmiste à vin, wie wohl er beinahe dieselbe Gestalt hat, ausgenommen die Blätter, die an Form einem Fächer gleichen und sieben oder acht Fuß im Umkreis haben, auch hat er ringsum Stacheln, ungefähr einen halben Fuß lang. Dieser Baum wirft seinen Samen so wie die anderen oben genannten, jedoch etwas größer und dicker, und er dient gleichfalls zur Mast der wilden Tiere. Die Blätter von diesem Baum werden nur zum Decken der Häuser gebraucht. Er wächst selten auf guten Gründen, sondern allzeit auf sandigen und felsigen Örtern.
Der Palmiste épiné wird also genannt, weil er von der Wurzel bis oben an die Blätter voller Dornen ist, die sind ungefähr drei oder vier Finger lang. Eine gewisse Nation von Indianern im südlichen Teil von Amerika gebraucht diese Dornen zur Tortur oder Peinigung ihrer Kriegsgefangenen und das auf solche Weise: Sie binden die Gefangenen an einen Baum fest, nehmen diese Dornen und stecken an einen jeden ein kleines in Baumöl getunktes Läpplein von Kattun, dann stoßen sie sie in das Fleisch des armen Sünders, so dicht aneinander, als die Dornen an den Bäumen wachsen, und zünden das Kattunläpplein mit Feuer an. Wenn dann der Patient singt, so wird er geachtet als ein generöser Soldat, der seine Feinde für so gering hält, ihm weh zu tun; sofern er aber klagt und winselt, so wird er für einen Feigling gehalten. Diese Historie habe ich von einem Indianer, der dieses oftmals an seinen Feinden geübt; es ist auch von Christen, die unter ihnen wohnen, mit Augen angesehen worden. Allein, wieder auf unsere Erzählung zu kommen, so ist dieser Palmenbaum in der Höhe von dem, welchen man Latanier nennt, nicht unterschieden, aber die Blätter sind gleich denen des Palmiste franc, nur dass sie keine Stiele wie die anderen haben. Von diesem Palmisten wird auch guter Wein gemacht, auf gleiche Weise wie oben gemeldet. Dieser Palmiste wirft seinen Samen auch wie der andere, doch ist er von ganz anderer Art, rund und so dick als ein Deut, inwendig hat er einen Kern, der sehr hart und von Geschmack so gut wie eine spanische Nuss ist. Man findet diesen Baum am Seegestade, in niedrigen Gründen.
Der Palmiste à vin wird so genannt, weil er in großen Mengen Wein gibt, er wird nicht mehr als vierzig oder fünfzig Fuß hoch und ist von einer wunderlichen Gestalt; denn unten von der Wurzel an bis etwa zur halben Höhe und etwas mehr ist er nicht mehr als drei Spannen dick, aber über der Mitte oder in zwei Drittel der Höhe ist er so dick als ein Eimer oder Weinfass, und diese Verdickung ist voll von einer gewissen Materie wie die in dem Strunk von einem Kohl, aber ganz voller Saft, der lieblich von Geschmack ist, und wenn er vergoren, dem Wein an Stärke nichts nachgibt. Es wird aber dieser Saft auf folgende Weise ausgepresst: Nachdem der Baum abgehauen ist (welches gar leichtlich geschieht, denn man kann ihn mit einem großen Messer, das an Gestalt wie eines Pastetenbäckers Messer ist, Machete genannt, schneiden), macht man in der Mitte der Verdickung eine viereckige Öffnung, stampft es, bis es ganz weich ist, und presst dann den Saft mit den Händen aus. Man findet an dem Baum alle dazu notwendigen Gerätschaften, denn man reinigt den Saft durch die Blätter und von den untersten der Blätter macht man Gefäße, den Wein hineinzutun und auch ihn daraus zu trinken. Dieser Baum trägt seine Frucht so wie die anderen Palmistenbäume, nur dass sie von einer anderen Gestalt, an Farbe und Dicke den Kirschen gleich und auch gut zu essen sind, jedoch eine raue Kehle verursachen. Er wächst auf hohen und felsigen Bergen.
Die Palmistenbäume, Palmiste à chapelet, weil die Spanier Rosenkränze oder Paternoster von deren Samen, der ebenfalls klein und sehr hart ist, machen, wachsen sehr hoch und dünn mit wenig Blättern auf den Gipfeln der hohen Berge.
Man findet auch andere Bäume da von Wuchs wie ein Birnbaum, die tragen Früchte, Cayemiete [vermutlich Sternapfel] genannt. Diese Frucht ist an Gestalt und Farbe wie die großen Schwarzen Pflaumen, voll weißen Milchsaftes, der von Geschmack sehr süß ist. Inwendig sind in einigen fünf in anderen drei Kerne, ungefähr so groß wie türkische Bohnen. Die wilden Schweine fressen diese Früchte gleichfalls sehr gerne, doch werden sie nicht allerorten gefunden.
Da wachsen auch noch große Bäume, die eine Frucht tragen, die man Genipas nennt. Dieser Baum wächst so hoch wie ein Kirschbaum und hat fast ebensolche Blätter, spreitet aber seine Äste sehr weit voneinander. Die Frucht ist an Gestalt einem Mohnkopf gleich, jedoch so dick wie zwei Fäuste, grau von Farbe und im Innern voll kleiner Kerne, mit einem Häutlein, das all die Kerne einschließt. Dieses Häutlein ist sehr scharf, also dass, wenn man die Frucht mitsamt demselben einschluckt, es den Leib verstopft und große Pein beim Stuhlgang verursacht. Wenn die Frucht unreif ist und man presst den Saft aus, wird er so schwarz wie Russ, man kann damit auf Papier schreiben. Aber innerhalb neun Tagen löscht es wieder aus, und das Papier ist, als ob niemals darauf geschrieben worden wäre. Das Holz von diesem Baum braucht man zum Bauen, zumal es fest und schön ist. Es soll überaus tauglich sein, Schiffe daraus zu zimmern, denn es hält sich sehr wohl im Wasser.