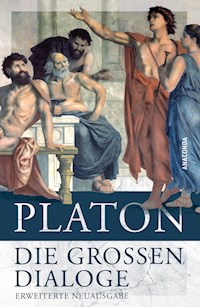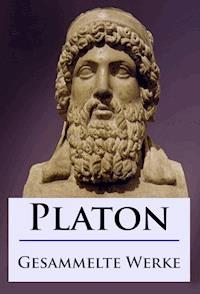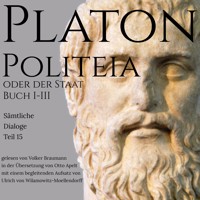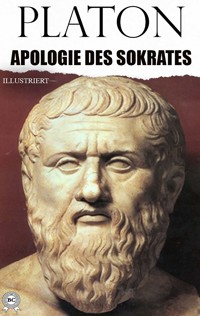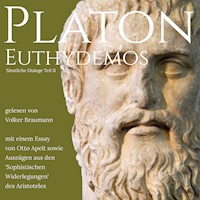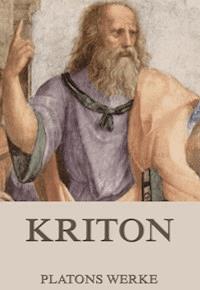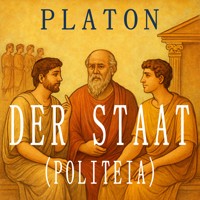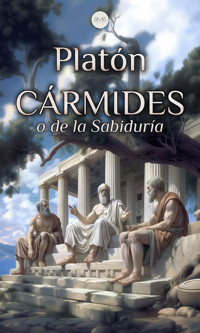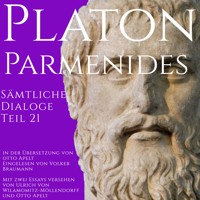Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Der Staat« ist das Hauptwerk Platons. Die politische Theorie vom einem guten Staatsaufbau, die Platon in »Der Staat« entwickelt, hat bis heute großen Einfluss auf das philosophische und politische Denken. Platon entwirft das Musterbild einer gerechten Verfassung. Enthalten ist der damals noch revolutionäre Gedanke von der Gleichheit von Mann und Frau. Kritisch wird heute zumeist Platons Idee gesehen, der Staat solle von den Philosophen geführt werden. Platon wäre als Philosoph selbst von einer »Philosophenherrschaft« begünstigt worden. Die vorliegende Ausgabe wurde mit einem ausführlichen Vorwort versehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Platon - Der Staat
TitelseiteVorwortErstes BuchZweites BuchDrittes BuchViertes BuchFünftes BuchSechstes BuchSiebentes BuchAchtes BuchNeuntes BuchZehntes BuchImpressumPlaton
Der Staat
Übersetzung und Vorwort von Friedrich Schleiermacher
Vorwort
Wenn man den Umfang dieses Werkes auch mit den größten unter denen, die ihm in unserer Anordnung vorangegangen sind, vergleicht, und bedenkt, dass es doch als ein ohne Unterbrechung fortlaufendes Gespräch, und zwar das erst am Abend begonnen habe, wieder erzählt wird: So muss man schon sehr lebhaft durch das »Gastmahl« davon überzeugt worden sein, dass, wen Sokrates einmal fasst in Reden, der auch die ganze Nacht aushalten müsse bis in den lichten Morgen hinein, und wenn auch die andern alle sich schon davon gemacht oder sich dem Schlaf ergeben haben, und dass er eben so unermüdet ist eigne oder fremde Reden zu wiederholen als von vorne herein die Wahrheit gemeinschaftlich mit anderen aufzusuchen und zu entwickeln. So erscheint er hier, indem er das ganze Gespräch gleich am unmittelbar folgenden Tag hintereinander wieder erzählt, und so verhielt es sich auch Tages zuvor, als es zuerst gehalten wurde. Denn von der großen Gesellschaft, welche anfangs teils den Sokrates und den Polemarchos begleitend namhaft gemacht wird, teils auch sich in des Letzteren Behausung vorfindet, verliert sich der größte Teil allmählich, man weiß nicht wie; wenigstens sagen sie es nicht, dass sie den sich immer weiter ausspinnenden sokratischen Reden von der Gerechtigkeit und vom Staat die vorbehaltene Schau des neu aufgekommenen festlichen Fackeltanzes vorziehen. Nur die beiden Söhne des Ariston, welche, nachdem zuerst Polemarchos und Thrasymachos über den Begriff der Gerechtigkeit mit Sokrates verhandelt hatten, durch tapfere Einwendungen einen vorzüglichen Beruf dazu bekundeten, halten auch tapfer aus abwechselnd dem Sokrates Rede stehend, ohne jedoch, dass es in den meisten Fällen eine besondere Bedeutung zu haben scheint, ob Glaukon oder Adeimantos das Wort führt.
Scheint nun der Schriftsteller durch diese Einkleidung den Wunsch auszusprechen, die Leser möchten das Werk eben so hintereinander als ein ungeteiltes Ganze in sich aufnehmen und genießen, wie die Reden selbst ohne Unterbrechung gesprochen sein sollen und ohne Absatz wieder erzählt: So tritt dem wieder die Einteilung in zehn Bücher entgegen. Diese ist allerdings, wenngleich Aristoteles sie nicht berücksichtiget, uralt, und weil schon seit den Kommentatoren des Stageiriten das Werk immer nach dieser angeführt wird, muss sie auch immer beibehalten werden; allein dass sie von Platon selbst herrühre, ist wohl nicht wahrscheinlich zu machen. Mir wenigstens widerstrebt es anzunehmen, dass wenn er das Werk zu teilen nötig gefunden hätte, er eine so ganz mechanische gar nicht gliedermäßige Zerstückelung sollte angegeben haben, die jeder, der den innern Zusammenhang des Ganzen aufsuchen will, ganz bei Seite stellen muss, wenn er nicht soll in Verwirrung geraten. Denn nur mit dem Ende des ersten Buches schließt auch der erste Teil des Werkes, und eben so beginnt mit dem Anfang des letzten Buches auch der Schluss des Ganzen; außerdem aber treffen mit einem in Bezug auf den Inhalt bedeutenden Abschnitt nur noch das Ende des vierten und des siebenten Buches zusammen. Alle übrigen Bücher brechen so in der Mitte einer Verhandlung ab, dass auch nicht einige Redensarten daran gewendet werden konnten, Schluss oder Eingang zu bezeichnen. Da nun die Bücher einander an Umfang ziemlich gleich sind, so kann sich die Sache leicht so verhalten, dass man den ersten bedeutenden Abschnitt als Maßstab angenommen und so viel Teile gemacht hat als sich in ziemlicher Gleichheit mit diesem ergeben wollten, ein Verfahren, wobei man offenbar nur die Abschreiber und die Büchersammlungen im Auge haben konnte.
Beseitiget man demnach den Gedanken gänzlich, dass diese Einteilung eine ursprüngliche mit der innern Anordnung des Ganzen zusammenhängende sei, und geht um Letztere zu finden den Andeutungen des Werkes selbst nach: So muss man es dem Verfasser zum Ruhme nachsagen, dass er auf alle Weise gesucht hat, dem Leser den Mangel zweckmäßiger äußerer Abteilungen zu ersetzen und die Auffassung des Zusammenhanges möglichst zu erleichtern. Denn es ist mit musterhafter Genauigkeit jede irgend bedeutende Abschweifung, wo sie beginnt, auch angedeutet, und am Ende wird wieder auf den Punkt zurückgewiesen, wo der Faden wieder aufgenommen werden muss. Eben so wird es überall sehr bemerklich gemacht, wo ein neuer Abschnitt beginnt; und zusammenfassende Wiederholungen des bisherigen sind so wenig gespart, dass es jedem nur irgend aufmerksamen Leser höchst leicht sein muss den Faden zu behalten, ja dass es fast unmöglich scheint über die wahre Abzweckung des Werkes, und über das Verhältnis der einzelnen Teile zu der Einheit des Ganzen in Ungewissheit zu geraten.
Der Gang des ganzen Werkes aber ist folgender. In dem vertraulichen Eingangsgespräch zwischen Sokrates und Kephalos vorzüglich über das Alter gedenkt letzterer auch der Sagen über die Unterwelt, welche auf dieser Lebensstufe sich besonders vergegenwärtigen, und rühmt es als den bedeutendsten Vorteil des Wohlstandes, dass der Reiche getrosteren Mutes dem bevorstehenden entgegengehen könne, indem er weniger als die Dürftigen zur Ungerechtigkeit versucht worden sei. Hieran nun knüpft Sokrates die Frage über das Wesen der Gerechtigkeit, indem er sogleich eine sehr geläufige Erklärung, dass sie Wahrhaftigkeit sei im Reden und Treue im Wiedergeben, durch bekannte Instanzen als unzureichend abweiset. Und hier überlässt Kephalos, zu solchen Gesprächen ohnedies schon zu betagt, seine Stelle, um draußen des Opfers zu pflegen, seinem Sohne Polemarchos, welcher sich hinter eine von Simonides gegebene Erklärung der Gerechtigkeit verschanzt, die jedoch Sokrates ebenfalls mit Anwendung der schon oft bewährten Methoden vernichtet. Hierauf tritt mit sophistischer Großsprecherei, die hie und da sogar an die unfeinen Späße im »Euthydemos« erinnert, der chalkedonische Thrasymachos auf, und übernimmt die Stelle des Kallikles im platonischen »Gorgias«, indem er die Behauptung aufstellt, das Gerechte sei nur die von den Stärkeren zu ihrem eigenen Vorteil gemachte Satzung; daher auch gerecht sein dem Schwächeren zum Schaden gereiche, die Ungerechtigkeit aber eine Weisheit sei und das ungerechte Leben das einzig förderliche. Sokrates schützt sich durch die Analogie aller herrschenden Künste, welche insgesamt das beste anderer und zwar der Schwächeren besorgen, keineswegs das eigene. Und weil die Weisen in jeder Sache nicht über das Maß ihrer Kunstgenossen und der Sache selbst hinauswollen, die Ungerechten aber gar kein Maß anerkennend dieser Regel nicht folgen, so sei auch wohl schwerlich die Ungerechtigkeit eine Weisheit zu nennen. Hieran knüpft sich zuletzt der Beweis, dass die Ungerechtigkeit weit entfernt stark zu machen und dadurch Vorteil zu bringen vielmehr, weil sie wesentlich Zwietracht errege, unkräftig sei; mithin das gerechte Leben allein das glückselige, weil auch die Seele ihr Geschäft, nämlich das Beraten Herrschen Besorgen, nur durch die ihr eigene Tugend, und das sei doch schon eingestandenermaßen die Gerechtigkeit nicht aber die Ungerechtigkeit, vollkommen verrichten könne. So schließt das erste Buch zwar mit dem Siege des Sokrates über den Sophisten, aber auch mit der Klage des Siegers selbst, dass das Wesen der Gerechtigkeit immer noch nicht gefunden sei, mithin auch die aufgeworfene Frage noch ganz unberührt da stehe, durch welchen Schluss also dieses Buch deutlich genug als Einleitung bezeichnet wird, so dass die bisherigen Reden nur als Vorbereitung einen Wert haben können.
Dasselbe wird aber eben dadurch auch behauptet von allen in dieser Übersetzung früher mitgeteilten sokratischen Gesprächen, so viele davon von irgend einer Tugend handelten, indem sie ja alle die richtige Erklärung nicht auffanden. So behandelte »Protagoras« die Frage von der Einheit und von der Lehrbarkeit der Tugend, aber ohne den Begriff derselben aufzustellen; so ist im »Laches« von der Tapferkeit die Rede und im »Charmides« von der Besonnenheit. Ja da auch in der Frage von der Gerechtigkeit der Gegensatz zwischen Freund und Feind ein bedeutendes Moment bildet, mögen wir auch des »Lysis« hier gedenken. Daher ist es auch gewiss nicht unabsichtlich, vielmehr ein sehr bestimmt aufgefaßter Zweck und sehr besonnen durchgeführt, dass dieses erste Buch unseres Werkes auf jede Weise jene früheren ethischen Schriften dem Leser ins Gedächtnis zurückruft, man sehe nun auf die Methode der Untersuchung oder auf den Gang der Komposition oder auf den Stil und die Sprache. Am stärksten freilich ist überall der Anklang an den »Protagoras«, der ja auch die ethische Frage allgemeiner behandelt als irgend ein anderes von jenen Werken. An dieses Gespräch erinnert die Pracht der Zurüstung und des Einganges, die Menge der zum Teil berühmten Personen, des Sophisten Vorliebe für lange aber keine Prüfung aushaltende Reden und sein entschiedener Widerwille gegen das Gespräch, die Berufung auf den lyrischen Dichter in ethischen Dingen, mit einem Worte nur nicht alles. Und wenn allerdings das Thema des Thrasymachos auch sehr bestimmt an den »Gorgias« erinnert, so trifft das nicht übel zusammen mit der Stellung, welche wir jenem Gespräch angewiesen haben, nämlich als Übergang von der ersten Hauptmasse der platonischen Werke zu der zweiten. Diese Methode, das Frühere durch Ähnlichkeit in Erinnerung zu bringen, ziemt nun freilich einem Schriftsteller ganz vorzüglich, dem schon die Form seiner Werke nicht gestattete, in den späteren sich geradezu auf die früheren zu berufen; aber doch ist die ganze Erscheinung nicht hieraus allein zu erklären, sondern diese Absicht hätte leichter durch einzelne Andeutungen können erreicht werden. Vielmehr wenn wir Platons Meinung ganz verstehen wollen, dürfen wir nicht aus der Acht lassen, dass diese ganze Ähnlichkeit unseres Werkes mit den älteren ethischen Gesprächen auch am Ende dieses ersten Buches gänzlich verschwindet. Das Gewühl der Personen verliert sich, und niemand nimmt mehr Teil am Gespräch als Glaukon und Adeimantos, wiewohl später noch einmal Alle als anwesend aufgeführte herbei gerufen werden. Nur ein einziges Mal regt sich Thrasymachos aber ganz versöhnt und beschwichtigt, gleichsam um anzudeuten, dass alle Fehde mit den Sophisten ein Ende habe. Auch die Methode ändert sich gänzlich; Sokrates tritt nicht mehr fragend als der Nichtwissende auf, der nur im Dienste des Gottes die größere Unwissenheit aufsucht, sondern als einer der gefunden hat, trägt er in strengem Zusammenhange fortschreitend die gewonnenen Einsichten mit. Ja auch dem Stile nach tragen nur noch die nächsten Reden der beiden Brüder als den Übergang bildend eine Ähnlichkeit mit dem bisherigen, hernach nichts mehr von dialogischer Pracht und reizender Ironie, sondern bündige Strenge allein soll den Preis gewinnen. Der gesamte Apparat der jugendlicheren Virtuosität glänzt hier noch einmal im Eingang, und erlischt dann auf immer, um so verständlich als möglich zu gestehen, dass alles Schöne und Gefällige dieser Art doch auf dem Gebiet der Philosophie nur in vorbereitenden mehr spornenden und anregenden als fördernden und befriedigenden Untersuchungen seinen Ort habe, dass aber, wo eine zusammenhängende Darstellung von den Resultaten philosophischer Forschung gegeben werden soll, solcher Schmuck mehr abziehend wirken als die vollständige Auffassung fördern würde. – In diesen vorbereitenden Reden werden aber einige Punkte aufgestellt, auf welche noch kürzlich aufmerksam zu machen nützlich sein mag, da sie sich in der Folge bedeutend erweisen, ohne doch hier besonders herausgehoben zu werden. Der erste ist, dass bei der Vergleichung der verschiedenen eine Herrschaft ausübenden Künste der daraus entstehende Gewinn von dem eigentlichen Zweck der Kunstübung ganz gesondert, und die Geschicklichkeit im Erwerben vielmehr als eine besondere Kunst aufgestellt wird, welche in solchen Fällen ein und derselbe Mann noch neben seiner anderen besitzt. Dies gibt zuerst einen Aufschluss über das, was in früheren Gesprächen, vorzüglich dem »Gorgias« und dem »Sophisten«, über die Schmeichelkunst in allen ihren mannigfaltigen Verzweigungen gesagt wurde. Denn aus jeder Kunst kann eben so gut als aus der wahren Dialektik und Rhetorik eine Schmeichelkunst werden, wenn sie nur als eine Art und Weise der Erwerbtüchtigkeit behandelt wird. Es ergibt sich aber daraus auch, was vielen der späteren Aufstellungen zum Grunde liegt, dass jede zumal herrschende Kunst, je höher sie gestellt sein und je reiner sie geübt werden soll, desto mehr von dieser Beimischung des Gewinnenwollens frei sein muss. Der zweite Punkt ist die von den Mitunterrednern sehr leicht, ja unerachtet mancher damaligen der Sache günstigen Umstände doch zu leicht zugestandene Behauptung, dass nämlich die, welche am meisten geeignet sind zu regieren, sich doch damit nur deshalb befassen, weil eine Strafe darauf steht, und wenn auch keine andere doch die, dass sie widrigenfalls selbst von Schlechteren regiert werden. Indes dürfen wir die Leichtigkeit, mit welcher dieser für den platonischen »Staat« höchst bedeutende Satz hier im Allgemeinen durchgeht, ihm nicht zum Fehler anrechnen, da die besondere Art, wie er hernach in Anwendung gebracht wird, sich in einer höchst glänzenden Darstellung rechtfertiget. Drittens ist noch zu beachten, dass schon die letzte Verhandlung des Sokrates mit dem Thrasymachos die Wendung nimmt, die Gerechtigkeit nicht darzustellen als etwas nur zwischen zwei von einander gesonderten stattfindendes, sondern auch als etwas inneres, und so auch die Ungerechtigkeit als etwas innerlich Zwiespalt und Zerstörung anrichtendes, wenn sie den Teilen eines und desselben Ganzen gegen einander einwohnt. Durch welche Betrachtung nun auch der Weg gebahnt ist zu der Art und Weise, wie die Frage von der Gerechtigkeit im folgenden behandelt wird.
Die Bestimmung dieser Art und Weise und die Vorbereitungen zu dem beschlossenen Verfahren enthält nun der zweite Teil des Werkes, welcher das zweite und dritte und auch noch den Anfang des vierten Buches umfasst. Die Fortschreitung aber ist diese.
An jene Klage des Sokrates, dass der Begriff der Gerechtigkeit noch nicht aufgefunden sei, schließt sich eine Deuterologie des Glaukon für den Thrasymachos, als habe dieser seine Sache zu früh aufgegeben, indem, dass die Gerechtigkeit mehr nutze als die Ungerechtigkeit, noch keineswegs erwiesen sei. Denn als nützlich gezeigt sei nur der Schein der Gerechtigkeit. Um sie aber recht zu prüfen, müsse man vielmehr den Gerechten denken mit dem ganzen Schein der Ungerechtigkeit belastet, dem Ungerechten hingegen müsse man die Verborgenheit zugestehen, und ihn mit dem ganzen Schein der Gerechtigkeit ausstatten. Und nachdem Glaukon auf diese Weise die Ungerechtigkeit gepriesen, tritt auch Adeimantos auf, und stellt noch die Forderung, das Lob der Gerechtigkeit müsse auch von der Freundschaft der Götter schweigen, und nichts, was irgend Belohnung sei, dürfe in Betracht kommen, sondern nur, was beide an und für sich an dem Menschen ausrichten, sei die Frage. Wenn nun durch diese Forderung Platon gleichsam sich selbst überbietet, und die sokratischen Darstellungen im »Gorgias« und »Phaidon«, was diesen Punkt betrifft für unzureichend erklärt: So ist doch erst nun ein rein ethischer Boden gewonnen, und derselbe Sokrates übernimmt die geschärfte und erschwerte Aufgabe, und legt den Entwurf seines Verfahrens dar, dass er nämlich die Gerechtigkeit zuerst im Staat aufsuchen wolle, wo sie ja müsse in größeren Zügen und also kenntlicher zu schauen sein, und dann erst werde er zur einzelnen Seele zurückkehren, um zu sehen ob und in wiefern sie auch da dasselbe sei wie dort. Dieser Entwurf ist auch ganz so und in derselben Ordnung, wie hier angekündigt, in dem folgenden dritten Hauptteil des Werkes ausgeführt, dieser zweite aber stellt nun zuvörderst zu jenem Behuf den Staat selbst dar, wie er entsteht und wie die Menschen in ihm und für ihn gebildet werden.
Hiebei ist nun zuerst merkwürdig, wie Sokrates den Staat zwar aus dem Bedürfnis entstehen lässt, welchem die ursprüngliche Verschiedenheit der Menschen zum Grunde liegt, weil nämlich nicht jeder zu allem, was das Leben erfordert von Natur gleich geschickt sei, und also auch nicht durch Übung zu allem gleich gut gewöhnt werden könne; ohne dass er jedoch auch nur mit Einem Worte angäbe, wie doch die sich finden sollen, welche sich so einander ergänzen müssen. Allein wenn er auch den Staat als ein Werk der Not ansieht: So ist doch seine Meinung gewiss nicht gewesen, dass er durch willkürliches Umhersuchen oder zufälliges Zusammentreffen der Einzelnen entstehen solle; sondern die allgemeine hellenische Voraussetzung liegt dabei zum Grunde, dass jede verwandte Masse auch in einem kleinen Umfange – wie denn der deutsche Leser unseres Werkes nicht genug daran erinnert werden kann, dass Stadt und Staat im hellenischen eins und dasselbe ist – eine solche Vollständigkeit der Naturen hervorbringt, und jenes Bedürfnis ist nur aufgestellt als die gesellige Natur des Menschen repräsentierend, und das Geschäft des Staates besteht darin, das Nebeneinanderleben in ein geordnetes Durch- und Füreinanderleben zu verwandeln, um so die Menschen in einem bestimmten Maß auf eigentümliche Weise zusammenzuhalten. Auch dieses aber ist auf der andern Seite nicht ohne bestimmte Beziehung auf die Seele, sofern sie nicht nur hier, sondern auch anderwärts bei Platon als ein zusammengesetztes dargestellt wird, und zwar so, dass wenn ein menschliches Leben sein soll, keiner von ihren Bestandteilen irgend eines von den andern entraten kann. – Bedenklicher schon erscheint dieses, dass die Notwendigkeit auf Krieg und Verteidigung Bedacht zu nehmen, mit welcher die ganze Organisation des platonischen Staates auf das genaueste zusammenhängt, nur aus einem Streben nach Wohlleben abgeleitet wird, welches Streben doch Sokrates selbst eigentlich mißbilligt, und nur die allereinfachste auf die Produktion der unentbehrlichsten Bedürfnisse sich beschränkende Gesellschaft für die eigentlich gesunde erklärt, auf welche Weise denn in dem Staat selbst, so lange er sich jener Gesundheit erfreut, nicht füglich eine andere Gesetzgebung vorkommen könnte als gerade die, welche Sokrates am Ende dieses Teiles als unbedeutend übergeht, nämlich die über den Tausch und über die vertragsmäßigen Handlungen. Wendet man nun aber eben dieses auch auf die Entstehungsart eines geordneten Zustandes in der Seele selbst an: so würden dann alle Tugenden auf einem krankhaften Zustande beruhen. Vielleicht jedoch ist nur jenes Lob eines ganz unentwickelten gesellschaftlichen Zustandes, als sei er die eigentliche Gesundheit, nicht so ernsthaft zu nehmen als es in neueren Zeiten von Vielen ist gesungen worden. Denn wenn gleich auf die ungestüme Forderung der Andern Sokrates vorzüglich sinnliche Genüsse, Bequemlichkeiten und Künste, die im Verfolg größtenteils verworfen werden, als dasjenige namhaft macht, was demnach eingelassen werden solle: so fehlen doch in der Beschreibung jener ursprünglichen einfachen Gesellschaft, wohlbedächtig möchte ich glauben, auch alle geistigen Elemente, ohne welche das Leben nicht zu leben ist. Auch hievon liegt also die eigentliche Abzweckung wohl in der Bezugnahme auf die Seele, in welcher ja auch erst bei größerer Mannigfaltigkeit sinnlicher Reizungen und bei sich vervielfältigender Tätigkeit die Tugend bestimmt hervortreten und der Gegensatz zwischen gut und schlecht sich entwickeln kann, vorher aber nicht. – Nur das scheint freilich die Darstellung des Staates selbst zu sehr jener Beziehung aufzuopfern, dass weil in der Seele die Trennung der Funktionen der Grund ist, worauf die ganze folgende Tugendlehre ruht, deshalb auch die Verteidigung und Kriegführung, weil sie einer eignen Funktion in der Seele entspricht, unerachtet doch das Kriegführen im Staate nur unterbrochen vorkommt, doch von allen andern Geschäften gesondert einen eigenen Stand bildet; so dass Platon hier als ein geschworner Verteidiger, der älteste philosophische wahrscheinlich, der stehenden Heere erscheint. Und nicht einmal mit gehörigem Rechte, da man doch wohl nur von den Führern des Heeres sagen kann, dass ihr Geschäft eine Kunst sei, die Leistungen des gemeinen Kriegers hingegen, sehe man nun auf das Tun oder auf das Erdulden, nichts in sich schließen, wozu die Fertigkeit nicht vermittelst einer gymnastischen Erziehung auch neben jedem andern Geschäft erworben werden könnte, jene Bürgschaft aber, welche ein fester Wille das Bestehende festzuhalten gewährt, jeder Bürger muss geben können, so dass das Platonische Kriegsheer, wie genügsam die Männer auch seien, doch immer eine unverhältnismäßige Last bleibt für die erzeugende Klasse. So leicht aber auch diesem Übelstande wäre abzuhelfen gewesen, wenn er die gemeinen Krieger aus den Gewerbtreibenden genommen und nur die Anführer zu einer eignen Abteilung gebildet hätte, er tat es nicht, weil dann das eiferartige in der Seele keinen ganz eigentümlichen und vollständigen Repräsentanten gehabt hätte im Staat. So sehr erscheint die Darstellung des Staates an und für sich hier untergeordnet, und alles nur darauf berechnet und dadurch bestimmt, dass er das vergrößerte Bild der Seele sein soll um an demselben die Gerechtigkeit besser zu erkennen.
Diese Unterordnung bestätigt sich auch durch das gleich folgende. Denn nachdem bestimmt worden, von welcher Gemütsart diejenigen sein, und welcher natürlichen Vorzüge sie sich erfreuen müssten, welche den Staat verteidigen sollen, wird doch nur unter dem leicht zugegebenen Vorwande, dass auch das nützlich sein werde zur Untersuchung der Gerechtigkeit, von der Art ihrer Erziehung gehandelt. Und so ist es auch offenbar wohl für die einzelne Seele von großer Wichtigkeit, was hier als der Maßstab aufgestellt wird, wonach alle pädagogischen Mythen zu beurteilen seien, dass sie nicht glaube, die Götter seien des Übels Urheber. Denn das eiferartige, wenn es mit Anstrengung gegen die zerstörenden Neigungen kämpfen soll, wird, beschwichtiget werden durch den Glauben, dass diese auch in den Göttern seien, und eben so wenig wird es auf schlichte Wahrheit kräftig dringen können, wenn ihm entgegnet werden kann, dass die Götter selbst sich ihren Lüsten zu Liebe verwandeln und Betrug ausüben. Auf die Verfassung und Anordnung des Gemeinwesens hingegen hat solcher Wahn unmittelbar keinen Einfluss, sondern nur, sofern er die einzelnen Seelen verdirbt. – Dasselbe lässt sich von allem pädagogischen in diesem Teile des Werkes behaupten, dass es am meisten auf den Einzelnen geht, und zwar in rein ethischer Beziehung, um in der Seele Eintracht hinsichtlich des Herrschens und Gehorchens zu bewirken, und damit jeder wesentliche Teil derselben nur das seinige tue und nicht darüber hinausgehe. Nur dass überall schon der Grundsatz berücksichtiget, wird, der Staat könne nicht besser sein als die Masse der Einzelnen, weshalb denn seine Ruhe von der Unbeweglichkeit der Sitte abhängt und seine Trefflichkeit von der Tüchtigkeit der Einzelnen in ihrer Art. So wie auch bei der Maxime, dass unter den Verteidigern nur diejenigen an der Regierung teilnehmen sollen, welche nichts im Stande wären zu tun als wodurch das Wohl des Ganzen gefördert wird, schon vorschwebt, was erst gegen das Ende des Werkes ausgeführt wird, dass nämlich die Vernunft allein beurteilen könne, was auch den andern Teilen der Seele heilsam ist, und dass der Vernünftige allein den Wert auch der andern Lebensweisen zu schätzen wisse. Von dieser rein ethischen Abzweckung auf den Einzelnen macht freilich eine Ausnahme die aufgestellte Lebensordnung für die Verteidiger, die ganz zu dem eigentümlichen des platonischen Staates gehört. Eben deshalb aber wird sie auch als eigentlich hieher nicht gehörig hier nur oberflächlich angelegt, und ist nur aus dem zu verstehen, was weiter unten ausführlich darüber gesagt wird. Wogegen das Gesetz, welches am Ende dieses Teiles geltend gemacht wird gegen Adeimantos, dass die Glückseligkeit im Ganzen des Staates sein müsse, nicht in einem einzelnen Teile, so wie auch die Vorschrift, dass Reichtum und Armut gleichmäßig von dem gemeinen Wesen müssten abgehalten werden, ganz hieher gehören, und nicht minder für die einzelne Seele gemeint sind als für den Staat. – Was aber ist zu antworten, wenn ein wohlmeinender jedoch etwas herber Wahrheitsfreund fragt, was denn in einem auf so rein ethischem Grunde erbauten Werke davon zu halten sei, dass Platon jene heilsame Unbeweglichkeit der Sitte vornehmlich durch ein falsches Vorgeben ober wie man sagt durch einen frommen Betrug zu erzielen meine, die Wahrheit der kindlichen Erinnerung nach Möglichkeit verfälschend, und mit göttlichen Befehlen und weissagenden Sprüchen Scherz treibend, so dass auch Sokrates selbst zaghaft genug mit diesem Teil seiner Rede ans Licht kommt. Diese Zaghaftigkeit jedoch ist wohl mehr scherzhaft zu nehmen, als möchte jemand etwas handfest alles mythische ganz und gar verwerfen wollen. Denn wenn Sokrates vorher das mythische überhaupt so erklärt, dass das meiste darin falsch sei, einiges aber auch wahr: so unterscheidet sich nun das gute von dem schlechten in dieser Gattung vornehmlich dadurch, wo die Wahrheit und wo die Dichtung ihren Sitz hat. Hier nun ist nur die Darstellungsweise Dichtung, das Wesen der Sache aber ist wahr; und fast jeder einzelne Punkt wird anderwärts in strengem Zusammenhange mit den Grundansichten vorgetragen. Denn die Verschiedenheit der Naturen geht doch unter göttlicher Vorsehung hervor aus den geheimsten Tätigkeiten des planetarischen Lebens; und eine Erziehung, welche nichts anders will, als so lange die Zöglinge sich selbst noch nicht leiten können das so gewordene weiter entwickeln, wird billig noch auf dasselbe Prinzip zurückgeführt. Und als göttliche Ordnung erweiset sich das hernach von allen Seiten, dass ein Gemeinwesen untergehen muss, in welchem Unbefugte und innerlich nicht Berufene zur Herrschaft gelangen; so dass dieserhalb unserm Schriftsteller die Rechtfertigung wohl nicht fehlen möchte. – Und auch das darf man ihm billigerweise wohl nicht bloß als Furcht vor dem Mißgeschick des Meisters und Anderer auslegen, dass nachdem der Staat so weit erbaut ist, er sich weigert eine Gesetzgebung über die Gottesdienste selbst zu machen, sondern diese dem vaterländischen Apollon überlässt. Wir wenigstens, die wir wissen, wie wenig immer die Neueren geschafft haben, die eine neue Verehrung des höchsten Gottes willkürlich und von frischem stiften wollten ohne geschichtliche Grundlage, dürfen wohl dem Platon um so weniger ähnliches zumuten, als er einer Zeit angehört, wo niemand eine Vorstellung haben konnte von einem Gottesdienste, der nicht volkstümlich wäre, und als er hier keineswegs wirklich Erdgeborne fabelhaft zusammenbringt auf irgend einem ganz neuen geschichtlosen Boden, sondern alles hier, wie abweichend auch von allem bisherigen, doch vollkommen hellenisch zugeht. Wenn sich Platon auch in den bisherigen Büchern schon mutig genug gegen alle die Idee des höchsten Wesens entwürdigende Fabelei erklärt: so war er zugleich zu tiefsinnig um sich der flachen raisonnierenden Göttervernichtung einiger Sophisten gleich zu stellen, und nicht vielmehr das wunderbare Gewebe von Naturahndung und geschichtlicher Sage in der hellenischen Götterlehre in Ehren zu halten und in guten Nutzen für seine Bürger verwenden zu wollen. Daher sei es ihm unverargt, dass er die Anordnung der heiligen Dinge in seinem Staat am liebsten dem vaterländischen Gotte überlässt, dessen Sprüche aus den geheimnisvollen Tiefen des Mittelpunktes der Erde emporsteigen. Und hier, nachdem die Grundlinien des Staates so weit entworfen sind, beginnt, deutlich genug bezeichnet dadurch, dass Sokrates den Adeimantos auffordert nun nicht nur seinen Bruder, sondern auch den Polemarchos und die Andern insgesamt herbeizurufen, der dritte Teil des Werkes, welcher nur den übrigen Teil des vierten Buches umfasst, aber doch nicht nur den Begriff der Gerechtigkeit aufstellt, sondern auch Erklärungen aller andern Tugenden, und zwar zuerst wie sie sich im Staate darstellen. Dann aber, nachdem gezeigt worden, dass und wie dieses Verfahren auf die einzelne Seele anzuwenden sei, werden dieselben Tugenden ebenmäßig auch in dieser nachgewiesen.
Hier ist nun zuerst auffallend, dass die vier sonst schon bekannten Kardinaltugenden als den Begriff des Guten erschöpfend dargestellt werden, ohne irgend einen Beweis und ohne dass ein solcher schon früher in irgend einer andern Schrift wäre mitgeteilt worden. Und doch beruht auf dieser Voraussetzung die Richtigkeit des ganzen Verfahrens; denn nur, wenn diese vier das ganze Gebiet der Tugend ausmessen, kann man sagen, wenn dreie davon erklärt sind, müsse dann das noch übrige die Gerechtigkeit sein. Ja man kann auch nicht einmal annehmen, jener Beweis sei aus mündlichen Verhandlungen bekannt gewesen, oder in einer verloren gegangenen Schrift mitgeteilt worden. Denn ein solcher Beweis konnte nicht geliefert werden, ohne dass zugleich die vier Tugenden gründlich erklärt wurden; und sonach wäre in dem letzten Falle unser ganzes Werk überflüssig, und im ersten Falle wäre kein Grund, warum nicht der Beweis eben so gut wie die Erklärungen sollte schriftlich wiederholt worden sein. Platon ist also hierüber nur zu rechtfertigen, wenn das Gebäude, so wie es hier aufgeführt ist, sich in sich selbst hält, und das ganze Verfahren, wodurch die Erklärungen aller dieser Tugenden gewonnen werden, durch unmittelbare Anschaulichkeit die Überzeugung des Lesers so in Anspruch nimmt, dass er zu seiner Befriedigung nichts weiter vermisst. Wie nun die Tugenden zuerst im Staat aufgesucht werden, beruht die Vollkommenheit desselben ganz auf dem richtigen Verhältnis der drei Klassen, in welche Sokrates die Bewohner geteilt hat; und wenn die vier Tugenden dieses leisten, dass durch dieselben jede dieser Klassen in das rechte Verhältnis zu den übrigen und zu dem Ganzen tritt, so kann sich freilich dem Anerkenntnis, dass der Staat vermittelst derselben ein guter sein müsse, niemand entziehen. Und bewundernswürdig muss wohl jeder die Kürze und Bündigkeit finden, mit welcher dieses gezeigt wird; ja diese Kürze in der Ausführung selbst erscheint zugleich als die schönste Rechtfertigung für das gesamte ethisch vorbereitende Verfahren sowohl in den frühern Büchern dieses Werkes als in den vorhergehenden Gesprächen. Wie genau nun auch in diesem Abschnitt alles auf den Staat bezogen sei: so wird doch unverkennbar immer auch schon auf die einzelne Seele im voraus Rücksicht genommen. So bei der Weisheit ist die Formel, dass nicht durch irgend eine Erkenntnis von etwas im Staat, sondern nur durch die vom Staate selbst und von seiner Art zu sein der Staat weise sei, vornehmlich um der Anwendung auf die Seele willen aufgestellt. Eben so die etwas zu leicht zugegebene Bemerkung, deren Richtigkeit für den Staat vielleicht erfolgreich zu bestreiten wäre, dass diese Erkenntnis nur einem sehr kleinen Teile der Bürger einwohnen könne, scheint mehr um der Seele willen hervorgehoben zu sein. Denn so wunderlich es auch klingt, dass die Vernunft soll der kleinste Teil der Seele sein: so ist doch gewiss das begehrliche, weil es sich so vielfach verbreitet, das größte, und deshalb erscheint das einfache sich immer gleich bleibende und immer nur innerlichste natürlich als das kleinste. Auch bei der Tapferkeit ist die Bemerkung, dass die gegebene Erklärung zunächst die bürgerliche Tapferkeit sei, darauf zu beziehen, dass die Tapferkeit der einzelnen Seele nicht etwa nur das zu ihrem Gebiete habe, was sich aus den bürgerlichen Verhältnissen entwickelt, sondern dass ihr gebühre alles, was je die Vernunft gebieten kann, gegen Lust und Unlust durchzusetzen. Durch solche Andeutungen wird nun hernach die Anwendung der aufgestellten Erklärungen auf die Tugenden der einzelnen Seele noch mehr abgekürzt. – Nächstdem muss auch wohl dieses dem Leser ziemlich gewagt und von vorn herein unklar erscheinen, dass alle andere Tugenden eher gesucht werden, und nur grade die Gerechtigkeit, welche doch der eigentliche Gegenstand der Untersuchung ist, nicht nur bis zuletzt aufgespart bleibt, sondern auch nicht einmal unmittelbar und geradezu gefunden und beschrieben wird, welches doch das einleuchtendste wäre, sondern nur als das übrig bleibende kommt sie auf einem indirekten Wege zum Vorschein. Das erste nun, dass sie bis zuletzt aufgespart bleibt, kann man sich freilich schon daraus erklären, dass sonst weniger Veranlassung gewesen wäre, die anderen Tugenden auch auf eine genügende Erklärung zurückzuführen; indes ist dies doch nicht der einzige Grund, vielmehr hängt beides, dass die Gerechtigkeit zuletzt und dass sie nur auf solchem Wege gefunden wird, genau zusammen, und es hat damit folgende Bewandtnis. Die Tugend im allgemeinen war schon früher beiläufig und im weiteren Sinne erklärt worden als diejenige Eigenschaft eines Dinges, vermöge dessen es sein eigentümliches Geschäft gut zu verrichten im Stande ist. Nun sollen die vier Tugenden aufgefunden werden im Staat; in demselben aber waren uns aufgezeigt worden die drei Klassen oder Gattungen der Bürger, von denen zweie zwar jede ein eigentümliches Geschäft im Staate verrichten, die dritte aber, die der Gewerbtreibenden, eine Mannigfaltigkeit von Geschäften umfasst, die aber nicht eigentlich Geschäfte im Staat sind, sondern jeder sucht nur durch Verrichtung des seinigen zunächst seinen eigenen Vorteil. Auf diese Weise nun zerfallen die vier Tugenden in zwei Klassen, denn jene beiden Gattungen haben vermöge ihres eigentümlichen Geschäfts auch jeder eine eigene Tugend. ein Staat nämlich sei noch so weise, er ist es immer nur durch die Weisheit seiner Hüter, und er sei noch so tapfer, so ist er es immer nur durch die Tapferkeit der Jugendblüte jener Klasse, nämlich der Vorfechter, der dritten Gattung aber wird Weisheit und Tapferkeit auch nicht einmal zugemutet. Nun ist freilich wahr, der Staat ist durch die Weisheit der Weisen nur weise, wenn diese Weisheit gesetzgebend und leitend wirken kann, das heißt, wenn ihr Folge geleistet wird, und so auch nur tapfer durch die Tapferkeit der Vorfechter, wenn diesen wie den Regierenden das nötige geleistet wird; und so scheinen zu diesen beiden Tugenden des edleren Teiles, denn die Weisheit liebenden sind doch immer nur eine engere Auswahl der Eifrigen, zwei andere des niederen zu gehören, nämlich der Gehorsam und der Fleiß, wodurch denn vier Tugenden unter die beiden Hauptteile des Staates gleichmäßig und gleichartig verteilt würden; und gewiss möchte von Seiten des Platonischen Staates gegen eine solche Konstruktion nicht leicht etwas einzuwenden sein. Allein Gehorsam und Fleiß sind nicht Besonnenheit und Gerechtigkeit, und die eigentliche Tugend worauf alles abgesehen ist, würde auf diese Art gar nicht sein gefunden worden, weder im Staat noch auch auf diesem Wege in der Seele, die Anwendung auf welche sich doch auch hier überall als die Hauptaufgabe erweiset. Geht man also auf die einmal angenommenen vier Tugenden zurück, und bedenkt, dass Besonnenheit und Gerechtigkeit im Staate wenigstens sich in sofern anders verhalten als Weisheit und Tapferkeit, dass diese beiden nur Einigen zugemutet, jene beiden aber niemanden erlassen werden können: so folgt, dass Besonnenheit und Gerechtigkeit zwar das leisten sollen, was Gehorsam und Fleiß verbürgen, dass sie aber nicht ausschließende Tugenden des einen Teils sondern gemeinsame Aller sein müssen. Auch so aber können sie sich, sofern sie dem edleren Teile einwohnen, nur auf die eigentümliche Unfähigkeit und Bedürftigkeit des unedleren Teiles, sofern sie aber diesem einwohnen, nur auf die eigentümlichen Tugenden des edleren Teiles beziehen; daher denn diese letzteren in der Darstellung notwendig vorangehen mußten. Wie nun aber Besonnenheit und Gerechtigkeit selbst von einander unterschieden werden, und weshalb auch ohne Rücksicht darauf, dass die Gerechtigkeit am schicklichsten den Schluss macht, die Besonnenheit ihr auch an und für sich vorangehen müsse, das ist wohl einer der schwächsten Teile der Darstellung, und zwar nicht nur, sofern diese Tugenden im Staat aufgezeigt werden, sondern auch in der Seele. Denn die Zusammenstimmung aller Abteilungen darüber, welche herrschen soll, und die dem gemäße Tätigkeit einer jeden Abteilung in Beziehung auf herrschen und gehorchen, dieses beides ist weit schwieriger auseinander zu halten, als es ist diese beiden Tugenden von jenen oder auch jene unter sich zu sondern; und deshalb scheint es nicht unangemessen, dass, nachdem die drei ersten Tugenden gefunden waren, soviel sonderbare und seufzerreiche Zurüstungen gemacht werden, um nun auch noch die Gerechtigkeit als eine besondere zu finden. Denn auf der einen Seite kann man sagen, dasjenige, dem die Gerechtigkeit erst die gehörige Kraft gebe, seien nicht sowohl alle drei Tugenden, als vielmehr die Besonnenheit allein, indem die in dieser gesetzte Zusammenstimmung durch Gerechtigkeit in Tat übergehe, also kräftig werde; dann aber sei auch auf der andern Seite in diesen beiden zusammen die ganze Vollkommenheit des Staates erschöpft; denn die Weisheit sei nur derjenige Teil der Gerechtigkeit, welcher der ersten, und die Tapferkeit derjenige, welcher der zweiten Abteilung zufalle, indem es offenbar ungerecht wäre, wenn die Weisheitliebenden nicht Ideen entwickeln und Gesetze aufstellen, und eben so wenn die Eiferartigen nicht antreiben und abwehren wollten. Und eben so weiter unten, wo die gegebenen Erklärungen auf die einzelne Seele angewendet, und um die der Gerechtigkeit zu prüfen die bekannten Gemeinplätze vorgebracht werden, könnte man sagen, dass auch der Besonnene dies alles unterlassen würde aus Mangel an aufgeschraubten und unnatürlichen Begierden. Indes nehme dies niemand für einen bedenklichen Tadel gegen die Sache selbst, welche dem Mittelpunkt des ganzen Werkes so nahe liegt. Dieser Tadel trifft höchstens die Aufstellung jener vier zusammengehörigen Tugenden, welche Platon offenbar genug nur mit richtigem praktischen Sinne aus Ehrfurcht für das Bestehende aufgenommen hat; wie sie denn schon auf dieselbe Weise aus dem gemeinen Gebrauch in die Lehrweise des Sokrates übergegangen sind. Statt dieser viere aber hatte Platon volle Freiheit auf der einen Seite die Weisheit, wenn er nur in dem vernünftigen Teil die Kraft erblickte mittelst des Eifers die ganze Seele in Bewegung zu setzen, auf der andern Seite aber auch die Gerechtigkeit als die einzige Tugend aufzustellen. Er konnte entweder sagen, Staat und Seele seien tugendhaft durch jenes einzigen Teiles Tüchtigkeit und Kraft, oder auch sie seien es durch aller Teile richtige eigentümliche Tätigkeit. Dass Platon, wie aus der Stellung, welche er der Gerechtigkeit in diesem Werke gibt, deutlich genug erhellt, das letzte vorgezogen hat, ist auf den Staat bezogen eine erwünschte Milderung eines sonst fast unerträglichen Aristokratismus. Denn wenn die Weisheit als die einzige Tugend angesehen wird: so haben auch nur die an der Regierung teilnehmenden, welche aus der gesamten Masse auch sich selbst ergänzen, allein Anteil an der bürgerlichen Tugend, und schon der nächst weitere Kreis, die Vorfechter nicht minder als der große gewerbtreibende Volkshaufe, sind von allem Anteil daran ausgeschlossen zu einem so strengen Gehorsam bestimmt, dass keine Tätigkeit anders von ihnen ausgehen darf, als der herrschende Teil geordnet hat; und wenn sich einer von beiden herrschsüchtig oder aus Eigennutz empört, so tragen nicht sie selbst die Schuld, sondern nur die Schwäche der Herrschenden. Da Platon aber die Gerechtigkeit als die in der Tat alle anderen in sich schließende Tugend aufstellt: so haben nun alle wesentlichen Elemente des Staates gleichmäßigen Anteil an der Sittlichkeit desselben. Von dieser Seite also muss die getroffene Wahl lobenswert erscheinen. In Bezug auf die einzelne Seele aber würden wir nach unserer Denkungsart das Gegenteil unbedenklich vorziehen, und die Weisheit als einzige Tugend aufstellen, und wenn die sinnlichen Begierden noch so unmäßig emporwüchsen, die Schuld davon lieber in der Schwachheit des vernünftigen Teiles suchen, als dass wir jenem untergeordneten Vermögen einen eigentümlichen Anteil an der Sittlichkeit beilegten. Und aus demselben Grunde würden wir schon gegen die vorangeschickte Erklärung der Besonnenheit Einspruch einlegen, indem die Formel einer freien Zusammenstimmung aller Teile der Seele in Beziehung auf das Regiment mehr einer ästhetischen als einer streng wissenschaftlichen Behandlung des Sittlichen angemessen ist. Und doch ist diese pythagorisierende Ansicht, die Tugend als Harmonie zu denken, welche erst dadurch in ihrer Vollendung erscheint, dass die Besonnenheit, als freie Zusammenstimmung der niederen Vermögen mit den höheren höher gestellt wird als die Mäßigung, die nur eine von der Vernunft errungene Gewalt über die Anmaßung der niedern Vermögen ist, diese Ansicht, welche von uns in einem vorzüglichen Sinne als heidnisch bezeichnet werden muss, ist doch nur zu sehr der Schlüssel des ganzen Werkes, und hängt mit allem auf das genaueste zusammen, was uns darin am meisten zurückschreckt, ja uns ganz verwerflich und frevelhaft erscheint. Denn hierauf zunächst beruht, dass die Ethisierung einer Gesellschaft vorzüglich von einem richtigen Verfahren bei der Erzeugung ausgehen muss; so wie auch des einzelnen Menschen Sittlichkeit zum größten Teil davon abhängig wird, dass er glücklich geboren ist. Wenn es nun freilich im Staat, zumal ein Hellene sich nicht leicht einen solchen als eine Mischung aus zwei ganz ungleichartigen Massen denken konnte, zu aristokratisch gewesen wäre, der größten Masse des Volkes die bürgerliche Tugend ganz abzusprechen, bei der Anwendung auf die Seele aber hieraus eine auch die wesentlichsten Unterschiede zerstörende Gleichmacherei entstehn muss: so sieht man wie das Verfahren bei Betrachtung der Tugend den Staat als das größere zum Grunde zu legen, wie sinnreich es auch bevorwortet und wie kunstreich es durchgeführt sei, doch nicht ohne Gefahr ist, und wie auch der größte Geist bei einer wissenschaftlichen Konstruktion nicht ungestraft das Gesetz der Einfachheit verletzt. Wird nun aber den niedern Seelenkräften soviel eingeräumt, dass sie durch sich selbst Anteil haben an der Tugend: so erscheint es da, wo diese drei Abteilungen, die herrschende die verteidigende und die erhaltende, auch in der Seele als vorhanden und als von einander verschieden nachgewiesen werden sollen, doch ziemlich willkürlich als ein allgemeiner Erfahrungssatz angenommen, dass das Eiferartige, wenn auch nicht immer mit der Vernunft, doch wenigstens niemals mit den Begierden sich verbinde. Vielmehr findet sich dieses Verderben in dem Ehrtriebe sowohl als der Scham, wenn sie einer falschen Meinung folgen, welche die angeschwellten Begierden lobt und die Aussprüche der Vernunft als Vorurteile herabsetzt; und grade was Platon mit so gerechtem Eifer im »Gorgias« und im Eingange dieses Werkes gegen den Thrasymachos bestreitet, könnte sich ohne ein solches Bündnis nicht so breit und geltend gemacht haben. Doch die Kritik über diese Gegenstände wird fast entwaffnet durch die nicht zu übersehende sehr bedeutende Äußerung, dass eine recht genaue und gründliche Erkenntnis von der Seele bei diesem Verfahren nicht zu erlangen sei. Übrigens aber ist die Nachweisung dieser drei Funktionen in der Seele besonders durch die Anwendung der Methode auch sie zugleich im Großen an den hervorstechenden Charakterzügen verschiedner Völker aufzuzeigen sehr schön und großartig; obgleich manchem edlen Hellenen es sehr schlecht mag gefallen haben, dass der gepriesene Eifer doch nur der Thrazier und Skythe in seiner Seele sein solle, und überhaupt wohl nicht ohne Einseitigkeit die oft zerstörende Rohheit dieser Völker einer engherzigen zwar und nur mechanischen aber doch der ganzen Menschheit ersprießlichen Kultur, wie die phönizische und ägyptische war, vorgezogen werden kann. – Weil aber die eigentliche Aufgabe nicht war, nur den Begriff der Gerechtigkeit aufzustellen, sondern vielmehr zwischen der gerechten und der ungerechten Lebensweise, welche von beiden förderlicher sei, zu entscheiden: so wird nun nach der Gerechtigkeit auch die Ungerechtigkeit als Vieltuerei und Auflehnung eines Teiles gegen die übrigen beschrieben; und Sokrates, obgleich er seinem Mitunterredner zugeben muss, die Sache sei schon abgemacht und unnötig das übrige noch durchzunehmen, kündigt dennoch an, er wolle um der Vollständigkeit willen die verschiedenen schlechten Lebensweisen ihrem ganzen Verlaufe nach eben so im großen an den verderbten Staatsformen nachweisen. Wie er nun dieses ankündigt am Ende unseres vierten und Anfange unseres fünften Buches, grade so führt er es hernach im fünften Hauptteile des Werkes dem achten und neunten Buche durch. Hier aber wird er von Polemarchos und Adeimantos, denen auch Thrasymachos sich beigesellt, in andere Untersuchungen hineingezogen, welche das fünfte sechste und siebente Buch einnehmend den vierten Hauptteil des Werkes bilden, aber unerachtet ihres bedeutenden Umfanges und noch bedeutendern Inhaltes doch schon hier und noch mehr am Anfange des achten Buches, wo der ursprüngliche Faden wieder aufgenommen wird, auf das allerdeutlichste als eine hineingeworfene und fast abgedrungene Episode bezeichnet sind.
Dieser ganze vierte Hauptteil knüpft sich an die Forderung des Adeimantos, dass Sokrates, ehe er auf die vorgezeichnete Weise weiter gehe, zuvor noch zur Vollendung des als Vorbild aufgestellten Staates, auch die eigentümliche Erziehung derer, welche darin zur Regierung und Verteidigung bestimmt sind, darstellen, und sich zugleich über die Geschlechtsverbindungen, aus welchen sie hervorgehn, näher als vorher geschehen erklären möge; und zwar fordert er dieses als etwas höchst wichtiges, nicht etwa für die Frage von der Gerechtigkeit, sondern für die richtige Verfassung des Staates, so dass also gegen jede etwanige gekünstelte Anwendung des in diesen Büchern verhandelten auf jene Hauptfrage von der Gerechtigkeit in der einzelnen Seele und von dem Verhältnis des gerechten Lebens zur Glückseligkeit schon hiedurch protestiert wird. Die erste Erörterung nun über die Verbindung der Geschlechter unter der herrschenden Abteilung des Staates, bezieht sich fast ausschließend auf jenen dem Platon eigentümlichen urbildlichen Staat, die zweite aber, von der Bildung zu dem was diese Männer und Frauen in sich vereinigen sollen, und besonders zur Philosophie handelnd, hat natürlich eine weit allgemeinere Abzweckung, und ist als weitere Fortsetzung dessen, was in den ersten Büchern über die allgemeinen Bildungsmittel für die erste Jugend gesagt worden ist, gleichsam eine allgemeine Platonische Enkyklopädie und Methodologie für alle Wissenschaft, aus pädagogischem Standpunkt freilich, aber doch in dem allgemeinsten Sinne wie überhaupt eine durchgebildete Anordnung des Lebens in hellenischem Geiste die höchste Aufgabe der Philosophie war. – Was nun den ersten Abschnitt dieses Teiles, den von der Verbindung der Geschlechter anlangt, so scheint mir die Art wie er eingeleitet wird, wie Sokrates sich sträubt und die Sache gern umgangen wäre, gar nicht darauf zu deuten, dass er etwas aller Meinung zuwiderlaufendes und noch nie gehörtes hier zum erstenmal in das Gespräch der Leute bringen wolle; vielmehr finde ich darin die deutlichsten Spuren davon, dass diese Lehre schon früher, natürlich aus seinen mündlichen Vorträgen und den Mitteilungen seiner Schüler, bekannt war und eine spöttische Behandlung erfahren hatte, in welchem Falle dann Anspielungen der Komiker auf die Platonische Gemeinschaft der Weiber für die Zeit der Abfassung des vorliegenden Werkes nichts beweisen könnten. Doch ist dies so sehr eine Sache des kritischen Gefühls außerhalb aller Argumentation liegend, dass ich nichts tun kann als die Leser, welche sich auch für solche Fragen der historischen Kritik interessieren, zu einer aufmerksamen Betrachtung der Stelle aus diesem Gesichtspunkt einzuladen. Bei den Anordnungen nun, welche hier in Betreff der Geschlechtsverbindungen für jenen Staat aufgestellt werden, liegt die Lehre von der Gleichheit beider Geschlechter zum Grunde, wobei allerdings zugestanden wird, dass das weibliche das schwächere sei, jedoch nicht auf solche Art, dass ihm für irgend eine ganze Gattung menschlicher Tätigkeit die Kräfte fehlten; also auch in dieser Beziehung im entschiedenen Streite mit der herrschenden Ansicht und Praxis seiner Zeit. Hat nun gleich das Christentum im Ganzen denselben Weg eingeschlagen, insofern es überall den Zustand des weiblichen Geschlechtes der Gleichheit mit dem männlichen näher gebracht hat, als es ihn fand: so lässt sich doch keineswegs sagen, dass diese Lehre irgendwie mit zu den Annäherungen an christliche Denkungsart gehörte, die man bei Platon finden will. Vielmehr sind sowohl die Gründe, von denen er ausgeht, als die Folgerungen, die er entwickelt, von der Art, dass aus dem Standpunkte des Christentumes auf das lebhafteste dagegen protestiert werden muss. Anstatt nämlich auf die Selbigkeit der Vernunft in beiden Geschlechtern zurückzugehen, welche also auch im wesentlichen auf dieselbe Weise müßte entwickelt und zur Herrschaft gebracht werden, woraus freilich keine Gleichheit gymnastischer Übungen gefolgt sein würde, geht er um seinen Satz zu erweisen auf die Tiere zurück, ohne dass ihm, so sehr er auch in die Tiefen der Natur einzudringen strebt, in die Augen gefallen wäre, wie zugleich mit der Steigerung des organischen Lebens auch der organische Gegensatz beider Geschlechter sich schärfer spannt, und also bei dem Menschen am stärksten heraustreten muss. Eben so wenig scheint er zu bedenken, welch ein großer Unterschied in Bezug auf die gemeinschaftlichen Beschäftigungen daraus entsteht, dass Empfangen und Gebären bei dem Menschen nicht periodisch ist, sondern von allem Einfluss der Jahreszeiten frei. Indes diese offenbar überragend physische Behandlung des Gegenstandes zeigt wohl hinreichend, dass Platon ihn nicht sokratisch sondern weit mehr pythagorisch genommen hat. Wie nun ferner von der größeren Gleichheit der Geschlechter aus die christliche Sitte den reinsten Begriff der Ehe und die vollkommenste Gestaltung des Hauswesens ins Leben gerufen hat: so hat den Platon seine Ansicht von dieser Gleichheit zu einer völligen Zerstörung von beiden verleitet, und dies ist es was jeder unserer Zeitgenossen von gesundem Sinn gern bis auf die letzte Spur aus diesem Werke verlöschen möchte. Allein diese Spuren führen sehr weit; ja ich möchte sagen hier konzentriert sich alles verfehlte der hellenischen Geistesentwicklung, und es zeigt sich deutlich das Unvermögen dieser Natur zu einer befriedigenden Gestaltung ethischer Verhältnisse. Auch Platon, dem man aus Mißverstand häufig in dieser Beziehung ganz falsche Ehre angetan hat, ist in der bloß sinnlichen Ansicht des Geschlechtsverhältnisses so befangen, dass er für die Bestimmung des Geschlechtstriebes zu einer persönlichen Neigung kein anderes Motiv anerkennt als den Reiz, den die Betrachtung schöner sich mannigfaltig und lebhaft bewegender Gestalten hervorbringt, so dass ein geistiges Element in der Geschlechtsliebe ihm völlig fremd geblieben ist. Eine solche leidenschaftliche Neigung kann nun im Platonischen Staate ihr Ziel nicht selbst erreichen, sondern sie ist nur ein mitwirkendes Motiv für die, welche die Brautleute zusammen führen. Diese aber müssen um den möglichsten Vorteil für das Gemeinwesen daraus zu ziehen, und doch zu verhindern dass über viel gewünschte Schönheiten kein Zwiespalt entstehe zu einem freilich insgeheim autorisierten Betrug ihre Zuflucht nehmen, und also mit der Wahrheit und Aufrichtigkeit das wesentlichste der persönlichen Sittlichkeit dem Gemeinwesen zum Opfer bringen. Aus demselben Reiz der Schönheit dürfen sich aber auch Neigungen in Männern zu Jünglingen entwickeln; und keineswegs hat Platon auch nur das Recht der plastischen Naturkraft hoch genug geachtet um solche Richtungen des Triebes durch die Scham besiegen zu wollen, sondern als Lohn der Tapferkeit sollen diese Neigungen begünstigt werden, so dass das Bestreben sich bürgerlich hervorzutun durch die Aussicht das Schönste aus beiden Geschlechtern zur Beute zu erlangen genährt werden darf, und dass auf solche Weise zum Gemeinnützigen und Guten gespornt werden zu können, noch zu den Vorzügen der edleren Naturen gehört, wovor unser sittlicher Rigorismus mit Recht zurückschreckt. Ja man sieht nicht nur, dass auch an den Edelsten sinnliche Leidenschaftlichkeit als ein bedeutendes Motiv gutgeheißen wird; sondern man sieht kaum, dass in solchem Leben noch eine andere Entstehungsweise einer freien persönlichen Zuneigung übrig bleibt. Auf der andern Seite muss man freilich gestehen, wenn das einmal richtig ist, dass die Wächter, damit in ihnen kein eigennütziges Wesen aufkommen könne gegen den Gemeingeist, kein Eigentum haben dürfen: so folgt nur gar zu leicht, dass sie auch kein Hauswesen haben können und keine Ehe; und dann erscheint die Gemeinschaftlichkeit der Erzeugung und der Erziehung als die leichteste Auskunft. Wenn aber als die schönste Frucht dieser Maßregel eine erweiterte Brüderlichkeit gepriesen wird, welche allem Zwiespalt am besten vorbeugen kann: so erstreckt sich diese doch nicht weiter als der Umfang jenes gemeinschaftlichen die Dunkelheit unterirdischer Vorbildung der Erderzeugten nachahmenden Erziehungshauses; und darum könnte unter diesem Gesetz immer nur eine sehr kleine Gemeinheit bestehen und sich erhalten, wie auch die Platonische nur sein sollte, und wie auch neuerlich in Amerika auf den sehr ähnlichen Grundsatz gemeinschaftlichen Erwerbes und einer von der zartesten Kindheit an gemeinschaftlichen Erziehung, nur eine kleine Gemeinde hat zu Stande gebracht werden können. In solchen untergeordneten Formen aber können die Geschicke des menschlichen Geschlechtes nicht erfüllt werden, sondern nur durch große bürgerliche Vereine, denen überall das abgeschlossene Hauswesen als ausgebildete organische Einheit zum Grunde liegt. Was also auch einem solchen aus Unwahrheit und Leidenschaft zusammengekünstelten Gemeinwesen geopfert wird: das alles kann doch nichts großes herbeiführen. Sonst aber sind in diese Darstellung völkerrechtliche Maximen besonders über das Verhalten im Kriege verwebt, welche strengen Tadel der hellenischen Unsitte in sich schließend den Weg zur Veredlung derselben vorzeichnen, wiewohl Platon auch hier in dem Gegensatz von Hellenen und Barbaren befangen bleibt. – Indem nun dieser erste Abschnitt unseres vierten Hauptteiles mit dem Zugeständnisse schließt, dass der beschriebene Staat nur als Vorbild sei gezeichnet worden, um nämlich aufzustellen unter welchen Bedingungen eine vollkommne Gerechtigkeit und ein solcher Mann möglich sei, dass man aber in der Wirklichkeit zufrieden sein müsse mit dem, was durch größtmögliche Annäherung an jenes Vorbild zu erreichen sei: so wird doch als diese Annäherung angegeben eine strenge Sonderung derer, welche als untergeordnete Naturen nur an die Dinge gewiesen sind sowohl mit ihrer Arbeitsamkeit und Geschäftsführung als mit ihrer Schaulust, und derer, welche sich als edlere für die Ausbildung des reinen Erkenntnisvermögens eignen, und sich von der verworrenen Mannigfaltigkeit der Dinge zu der klaren Einheit der Begriffe zu erheben vermögen, zu dem also, wozu auch der Platonische Sokrates in den früheren Gesprächen so oft diejenigen unfähig erweiset, welche sich doch teils selbst mit der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten befassen, teils mit der Bildung derer welche regieren sollen. Die Forderung aber soll den Zweck haben, auch in dem wirklichen Gemeinwesen jene Klasse ganz vom Regimente auszuschließen, damit die Staatsgewalt immer allein in den Händen derer sei, welche auch philosophieren. Hier handelt es sich nun notwendig um eine Erklärung dessen, was man unter Philosophieren zu verstehen hat, und Platon gibt diese in einer ziemlich gedrängten Verhandlung, worin er so weit auf die Prinzipien zurückgehend als er mußte, um nicht geradezu sich selbst zu zitieren, doch sichtlich alles voraussetzt, was wir aus den Gesprächen kennen, als deren Kern der »Sophist« anzusehen ist. Und indem er nun genau an sein Thema sich haltend auseinandersetzt, dass eine Natur, welche im Stande ist diese Richtung zu verfolgen, auch alle die Eigenschaften besitzen muss, welche zum Regieren gehören, versetzt er seine Leser aus der fantastischen Welt seines Staates plötzlich, wiewohl nur auf kurze Zeit, wieder mitten in die damaligen Verhältnisse, offenbar um ein wenig Raum zu gewinnen zur Selbstverteidigung gegen einen Vorwurf, der oft und auch kürzlich wieder erneut worden ist, dass nämlich er selbst das Vaterland im Stich lasse, und auch die ausgezeichneten Naturen unter den Jünglingen dem öffentlichen Leben abwendig zu machen suche. Adeimantos nämlich nimmt, als Sokrates jenen Satz ausgesprochen, die Partei der Gegner, welche sich auf die Erfahrung berufen, dass immer diejenigen, welche sich mit der Philosophie zu ernsthaft beschäftigen, dem Staate unnütz geworden sind. Sokrates aber verschanzt sich, um seinen Satz zu verteidigen, hinter die Behauptung, dass man von dem damaligen ganz verderbten Zustande aus die Sache nicht beurteilen könne, und setzt nun auseinander wie in solcher allgemeinen Verwirrung die wahrhaft philosophischen Naturen durch schlechte Behandlung untergehen, und dann schlechte Leute von der gewerbtreibenden Klasse sich auf eine scheinbare Weise der Philosophie bemächtigen. Diese Schilderungen, in deren einer man den Alkibiades und ähnliche nicht verkennen kann, die andere aber die rhetorisierenden Sophisten vorzüglich trifft, bringen noch immer die Gegenstände der früheren Platonischen Polemik vor Augen, um sein Verfahren zu rechtfertigen. Zugleich aber auch um dasselbe durch die stillschweigende Erklärung zu beschließen, dass wenn nicht andere Grundsätze im Staat geltend gemacht werden könnten und richtigere Sitten und Lebensweise der Lehre zu Hülfe kommen, Menschen dieser Art doch immer wieder auftreten würden. – Und so macht dieses den Übergang zu dem zweiten Abschnitt dieses Teiles; worin die Bildung derer, die zum Herrschen bestimmt sind, genauer beschrieben werden soll. Hier nun wird die Idee des Guten als der höchste Gegenstand dargestellt, welchem das Erkenntnisvermögen des Menschen sich zuwenden kann; leider freilich so als ob auch die hier bewiesene gewiss nicht häufig anzutreffende Meisterschaft in spekulativer Darstellung an diesen Gegenstand nicht hinanreiche; sondern die befriedigende Behandlung desselben wird an ich weiß nicht was für einen noch weit herrlicheren Ort gewiesen, hier aber das Gute nur in Bildern und durch weitere Ausführung bildlicher Rede als die Quelle aller Erkenntnis und alles Seins, also auch über beides gestellt, auf das herrlichste gepriesen, so jedoch, dass unläugbar auf das, was hierüber im »Philebos« teils angedeutet teils ausgeführt worden, zurückverwiesen wird. Und bei weitem erfreulicher ist hier der Vortrag als dort; ja eben dieses Bild, dass die Idee des Guten sich zu dem Gebiet des Erkennbaren verhält wie die als sein Ebenbild von dem Guten erzeugte Sonne zu dem Gebiet des Sichtbaren, gewährt durch eine treffliche Benutzung aller sich ergebenden Verhältnisse eine klare und reinliche Übersicht des ganzen Gegenstandes, dass nämlich die Vernunft sich zu dem Erkennbaren verhält wie das Auge zu dem Sichtbaren, und dass wie Licht und Auge – wobei man sich erinnern mag, welche Selbsttätigkeit in Bezug auf das Licht dem Auge schon in früheren Darstellungen beigelegt wurde – zwar nicht selbst die Sonne, aber doch das ihr mehr als alles andere verwandte sei, so auch die eines solchen Ausflusses des Guten bedürftige menschliche Vernunft in der Tätigkeit des Erkennens nicht das Gute selbst, aber doch das ihm am meisten unter allem verwandte. Und es gewährt einen tiefen Blick in eine bei unserm Schriftsteller nicht mit Unrecht sehr geheimnisvoll behandelte Gegend, wie sich Platon die Identität des Seins und des Bewußtseins gedacht hat, dass es nämlich derselbe Ausfluß des Guten, das geistige Licht, dass ich so sage, ist, welcher dem erkennbaren Wesen der Dinge oder den Begriffen die Wahrheit und der Vernunft das Vermögen zu erkennen verleiht, welches eben so die Wahrheit ihres Wesens ist. Dieses aber will sagen, dass die Vernunft irgend etwas nicht anders als in Beziehung auf die Idee des Guten und vermittelst derselben erkennen kann, und dass dem ganzen Gebiet des Sichtbaren oder, wie wir wohl sagen dürfen, des Wahrnehmbaren überhaupt, gar kein Sein entspräche, sondern es in der Tat nichts wäre als der ewig unruhige Fluß des Nichtseienden, wofern nicht durch die lebendige Einwirkung der Idee des Guten dieser Fluß festgehalten, und es so erst etwas würde, was, wenngleich auch noch an dem unstäten und unruhigen teilnehmend, doch auf das wahre Sein bezogen werden kann. Über dieses alles zwar findet der Leser nur leise Andeutungen, aber sie führen den Aufmerksamen in Verbindung mit dem oben bei der allgemeinen Erklärung der Philosophie vorgetragenen auf die früheren dialektischen Gespräche zurück, die sich nun zu solchen Resultaten verklären. Wenn aber auf der einen Seite die beiden Gebiete des Sichtbaren und Erkennbaren neben einander gestellt auch mit einander verglichen werden, so fehlt auch hier nicht ihre schon bekannte Unterordnung. Ist die Sonne nur ein Bild des wesentlichen schlechthin Guten: so verhält sich auch das leibliche Licht eben so zu dem geistigen, und ist von dem geistigen Gebiet aus betrachtet nur die Finsternis, in welcher jede Seele umhertappt, die von dem Reiz der irdischen Sonne bezaubert ohne weiter hinauf zu streben allein bei den von ihr erleuchteten Dingen weilt. Und wie sich das ganze Gebiet des Sichtbaren als Bild verhält zu dem des Erkennbaren: so gibt es in jedem von beiden wieder den ähnlichen Unterschied, ein in seiner Art wahres und dessen Bild. Hier nun kann es überraschen, dass die mathematischen Gedankendinge, Zahl und Figur, als Bilder der Ideen angegeben werden; indes wollen wir immer zufrieden damit sein, dass dieser Zweig der Verstandestätigkeit hier seine feste Stellung bekommt, und wir zugleich einen Schlüssel erhalten für den Platonischen Gebrauch der Zahl und Figur auf dem philosophischen Gebiet und für Platons Verhältnis zur phythagorischen Schule in dieser Beziehung. Sehr merkwürdig sind auch die Erklärungen über das Verhältnis der mathematischen Methode zur dialektischen, wiewohl sie mit jener Bestimmung in gar keiner Verbindung stehen, ausgenommen durch ein hier auch gar nicht angedeutetes Mittelglied, sofern nämlich die mathematischen Voraussetzungen auch als Bilder eigentlicher Anfänge, Prinzipien, betrachtet werden können. So wenigstens wäre es nach diesen Reden dem Platon ganz angemessen sich von denen zu unterscheiden, welche das Wesen der Dinge selbst durch Zahl und Figur bestimmen zu können glauben, und wähnen, dass sie im philosophischen Sinne des Wortes erkennen, während sie nur mathematische Verknüpfungen machen. Wenn aber schon früher die wirklichen Dinge, als das wahre auf dem Gebiet des Sichtbaren, auch Bilder der Begriffe genannt worden sind, so haben doch vor ihnen die mathematischen Produktionen als dem Gebiet des Erkennbaren angehörig mit Recht den Vorrang, und so entstehen für die erkennende Tätigkeit jene vier Stufen: der Augenschein hat die Bilder, der Glaube die wirklichen Dinge, die anschauliche Einsicht hat die mathematischen Gegenstände und die eigentliche Erkenntnis hat die Ideen zum Gegenstand. An diese Abstufung soll nun die ganze Reihe der Studien für die zur Herrschaft bestimmten sich anknüpfen; und damit wir diese desto besser übersehen und die Abwechselung zwischen Studien und Ausführung schätzen lernen, führt uns Sokrates aus der Mitte dieser Untersuchungen plötzlich in jene Höhle, in welcher uns der Lebensgehalt und Zustand derer, welche, weil es ihnen unmöglich ist sich mit ihren Augen der geistigen Sonne zuzuwenden, den Schein und die Bilder, nämlich die sichtbaren Dinge, für das Sein und Wesen selbst halten, mit so grellen Zügen dargestellt wird, dass man kaum sieht, wenn auch die Wissenden von der eignen Glückseligkeit, deren sie droben genießen, absehen und sie dran geben wollten, weshalb es nur der Mühe lohnen sollte ein solches dürftiges Leben zu leiten, an dem nichts zu verbessern ist und nichts zu verlieren, so dass wahrlich der kein gemeiner Vaterlandsfreund ist, welcher auch hierauf, wie hier gefordert wird, den großartigen Spruch anwendet, nicht darauf komme es an, dass irgend ein Teil des Ganzen sich ausgezeichnet wohlbefinde. Bleibt aber aller Leitung ohngeachtet die große Masse sich gleich, – und anders scheint sich Platon das Leben nicht vorzustellen, und eine Fortschreitung, welche auch das Volk ergriffe, in seine Gedanken nicht mit aufgenommen zu haben – so kann doch auch die großmütigste Hingebung nur in sofern lohnen, als es hiedurch allein möglich wird aus dieser Masse immer wieder bei jedem neuen Geschlecht die edleren Naturen herauszufinden und einem besseren Lose entgegenzuführen. Nimmt man nun hinzu, dass die Bevölkerung in seinem Staat, in den wir nun wieder zurückgeführt werden, sich eben auch nicht mehren soll, und das Verhältnis zwischen den Ernährern und Verzehrern ihm auch in sehr bestimmte Grenzen eingeschlossen erscheinen mußte: so kann man sagen, die Aufgabe des Platonischen Staates, und also der gesamten menschlichen Tätigkeit im Großen betrachtet, sei keine andere als die menschliche Natur in ihren einmal gegebenen Verhältnissen ohne Verschlimmerung zu erhalten. So dass unser Weiser als der strengste und eigentlichste Verteidiger der Stabilität erscheint. – Wie nun die kleine Auswahl der edleren Naturen für ihr besseres Los geprüft und allmählich eingeübt und gewöhnt werden sollen, das entwickelt Platon zunächst durch eine zierliche Zurückführung dieses Bildes von der Höhle auf das ursprüngliche von der Sonne, wo sich dann von selbst ergibt, dass die Fähigkeit in die Sonne selbst hineinzusehen nur durch mannigfaltige Vorübungen erworben werden kann. Wie nun die gemeinsamen gymnastischen und musikalischen Übungen der Kinder unvermeidlich viel mit Bildern schon des mythischen wegen zu tun hatten, und die ganze Entwicklung des kindlichen Lebens im Gebiete der wirklichen Dinge also des Glaubens spielt: so liegen natürlich die Vorübungen der erwachsenern Knaben ausgezeichneter Art ganz in dem Gebiet der Anschaulichkeit und Einsicht, welches die mathematischen Disziplinen in ihrer natürlichen Stufenfolge ausfüllen. Doch unterscheidet Platon auch hier zwei verschiedene durch ein Paar streng gymnastische Jahre getrennte Verfahrungsarten, die erste ist der Vortrag dieser Wissenschaften, ihm nur uneigentlich so genannt, jeder für sich, wiewohl immer schon – mit Beseitigung bloß empirischen Verfahrens und jeder praktischen Beziehung auf die wirklichen Dinge – nur auf die Zahl an sich, die Figur an sich und so auch auf die Bewegungen und Verhältnisse an sich gerichtet; die andere aber ist die Aufstellung dieser Disziplinen in ihrer Verwandtschaft und ihrem Verhältnis zu der Natur des Seins, und nur diejenigen, die bis hierher zu folgen und dies zusammenzuschauen vermögen, werden für dialektische und also auch königliche Naturen erkannt. Aber auch diese gelangen erst spät und nachdem sie sehr ungleich ihre Zeit zwischen dem erwünschten wissenschaftlichen Leben und dem unerfreulichen Dienst in der Höhle haben teilen müssen, zugleich zur Anschauung der Idee des Guten und zur Herrschaft, welcher sie jedoch jetzt nur abwechselnd den kleineren Teil der Zeit zu widmen haben, den größeren aber der Betrachtung weihen dürfen, bis sie endlich zur guten Stunde von Allen gepriesen das zeitliche gesegnen. Und hiemit hat sich nun Sokrates, nachdem er noch erst einen flüchtigen Wink gegeben, auf welche Weise, wenn erst nur einmal wahre Philosophen die Gewalt in Händen hätten, ein solcher Staat zu Stande kommen könne, der ganzen Aufgabe, die ihm Adeimantos gestellt hatte, vollständig entledigt, und kehrt am Anfang des achten Buches dahin zurück, wo ihm diese große Einschaltung war aufgegeben worden, und wir nehmen nun von diesem sonderbar erfundenen Staate Abschied. Soll es nun vergönnt sein hier noch ein Paar Worte über denselben zu sagen: so möchte ich zuerst aufmerksam darauf machen, wie wenig Platon, was man ihm doch nicht selten zum Vorwurf macht, ein Verächter seines Volkes gewesen, wie großes er vielmehr von der hellenischen Natur gehalten, da er nicht nur ihr allein eine hervortretende Entwicklung des wißbegierigen Elementes in der menschlichen Seele zuschreibt, sondern auch darauf rechnet unter einer so mäßigen Bevölkerung, wie wir uns für seinen Staat vorzustellen haben, jene seltene Vereinigung von Eigenschaften, und zwar stark genug um alle diese Übungen und Prüfungen glücklich zu bestehen bei so vielen Einzelnen, selbst das weibliche Geschlecht mit eingerechnet, anzutreffen, dass es ihm nie an Herrschern fehlen werde, wenngleich vor dem fünfzigsten Jahre niemand zur höchsten Gewalt gelangt und dann mehrere einander abwechselnd ablösen sollen. Vielleicht würden wir selbst in unsern volkreichen Staaten es nicht auf uns nehmen dieses zu bewirken, nur lässt sich eben bei der gänzlichen Verschiedenheit unserer Bildungsweise der Versuch nicht anstellen. Indessen sind wir doch dahin gekommen, von allen denen, welche einen größeren Einfluss auf die Gesellschaft ausüben wollen, eine Verbindung wissenschaftlicher Bestrebungen mit den kriegerischen und umgekehrt zu fordern. Und wenn wir nicht begehren können, dass diejenigen, welche die höchste Gewalt auszuüben haben, die am meisten dialektischen Naturen sein sollen: so umfasst dafür die höchste Gewalt bei uns nicht unmittelbar so vieles als bei Platon; und wir rechnen doch sehr darauf, dass diejenigen, welche am meisten im Reich der Begriffe leben, indem sie mannigfaltig auf den Unterricht einwirken, auch vorzüglich die öffentliche Meinung bilden werden, welche doch immer, wenn auch unbewußt, der höchsten Gewalt das Maß gibt. Ja wir können es, wenn auch augenblickliches Unheil nicht immer sollte zu vermeiden sein, doch mit ziemlicher Zuversicht dem eiferartigen Element, in dessen Entwicklung wir den Alten so weit voraus sind, anheimstellen zu unterscheiden, wo selbstsüchtige oder schmeichlerische Sophisterei die Person des Philosophen spielen und die Darstellung der Idee des Guten verfälschen will.