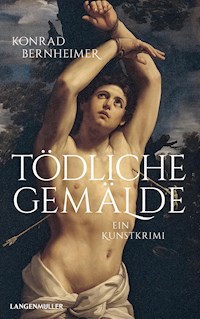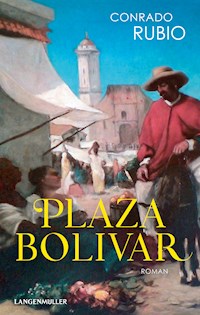
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem ersten historischen Roman erzählt Konrad Bernheimer von der jüngeren Geschichte seines Geburtslandes Venezuela. Sein Protagonist spiegelt die Tragik des Landes, wo hoffnungsvoller Aufbruch immer wieder am zerstörerischen Bazillus der Korruption scheitert. Don Juan Vicente Morales repräsentiert eine der letzten alten Familien Venezuelas. Seine Frau und sein einziger Sohn sind durch tragische Umstände ums Leben gekommen. Als er mit der Drogenabhängigkeit seines jungen Neffen konfrontiert wird, steht sein Leben endgültig an einem Wendepunkt: Er erklärt er den Drogen und der Korruption in Venezuela den Krieg. In seinem Freund, dem Herausgeber der Zeitung in San Cristóbal, findet er einen Verbündeten im Kampf gegen die Missstände. Erst spät begreift Don Juan, dass er quasi wider Willen Politiker geworden ist. Als man ihn drängt, sich als Provinzgouverneur zur Wahl zu stellen, trifft er eine Entscheidung mit fatalen Folgen für sich selbst und sein Land ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Distanzierungserklärung: Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
© 2022 Langen Müller Verlag GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Sabine Schröder
Umschlagmotiv: Camille Pissarro, Plaza Mayor
Satz und E-Book Konvertierung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7844-8437-2
www.langenmueller.de
Für meine Mutter,
von der ich die Liebe zu diesem wunderbaren Land geerbt habe.
Sie hat die glücklichen Zeiten Venezuelas erlebt und musste die schlimmen Zeiten nicht mehr mit ansehen.
Und für meine Töchter und meine Enkel, denen ich von Herzen wünsche, dass sie eines Tages, wenn die schlimmen Zeiten hoffentlich vorbei sind, das Land und seine Menschen wieder besuchen können und kennenlernen.
Conrado Rubio
Meinem Verleger Michael Fleissner danke ich sehr, dass er sich entschieden hat, meinen Venezuela-Roman herauszugeben, der mir sehr wichtig war.
Der Verlagsleiterin Sissi Klauser danke ich für die immerwährende Unterstützung, und Daniela Wilhelm Bernstein für die vorzügliche Betreuung.
Rainer Wieland hat sich wieder als beratender und korrigierender Lektor sehr um das Buch verdient macht.
Inhalt
Dramatis Personae
Prolog
I. DER ONKEL
II. RODRIGO TORRES
III. LA CAYENA
IV. DER NEFFE
V. MARIELA
VI. BANKEN UND DROGEN
VII. NARCOTRÁFICO
VIII. CLUB SUCRE
IX. SEMANA SANTA
X. TANTE GREGORIA
XI. CLUB TÁCHIRA
XII. DIE ANAKONDA
XIII. DIE VERSUCHUNG
XIV. DIE VERSCHMÄHTE GELIEBTE
XV. HINTERZIMMERPOLITIK
XVI. SPIEL MIT DER MACHT
XVII. DIE ANKÜNDIGUNG
XVIII. DER BESUCH
Epilog
Nachwort
Dramatis Personae
Don Juan Vicente Morales Ramírez
Besitzer der Kaffeeplantage »La Cayena«, einer der größten Haziendas im Táchira, dem Anden-Bundesstaat im Westen Venezuelas
Doña Mariela García de Morales
seine verstorbene Frau, Tochter von Dr. Pablo García aus San Cristóbal
Miguelito
sein verstorbener Sohn
Don Alfonso Morales Urdaneta
und
Doña Rosita Ramírez de Morales
seine Eltern
Rodrigo Torres Moreno
Herausgeber und Eigentümer der Tageszeitung El Diario del Táchira, Don Juan Vicentes Freund
Amira
seine Frau
José Miguel Medina
Onkel von Don Juan, verheiratet mit Doña Celestina, Schwester von Doña Rosita
Carlos Contreras
Neffe von Don Juan, Sohn seines Halbbruders
Maruja
Don Juans treue Köchin
Ramón Mantilla
Mayordomo auf der Hazienda La Cayena und Vertrauter von Don Juan, auf der Hazienda aufgewachsen, und seine Frau Esperanza,
seine Eltern Domingo Mantilla und seine Frau Dolores, genannt Chicha
Ramóns Tante, Tía Gregoria,
ältere Schwester von Chicha, bekannt für ihre brujerías.
Serafina
Besitzerin des Dorfladens in El Chícaro
Roberto Lopez
junger Fahrer auf der Hazienda La Cayena
Pedro Lozano
Bürgermeister von Rubio
Nelson Gutiérrez
Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität San Cristóbal, Gouverneur des Staates Táchira von Don Juans Gnaden
Luís Alvarez Moreno
Präsident der Republik
General Juan Vicente Gómez
Venezolanischer Präsident, regierte Venezuela mit eiserner Hand mit Unterbrechungen zwischen 1908 und 1935, Patenonkel von Don Juan Vicente Morales
Marcos Pérez Jiménez
Diktator, regierte Venezuela von 1952 bis 1958
Carlos Andrés Pérez
Präsident Venezuelas von 1974 bis 1979 und von 1989 bis 1993, als er wegen Unterschlagung öffentlicher Gelder seines Amtes enthoben wurde
Prolog
In den Straßen dauerten die Kämpfe bereits seit Tagen an, und es wurde nicht ruhiger. Einige Viertel von San Cristóbal, der einst so schönen und stolzen Hauptstadt des Andenstaates Táchira im Südwesten Venezuelas, waren teilweise unpassierbar. Eine weitere Detonation erschütterte das Gebäude. Ein Stoß von Akten und Papieren rutschte vom Tisch. Rodrigo Torres musste sich bücken, um die Papiere aufzusammeln. Er seufzte und zuckte mit den Schultern, man hatte sich ja schon fast daran gewöhnt.
Den ganzen Vormittag war es schon heftig hergegangen, unten auf der Straße, an ein geregeltes Arbeiten war ohnehin seit der Zuspitzung der Kämpfe nicht mehr zu denken. Rodrigo Torres war wie jeden Tag aus Gewohnheit in sein Büro gekommen, denn zu tun war ja nun nichts mehr, seit die Zeitung aus Mangel an Papier eingestellt werden musste. Aber dieses Mal war er gekommen, um etwas zu suchen.
Die Zeitung war sein Leben gewesen, er hatte sich nie etwas anderes vorstellen können als die Zeitung seines Vaters und Großvaters, die stolze Tageszeitung der Familie, El Diario del Táchira in San Cristóbal, als Herausgeber und Eigentümer weiterzuführen. Alle noch so unglücklichen und glücklichen Zeiten hatte die Zeitung überlebt. Wie viele Diktatoren waren es in den vergangenen neunzig oder hundert Jahren, sagte Rodrigo Torres zu sich selbst, er führte oft Selbstgespräche, wenn er allein am Schreibtisch saß. Vier oder fünf, bis Pérez Jiménez, der letzte von ihnen, im Jahr 1958 das Land verließ? Das »demokratische« System, das darauf folgte, hat nie wirklich funktioniert. Unser korruptes Zweiparteiensystem hat uns ruiniert! Die eine, das Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), christlich-sozial und mitte-rechts, die andere, die Acción Democrática (AD) sozial-demokratisch und mitte-links. Jahrzehntelang haben sie sich alle fünf Jahre abgelöst, denn nach einer Legislaturperiode war die Partei, die gerade an der Regierung war, bereits unwählbar, so viel Mist hatte sie in dieser Zeit angehäuft! Und so kam in schöner Regelmäßigkeit nach fünf Jahren wieder die andere Partei ans Ruder, als hätten sie sich abgesprochen – und jeweils ein neuer Präsident: von Rómulo Betancourt zu Raúl Leoni, von Rafael Caldera zu Carlos Andrés Pérez, dann zu Luís Herrera Campíns und wieder zurück zu Carlos Andrés Pérez, bis dann schließlich der mittlerweile greise Caldera erneut das Amt übernahm. Und jedes Mal wurde dabei das gesamte Personal ausgetauscht, von den Ministerien und Gouverneuren zu den Bürgermeistern und Gemeinderäten bis hinunter zum kleinen Verkehrspolizisten. Und jeder, der mit seiner Partei ins Amt kam, wusste von Anfang an, dass er sich beeilen musste, die Gefälligkeiten, die jetzt in seiner Macht lagen, seiner Familie und seinen Amigos zu gewähren und dabei natürlich sich selbst nicht zu vergessen, weil in fünf Jahren war die Bonanza wieder vorbei! So war es doch seit den sechziger Jahren immer gewesen. Und so ist ein ganzes Land von seinem eigenen System korrumpiert worden.
Wo waren wir, die Journalisten, die schon vor Jahren längst hätten aufschreien müssen? Versagt haben wir! Wir haben alle gewusst, warum alles so falsch läuft, und keiner hat etwas dagegen getan. Korrupt waren sie alle, unsere Präsidenten und ihre Gefolgsleute, aber es war dem Land wenigstens gut dabei gegangen, wir waren das reichste Land Südamerikas. Haben wir deshalb nichts gesagt? Wir waren alle käuflich …
Und dann kam Hugo Chávez, und anschließend, noch schlimmer, Nicolás Maduro. Und was ist uns jetzt, nach dieser unglaublichen Misswirtschaft und Korruption der beiden, geblieben? Die Menschen hungern, es gibt keine Medikamente, kein Klopapier, nichts, die Läden sind leer, neulich ist ihnen sogar das Tränengas ausgegangen! Die Not im Land ist unaussprechlich. Wir sind zu einer der ärmsten Nationen der Welt geworden.
Das ist nicht mehr mein Venezuela, sagte sich Rodrigo Torres, dieses herrliche Land mit seinen Menschen voller Fröhlichkeit und Leichtigkeit. Die Opposition ist so zerstritten, dass sie keine Rolle mehr spielt, sie könnte Maduro keinen größeren Gefallen tun. Und weil die Opposition keine Rolle mehr spielt, verfällt das Land in Lethargie, obwohl das Parlament aufgelöst wurde und eine Verhaftungswelle der anderen folgt. Am Anfang sind wenigstens noch die Studenten auf die Straße gegangen. Die vom Volk gewählten Abgeordneten der Opposition verschwanden einer nach dem anderen, entweder sind sie vor der drohenden Verhaftung ins Ausland geflohen, oder sie sind tatsächlich verhaftet worden und schmoren ohne Prozess und abgeschnitten von der Außenwelt in den Gefängnissen. Einer nach dem anderen ist verschwunden, und die meisten im Land haben die Hoffnung aufgegeben. Oder sie sind ausgewandert, die meisten Kinder meiner Freunde sind ausgewandert, sie sahen keine Zukunft mehr in diesem verkommenen Land, keine Hoffnung.
Wenn wir das Land nach dem Abgang dieses unsäglichen Regimes wiederaufbauen wollen, wird uns eine ganze Generation fehlen. Wir haben alle versagt. Wie hat es nur so weit kommen können? Das ganze Land verfällt in Chaos, die öffentliche Ordnung ist aufgehoben, und man weiß nicht mehr, von wem man auf der Straße erschossen wird: Sind es die verbrecherischen Chaoten, die sich immer noch als Anhänger von Maduro bezeichnen, oder ist es das Militär, das keine Ahnung hat, gegen wen es eigentlich kämpft? Es macht keinen Unterschied. Tot ist tot. Und wenn die Leute nicht erschossen werden, dann verhungern sie. Mittlerweile sind wir das ärmste Land des Kontinents. Die Mehrheit der Familien des Landes lebt in extremer Armut und hungert. Es wäre der Gipfel des Zynismus, wenn es wirklich so wäre, wie viele Leute mittlerweile sagen, dass Maduro den Hunger der Bevölkerung bewusst ausnutzt, um die Menschen noch abhängiger zu machen. Aber wie sonst kann man erklären, dass es gerade die Ärmsten der Armen sind, die dem Regime hinterherlaufen und Maduro immer wieder wählen? Und das, obwohl wir alle wissen, dass seit den ersten Wahlen, die Chávez abgehalten hat, bis zum heutigen Tag alle Wahlergebnisse gefälscht wurden und sich Maduro nicht schämt, sein ganzes Volk zu betrügen? Maduro klammert sich an die Macht mithilfe des permanenten Ausnahmezustandes.
Ja, ich auch, ich weiß, sagte Rodrigo Torres zu sich selbst. Ich habe auch versagt. Wir alle haben versagt, und die Opposition am allermeisten. Die Wahlen zu boykottieren – wie dumm kann man sein! Maduro sozusagen kampflos das Land zu überlassen! Aber bei der letzten Wahl waren wir vereint, und wir haben die Mehrheit im Parlament gegen Maduro errungen. Und was hat es uns gebracht?
Nichts! Er hat einfach ein Gegenparlament eingesetzt. Der Kampf eines Juan Guaidó und anderer Oppositionspolitiker, die den Mut aufbrachten, nicht das Land zu verlassen und versuchten, die immer größere Opposition in eine nationale Liga der Unzufriedenen zu führen, schien wie ein Kampf gegen Windmühlen. Die einzige Chance, die das Land noch hatte, die Diktatur von Maduro und seiner Militärjunta loszuwerden, lag in der Hand der USA. Nur noch ein militärisches Eingreifen des Auslandes hätte helfen können. So schien es wenigstens.
Rodrigo konnte nur noch verständnislos den Kopf schütteln. Aber ich habe mein Leben hinter mir, sagte er sich, mit meinen fast achtzig Jahren. Wenn ich gehe, kräht kein Hahn nach mir.
Rodrigo setzte sich in seinen alten Schreibtischstuhl, auf dem schon sein Vater gesessen hatte, ein altes knarzendes hölzernes Modell, wie es in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Mode war. Etwas unbequem. Der Vater hatte gesagt, ein Schreibtischstuhl soll unbequem sein, dann hält er dich wach, in einem bequemen Stuhl schläfst du ein. Rodrigo hatte dennoch, und das war eine der wenigen Handlungen gewesen, mit der er sich dem allmächtigen Vater gegenüber posthum als ungehorsam erwiesen hatte, ein Kissen aufgelegt. Nach so vielen Jahren war das Kissen durchgesessen, so dass es keinen Unterschied mehr machte, ob man auf einem Kissen saß oder auf dem blanken Holz. Die Knochen taten ihm heute wieder weh. Er lehnte sich zurück, seine Beine unter dem Schreibtisch ausgestreckt, und verschränkte die Arme hinter dem Kopf.
Eine Stunde zuvor war er in seinem Büro angekommen. Er hatte sein Haus oben in den Hügeln über San Cristóbal in seinem alten Toyota verlassen, hatte sich einen Weg gebahnt auf Nebenstraßen, die teilweise verbarrikadiert waren, und er war um einen Berg brennender Autoreifen herumgefahren, um festzustellen, dass sein gewohnter Schleichweg nicht mehr passierbar war. Zwei ausgebrannte Autos versperrten den Weg. Er musste auf der schmalen Gasse wenden, die eine Einbahnstraße war, und in verkehrter Richtung zurückfahren, aber darum kümmerte sich jetzt ohnehin niemand mehr. Er musste ein paarmal vor- und zurücksetzen, bis er wenden konnte, und jedes Mal, bei jedem nutzlosen Manöver, fürchtete er, das Benzin könnte ihm wieder ausgehen. Es war gar nicht daran zu denken, noch Benzin aufzutreiben. Dann fuhr er wieder zurück auf die große Avenida, die ins Zentrum hinunterführte. Rodrigo überlegte, wie er jetzt fahren sollte. Die Avenida hinunter, um dann in die Transversal einzubiegen, das hatte wahrscheinlich keinen Sinn. Er fuhr wieder ein Stück zurück, fuhr wieder an der Straße, die zu seinem Haus führte, vorbei und noch höher hinauf in die Hügel. Früher hatte hier oben, in den colinas, die bessere Gesellschaft der Stadt gewohnt, hier war auch das ehemals beste Hotel der Stadt, das Hotel Tamá, das noch unter Pérez Jiménez in den fünfziger Jahren gebaut worden war. Als er am Hotel vorbeifuhr, sah er, wie verwahrlost die Auffahrt aussah. Die schönen Blumenbeete, vertrocknet. Das Pförtnerhäuschen, zerschossen. Hier hatten sich offenbar irgendwelche Kämpfer von irgendeiner Seite verschanzt. Er sah auch die Blutspritzer an der Wand des Wärterhäuschens. Die Sache war offenbar nicht gut ausgegangen. Und das Hotel war geschlossen.
Alle großen Feste hatte man früher hier in der feineren Gesellschaft der Stadt gefeiert, wenn die Räumlichkeiten im Club Táchira nicht ausreichten. Der große Saal des Hotels war sogar größer als die Kirche, hatte der Hoteldirektor immer ganz stolz gesagt. Im Club Táchira war es zwar feiner, aber der eignete sich nur für kleinere Gesellschaften. Die Familie Torres hatte die jährlichen Empfänge anlässlich des Jahrestags der Unabhängigkeitserklärung früher immer im großen Saal abgehalten, es gab üppige Buffets, und man tanzte zu herrlicher Salsa, gespielt von einer Band, und die Zeitung erschien in Sonderausgaben und berichtete vom Empfang im Hotel Tamá.
Es gab auch immer Ansprachen. Gefeiert wurde jedes Jahr am 5. Juli, dem Tag der Unabhängigkeitserklärung des Jahres 1811. Es dauerte zwar danach noch viele Jahre bis zur wirklichen Unabhängigkeit, und es floss noch viel Blut in mehreren Schlachten und Scharmützeln unter wechselnden königlich-spanischen Befehlshabern, bis sich schließlich im Juni 1821 die Spanier in der glorreichen Schlacht von Carabobo dem charismatischen General und späteren ersten Präsidenten Venezuelas Simón Bolívar endgültig ergaben und die zuvor proklamierte Unabhängigkeit des Landes Wirklichkeit werden konnte. Seitdem stand in jedem noch so kleinen Dorf ein Denkmal für den Befreier Simón Bolívar inmitten des zentralen Platzes eines jeden Dorfes, jeder Stadt bis hin zur Hauptstadt Caracas, der dem siegreichen Libertador geweiht war: die Plaza Bolívar.
Jedes Jahr machte es seinem Vater großes Vergnügen, auf alle historischen Details einzugehen. Es waren jedes Jahr die gleichen Ansprachen, dachte Rodrigo, aber sie taten gut, sie gaben uns Identität und ließen uns, angesichts der nationalen Größe Venezuelas, auf die wir so stolz waren, die Unzulänglichkeiten des Alltags vergessen.
Über den jährlichen Empfang zum Unabhängigkeitstag berichtete dann El Diario del Táchira an den darauffolgenden Tagen immer sehr ausführlich. Seitenweise waren die Reichen und Schönen der Stadt abgebildet, und Rodrigos Vater war auf jedem zweiten Foto zu sehen, umgeben von den wichtigsten Persönlichkeiten des Andenstaates. Jahr für Jahr, bis zu seinem Tod. Als Rodrigo die Zeitung in den siebziger Jahren übernahm, versuchte er, sich langsam von den Angewohnheiten und Traditionen seines Vaters zu lösen. Er mochte es nicht, sich selbst in der Zeitung zu sehen, er hatte auch nicht die stattliche Figur, mit der der Vater jeden in seiner Umgebung fast um Haupteslänge überragte. Rodrigo war eher zierlich, eigentlich dürr, musste er selbst zugeben, und hatte bereits in jungen Jahren einen leichten Buckel. Seine Mutter hatte ihm ständig in den Ohren gelegen, er solle doch anständig essen, damit er so stattlich werde wie sein Vater.
Als er dann seine Jugendliebe Amira geheiratet hatte, stellte er sehr bald fest, dass er vom Regen in die Traufe geraten war. Die ständige Hauptsorge seiner Frau war, ob er denn genug zu essen hätte. Sie hatte es allerdings bald aufgegeben, ihm sein Mittagessen in Blechbüchsen fürs Büro mitzugeben, weil er die Büchsen immer im Auto liegen ließ. Stattdessen kümmerte sie sich darum, dass der Kühlschrank im Büro immer wohlgefüllt war, und hielt die Sekretärinnen des Verlages dazu an, für den Chef zu sorgen.
In all den Jahren ihrer Ehe hatte Amira es sich nicht abgewöhnt, sich um das Essen ihres Mannes zu sorgen. Aber jetzt, beim Gedanken an die Marotte seiner Frau, ihn ständig füttern zu müssen, knurrte Rodrigo tatsächlich der Magen. Das Mittagessen war ausgefallen, und er hatte es gar nicht bemerkt. Amira war zu ihrer Schwester nach Táriba, in das kleine Dörfchen oberhalb von San Cristóbal, hinaufgefahren und hatte ihm wohl irgendetwas im Kühlschrank zurückgelassen, aber Rodrigo hatte nicht daran gedacht, als er sich entschlossen hatte, ins Büro zu fahren. Er stand auf und ging durch das leere Vorzimmer in die kleine Küche, in der der mannshohe Kühlschrank stand. Der stand nicht nur leer, er war auch abgeschaltet. Rodrigo entfuhr ein tiefer Seufzer: Ach, Amira, was gäbe ich jetzt darum, du wärst hier und hättest etwas zu essen für mich!
Unverrichteter Dinge setzte er sich wieder auf seinen Stuhl, und ohne nachzudenken, ganz automatisch seiner alten Gewohnheit folgend, nahm er die Abdeckung von seiner alten Schreibmaschine. Auch in dieser Beziehung war Rodrigo Torres ein Dinosaurier. Er hatte es versäumt, damals, als die ersten PCs aufkamen, sich einen Computer zuzulegen. Das Büro, die Redakteure, ja natürlich, die mussten mit der Zeit gehen und waren dann sogar eines Tages »vernetzt«. Rodrigo hatte nie verstanden, wie das funktionieren sollte. Er jedenfalls blieb bei seiner alten Schreibmaschine, die Rodrigos Vater einst von seiner einzigen Europa-Reise mitgebracht hatte! Eine deutsche »Adler« mit extra breitem Wagen, so dass er eine DIN-A4-Seite auch quer einlegen konnte, wobei er davon nie Gebrauch gemacht hatte. Seine täglichen Leitartikel, die er schnell und ohne auf Schreibfehler zu achten, herunterschrieb – »Das ist nicht meine Aufgabe!« –, wurden einer der Sekretärinnen zum Abschreiben übergeben, und die waren dann auch »vernetzt«. Er sah sich in der nachmittäglichen Konferenz die am Morgen in Auftrag gegebenen Artikel und Beiträge an, stimmte dem Umbruch zu, überflog noch einmal seinen Leitartikel, um zu kontrollieren, ob man nicht eine seiner geliebten, bewusst altmodischen Ausdrucksweisen verändert hatte, und gab den Druck frei.
Diese täglichen Rituale fehlten ihm. Lange Zeit hatte Rodrigo Torres versucht, im Interesse des Fortbestehens der Zeitung, mit seiner Kritik an der Regierung Zurückhaltung zu üben, aber als der Präsident auch noch das Parlament auflösen ließ und seiner »Verfassunggebenden Versammlung«, die ausschließlich aus seinen eigenen Leuten zusammengesetzt war, alle Vollmachten im Staat übertrug, war es ihm zu viel geworden. Er konnte sich nicht weiter verbiegen, sein geliebtes Land war endgültig zu einer Diktatur verkommen, in der seine Ideale von Freiheit und Demokratie, an die er sein Leben lang geglaubt und für die er gekämpft hatte, pervertiert worden waren. Das Land hungerte, die Inflation galoppierte, und der Präsident und seine Leute taten noch immer so, als seien alle Schwierigkeiten des Landes dem bösen Einfluss des kapitalistischen Imperiums zu verdanken, der internationalen Verschwörung gegen die »Bolivarianische Revolution«.
Der Hunger im Land war unvorstellbar. Eine Weile war wenigstens der teure Supermarkt oben in den colinas, wo die vermögenden Bürger der Stadt einkauften, noch einigermaßen gefüllt. Aber der Mangel an Klopapier und an Toilettenartikeln hatte inzwischen auch die teureren Supermärkte erreicht. Eine Zeit lang war es noch möglich gewesen, dort die Dinge des täglichen Lebens zu finden, zu wesentlich höheren Preisen als unten im Stadtzentrum, aber bald ging dies nur noch über den Freund des Fahrers, den compadre des Gärtners, der Schwester des Pförtners, die noch irgendeinen Zugang zum Schwarzmarkt hatten. Anders war an nichts mehr heranzukommen. Selbst Amira hatte sich angewöhnt, ihren Kaffee schwarz zu trinken, es war zu kompliziert und geradezu unsinnig teuer geworden, gepantschtem Milchpulver nachzujagen.
»Claro, el presidente y su gente se limpian el culo con tres hojas a la vez!«, hatte Rodrigo neulich die Köchin ausrufen hören. Vergnügt hatte Rodrigo damals in die Küche zurückgerufen: »Und woher weißt du, dass er sich seinen Arsch mit drei Blättern gleichzeitig abwischt?«
Seine Frau wies ihn zurecht. Er hatte es bis zu diesem Tag nicht bemerkt, dass die Beschaffung von Klopapier ein so großes Problem geworden war. Amira hatte es sich immer zu ihrer Aufgabe gemacht, die hässlichen Seiten der immer schwieriger werdenden Bewältigung des Alltags von ihrem Mann fernzuhalten. Mittlerweile waren die Regale der Supermärkte vollkommen leer. Es gab nichts mehr. Nichts. Vor allem gab es nichts mehr zu essen. Seine Frau, die nie sehr korpulent gewesen war, aber doch einige Rundungen aufzuweisen hatte, war sehr schmal geworden. La »dieta Maduro« hatte sie mindestens acht Kilo leichter gemacht. Auch das war Rodrigo irgendwie entgangen. Da er sich nie viel aus Essen gemacht hatte, war es für ihn eher angenehm, dass seine Frau nicht mehr ständig mit dem Essen hinter ihm her war. Das ganze Land hatte abgenommen.
Die Maduro-Diät war die erfolgreichste »Errungenschaft« des Präsidenten. Aber das war leider alles andere als komisch: Das Volk hungerte, in den Krankenhäusern starben die Menschen, weil es keine Medikamente gab, die Kindersterblichkeit war rasant gestiegen, aber der Präsident wehrte sich immer noch gegen internationale Hilfe. Man habe schließlich die größten Erdölvorkommen der Welt! Nur, dass die Ölindustrie, die immerwährende und leider auch einzige Melkkuh des Landes, langsam ihren Geist aufgab, weil seit Jahren nichts mehr investiert wurde und die Anlagen verrotteten, das wollte Maduro nicht sehen. Ab und zu ernannte er einen neuen Ölminister, der als Vorsitzender des staatlichen Ölkonzerns PDVSA die Misere verwalten sollte, mit dem Ergebnis, dass immer mehr Leute aus seiner Umgebung jede Möglichkeit nutzten, noch größere Mengen Dollar außer Landes zu schaffen. Es war, so schien es Rodrigo, als wollte man den kaputten Motor des Autos reparieren, indem man ihm einen neuen, mindestens so inkompetenten Fahrer gab. Der dachte an alles, nur nicht daran, den Motor zu reparieren.
Um sich den Anschein von Aktivität zu geben, hatte der Präsident vor Kurzem zwei Manager der Ölfirma, immerhin Chavistas der ersten Stunde, verhaften lassen. Man hatte ihnen vorgeworfen, eine unbeschreibliche Summe aus der Kasse der PDVSA außer Landes gebracht zu haben – nach Andorra! Angeblich waren es mehrere Hundert Millionen Dollar.
Rodrigo Torres stützte den Kopf in beide Hände. Wir wissen doch alle nicht mehr, wie es weitergehen soll! Der Realitätsverlust des Regimes war nicht mehr nachzuvollziehen. Dann streckte er sich und schüttelte den Kopf. Nein, so ist es doch gar nicht. Die sind doch nicht so naiv, selber an das zu glauben, was sie da jeden Tag an Unsinn von sich geben! Schon lange ging es doch nur noch um eines: den Machterhalt und darum, mehr Zeit zu gewinnen, um noch mehr Reichtümer außer Landes zu schaffen!
Rodrigo stand auf und begann im Zimmer auf und ab zu gehen.
Allerdings, wo sollten sie denn jetzt noch hin? Es wird kaum ein Land geben, das die Clique um Maduro noch aufnähme. Nicht mal mehr Kuba! Wohin mag er sich dann noch absetzen wollen! Mein Gott, unsere Diktatoren! Entweder man muss sie umbringen, oder sie gehen vorher mehr oder weniger freiwillig und verlassen das Land! Pérez Jiménez war damals nach Madrid gegangen. In Madrid würde Maduro sich wenigstens noch verständigen können, denn Spanisch war ja wohl die einzige Sprache, die dieser Trottel halbwegs beherrschte.
Rodrigo Torres hatte alle seine Mitarbeiter entlassen, seine ganze stolze Redaktion auflösen müssen. Das war vor zwei Jahren. Der Maduro-hörige Gouverneur des Táchira hatte ihm zunächst die Papierlieferungen gestrichen, und als Torres dann mit einer Online-Ausgabe weitermachen wollte, wurde ihm die Lizenz genommen. So einfach war das. Alle Mitarbeiter hatte Torres entlassen müssen, bis auf seinen alten Fahrer José, den er selbst meistens fahren musste, weil er am Steuer einschlief. Aber er brachte es nicht übers Herz, den alten treuen José auch noch gehen zu lassen.
Er schloss die Schreibtischschublade auf – sie klemmte, aber das tat sie schon immer – und schüttete den Inhalt auf die Schreibtischplatte. Da, ganz hinten, da war der Schlüssel, den er verloren glaubte, der Schlüssel zu dem alten Aktenschrank im Vorzimmer. Aufgeregt ging er hinaus, schloss den Schrank auf, und endlich – jetzt hatte er gefunden, wonach er gesucht hatte, sein ganzes Büro hatte er danach durchsucht! Rodrigo hatte nicht mehr gewusst, wo er das Manuskript versteckt hatte, damals, vor zwanzig Jahren, offenbar doch zu gut versteckt: den Nachruf auf seinen alten Freund Don Juan. Dann war ihm doch noch der Schlüssel zum alten Aktenschrank eingefallen.
Mit zitternden Händen hielt Rodrigo den Packen Papier in beiden Händen und setzte sich wieder an den Schreibtisch.
Er begann, nach fast zwanzig Jahren, seine eigenen Zeilen zu lesen, seit damals hatte er das Manuskript nicht mehr in der Hand gehalten. Er wusste auch, warum: Er hatte es sich nie verziehen, er hatte sich selbst die Schuld gegeben, an allem, was geschehen war.
Rodrigo Torres stieß den Rauch seiner Zigarette aus und legte sie in den Aschenbecher. Früher liebte er die ruhigen, späten Stunden in seinem Büro, wenn von der Redaktion niemand mehr im Haus war. Damals, nach den schrecklichen Ereignissen, hatte er sich gequält, um jedes seiner Worte hatte er ringen müssen, um das Unsägliche zu beschreiben …
Er erinnerte sich, wie er damals an seinem Schreibtisch saß. Es war im Spätsommer 1998, einige Monate bevor Hugo Chávez zum Präsidenten Venezuelas gewählt wurde. Ich bin schuld am Tod meines Freundes!, sagte sich Rodrigo immer wieder. Ich bin schuld, ich habe ihn bedrängt, in die Politik zu gehen! Nach den tragischen Geschehnissen drüben in Rubio auf der Plaza Bolívar hatte er drei Tage lang nicht geschlafen. Er versuchte, den Nachruf auf seinen Freund Don Juan zu schreiben.
Rodrigo erinnerte sich daran, wie er sich immer wieder von Neuem hinsetzte und hektisch in die Tastatur hackte:
»Wir hatten mit ihm die Chance für einen Neuanfang. Ehrlichkeit, Integrität, Unbestechlichkeit schienen wieder Tugenden zu sein, die existieren! Erstmals hatten wir seit Langem, seit vielen Jahren, wieder das Gefühl, Politik sei nicht nur ein schmutziges Geschäft …«
»Dergran líder, auf den wir so lange gewartet hatten, ist von uns gegangen, bevor er die Chance bekommen hatte …«
Nein, bevor WIR die Chance bekamen, wäre besser, wäre wahrer!
»Das Begräbnis von Don Juan hat sich zu einer politischen Demonstration nie gesehenen Ausmaßes entwickelt …«
»Einer der letzten Großen unseres Landes …«
Ich kann es nicht! Rodrigo war verzweifelt. Zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich für diese Zeitung lebe, bin ich nicht in der Lage, zu schreiben! Mein Leben lang habe ich nichts anderes getan als schreiben, schreiben, schreiben, und jetzt kann ich nicht. Eine totale Blockade! Er war wirklich verzweifelt.
Aber er wusste, er konnte diese Aufgabe nicht an einen Redakteur weitergeben. Den Nachruf auf seinen Freund, seinen besten Freund, Don Juan Vicente Morales Ramírez, den musste er selbst schreiben. Dieser Pflicht konnte er sich nicht entziehen.
Rodrigo stand auf und ging in seinem Büro auf und ab. Er blieb stehen, um sich eine Zigarette anzuzünden. Wie oft hatte Don Juan ihn damals angerufen, sobald er drüben in Rubio die Zeitung gelesen hatte. Er war immer einer der ersten Anrufer, wusste immer einen Kommentar zu den Berichten und vor allem zu Rodrigos Leitartikeln. Und er, Don Juan, war damals selbst sehr häufig Gegenstand von Berichten, Kommentaren und Leitartikeln.
Rodrigo lächelte. Im letzten Jahr vor seinem Tod hatte ihn Don Juan fast jeden Morgen angerufen. Er sagte dann immer wieder, er hätte die Eitelkeiten früherer Jahre überwunden. Die Eitelkeit, das wusste Don Juan selbst zu genau, war sein wunder Punkt. Und er liebte es, die Rolle des Gran Señor zu spielen, sie auszufüllen, die Rolle, in die er hineingeboren war; es war für ihn zwar nur ein Spiel, wie er selbst immer wieder sagte, zu ihm, seinem Freund Rodrigo, und zu sich selbst, in seinen endlosen durchaus kritischen Dialogen, die er mit sich selbst führte, aber es war ein sehr ernstes Spiel. Spätestens seit er sich selbst, kurz nachdem sein Vater gestorben war, mit »Don Juan« ansprach, nahm er sich in seiner Rolle ernst. Und er sprach oft mit sich selbst in der Sie-Form, das war der alte Umgangston der traditionsbewussten Familien, vor allem in der Andenregion. Rodrigo hatte seine Eltern niemals gesiezt, und Don Juan hätte es als Respektlosigkeit angesehen, sie zu duzen, vielleicht war es bei ihm aber auch nur eine Art Ritual, wie so vieles in seinem Leben Ritual oder Spielregel war. Niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, seinen engsten Freund zu duzen. So war es zwischen ihnen immer bei »Don Juan« und »Don Rodrigo« geblieben.
»Er herrschte über ein kleines Imperium, als einer der letzten großen Landbesitzer, seine Hazienda La Cayena war eine der größten Kaffeeplantagen des Landes. Begründet von seinem Großvater Don Umberto bereits im 19. Jahrhundert, war la Cayena von Don Alfonso, dem Vater, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu großer Blüte gekommen, er war einer der wenigen, die in den ersten Jahren des Ölbooms an die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft glaubten. Und schließlich hat Don Juan sein Erbe nicht nur übernommen, sondern es beträchtlich ausgebaut.«
Und wie hatte Don Juan sein Land geliebt! Er konnte schwärmerisch werden, seine Augen, die manchmal, wenn er sich sorgte, müde und erloschen schienen, konnten dunkel glänzen, dann war er kein knapp siebzigjähriger, leicht gebeugter Mann mehr, dann war er wie ein kleiner Junge, der von einem großen Abenteuer erzählte, wenn er über die Dinge sprach, die er liebte – über sein Land, seine Hazienda, über die Schönheit seiner Hügel, seiner Täler, über den Geruch des Kaffees, wenn sich während der Ernte das große Rad der Mühle Tag und Nacht drehte.
Wie unendlich traurig und deprimiert konnte er sein, wenn er über die Bedrohungen sprach, die in seine Welt eindrangen, über den chronischen Wassermangel, über die Erdölbohrungen auf seiner Hazienda, über das Drogenproblem, das grauenvolle Drogenproblem, das ganze Familien in den Abgrund stürzte und in das Don Juan sich plötzlich selbst verstrickt sah; und wie glücklich konnte er wiederum sein, wenn er sich in seine Tagträume zurückzog, wenn er von seiner Familie, von früher, von seinem verrückten und verehrten Onkel José Miguel erzählte, von seiner Reise nach Spanien; wie konnte er schwärmen von Sevilla und der Semana Santa, vom Stierkampf, von einer guten Zigarre! Und wie leidenschaftlich konnte er werden, wenn er mit Rodrigo über die verfahrene Politik des Landes sprach, über die Korruption, über Demokratie und über Diktatur.
Wie konnte ich mich mit ihm streiten über dieses alte Thema, dachte Rodrigo. Nicht zu fassen, aber es war aus seinem Kopf nicht herauszubringen, diese Sehnsucht nach dem »starken Mann«, der schon alles wieder in Ordnung bringen würde! Warum nur konnte er nicht sehen, wie so viele andere auch, dass es so etwas wie einen »guten Diktator« nicht gab? Immer, wenn er von General Gómez sprach, dem Diktator der zwanziger und dreißiger Jahre, der auch dann das Land regierte, wenn er gar nicht auf dem Präsidentenstuhl saß, kam er ins Schwärmen und wollte nur die guten Seiten sehen. Selbst wenn man auf die desaströsen Familienverhältnisse von General Gómez zu sprechen kam: Er war nie verheiratet gewesen, dafür hatte er von wechselnden Frauen mindestens 64 Kinder, die er auch anerkannt hatte. Und natürlich setzte er immer wieder Mitglieder seines Clans in wichtige offizielle Positionen. Dass das Nepotismus in Reinkultur war, hatte Don Juan immer mit einer wegwerfenden Handbewegung abgetan. In dieser Beziehung war er unverbesserlich.
Rodrigo Torres ging zum Schreibtisch zurück und zündete sich noch eine Zigarette an.
»Einer der letzten Großen unseres Landes …«
»Don Juan Vicente Morales, die große Hoffnung unseres Landes, ist nicht mehr.«
»Ein ungewöhnliches Leben, ein ungewöhnlicher, großer Mann ist uns genommen worden.«
Nach einer Stunde hielt Rodrigo inne, überflog seinen Text und zog das Blatt aus der Schreibmaschine.
Er lehnte sich im Stuhl zurück. Ich kann es nicht glauben, dachte Rodrigo. Und ich bin schuld, ich habe ihn dazu gebracht! Als er mich damals anrief und wir uns gestritten hatten über den missglückten Militärputsch eines gewissen Colonel Chávez …
I. DER ONKEL
Don Juan Vicente Morales schlug seinen Tischkalender auf. Es war der 24. März 1998. Er trug, wie jeden Tag, die Wetterbedingungen dieses Tages in einer kurzen Notiz ein. Der Tag war heiß gewesen, und es hatte wieder nicht geregnet. Es hatten sich die Wolken grau und schwarz zusammengeballt, wie so oft in den vergangenen Wochen, und die Luftfeuchtigkeit hatte stark zugenommen. Aus der Ferne war, vor allem nachts, immer wieder das Grollen eines heftigen Gewitters zu hören, aber wahrscheinlich war es wieder nur jenseits der Grenze zum Regnen gekommen, in Kolumbien, hinter Cúcuta. Aber jetzt, Ende März, war es Zeit. Die quebradas auf der Hazienda führten kaum noch Wasser. Die Regenzeit ließ auf sich warten. Es hatte Anfang Januar ein paarmal kürzere nächtliche Platzregen gegeben; dabei sollte es im Januar normalerweise überhaupt nicht regnen. Der Kaffee stand dann kurz vor der Blüte, und ein einziger starker Regenguss konnte genügen, um der nächsten Ernte schweren Schaden zuzufügen. Aber jetzt, im März, nach der Blüte, jetzt bräuchten die Pflanzen dringend Wasser.
Sein mittlerweile mehr grau meliertes als braunes Haar hatte er wie immer mit etwas Gel streng nach hinten gekämmt, was ihm, zusammen mit seinem Rasierwasser, seinen typischen Geruch gab. Seit seiner Jugend hatte er weder sein Haargel noch sein Rasierwasser gewechselt. Es war seine eigene Mischung, die nach Zedernholz, Citrus, Lavendelseife und einigen weiteren Noten roch, die er selbst nie hätte identifizieren können, aber sie waren vertraut, und er wusste, dass sein Vater auch so gerochen hatte.
Die Verknappung des Wassers machte ihm große Sorgen. Früher war das nicht so, dachte Don Juan kopfschüttelnd, wir hatten immer genügend Wasser. Auf der Hazienda war dies mittlerweile sein größtes Problem: Die kleinen Bäche und Flussläufe, die kleinen und größeren quebradas, die seine Hazienda durchquerten, die ihre Lebensadern waren, wurden immer dünner, und aus den noch bis vor einigen Jahren herrlich anzusehenden Kaskaden waren Rinnsale geworden. Als Kinder hatten sie in den Kaskaden immer gebadet, dort oberhalb des Hauses, als es noch kein Badezimmer im Haus gab. Es war immer wieder eine kleine Mutprobe gewesen, über die glitschigen Steine in das Wasser einzutauchen – sauber, aber dunkelbraun und rötlich wegen des hohen Eisengehaltes der Erde. Mulmig war einem immer dabei, da man nicht auf den Grund sehen konnte, und die ins Wasser eingetauchten Hände und Füße waren unterhalb der Knöchel nicht einmal mehr zu erahnen. Man konnte die anderen Kinder so herrlich erschrecken, wenn man plötzlich aufschrie und so tat, als sei irgendein Monster im Wasser, das einem nach dem Leben trachtete!
Es sind die neuen urbanizaciones, die sich oberhalb von La Cayena ansiedeln, dachte Don Juan, sie nehmen meiner Hazienda immer mehr Wasser weg. Eine Siedlung nach der anderen hat man da oben gebaut, dort, wo früher nur Plantagen waren. Da siedeln sie die Leute an, verteilen das Land, ohne irgendeine vernünftige Infrastruktur, keine Wasserleitungen, keine Kanalisation, keine vernünftigen Straßen, und dann haben alle diese Leute noch nicht mal eine vernünftige Arbeit! Wenn sie wenigstens bei mir arbeiten wollten, zur Erntezeit kann ich immer zusätzliche Leute gebrauchen, aber dafür sind sie sich zu gut! Fahren lieber stundenlang mit dem Bus, der auch nur unregelmäßig geht, um auf halbem Weg nach San Cristóbal in der neuen Lampenfabrik zu arbeiten. Dabei war es ja gut, wenn sie wenigstens einer geregelten Arbeit nachgingen, denn die meisten Bewohner Rubios waren nur noch auf dem Schwarzmarkt unterwegs.
Aber wenigstens und Gott sei Dank, sagte sich Don Juan, haben wir hier unten in Rubio immer genug Wasser. Die große Investition in den neuen Aquädukt, der das ganze Jahr über Wasser aus den Bergen herunterführte, hatte sich bezahlt gemacht. Nur ärgerte er sich, dass niemand mehr davon sprach, dass er, Don Juan, und kein anderer es gewesen war, der darauf gedrängt hatte. Stattdessen brüstete sich dieser imbécil, dieser Trottel von Pedro Lozano damit, es sei seine größte Errungenschaft gewesen, und dabei war er damals nur deswegen Bürgermeister geworden, weil er, Don Juan, ihm damals seinen Wahlkampf bezahlt hatte!
Don Juan saß in seinem Haus am Ende des corredor am Schreibtisch und paffte seine Nachmittagszigarre, in der Ecke, von der aus er den ganzen Patio überblickte, inmitten der vertrauten Geräusche: das Zwitschern der Vögel; das zischend-ziehende Geräusch der in unregelmäßigen Abständen anspringenden Pumpe, die bei Bedarf Wasser aus dem unterirdischen Tank heraufholte; das schnelle und nervös schnatternde Schlagen der Flügel des kleinen frechen Kolibris, der sich völlig ungeniert zwei Meter von ihm entfernt über dem blutroten Stempel der hellgelben Hibiskusblüte wie ein kleiner Helikopter in der Balance hielt, bis er genug von seiner Lieblingsspeise durch seinen gebogenen, scharfen Schnabel eingesogen hatte; in der Nachbarschaft übte ein Kind auf einem ziemlich verstimmten Klavier immer wieder dieselbe Stelle eines Stückes zunächst noch undefinierbaren Charakters, welches sich vielleicht einmal – und hoffentlich bald – anders anhören würde. Chopin, es sollte wohl Chopin sein, der würde sich im Grab umdrehen!
Über das alte Ziegeldach des kleinen Anbaues, der das Pumpenhaus beherbergte, sah Don Juan auf seinen »heiligen Berg«, den Tamá, die hohe Kordillerenkette, die an die dreitausend Meter hochragte, dunkelgrün bewaldet bis fast oben hin und stets von geheimnisvollen Wolken umgeben. Geheimnisvoll deswegen, weil die Leute schon immer gesagt hatten, dieser Berg, El Tamá, sei geheimnisvoll. Er liebte diesen Berg, seit seiner Kindheit war ihm der Anblick vertraut; dort, unterhalb des Tamá, lag La Cayena, seine Hazienda, benannt nach den rot blühenden Hibiskusstauden, die dort überall wild wuchsen.
Es war die Stunde, in der die Hitze des Tages sich langsam auflöste. Eine leichte Brise kam auf, die Wolken zogen sich, wie fast jeden Tag um diese Zeit, dichter zusammen, als überlegten sie, ob sie es heute vielleicht doch noch regnen ließen. Wahrscheinlich würden sie es auch heute wieder mit einer Ahnung von Regen, mit einigen Tropfen bewenden lassen. Es müsste wirklich dringend regnen, dachte Don Juan, während er die Zeitung las.
Drüben in San Cristóbal war wegen des Wassermangels der Ausnahmezustand verhängt worden. Die ley seca, die verkündet werden musste, hatte bereits erste Festnahmen zur Folge: ein Mann, der die Ungeschicklichkeit oder auch die unbelehrbare Frechheit besaß, seinen Wagen vor dem Haus in aller Öffentlichkeit zu waschen, und sofort von einer Patrouille mitgenommen wurde; oder eine Frau, die es nicht übers Herz bringen konnte, ihre vielen Topfpflanzen vertrocknen zu lassen, und von ihrer Nachbarin angezeigt wurde.
In San Cristóbal zeigten sich die Folgen einer planlosen Wucherung der Wohnviertel; fehlende oder unvollständige Planung der Wasserversorgung ging einher mit der üblichen Korruption, die offenbar auch hier ihre Spuren hinterlassen hatte: die Gelder, die vom Gouverneur zum Bau des neuen Aquädukts zur Verfügung gestellt worden waren, waren zum großen Teil entweder nie beim contratista angekommen oder dort veruntreut worden, jedenfalls war der neue Aquädukt schlecht gebaut worden, hatte nie richtig funktioniert und war vor Kurzem eingestürzt. Die armen Leute in San Cristóbal! Man würde dort jetzt wahrscheinlich einige Monate unter akutem Wassermangel leiden.
Don Juan stand auf, um auf die Hazienda zu fahren. Er stieg in seinen weißen Jeep und rief Maruja, seiner Köchin, am offenen Tor zu, sie möge Ramón, seinen Verwalter auf der Hazienda, anrufen und ihm sagen, er käme etwas später. »Ich möchte noch eine Runde drehen, bevor ich hinauffahre. Seine Frau soll mir aber bitte ein kleines Mittagessen vorbereiten!«
Sollte seine Hazienda wirklich in Gefahr sein? Das konnte er nicht zulassen. La Cayena war sein Leben.
Er fuhr hinunter zur Plaza Bolívar und bog nach rechts ab, nach Pueblo Viejo. Er liebte diese Straße mit seinen corredores, die zur Zeit seines Vaters gebaut worden waren. Es musste wohl noch unter Juan Vicente Gómez gewesen sein: Man wollte eine Architektur errichten, die damals schon im Verschwinden begriffen war, die traditionelle koloniale Architektur, die aus den Zentren der Städtchen und Dörfer langsam verschwand und in den großen Städten schon kaum mehr existierte. Aber, und darüber musste Don Juan immer wieder schmunzeln, man hatte hier in Pueblo Viejo nur Fassaden errichtet und dahinter keine Häuser! Erst später entstanden hinter den Fassaden richtige Häuser, aber die hatten mit der Architektur des traditionellen kolonialen Hauses – wie das Haus seiner Familie, mit einem Patio in der Mitte und dem umlaufenden corredor, von dem die Zimmer ausgingen – nichts zu tun, meist waren es eher einfach gebaute Hütten. Don Juan liebte es, durch diese Straße zu fahren, denn sie führte zum Friedhof, auf dem die Verstorbenen seiner Familie lagen. Aber die Straße führte noch weiter hinauf, auf den Hügel über dem Städtchen, zu einem Platz, den er besonders liebte, zur curva del diablo. Dort oben an der Biegung der Straße, die nach Cuquí führte, jenem kleinen verträumten Dörfchen, das aus ganzen acht Häusern bestand und aus dem seine Großmutter stammte, von dieser Kurve hatte man einen wunderbaren Blick auf ganz Rubio. Er liebte diesen Ort seit seiner Kindheit, sein Vater hatte ihn immer wieder hier heraufgeführt, und mit seinem geliebten Onkel José Miguel war er ein paarmal heraufgeritten. La curva del diablo. Immer wenn Don Juan von Sorgen geplagt war oder wenn er nachdenken wollte, war er hierhergefahren.
Er stieg aus dem Auto und setzte sich auf das kleine Mäuerchen. Es wurde einst gebaut, um zu verhindern, dass noch mehr Autos über die steile Böschung hinunterstürzten. Dies hier schien schon immer ein verwunschener Ort zu sein, an dem viel Unglück geschehen war, versehentliche Unglücksfälle, aber auch Selbstmorde. Die Wahrheit war wohl, dass hier oben weder böse Geister noch der Teufel ihr Unwesen trieben, sondern dass sich dort in alten Zeiten, als an der Stelle noch die alte Straße nach San Antonio vorbeiführte, Wegelagerer mit schwarzen Kapuzen versteckten.
Dabei war dieser Platz besonders schön. Weil aber die Leute in Rubio daran glaubten, dass die Geister der Toten sich hier herumtrieben, auch die unerlösten Seelen vom Friedhof, der unterhalb des Hügels lag, konnte Don Juan sich sicher sein, dass sich hier niemand niederließ, um, so wie er, einfach nur den Ausblick zu genießen.
Von hier hatte man auch den schönsten Blick auf die Kirche von Rubio. Früher hatte die Kirche noch ihre wunderschöne weiße Fassade im spanischen Kolonialstil, es war eine relativ kleine Kirche, die hinter der alten Fassade errichtet worden war. Der sehr viel größere Kirchenneubau war in den zwanziger Jahren entstanden, fast vollständig finanziert von den familias von Rubio, die sich ringsherum in den prächtigen Kirchenfenstern, die man größtenteils in Deutschland in Auftrag gegeben hatte, verewigen ließen. Die Fenster der Taufkapelle mit dem mächtigen Taufstein aus weißem Carrara-Marmor waren von der Familie Morales gestiftet worden, mit der Darstellung der Taufe Christi in der Mitte, dem predigenden Johannes dem Täufer zur Linken und der Heiligen Familie mit dem Johannesknaben auf der rechten Seite, das dem berühmten Bild Raffaels im Prado nachempfunden wurde. Gleich nebenan, in der zweiten Seitenkapelle, waren die Fenster der Familie Uzcátegui, der stolzen Cousins und Nachbarn von Don Juan, dann die der Alarcón, der Pinzón, der Medina, der Cordero und der Ramírez. Die unverputzten glasierten Ziegel, die man zum Bau verwendet hatte, waren in Rubio gebrannt worden, in jenen Ziegeleien, die inzwischen nur noch als Ruinen in einer ziemlich trostlosen Gegend hinter dem Friedhof standen, dort, auf der anderen Seite des Flusses, kurz vor der Abzweigung, die hinaufführte zur Straße nach Cuquí, vorbei an der curva del diablo.
Aber dann wollte sich der Präsident Carlos Andrés Pérez während seiner ersten Präsidentschaft von 1974 bis 1979 in seinem Heimatort ein Denkmal setzen. Er ließ die schöne weiße Fassade im alten Kolonialstil abreißen und ersetzte sie durch eine ziemlich scheußliche neogotische Fassade mit zwei hohen Türmen, was keine stilistische Verbesserung war, aber ihren Zweck erfüllte: ein sichtbares Zeichen, das dem Sohn der Stadt zu verdanken war. Ebenso wie die Verschönerung des Platzes, das neue Denkmal für Simón Bolívar, der mit ausgebreiteten Armen auf seinem Pferd saß, so wie er selbst, der Präsident Carlos Andrés Pérez, seine Arme ausbreitete, wenn er zum Volk sprach.