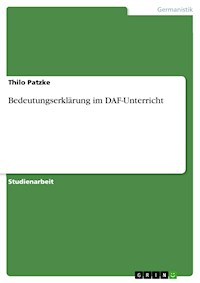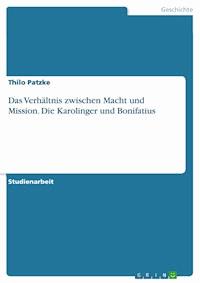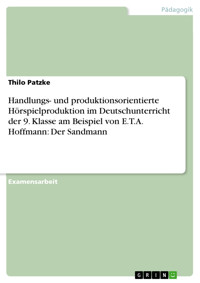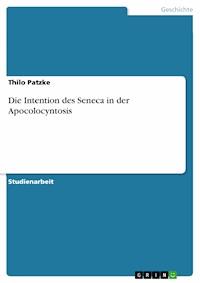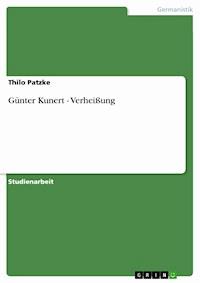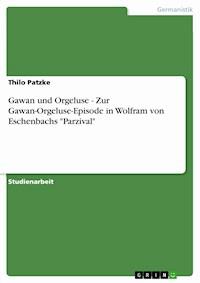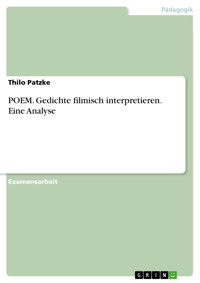
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 2,0, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Didaktik der deutschen Sprache und Literatur), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptabschnitte. Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) werden zunächst ausgewählte Lyrikverfilmungen des Films betrachtet und analysiert, um die Besonderheiten und Schwierigkeiten verfilmter Lyrik deutlich zu machen. Eine Begrenzung der aufgeführten Beispiele erfolgte, da die Analysetätigkeit aufgrund der dem Film innewohnenden Informationsmenge prinzipiell endlos ist und somit den Rahmen der Arbeit überschreiten würde. Auch sind sich einige Clips in ihrer Struktur so ähnlich, dass eine beispielhafte Analyse ausreichend ist, um die jeweilige Art der Gedichtverfilmung darzustellen. Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten der Filmanalyse eingegangen und anschließend im dritten Teil (Kapitel 4) auf die Besonderheiten von Filmdidaktik und Literaturunterricht, um somit, ausgehend von der Sachanalyse, das nachfolgende Schulprojekt didaktisch zu verorten Nach diesem Hauptteil folgt in Kapitel 5 der praktisch-theoretische Teil des Projekts, die Umsetzung in der Schule, die sich in Gedichtanalyse, Erwerb filmanalytischer Kategorien und Methoden und schließlich in einen Produktionsteil aufgliedert. Dabei wurde der Versuch unternommen, eine Unterrichtsplanung zu erarbeiten, die Lernfortschritte dadurch ermöglicht, dass Kognition und Operation aufeinander bezogen sind und sich abwechseln.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2007
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Analyse ausgewählter Gedichtverfilmungen
2.1 Ernst Jandl – glauben und gestehen
2.2 Mascha Kaléko – Sozusagen grundlos vergnügt
2.3 Ingeborg Bachmann – Nach grauen Tagen
2.4 Kurt Tucholsky – Aus!
2.5 Erich Kästner – Kleines Solo
2.6 Hans Arp – Sophie
2.7 Else Lasker-Schüler – An den Ritter aus Gold
2.8 Heinrich Heine – Der Schiffbrüchige
2.9 Rainer Maria Rilke – Siehe, ich wußte, es sind
3 Filmanalyse
3.1 Kategorien
3.1.1 Kategorien der Gedichtverfilmungen
3.1.2 Kategorien der Analyse von Gedichtverfilmungen
4 Film im Unterricht
4.1 Medienkompetenz
4.1.1 Medienkompetenz als Projektaufgabe
4.2 Besonderheiten von AV-Medien
4.3 Film im Deutschunterricht
4.4 POEM als Beispiel
5 POEM im Unterricht
5.1 Lernziele
5.2 Phase 1: Gedichtanalyse
5.3 Phase 2: Filmanalyse
5.4 Phase 3: Produktion
5.5 Lernzielkontrolle
6 Zusammenfassung
7 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse eines medialen Phänomens, der Lyrikverfilmung. Ralf Schmerberg hat in fünfjähriger Arbeit seinen Film POEM geschaffen (Schmerberg 2003). Die Idee des Films ging einher mit seiner persönlichen Feststellung einer zunehmenden Banalisierung der Sprache.
Verfilmte Lyrik ist für den Deutschunterricht eine besondere Herausforderung, aber auch eine einmalige Chance. Die Herausforderung besteht darin, den Film angemessen zu analysieren und zu bearbeiten. Die Schwierigkeit der Analyse besteht darin, dass sowohl der Text (das einzelne Gedicht) als auch der Film eigentlich separate Kunstwerke darstellen und als solche zu betrachten sind. Diese beiden Bereiche durch eine Analyse in Verbindung zu bringen ist das erste Ziel dieser Arbeit. Die einzelnen Verfilmungen, im Folgenden als Clips bezeichnet, da sie in ihrer Struktur Musikvideoclips ähneln, werden in Bezug auf ihren formalen Eigenwert, also ihre Ästhetik, ihre Aussage und ihre Wirkung, untersucht.
Die Chance verfilmter Lyrik gerade für den Deutschunterricht besteht darin, zum einen etwas zu bearbeiten, das an die Lebenswirklichkeit der Schüler angelehnt ist, zum anderen auf die Besonderheiten von verfilmten Texten eingehen zu können, um für diese besonders zu sensibilisieren.[1]
Das zweite Ziel ist, einen Blick auf die aktuelle Mediendidaktik zum Thema „Film im Unterricht“ zu werfen und daraus die Begründung für eine Beschäftigung mit POEM im Unterricht abzuleiten.
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptabschnitte. Im ersten Teil dieser Arbeit (Kapitel 2) werden zunächst ausgewählte Lyrikverfilmungen des Films betrachtet und analysiert, um die Besonderheiten und Schwierigkeiten verfilmter Lyrik deutlich zu machen.
Eine Begrenzung der aufgeführten Beispiele erfolgte, da die Analysetätigkeit aufgrund der dem Film innewohnenden Informationsmenge prinzipiell endlos ist und somit den Rahmen der Arbeit überschreiten würde. Auch sind sich einige Clips in ihrer Struktur so ähnlich, dass eine beispielhafte Analyse ausreichend ist, um die jeweilige Art der Gedichtverfilmung darzustellen.
Im zweiten Teil (Kapitel 3) wird auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten der Filmanalyse eingegangen und anschließend im dritten Teil (Kapitel 4) auf die Besonderheiten von Filmdidaktik und Literaturunterricht, um somit, ausgehend von der Sachanalyse, das nachfolgende Schulprojekt didaktisch zu verorten.
Nach diesem Hauptteil folgt in Kapitel 5 der praktisch-theoretische Teil des Projekts, die Umsetzung in der Schule, die sich in Gedichtanalyse, Erwerb filmanalytischer Kategorien und Methoden und schließlich in einen Produktionsteil aufgliedert. Dabei wurde der Versuch unternommen, eine Unterrichtsplanung zu erarbeiten, die Lernfortschritte dadurch ermöglicht, dass Kognition und Operation aufeinander bezogen sind und sich abwechseln.
2 Analyse ausgewählter Gedichtverfilmungen
Die Gedichtverfilmungen, die in den folgenden Analysen untersucht werden, sind nach der Reihenfolge ihres Erscheinens in POEM geordnet und nummeriert. Es werden nicht alle Clips des Films ausführlich besprochen, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde.
Die Auswahl der Clips ist dennoch repräsentativ, da in den hier behandelten Clips die Wirkungsintention sowohl der einzelnen Clips als auch des gesamten Films und die spezifischen Besonderheiten von Gedichtverfilmung deutlich werden.
Die Analysen selbst sind ihrerseits nach folgenden Gesichtspunkten strukturiert: Der erste Aspekt ist die Beschreibung, der zweite die Inhaltsanalyse und der dritte die Interpretation.
Ausgangspunkt der Filmanalyse ist in Übereinstimmung mit gängigen Filmanalysemethoden eine formal-inhaltliche Protokollierungdes filmischen Ablaufs, die die notwendige Voraussetzung für die Interpretation darstellt. Dabei werden wichtige Bildmotive aufgezeigt, gegenübergestellt und miteinander verglichen.
In einem zweiten Schritt werden die eingesetzten filmischen Mittel analysiert und kommentiert. So werden die Relationen von Einstellungsgrößen, Perspektiven und Kamerabewegung untersucht. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Beziehungen von Wort, Bild und Ton.
Der dritte und entscheidende Schritt ist die Sequenzanalyse des Kurzfilms. Hier werden die Symbole und Zeichen des Films sowie die Wechselbeziehung von Form und Inhalt entschlüsselt.
Die Sequenzanalyse folgt dabei dem Schema der Kategorien, das Hesse / Krommer / Müller (2005, S. 43) vorgestellt haben, d.h. die filmischen Bilder werden unter Einbeziehung der sprachlichen Bilder betrachtet. Dabei liegt der Schwerpunkt auf den neu eingeführten filmischen Symbolen, die sich von den in der Vorlage angelegten signifikant unterscheiden, und auf der Sprecherrolle, die den Deutungsansatz des Regisseurs am deutlichsten darstellt, da die Entscheidung, ob ein On- oder Off-Sprecher verwendet wird, Einfluss darauf hat, ob durch die Rezitation des Gedichtes eine Nähe zur Person des Sprechers oder zur Situation hergestellt wird.
Diese drei Kategorien, sprachliche Bilder, neu eingeführte filmische Symbole und die Sprecherrolle, werden sodann miteinander in Verbindung gebracht und auf ihre Aussage hin untersucht, denn Film und Gedicht müssen stets als synthetische Einheit betrachtet werden.
2.1 Ernst Jandl – glauben und gestehen
ich glaube
daß meinem toten großvater anton
und meiner toten großmutter marie
und meiner toten mutter luise
und meinem toten vater viktor
und meinen toten vettern herbert und hans
und meinen toten onkeln und tanten
und meinem toten freund dietrich
und allen toten die ich lebendig gekannt habe
ich niemals irgendwo wieder begegnen werde
und
ich gestehe
daß irgend einem von ihnen
wie sehr ich ihn auch geliebt haben mochte
jemals irgendwo wieder zu begegnen
ich nicht den leisesten wunsch hege
(Jandl 1980, S. 104)
Der Clip zeigt Videoaufnahmen eines Amateurfilmers. Zu sehen sind Bilder eines Hochzeitsfestes: salbungsvolle Orgelmusik, alte und junge Menschen, das Brautpaar beim Fototermin, Tische voller Geschenke, überall Umarmungen, Küsschen und aufgeregt herumspringende Kinder - ein intelligenter, wirkungsvoller Kunstgriff, der die Brechung zwischen Wort und Bild perfekt macht, denn der Text des Gedichts passt so gar nicht zu der gezeigten Familien- und Hochzeitsidylle. Subversiv, mit einer zynischen Note, inszeniert Schmerberg Ernst Jandls „glauben und gestehen" und setzt bewusst auf den Kontrast zwischen Wort und Bild. Eine Journalistin (Decker 2005) schrieb in einer negativen Kritik, den düsteren Ton des Gedichts hervorhebend: „Ein Redner des Jüngsten Gerichts (über seine Anverwandten), während die Kamera leicht über eine unendlich gelöste Festgesellschaft schwebt.“
Der abgebildete Handlungsrahmen trennt das Wort vom Bild. Gleichzeitig wird aber durch den Film und das Zusammenspiel von Sprache und Bild eine Einheit erzeugt, die die Gesamtwirkung hochgradig verstärkt, wie in der Detailanalyse untersucht werden soll.
Detailanalyse:
Kommentierte Inhaltszusammenfassung:
Inhaltlich zeigt der Clip verschiedene Aufnahmen in einer Kirche, während einer Hochzeit. Gefilmt wird mithilfe der „subjektiven Kamera“, wodurch der Eindruck einer Amateuraufnahme und somit von Authentizität vermittelt wird. [2]
Der Clip beginnt mit einer Detailaufnahme zweier verschränkter Hände des Brautpaares und betont damit ein Motiv der Verbundenheit und Zusammengehörigkeit, stimmt also auf die zu erwartende gefühlvolle und heitere Hochzeitsatmosphäre ein.
Gleichzeitig ist aus dem Off zum Thema „Hochzeit“ passend, Orgelmusik zu hören. Der Organist wird während der zweiten Einstellung halbnah gezeigt, danach erklingt die Musik aus dem Off.
Die dritte Einstellung zeigt, überraschend aus der Vogelperspektive, verschiedene Personen. In der Bildmitte sind zwei Erwachsene und zwei spielende Kleinkinder zu sehen. Es folgen Detailaufnahmen einer zeichnenden Hand und der Frackschöße des Organisten aus der Untersicht. In einer weiteren Einstellung wird der Innenraum der Kirche mitsamt den Hochzeitsgästen gezeigt. Kontrastierend werden in mehreren Einstellungen alte, sitzende Frauen und ein im Mittelgang herumlaufendes Kind gegenübergestellt, symbolisch für das Alte und Neue.
Zeitgleich zur Vermählungszeremonie beginnt Herbert Fritsch als Off-Sprecher das Gedicht „glauben und gestehen“ in einer langsamen, abgehackten Sprechweise zu rezitieren, mehr „hervorzupressen“, zudem werden alle von den Personen verursachten Geräusche stark gedämpft, der Film läuft fast tonlos im Hintergrund als Untermalung und wird im Vordergrund durch die Worte des Sprechers scheinbar kommentiert.
Die ersten zwei Worte des Titels „glauben und gestehen“ lassen sich noch inhaltlich mit der gezeigten Handlung verbinden und könnten mit den Worten des Pfarrers verwechselt werden. Aber nach wenigen Sekunden, während die filmische Narration bereits zu den Glückwünschen und Gesprächen nach der Hochzeit übergeht, fallen unerwartet und vom bildlichen Kontext losgelöst die Worte „daß meinem toten großvater anton“. Hier wird die Beziehung zwischen den Worten und den gezeigten Bildern fraglich bzw. entwickelt sich nicht weiter. Auch die 14 folgenden Verse stehen in direktem Kontrast zu den gezeigten fröhlichen Gästen und Bildern. In einer Oszillationsbewegung zwischen Wort und Bild, wobei fast jedem Wort eine neue Einstellung entspricht, wird das Gedicht rezitiert. Die Bilder haben keine direkte Entsprechung in den Worten, die einzige erzeugte Gemeinsamkeit ist die der Schnittfolge und Sprechweise.
Die Begebenheiten der Hochzeitsfeier werden in der weiteren Bildfolge im Zeitraffer zusammengefasst, bis der Abend erreicht ist. Die letzten Einstellungen zeigen tanzende Gäste unterschiedlichen Alters, die sich zu einer unhörbaren Musik bewegen, das Ende des offiziellen Programms. Bei den Worten des letzten Verses „ich nicht den leisesten Wunsch hege“ werden abrupt die Bilder ausgeblendet und die letzten Worte verhallen vor einem schwarzen Bildschirm.
Sequenzanalyse:
Im vierten POEM-Clip ist das gezeigte Bild dem Ton gegenläufig, dieses Auseinanderfallen von Text- und Bildinformationen wird als „Wort-Bild-Schere“ bezeichnet, die hier besonders augenfällig wird (vgl. hierzu Gast 1993, S. 36). „Wenn Verse von Ernst Jandl mit Bildern einer glücklichen Hochzeitsgesellschaft unterlegt sind, führt das Wort zu einer Destruktion des Bildes.“ (Cizmecioglu 2005)
Auch die Tatsache, dass zwar zu Beginn Orgelmusik zu hören ist, aber die Rezitation von keiner Begleitmusik unterlegt ist, passt zu der apodiktischen Forderung Jandls, „jede Verwendung von Musik ist zu unterlassen“. (Mon 1982, S. 29)
Gerade die stark akzentuierte und rhythmisierte, aber auch abgehackte Sprechweise sowie der Inhalt des Gedichts machen es dem Zuschauer unmöglich, eine wie auch immer geartete sinnvolle Verbindung zwischen den gezeigten Bildern und dem rezitierten Gedicht herzustellen. Dennoch entsteht sie, wenn auch nur auf einer additiven Ebene. Im filmischen Rahmen des Schauplatzes „Hochzeit“ erscheinen das Bild und das Gedicht als etwas Zusammengehöriges. Diese filmische Zusammengehörigkeit wird jedoch durch den Inhalt des Gedichts gleichzeitig wieder dekonstruiert. Der gesprochene Text des Gedichtes versetzt den Zuschauer in eine Atmosphäre der Spannung und Unruhe, in der er nicht weiß, in welcher Verbindung die gezeigten Bilder zu der Aufzählung toter Verwandter stehen.
Es ist der Text, der zeitgleich eine paradoxe Dekonstruktion und Einheit mit den Bildern schafft. Dadurch entsteht ein spezifischer filmischer Raum, der durch beide Komponenten, Sprache und Bild, bedingt ist, die zwar inhaltlich kontrastieren, aber im filmischen Ergebnis eine untrennbare Einheit darstellen und somit eine neue, vom ursprünglichen Gedicht differente Bedeutung schaffen.
Das Gedicht selbst zeichnet sich durch eine besondere Struktur aus. Zunächst ist es ein langer Satz, optisch wie textlich, durch das allein stehende Wort „und“ in zwei nebeneinander stehende Hauptsätze unterteilt. Beide Teilsätze sind formal parallel aufgebaut, werden eingeleitet durch eine Tätigkeit des lyrischen Ich und beendet durch einen negierten Wunsch. Ebenso sind die Verse 2-9 formal parallel konstruiert. Mithilfe der gebrochenen Syntax und des Parallelismus werden die Betonung und der Schwerpunkt des Gedichtes auf das jeweilige Ende des Satzes gelenkt, die dem Gedicht erst seine negative und ablehnende Bedeutung geben.
Die Wirkung wird ebenfalls durch die elliptische Form des Gedichts bestimmt, die sich wiederum in den überlangen Sprechpausen konstituiert. Durch diese Sprechweise werden sowohl die einzelnen Wörter des Gedichtes stark betont als auch der Rezipient in eine erwartende Haltung darüber versetzt, was als Nächstes auf ihn zukommt, da das Gedicht erst an seinem Ende über seine Bedeutung Aufschluss gibt. Denn das Gedicht zögert durch die Konstruktion seine eigentliche Botschaft so lange wie möglich hinaus. Die entscheidende Fragestellung ist die, auf welche Art und Weise sich diese textimmanente Struktur in den gezeigten Bildern und somit in der Gesamtwirkung widerspiegelt.
Der Zuschauer weiß beim erstmaligen Sehen, und so bedingt es die Rezeption im Kino, beim einmaligen Sehen nicht, welche Aussage am Ende des Gedichts steht und in welcher Verbindung das Gedicht und seine Aussage zum gezeigten Schauplatz stehen.
Die Form des Gedichts wird durch dem chronologischen Ablauf der Hochzeit verdeutlicht und daher ist es nur konsequent, das Ende des Gedichts nach dem Ende der Bilder in einem leeren Raum erklingen zu lassen, so dass sowohl der bestehende Zusammenhang zwischen der Hochzeit und Ernst Jandls Gedicht deutlich zu Tage tritt als auch die ablehnende Aussage des lyrischen Ichs besonders betont wird.
Das Gedicht ist motiviert durch das, was es verschweigt und nicht explizit erwähnt. Die Wahl des Präsens als Erzähltempus erweckt eine Vorstellung von Gleichzeitigkeit von Erfahrung und Umsetzung. Den Anlass der Ablehnung seiner Verwandten erwähnt das lyrische Ich nicht, die Erzählung verharrt objektiv an der Oberfläche.