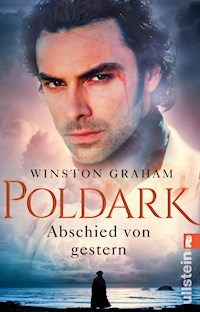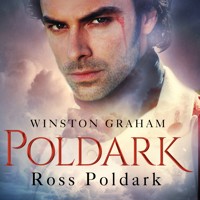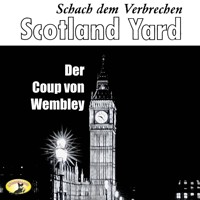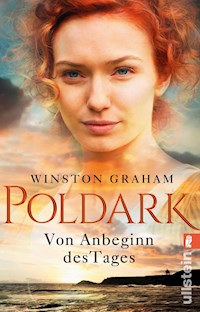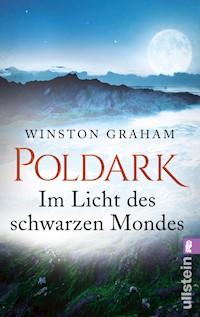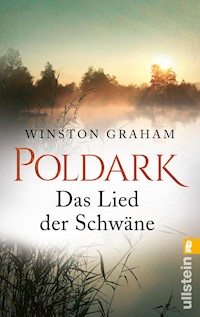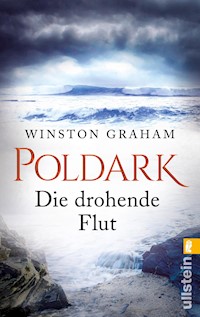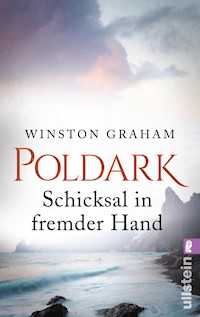
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Cornwall 1792-1793 Ross Poldark stürzt sich in ein hochriskantes Minengeschäft, das nicht nur die finanzielle Sicherheit seiner Familie gefährdet, sondern auch seine turbulente Ehe mit Demelza. Als Ross sich wieder zu seiner alten Liebe Elizabeth hingezogen fühlt, rächt sich Demelza, indem sie sich mit einem attraktiven schottischen Kavallerieoffizier einlässt. Mit dem drohenden Bankrott muss sich die Ehe von Ross und Demelza Gefahren von allen Seiten stellen ... »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der vierte Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1792 bis 1793: Das Leben von Ross Poldark und seiner Frau Demelza war schon immer turbulent. Jetzt wird ihre Ehe auf die bislang größte Probe gestellt. Denn Ross stürzt sich in ein hochriskantes Minengeschäft, das die finanzielle Sicherheit seiner Familie gefährdet. Als er sich obendrein wieder zu seiner alten Liebe Elizabeth hingezogen fühlt, rächt sich Demelza, indem sie sich mit einem attraktiven schottischen Kavallerieoffizier einlässt. Schon bald fordern diese Gefühle ihren Preis, und Ross und Demelza müssen stärker als je zuvor um ihre Ehe kämpfen.
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gesternPoldark – Von Anbeginn des TagesPoldark – Schatten auf dem WegPoldark – Schicksal in fremder HandPoldark – Im Licht des schwarzen MondesPoldark – Das Lied der SchwänePoldark – Die drohende Flut
Winston Graham
Poldark
Schicksal in fremder Hand
Roman
Aus dem Englischenvon Christiane Kashin
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten:
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1238-5
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1953Titel der englischen Originalausgabe: Warleggan (Pan Books, Pan Macmillan, London 2008; first published in 1953 by Werner Laurie Ltd.)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, München
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Erstes Buch
1
In den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts herrschte in dem Dreieck, das Truro, St. Ann’s und St. Michael an der Küste von Cornwall bilden, kein sonderlich reges geselliges Leben. Es gab dort sechs große Herrenhäuser, doch die Lebensumstände der Familien, die sie bewohnten, begünstigten einen Verkehr mit den Nachbarn nicht gerade.
Der älteste und am meisten östlich gelegene Besitz war Mingoose House. Ruth Treneglos, geborene Teague, hatte sich die größte Mühe gegeben, das gesellige Leben in Schwung zu bringen, doch ihre mehrmalige Niederkunft nach Jahren vergeblichen Wartens hatte ihre Kraft ein wenig erschöpft; der hemdsärmelige John Treneglos war nur an der Jagd interessiert, und Ruths Schwiegervater war ein schwerhöriger Bücherwurm, den es nicht kümmerte, wer in seinen Empfangsräumen ein und aus ging. In Werry House, dem größten und ansehnlichsten der sechs Landsitze, wohnte der vierschrötige Sir Hugh Bodrugan, ein rücksichtsloser Schürzenjäger. Lady Constance Bodrugan, seine Stiefmutter, die dem Alter nach seine Tochter hätte sein können, züchtete Hunde und sprach den ganzen Tag kaum von etwas anderem.
An der Westseite des Dreiecks lagen Place House, das zu Beginn des Jahrhunderts in palladianischem Stil erbaut worden war, von Sir John Trevaunance, einem verwitweten, kinderlosen Baronet, bewohnt wurde, und Killewarren, das kaum mehr als ein besseres Bauernhaus war und Ray Penvenen gehörte, der noch reicher und noch sparsamer war als sein Nachbar.
Von den beiden Familien, die dazwischen wohnten – das eine Haus lag unmittelbar an der Küste, das andere etwas weiter entfernt –, hätte man einigen Sinn für geselligen Umgang erwarten können, nicht nur wegen des Namens, den sie trugen, sondern auch, weil sie noch jung waren. Doch beiden jungen Paaren fehlte es an Geld.
Zwischen Sawle und St. Ann’s lag auf einer Anhöhe, doch von Bäumen schützend umringt, Trenwith House, ein schönes elisabethanisches Gebäude. Dort lebte Francis Poldark mit seiner Frau Elizabeth, seinem knapp achtjährigen Sohn Geoffrey Charles und seiner Großtante Agatha, einer steinalten, tauben Dame. Rund fünf Kilometer östlich lag das kleinste der sechs Herrenhäuser, Nampara, ein nach praktischen Gesichtspunkten in georgianischem Stil erbautes Haus, das nie ganz vollendet worden war, das aber dennoch einen besonderen individuellen Zauber ausstrahlte. Hier lebte Ross Poldark mit seiner Frau Demelza; ihr kleiner Sohn Jeremy war gerade ein Jahr alt.
Von diesen sechs Familien waren also die zwei ersten vollauf mit Hunden und kleinen Kindern beschäftigt, zwei andere besaßen zwar die Geldmittel, Gesellschaften zu geben, verspürten aber keinen Antrieb in dieser Richtung, und die beiden letzten hatten zwar den Antrieb, aber kein Geld. Und als Sir John Trevaunance an die andern fünf Familien eine Einladung zum Abendessen am vierundzwanzigsten Mai 1792 verschickte, löste er damit die größte Überraschung aus. Sir John schrieb, er wolle die Gelegenheit, dass seine Schwester und auch sein Bruder Unwin, der die Stadt Bodmin im Parlament vertrat, zu Besuch kommen würden, ergreifen, Gäste zu sich zu bitten.
Diese Begründung schien nach der jahrelangen Zurückgezogenheit, die Sir John geübt hatte, ziemlich weit hergeholt, und alle fragten sich nach dem eigentlichen Grund für Sir Johns Verhalten. Demelza Poldark glaubte ihn zu erraten, und sie wartete ungeduldig auf Ross’ Rückkehr von der Mine, jener neuen Mine Wheal Grace, in der er nun den größten Teil seiner Zeit verbrachte.
Während Demelza den Tisch für den Tee deckte – Abendessen gab es erst um acht –, sann sie darüber nach, wie dieses letzte Wagnis, das Ross unternommen hatte, wohl ausgehen mochte. Wheal Leisure, die Mine auf den Klippen, die Ross im Jahre 87 mit sechs anderen Unternehmern in Betrieb genommen hatte, florierte nach wie vor, doch im vergangenen Jahr hatte er die Hälfte seiner Anteile verkauft.
Das hatte sich bisher als Fehlschlag erwiesen. Zwar arbeitete die neue Entwässerungsmaschine, die zwei junge Ingenieure aus Redruth entworfen und gebaut hatten, ausgezeichnet, doch die von den alten Bergleuten angelegte fünfzig Klafter tiefe Sohle war längst ausgebeutet gewesen, und die neuen, siebzig und fünfundachtzig Klafter tiefen Sohlen hatten sich als unergiebig erwiesen und nur minderwertige oder gar keine Erträge geliefert.
Demelza warf einen Blick aus dem Fenster und sah Ross, der mit seinem Vetter Francis, der gleichzeitig sein Partner war, durch den Garten kam. Sie unterhielten sich angeregt, doch Demelza erkannte sofort, dass sie nicht über eine spektakuläre Entdeckung in der Mine sprachen.
Sie nahm Jeremy, der bei seinen wackligen Gehversuchen das Tischtuch gepackt hatte, auf den Arm und ging mit ihm zur Tür. Der Wind bauschte den Rock ihres grün gestreiften Baumwollkleides.
Als die beiden Männer näher kamen, sagte Francis: »Demelza, ich glaube, du wirst nie ganz erwachsen; du siehst aus wie siebzehn. Ich hatte eigentlich gar nicht vor, heute herzukommen, aber die Luft hat mir gutgetan, und eine Tasse Tee in deiner Gesellschaft ist das Einzige, was ich nun noch brauche.«
»Bist du heute zum ersten Mal draußen gewesen?«, fragte sie. »Ich hoffe nur, du bist nicht in die Mine hinabgestiegen.«
»Es ist das zweite Mal. Und in der Mine war ich nicht. Ross hat sich allein unten umgesehen, mit dem üblichen mäßigen Erfolg. Ich glaube, Jeremy bekommt noch einen Zahn. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er das letzte Mal, als ich ihn sah, erst drei.«
»Sieben!«, warf Ross ein. »Überleg dir, was du sagst, das ist ein gefährliches Thema.«
Lachend gingen sie ins Haus. Im ersten Teil der Teestunde beanspruchte Jeremy die ganze Aufmerksamkeit für sich, doch dann kam Mrs Gimlett und trug ihn fort. Ein wenig atemlos goss sich Demelza eine zweite Tasse Tee ein.
»Geht es dir jetzt wirklich besser, Francis? Ist das Fieber ganz weg?«
»Es war nur eine Grippe«, antwortete Francis. »Wir haben sie alle gehabt, aber mich hatte es am schlimmsten erwischt. Choake hat mich zur Ader gelassen und mir Chinarinde eingegeben; ich habe mich aber trotzdem wieder erholt.«
Ross dehnte sich und streckte seine langen Beine. »Warum rufst du nicht Dwight Enys, wenn du krank bist? Er ist tüchtig und mit den neuesten Methoden vertraut.«
Francis zuckte die Achseln. »Dr Choake ist schon so lange unser Hausarzt. Meiner Meinung nach sind diese Kurpfuscher alle gleich. Und so viel ich gehört habe, ist euer Freund Enys wegen dem alten John Ellery ziemlich in der Klemme.«
»Was ist denn los mit ihm?«
»Er hatte Zahnschmerzen, und Enys hat ihm drei Zähne gezogen, mitsamt den Wurzeln. Choake hatte sich damit begnügt, die Kronen abzuzwicken. Diesmal muss aber mit Dwights Methode irgendetwas schiefgegangen sein, denn Ellery hat seitdem ständig Schmerzen.«
»Deshalb sah Dwight also derart bekümmert aus, als er gestern hier war«, sagte Demelza.
»Er nimmt sich seine Misserfolge zu sehr zu Herzen«, sagte Ross. »Das ist ein großes Handicap in seinem Beruf.«
»Es ist ein Handicap in jedem Beruf«, erwiderte Demelza.
Francis zog ironisch eine Augenbraue hoch. Um das folgende Schweigen zu überbrücken, holte Demelza den Brief vom Kaminsims.
»Sir John hat uns eingeladen, Ross! Kaum zu glauben, in diesen schlechten Zeiten. Habt ihr auch eine Einladung bekommen, Francis? Bestimmt wird es eine ziemlich pompöse Sache. Ich habe mir schon den Kopf zerbrochen, was ich anziehen soll. Was sagt Elizabeth dazu?«
»Wir haben auch eine Einladung bekommen«, antwortete Francis, während Ross den Brief las. »Sir John wird auf seine alten Tage noch extravagant. Aber wie ich ihn kenne, steckt da etwas dahinter.«
»Genau das habe ich auch gedacht«, sagte Demelza.
»Und was?«, fragte Ross und schaute auf.
Francis blickte Demelza an, doch sie wartete offenbar darauf, dass er etwas sagte. Er lachte. »Ross, deine Frau und ich, wir haben einen unbarmherzig scharfen Blick. Ray Penvenens Nichte, Caroline, ist eine reiche Erbin. Unwin Trevaunance stellt ihr seit zwei Jahren nach! Vielleicht ist dies die Gelegenheit, bei der das Wild endlich erlegt werden soll.«
»Ich wusste gar nicht, dass das Mädchen wieder hier ist.«
»Sie ist, soviel ich weiß, vorige Woche aus Oxfordshire zurückgekommen.«
»Aber«, sagte Demelza, »wenn die Verlobung verkündet werden soll, müsste dann nicht Mr Penvenen die Gesellschaft geben?«
»Ray Penvenen«, meinte Francis, »würde noch nicht mal für seine eigene Verlobung eine Gesellschaft geben.«
»Hoffentlich entschließen sich die beiden endlich zu der Verlobung«, sagte Ross. »Denn wenn sich Caroline Penvenen länger hier aufhält, wird sie Dwights inneren Frieden wieder stören.«
»Ich habe auch gehört, dass bei ihrem letzten Besuch hier eine Art Techtelmechtel zwischen ihr und Enys war, aber ich halte ihn doch für klug genug, sich nicht zu sehr in ihre Netze verstricken zu lassen.«
»Kein Mann ist klug genug, wenn die Frau nicht klug genug ist«, sagte Demelza.
Ross grinste. »Eine scharfsinnige Bemerkung. Sprichst du aus persönlicher Erfahrung?«
»Ja, Ross. Ich spreche aus persönlicher Erfahrung. Denk doch nur daran, wie töricht Sir Hugh Bodrugan sich mir gegenüber benommen hätte, wenn ich es zugelassen hätte.«
Der tiefere Sinn seiner Frage ging ihm erst auf, als er sie schon ausgesprochen hatte, und er war froh, dass Demelza sie nicht falsch verstanden und auf eine andere Person bezogen hatte. Doch er dachte nicht darüber nach, dass es noch zwei Jahre zuvor keinerlei Zweifel über diesen Punkt gegeben hätte.
Etwa um die gleiche Zeit, als Francis und Ross von der Mine nach Nampara zurückgingen, um Tee zu trinken, stieg George Warleggan vor Trenwith House vom Pferd.
Nach dem ersten Augenschein wäre niemand darauf gekommen, dass er der Enkel eines Schmiedes und in seiner Familie der Erste war, der eine vornehme Erziehung genossen hatte. Und dennoch war gerade seine Kleidung verräterisch – kein anderer Landedelmann hätte sich für einen Nachmittagsbesuch so sorgfältig und teuer angezogen, nicht einmal, wenn er in der Absicht gekommen war, die Dame des Hauses zu beeindrucken. Und diese Absicht hatte George.
Als Mrs Tabb, die ihn eingelassen hatte, verwirrt und ein wenig aufgeregt auf die Suche nach Mrs Poldark gegangen war, schlenderte George in der Eingangshalle herum, klopfte mit seiner Reitpeitsche an seine Stiefel und betrachtete die Ahnenbildnisse an den Wänden. Francis und Elizabeth waren ebenso arm wie Ross und Demelza; dennoch gab es Unterschiede. Einem schönen elisabethanischen Haus konnten einige Jahre der Vernachlässigung nicht viel anhaben. Bewundernd betrachtete George das herrliche große Fenster mit den Hunderten kleiner Scheiben. Dann hörte er Schritte hinter sich und wandte sich um. Elizabeth kam die Treppe herab.
Als sie ihn erblickte, verlangsamte sie ihren Schritt. »Oh, George … Als Mrs Tabb mir sagte … ich konnte es kaum glauben …«
»Dass ich tatsächlich gewagt habe zu kommen.« Höflich neigte er sich über ihre Hand. »Ich war gerade in der Nähe, deshalb habe ich für meinen Patensohn ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht. Ich dachte, das ist mir vielleicht erlaubt.«
Verwirrt nahm sie das Geschenk entgegen. »Aber es ist noch Monate hin bis zu Geoffrey Charles’ Geburtstag.«
»Ich meine ja auch den vom letzten Jahr.«
»Weiß Francis …«
»Dass ich hier bin? Nein. Und wenn er es wüsste? Diese kindische Feindschaft sollte endlich ein Ende haben. Elizabeth, ich freue mich wirklich sehr, dich wiederzusehen.«
Sie lächelte ihn an, doch ohne zu erröten – wie sie es noch vor wenigen Jahren getan hätte. Seine bewundernden Blicke taten ihr wohl. Man konnte bei George nie sicher sein, ob seine Worte aufrichtig gemeint waren, aber sie wusste, dass seine Bewunderung für sie echt war. Seit ihrem letzten Zusammentreffen war er breiter und fülliger geworden. Zwar verurteilte sie das Verhalten, das er Ross gegenüber an den Tag gelegt hatte, aber sie musste zugeben, dass er Francis gegenüber immer völlig fair und zu ihr von unwandelbarer Liebenswürdigkeit gewesen war.
Sie gingen in den Salon, und dort wickelte sie das kleine Päckchen, das er mitgebracht hatte, aus. Es enthielt eine goldene Uhr.
»Wenn du meinst, dass Geoffrey Charles noch zu jung dafür ist, so hebe sie eben einige Jahre für ihn auf. Mit unserem Streit hat er nichts zu tun. Wenn er alt genug ist, die Uhr zu tragen, werden wir alle vielleicht wieder Freunde sein.«
»Ich habe diesen Streit nie gewollt«, antwortete sie. »Wir leben hier sehr zurückgezogen, und die wenigen Freunde, die ich habe, sind mir sehr wertvoll. Aber du kennst ja Francis ebenso gut wie ich. Er ist niemals halbherzig in seinen Gefühlen, und wenn er jetzt hereinkäme, würde sich alles nur noch verschlimmern.«
»Mit andern Worten«, sagte George freundlich, »er würde mich hinauswerfen. Vielleicht hältst du mich für übervorsichtig, aber ich habe meinen Diener angewiesen, auf dem Hügel bei der Kirche von Sawle Ausschau zu halten. Wenn er Francis kommen sieht, wird er mich warnen, du brauchst also keine Angst vor einer Auseinandersetzung zu haben. Ich habe es nur mit Rücksicht auf dich getan, denn für einen Feigling sollst du mich nicht halten.«
Elizabeth setzte sich am Fenster nieder und blickte über den Kräutergarten. George beobachtete sie scharf. Nach einer Weile sagte sie: »Ich möchte dir vor allem für die Freundlichkeit danken, die du meinen Eltern erwiesen hast. Meiner Mutter geht es noch immer gar nicht gut, und dass du sie eingeladen hast …«
George setzte sich nun auch. »Elizabeth, ich erwarte natürlich nicht, dass du bei diesem Streit zwischen Francis und mir gegen deinen Mann Partei ergreifst, aber bist du im Grunde nicht auch der Meinung, dass wir ihn nun endlich beilegen sollten? Es kommt für keinen von uns etwas Gutes dabei heraus. Und Francis schneidet sich dabei buchstäblich ins eigene Fleisch. Sicher weißt du, dass ich ihn, wenn ich böswillig handeln wollte, jederzeit ruinieren kann.«
»Ich weiß es«, antwortete Elizabeth und errötete.
»Ich wünschte, die Dinge lägen anders. Und ich würde sie gern ändern. Aber solange dieser Zwist besteht … Ich wünschte, du würdest mir helfen, ihn zu schlichten.«
Elizabeth schob den Riegel des Fensters zurück und öffnete es um einen Spalt. Von dem braunen Vorhang hob sich ihr klargeschnittenes Profil ab wie eine Kamee. »Erst sagst du, du möchtest nicht, dass ich Partei gegen Francis ergreife, und dann zwingst du mich gerade dazu –«
»Nein. Ganz und gar nicht. Ich bitte dich nur, zu vermitteln.«
»Glaubst du denn wirklich, dass meine Vermittlung viel ausrichten könnte? George, du kennst Francis doch ebenso gut wie ich. Er glaubt, dass du hinter der Anklage steckst, die damals gegen Ross erhoben wurde.«
»Ach, Ross …« Kaum hatte er diesen Namen ausgesprochen, erkannte er schon, dass er das Falsche getan hatte. Dennoch fuhr er fort und bemühte sich um einen sachlichen Ton. »Ich weiß, dass du eine starke Zuneigung für Ross empfindest, Elizabeth. Ich wünschte, ich stünde in deinen Augen so gut da wie er. Aber lass mich eines klarstellen: Seit unserer Schulzeit waren Ross und ich nie einer Meinung. Das ist etwas – Grundsätzliches. Wir mögen uns nicht besonders. Was mich betrifft, so ist es nicht mehr als das. Bei ihm aber ist es eine Art Krankheit. Er stürzt sich von einem Misserfolg in den andern und macht mich dafür verantwortlich!«
Elizabeth stand auf. »Das hättest du lieber nicht sagen sollen. Es ist nicht fair, von mir zu verlangen, dass ich mir das anhöre.«
Sie wollte durch das Zimmer gehen, doch da er sich nicht fortrührte, fand sie ihren Weg aus dem Erker versperrt.
»Aber hörst du dir nicht auch Ross’ Darstellung an? Wieso ist es denn unfair, wenn ich dich bitte, meine anzuhören?«
Elizabeth schwieg. George erkannte, dass er die erste Hürde genommen hatte, und fuhr rasch fort: »Ross ist impulsiv, sehr halsstarrig, unbesonnen. Dafür kannst du nicht mich verantwortlich machen. Es liegt daran, dass er als Kind reicher Eltern geboren wurde, aus einer Familie stammt, die immer reich war. Trotzdem hätte er nicht so handeln müssen, wie er es getan hat. Vor vier Jahren kam er auf diese unglückselige Idee, in Cornwall eine Kupferschmelzhütte zu errichten. Er macht mich dafür verantwortlich, dass die Sache fehlschlug, dabei war sie von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Als er dann finanziell dafür geradestehen musste, war er zu stolz, seine Freunde um Hilfe zu bitten, und unterschrieb, von seinen übrigen Schulden ganz abgesehen, einen Wechsel über tausend Pfund mit Wucherzinsen. Er ist inzwischen in die Hände meines Onkels gelangt, daher weiß ich davon – und Ross hat diese Zinsen seitdem ständig zahlen müssen. Doch damit nicht genug – im vorigen Jahr hat er auch noch die Hälfte seiner Anteile an einer gewinnbringenden Mine verkauft und Francis dazu verleitet, sein Partner bei Wheal Grace zu werden, einer Mine, die sein Vater schon vor zwanzig Jahren ausgebeutet hat! Und wenn er eines Tages sich und auch dich an den Bettelstab bringt, so wird er mich zweifellos beschuldigen, ich hätte ihm heimlich zu finsterer Nacht das Kupfer aus seiner Mine gestohlen!«
Endlich gelang es Elizabeth, sich an George vorbeizudrücken, und sie schritt hastig durchs Zimmer. Was George gesagt hatte, klang überspitzt; die Wahrheit lag wahrscheinlich zwischen seiner Darstellung und der von Francis. Sie war sich nie wirklich darüber klar gewesen, was sie eigentlich für Ross empfand, und merkwürdigerweise hörte sie die Argumente der Gegenseite nun sogar mit einem gewissen Vergnügen.
George folgte ihr nicht. Nach kurzem Schweigen sagte er: »Sicher weißt du, dass du eine der schönsten Frauen von England bist.«
Die Uhr auf dem Kaminsims schlug fünf. Als die Schläge verhallt waren, antwortete Elizabeth: »Falls das, was du eben sagtest, nur halb zutrifft, so würde ich es als eine Galanterie betrachten, wenn Francis anwesend wäre; da er aber fort ist, betrachte ich es als eine Freiheit, die du dir herausnimmst.«
»Nun gut«, antwortete George, »wenn die Wahrheit eine Freiheit ist, die ich mir herausnehme, dann wage ich es, sie mir herauszunehmen, denn was ich sagte, ist wahr. Jedermann wird dir das Gleiche sagen. Alle werden dir das Gleiche sagen, Männer und Frauen, wenn du dich nur mehr in der Welt bewegen und dich zeigen würdest. Selbst jetzt noch höre ich die Leute manchmal sagen: ›Erinnern Sie sich an Elizabeth Poldark – damals noch Chynoweth? Eine wirkliche Schönheit. Ich würde gern wissen, was aus ihr geworden ist.‹«
»Du glaubst doch nicht –«
»Ich könnte Francis helfen«, fuhr George fort, »wenn er mich nur ließe. Er kann ruhig weiter mit seiner Mine spielen, wenn er so großen Wert darauf legt. Aber das brauchte nur eine Nebenbeschäftigung zu sein. Ich habe schon einmal, als ich hier war, von sogenannten Sinekuren gesprochen. Ich könnte ihm jetzt de facto zwei derartige Positionen verschaffen.
Es ist nichts Unehrenhaftes daran. Dieses Leben hier ist für dich überhaupt kein Leben. Deine Armut ist nicht nur unverschuldet – sie ist auch völlig unnötig!«
Elizabeth schwieg. George hatte einen wunden Punkt berührt. Sie war achtundzwanzig, und ihre Schönheit konnte nicht ewig blühen. Die Anzahl der Festlichkeiten, an denen sie seit ihrem fünfundzwanzigsten Lebensjahr teilgenommen hatte, konnte sie an einer Hand abzählen.
»Ich weiß, du meinst es gut, George«, sagte sie. »Ich weiß es deshalb so genau, weil mir klar ist, dass du nichts zu gewinnen hast. Ich –«
»Im Gegenteil«, antwortete George, »ich habe alles zu gewinnen.«
»Ich weiß nicht, was ich zu all dem sagen soll. Du überhäufst meine Eltern und meinen Sohn mit Freundlichkeiten, und du würdest es auch mit Francis tun, wenn er es zuließe. Ich wäre so froh, wenn dieser Zwist endlich beigelegt wäre. Aber machst du dir nicht etwas vor, wenn du versuchst, die Sache zu bagatellisieren? So simpel, wie du die Dinge darstellst, sind sie nicht. Ich wünschte, sie wären es. Ich wäre überglücklich, wenn unsere Freundschaft wieder gekittet werden könnte.«
Er ging zu ihr hinüber zum Kamin. »Und wirst du dich bemühen, sie zu kitten?«
»Ja, wenn du dich auch bemühst.«
»Und wie soll ich das tun?«
»Versuche Ross davon zu überzeugen, dass du nicht sein Feind bist.«
»An Ross bin ich nicht interessiert.«
»Ich weiß, aber Francis ist jetzt Ross’ Partner. Du kannst nur mit beiden befreundet sein oder mit keinem.«
George blickte auf seine Reitpeitsche hinab. »Auch meine Möglichkeiten sind begrenzt. Was soll ich tun?«
»Wenn du dein Bestes tust«, antwortete Elizabeth, »werde auch ich mein Bestes tun.«
»Ich hoffe, ich kann mich auf diese Abmachung verlassen.«
»Du kannst dich darauf verlassen.«
Wieder beugte er sich über ihre Hand und küsste sie diesmal, höflich und viel sagend zugleich. Dann sagte er: »Bitte mach dir nicht die Mühe, mich hinauszubegleiten. Mein Pferd steht draußen.«
Er ging hinaus, schloss die Tür und durchquerte die große, leere Halle. Als er bei der Tür angelangt war, kam Tante Agatha aus einem kleinen Wohnzimmer heraus und schlurfte auf ihn zu. Er machte einen vergeblichen Versuch, sich fortzustehlen; obwohl sie stocktaub war, hatten ihre scharfen Augen ihn bereits erblickt.
»Nein, so was, wenn das nicht George Warleggan ist! Ich wette, es ist Jahre her, seit Sie zuletzt dieses Haus betreten haben. Sie werden wohl langsam zu vornehm für uns, wie?«
Lächelnd beugte sich George über ihre runzlige Hand. »Ich begrüße dich, alte Hexe. Die Würmer sind es anscheinend leid, auf dich zu warten.«
»Ja, ja, Sie werden wohl zu vornehm für uns«, wiederholte Tante Agatha und stützte sich mit ihren beiden zitternden klauenartigen Händen auf ihren Stock. »Sieh mal einer diese Weste. Ich erinnere mich an Sie, als Sie noch ein Junge waren, George. Kaum größer als Geoffrey Charles. Da haben Sie Augen und Mund aufgerissen, als Sie das erste Mal hierher kamen. Das hat sich inzwischen geändert.«
George nickte lächelnd. »Es sollte ein Gesetz geben, dass man alte Weiber vergiften darf, Madame. Oder ein Kissen auf die Nase drücken – das ginge auch ziemlich rasch. Wenn du das letzte Mitglied der Poldark-Familie wärst, würde ich es selber tun. Aber reg dich nicht auf; deine Großneffen schaufeln sich ihr eigenes Grab. Kann nicht mehr lange dauern.«
»Leben Sie wohl«, sagte Tante Agatha. »Kommen Sie bald einmal wieder und essen Sie mit uns. Wir haben in letzter Zeit nicht viel Gesellschaft.«
2
Francis kam kurz vor sechs nach Hause. Elizabeth saß am Fenster und stickte an einem Stuhlbezug, und Tante Agatha kauerte vor dem Feuer.
»Puh, heiß ist es hier drin.« Francis ging zu einem Fenster und öffnete es.
Tante Agatha richtete ihren scharfen Blick auf ihn. »Du hast euren Besucher verpasst, Francis. Wir haben in letzter Zeit nur noch selten Besuch.
Du hättest ihn zum Essen einladen sollen, Elizabeth.«
Elizabeth wurde rot, ärgerlich darüber, dass die alte Dame ihr zuvorgekommen war, und wütend, dass ihr das etwas ausmachte. »George Warleggan war da.«
»George?« Die Art, wie Francis diesen Namen aussprach, genügte. »Und du hast ihn empfangen?«
»Ja. Er ist nicht lange geblieben.«
»Das will ich hoffen. Was wollte er?«
»Ich glaube, er wollte nichts Bestimmtes. Er sagte, er halte es für unnötig, diesen Streit weiter fortzusetzen.«
»Diesen Streit.
»Er sagte, du und er, ihr wärt von klein auf Freunde gewesen«, bemerkte Elizabeth und stickte weiter, »und er würde dieser Entfremdung zwischen euch gern ein Ende machen. Er wolle sich nicht in deine oder in Ross’ Privatangelegenheiten einmischen, sein einziger Wunsch sei, dass wir alle friedlich miteinander leben könnten …«
»Du redest, als hättest du eine Lektion gut auswendig gelernt.«
Nervös tastete Elizabeth in ihrem Arbeitskorb nach einer Garnspule. »Das hat er jedenfalls gesagt.«
»Ich erinnere mich noch«, sagte Tante Agatha, »wie du ihn zum ersten Mal hierher gebracht hast. Mein Gott, wie war der Junge ausstaffiert! In Samt und Seide; man sah gleich, dass seine Mutter keinen Geschmack hatte … und er stand da und glotzte wie ein Kalb.«
»Er hat eine flinke, gewandte Zunge«, sagte Francis, »und versteht die Dinge so darzustellen, dass sie überzeugend klingen. Bildet er sich denn ein, dass wir ein schönes, friedliches Leben leben können, weil er so gnädig ist, uns mit seiner Freundschaft zu beschenken? Ich hoffe doch, dass er dir das mit seinen Schmeicheleien nicht eingeredet hat.«
»Ich kann mir mein eigenes Urteil bilden«, antwortete Elizabeth. »Gerechterweise muss ich aber sagen, dass unser Leben ganz anders aussähe, wenn er in Bezug auf die Hypotheken nicht so nachsichtig gewesen wäre.«
»Die Nachsichtigkeit«, erwiderte Francis nachdenklich, »verstehe ich nicht, das muss ich zugeben. Sie passt gar nicht zu ihm. Vor allem jetzt, da ich Ross’ Partner bin … Das ist der Grund, warum ich Wheal Grace auf Geoffrey Charles’ Namen habe eintragen lassen. Aber George unternimmt nichts.«
»Er bemüht sich nur um unsere Freundschaft«, sagte Elizabeth.
Francis ging zu dem offenen Fenster hinüber und atmete tief die kühle Luft ein. »Ich habe das unangenehme Gefühl, dass ich Georges Nachsicht dir verdanke.«
»Mir? Das ist doch albern. Wirklich, Francis –«
»Albern? Absolut nicht. Seit Jahren ist George wie von dir hypnotisiert. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass er menschlich genug ist, sich bei seinen Geschäften auch von Gefühlen leiten zu lassen, aber mir fällt keine andere Erklärung ein …«
Elizabeth stand auf. »Dann wirst du eben eine andere suchen müssen. Ich muss jetzt Geoffrey Charles vorlesen.«
Als sie an Francis vorbeiging, fasste er sie am Arm. In den letzten zwei Jahren hatte ihrer Beziehung zwar nach wie vor die Wärme gefehlt, aber sie war etwas freundlicher geworden. »Ich glaube«, sagte Francis, »George hatte einen ganz bestimmten Grund, warum er heute herkam. Es spielt keine Rolle, wie du seine Gefühle für mich einschätzt oder wie ich seine Gefühle für dich einschätze – was er von Ross hält, darüber besteht kein Zweifel. Wenn er die Freundschaft mit uns wieder aufwärmt und dadurch einen Keil zwischen uns und Ross treibt, dann hat er sein Ziel erreicht. Möchtest du das?«
Elizabeth schwieg. Dann antwortete sie: »Nein.«
»Ich auch nicht.« Er ließ ihren Arm los, und sie ging hinaus.
Auf dem Heimweg traf George Dwight Enys, der von Goon Prince kam. Dwight wollte grüßen und weiterreiten, doch George zügelte sein Pferd, und so musste auch Dwight anhalten.
»Sie machen weite Ritte, Dr Enys«, sagte George, »in Erfüllung Ihrer ärztlichen Pflichten. Nach Truro kommen Sie wohl nie?«
»Nur selten.«
»Und wenn Sie in Truro sind, dann kommen Sie nicht zu den Warleggans.«
Dwight beruhigte umständlich sein Pferd und dachte dabei über die Antwort nach. Er beschloss, offen zu sein. »Ihre Familie hat sich mir gegenüber immer freundschaftlich verhalten, Mr Warleggan, und auch meine Einstellung ihr gegenüber ist freundschaftlich, aber die Poldarks von Nampara sind meine besten Freunde; ich lebe in ihrer Nähe, arbeite unter ihren Bergleuten, esse an ihrem Tisch und genieße ihr volles Vertrauen. Und ich halte es deshalb für besser, wenn ich mich darauf beschränke.«
Georges Blick wanderte über Dwights abgetragenen Samtrock mit den vergoldeten Knöpfen. »Liegt denn eine so tiefe Kluft zwischen diesen beiden Welten, dass ein unabhängiger Mensch nicht aus freiem Willen beide besuchen kann?«
»Soviel ich weiß, ist sie so tief«, antwortete Dwight.
Georges Miene verdüsterte sich. »Manchmal klatschen die Männer mehr als die Frauen. Und wie läuft Ihre Praxis?«
»Danke, recht gut.«
»Ich war vorige Woche bei den Penvenens und hörte, dass Sie nun ihr Hausarzt sind.«
»Mr Penvenen ist ganz gesund. Ich sehe ihn daher nur selten.«
»So viel ich gehört habe, ist seine Nichte wieder zurück.«
»Ja, das ist sie wohl.«
»Ich hörte, Sie haben eine sehr geschickte Operation an ihrem Hals vorgenommen und ihr das Leben gerettet.«
»Darauf kann ich nur sagen, dass die Männer wirklich manchmal mehr klatschen als die Frauen.«
George schätzte es nicht, wenn seine eigenen Aussprüche wie ein Bumerang zu ihm zurückkamen. Er empfand eine zunehmende Abneigung gegen den jungen Arzt, der sich so offenherzig zeigte und sich nicht die geringste Mühe gab, seine Sympathien zu verhehlen.
»Ich muss gestehen«, sagte er, »ich persönlich habe wenig Vertrauen zu Ärzten oder Apothekern; meiner Meinung nach bringen sie ebenso viele Patienten um, wie sie heilen. Glücklicherweise ist meine Familie nicht so schwächlich wie manche der Älteren hier.« Er gab seinem Pferd die Sporen und ritt davon, von seinem Diener gefolgt. Dwight blickte ihm eine Weile nach, dann ritt auch er weiter. Ihm war klar, dass er einen einflussreichen Mann verstimmt hatte. Mit Rücksicht auf seinen Beruf wäre ihm ein neutrales Verhalten lieber gewesen, aber die Entscheidung, wer zu seinen Freunden zählte, war längst gefallen.
Dwight hatte in Sawle zu tun. Als er sein Pferd vorsichtig den steilen, glitschigen Pfad zu den Schuppen der Fischer am Fuß des Hügels hinablenkte, hörte er hinter sich ein klapperndes Geräusch und sah, als er sich umdrehte, dass Rosina Hoblyn mit einem Eimer Wasser, den sie trug, hingefallen war. Rasch warf er die Zügel seines Pferdes über einen Pfahl und versuchte dem Mädchen aufzuhelfen. Aber sie blieb liegen. Jedes Mal, wenn Dwight auf dieses Thema zu sprechen gekommen war – warum die neunzehnjährige Rosina hinkte –, hatte die Familie ängstlich abgewehrt und abgelenkt. Nun lag Rosina, das hübsche Gesicht kreidebleich vor Schmerzen, da, und Dwight musste sie aufheben.
»Es ist bloß mein Knie, Herr Doktor. Gleich geht’s wieder. Manchmal kann ich’s plötzlich gar nicht mehr bewegen. Vielen Dank.«
Ihre jüngere Schwester Parthesia kam aus dem Haus gelaufen, nahm den Eimer, machte vor Dwight einen Knicks und wollte Rosina aufhelfen.
»Nein, noch nicht«, sagte Rosina und fügte, zu Dwight gewandt, hinzu: »Wenn ich ’n bisschen warte, geht’s weg.«
Nach einer Weile konnten sie ihr ins Haus helfen. Dwight war froh, dass Jacka Hoblyn, Rosinas Vater, nicht zugegen war, denn seine Launen waren unberechenbar.
Mrs Hoblyn und Rosina versuchten Dwight davon zu überzeugen, es sei eine Lappalie, doch er hörte nicht auf sie; entschlossen untersuchte er das Knie und war erleichtert, als er keine Anzeichen von Skrofulose entdecken konnte. Es war zwar geschwollen und ein wenig gerötet, aber die Haut war nicht glänzend oder heiß.
»Dieser Ärger mit dem Knie hat also vor acht Jahren angefangen?«
»Ja, Herr Doktor, ungefähr da.«
»Tut es ständig weh?«
»Nein, Herr Doktor. Nur wenn’s so steif wird wie jetzt.«
»Und haben Sie auch die gleichen Beschwerden mit Ihrer Hüfte?«
»Nein, mit der ist alles in Ordnung.«
»Eitert das Knie manchmal?«
»Nein, Herr Doktor. Es ist bloß manchmal, wie wenn jemand ’n Schlüssel dreht und es abschließt«, antwortete Rosina und zog ihren Rock wieder herunter.
»Ist es mal von einem andern Arzt untersucht worden?«
Ihm schien, als tauschten sie hinter seinem Rücken Blicke aus. Rosina antwortete: »Ja, 84, wie es mir zum ersten Mal Ärger machte. Von Mr Nye, aber der ist schon tot.«
»Und was hat er gesagt?«
»Der hat gar nichts drüber gesagt«, warf Mrs Hoblyn hastig ein. »Der wusste nicht, was es war.«
Dwight riet dem Mädchen, eine kalte Kompresse anzulegen, und versprach, in einer Woche wiederzukommen. Die Atmosphäre dieses Hauses war bedrückend und entmutigend, doch als er in die Dämmerung hinaustrat, lag der unangenehmste Besuch noch vor ihm.
Am Fuß des Hügels lag auf dem Strandkies ein flaches, grünes Dreieck aus Gras und Unkraut, und an einer Seite standen Hütten mit Fischschuppen. Um zu ihnen zu gelangen, musste man über eine schmale, bucklige Brücke gehen. Dwight blieb einen Augenblick stehen und blickte auf das Meer. Der Wind wehte stärker, und die weiter entfernt liegenden Klippen waren in der zunehmenden Dämmerung kaum noch zu sehen. In einem Boot war ein alter Mann mit einem Netz beschäftigt. Hinter dem Wirtshaus stritten sich Möwen um einen Fischkopf. Eine Kerze schimmerte hinter einem Fenster.
Über das Rauschen der Wellen glaubte Dwight das Getuschel der Dorfleute zu hören: »Habt ihr schon die Sache mit John James Ellery gehört? Hatte bloß Zahnweh, ging zu dem Doktor rüber nach Mingoose, der hat ihm drei Zähne rausgezogen. Und seitdem ist John James halb verrückt vor Schmerzen. Lasst euch bloß nicht mit dem ein, wenn ihr krank seid!«
Dwight drehte sich um; in diesem Augenblick kam ein Mann hinter dem Wirtshaus hervor und schien sich an ihm vorbeidrücken zu wollen. Doch Dwight blieb stehen, und der Mann blieb ebenfalls stehen. Es war Charlie Kempthorne, den Dwight von der Schwindsucht geheilt hatte und der nun Rosina Hoblyn den Hof machte, obwohl er ein Witwer über vierzig mit zwei Kindern und sie erst neunzehn war.
»Sie sind noch ziemlich spät draußen, Herr Doktor, wie? An so ’nem Abend bleibt man am besten daheim beim Herd – wenn man einen hat.«
»Das wollte ich grade zu Ihnen sagen.«
Kempthorne grinste und hustete. »Es gibt so Geschäfte, die erledigt man am besten in der Dämmerung, wissen Sie. Wenn die Zollbeamten nichts sehen.«
»Wenn ich Zollbeamter wäre, dann würde ich mich gerade in der Dämmerung an die Arbeit machen.«
»Hm ja, aber die sitzen eben auch gern zu Haus am Herd.« Charlie schlurfte weiter, doch seine ganze Haltung verriet inneres Unbehagen.
Phoebe Ellery machte Dwight auf und führte ihn nach oben. John James Ellerys Zimmer war nur über eine Leiter von einem Raum aus zu erreichen, in dem Säcke mit Kartoffeln, Netze, Ruder und Angelkorken gestapelt waren. Er war so niedrig, dass man nicht aufrecht darin stehen konnte. Ein Lämpchen war angezündet. Der größte Teil des Fensterglases war herausgebrochen, und der Wind pfiff in den Raum; gelegentlich sprühte auch Regen herein. Eine große schwarzweiße Katze strich ruhelos umher und warf einen grotesken, huschenden Schatten auf die Wände. Der Kranke hatte sich eine alte Sackleinwand um das Gesicht gewickelt und murmelte unaufhörlich: »Gott sei mir gnädig, Gott sei mir gnädig.«
Phoebe blieb bei der Leiter stehen und betrachtete Dwight mit hartem, vorwurfsvollem Blick. »’s wird ihm bald besser gehen«, sagte sie. »Die Schmerzen dauern meistens ’ne Stunde oder so, und dann gehen sie wieder für ’ne Weile weg.«
Dwight konnte nur wenig tun. Er blieb eine halbe Stunde bei dem Kranken sitzen, verabreichte ihm Opium und horchte auf das laute Rauschen des Meeres. Endlich ließ der Krampf nach, und Dwight ging.
Es war eine stürmische Nacht. Dwight konnte nicht schlafen; das Bewusstsein seines Versagens und seiner Ohnmacht als Arzt quälte ihn.
3
Ross und Demelza waren unter den letzten Gästen, die am Abend des vierundzwanzigsten Mai bei den Trevaunances eintrafen. Sie hatten sich von Francis, der noch drei Pferde besaß, eines ausleihen müssen. Als sie nach oben gingen, waren in dem großen Salon bereits etwa zwanzig plaudernde und lachende Gäste versammelt. Demelza brauchte eine halbe Stunde, um sich umzukleiden, und Ross, der sich rascher für das Fest zurechtgemacht hatte, las inzwischen die letzte Ausgabe des Sherborne Mercury, die man im Schlafzimmer für ihn bereitgelegt hatte.
Frankreich führte Krieg gegen Österreich. Vor drei Wochen hatte sich das revolutionäre Feuer zu einem großen Brand ausgeweitet. In der Zeitung stand zu lesen, M. Robespierre sei gegen den Krieg gewesen, von anderen aber überstimmt worden, und eine große Armee sei in Belgien einmarschiert. Man war auf einen Zusammenstoß mit den österreichischen Truppen gefasst. Und wie stand England da? Mr Pitt hatte im März leicht einen fünfzehnjährigen Frieden voraussagen können; Prophezeiungen kosteten ja nichts, doch wenn die armselige britische Armee und Marine noch weiter reduziert wurden, bedeutete das eine ernste Bedrohung für Englands Sicherheit.
Ross war so in die Zeitung vertieft, dass er die Worte, die Demelza an ihn richtete, zuerst nicht hörte; sie musste sie wiederholen.
Er stand auf und blickte sie an. Drei Jahre voll Kummer und drohender Armut hatten dem Liebreiz seiner Frau nichts anhaben können. Als er zur Tür ging, um sie für sie zu öffnen, sagte er: »Hast du jetzt eigentlich immer noch Angst, dich in der Gesellschaft zu bewegen, wie damals? In letzter Zeit kann ich nicht mehr erkennen, ob du nervös bist oder nicht.«
»In den ersten zehn Minuten zittern mir immer die Knie«, antwortete sie. »Aber glücklicherweise ist dieser Teil meines Körpers gut zugedeckt.«
Er lachte. »Ich weiß schon, was dieses Zittern heilen kann.«
»Und was?«
»Portwein.«
»Ja, meistens. Aber auch noch andere Dinge.«
»Und was ist das?«
»Das Bewusstsein, dass andere Menschen mir vertrauen«, sagte sie nachdenklich.
»Und gehöre ich auch zu diesen anderen Menschen?«
»Du ganz besonders.«
Er neigte sich leicht vor und küsste sie auf ihre weiche, nackte Schulter. »Dann darf ich dir sagen, dass ich dir im Augenblick ganz besonders viel zutraue.«
»Danke, Ross.«
Er küsste sie abermals, und sie strich ihm sanft das Haar am Ohr glatt.
»Empfindest du noch etwas für mich?«
Er blickte sie verwundert an. »Du lieber Gott, das solltest du doch wissen!«
»Natürlich, Ross, aber es gibt solche Gefühle und solche. Ich frage dich nach einem ganz bestimmten Gefühl.«
»Erwartest du von mir, dass ich mich mit dir in eine komplizierte Auseinandersetzung über Gefühle einlasse, während unten ein ganzer Schwarm deiner Galane auf dich wartet, die mit dir flirten wollen?«
»Es sind nicht meine Galane. Und ich glaube, es wäre auch keine … Auseinandersetzung.« Sie trat auf die Tür zu.
»Demelza«, sagte er.
»Ja?«
»Wenn es zwei Arten von Gefühlen gibt, so glaube ich nicht, dass du sie in zwei verschiedene Schubladen tun kannst, denn sie gehören zusammen und sind untrennbar. Du solltest doch wissen, dass ich dich liebe. Was muss ich noch tun, um dir Sicherheit zu geben?«
Sie lächelte. »Nichts, du sollst es mir nur sagen.«
Sie gingen nach unten und fanden dort all ihre Nachbarn vor: die jüngeren Trenegloses, die Bodrugans, Dr und Mrs Choake und natürlich die Penvenens.
Und George Warleggan.
Die Trevaunances hatten einen groben gesellschaftlichen Schnitzer begangen, als sie George und Ross zusammen eingeladen hatten, doch nun war es einmal geschehen, und sie mussten das Beste aus der Situation machen.
George vermied jede Provokation und eine Zeitlang auch jeden Kontakt mit den Poldarks. Beim Essen saß Ross ziemlich weit oben an der Tafel, Lady Constance Bodrugan zu seiner Rechten, Elizabeth zu seiner Linken und Caroline Penvenen ihm gegenüber.
Er hatte inzwischen so viel über Caroline gehört, dass er nun, da er sie persönlich kennenlernte, fast etwas enttäuscht war. Er fand, sie sei nicht so schön wie Elizabeth und nicht so charmant wie Demelza, musste aber zugeben, dass ihr scharfsinniger Witz und ihr lebhaftes Temperament eindrucksvoll waren. Die Smaragdkette, die sie um ihren milchweißen Hals trug, stand ihr vorzüglich; wie ihre Trägerin sahen die Steine in verschiedener Beleuchtung immer wieder anders aus, einmal kühl und unergründlich, dann wieder funkelnd und schimmernd. Er konnte Unwin Trevaunance – von seinen materiellen Interessen abgesehen – verstehen. Allerdings mochte sich mancher Gast an diesem Abend Gedanken machen, wie sonderbar die Beziehung der beiden zueinander war, denn Caroline behandelte Unwin mit bloßer, kühler Höflichkeit, und man musste sich fragen, wie die Dinge nach der Hochzeit aussehen mochten. Ein Mann mit einem solchen Löwenkopf und dieser eigenwillig vorgeschobenen Unterlippe war sicher nicht geneigt, zu viel einzustecken.
Als die Gäste Platz genommen hatten, sagte Sir John: »Kennen Sie Miss Penvenen schon, Ross? Caroline, das ist Hauptmann Poldark«, und Ross blickte in zwei große, grau-grüne Augen.
Caroline nickte höflich. »Wir begegnen uns heute Abend zum ersten Mal, John. Allerdings habe ich Hauptmann Poldark schon vorher gesehen – unter ganz anderen Umständen.«
»Und wann war das?«, fragte Ross.
»Oh, da haben Sie mich sicher nicht bemerkt. Ich war im Gerichtssaal in Bodmin, als Sie angeklagt waren, zwei Schiffe geplündert zu haben. Sie erinnern sich sicher noch.«
»Und ob ich mich erinnere«, antwortete Ross. »Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass diese Verhandlung sonderlich unterhaltend für Sie war.«
»O doch, durchaus. Wissen Sie, wenn man im Theater ein Schauspiel sieht, so weiß man, dass die Tugend triumphieren wird, doch im wirklichen Leben zittert man vor der Ungerechtigkeit und fürchtet für das Ende.«
»Dann müssen Sie der falschen Verhandlung beigewohnt haben, Miss Penvenen. Bei meinem Fall konnte von Tugend kaum die Rede sein und schon gar nicht von Triumph bei meinem Freispruch – es sei denn, es war ein Triumph des Starrsinns der Geschworenen. Sie hätten lieber für den Richter Mitleid empfinden sollen.«
Carolines Augen blitzten. »Oh, das habe ich. Er sah schrecklich traurig aus, als er feststellen musste, dass er Sie nicht bestrafen konnte.«
Etwas später unterhielt sich Ross mit Elizabeth. Beide waren sehr vergnügt miteinander, und das entging Demelza nicht. Sie saß am Fuß der Tafel zwischen Sir Hugh Bodrugan, der nach wie vor ein aufdringliches Interesse an ihrer Gesellschaft bekundete, und Hauptmann McNeil vom Zweiten schottischen Dragonerregiment. McNeil war schon vor einigen Jahren mit einer Dragonerkompanie in diesem Bezirk stationiert gewesen, um die Unruhen unter den Bergleuten unter Kontrolle zu halten und dem Schmuggel einen Riegel vorzuschieben.
Malcolm McNeil war mit der Tischordnung außerordentlich zufrieden. Das Einzige, was ihm missfiel, war die Art, wie Sir Hugh Mrs Poldark mit Beschlag belegte. Immer wieder versuchte McNeil, Demelzas Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, und immer wieder drängte sich der vierschrötige Baronet dazwischen. McNeil hatte erst eine Chance, als Sir Hugh für Mrs Frensham, Sir Johns Schwester, ein Stück vom Braten abschneiden musste, und er ergriff rasch die Gelegenheit, Demelza zu fragen, ob er nicht das Gleiche für sie tun dürfe.
»Vielen Dank, nein«, sagte Demelza. »Es überrascht mich, Sie hier zu sehen, Hauptmann McNeil. Ich dachte, Sie wären wieder in Schottland.«
»Das war ich, aber zwischendurch bin ich wieder hergekommen«, erklärte er eifrig und betrachtete sie bewundernd. »Ich war auch in Übersee. Und in London und in Windsor. Aber dieser Teil des Landes hat es mir besonders angetan – auch manche Menschen, die hier leben –, und als sich die Gelegenheit ergab, das alles wiederzusehen …«
»Mit Ihren Dragonern?«
»Diesmal ohne Dragoner.«
»Kein einziger Dragoner?«
»Nur ich, Mrs Poldark. Ich musste mit Fieber das Bett hüten, und als ich dann Sir John in London traf, lud er mich ein, meinen Genesungsurlaub hier zu verbringen.«
Demelza lächelte ihn freundlich an. »Sie sehen gar nicht krank aus, Hauptmann McNeil.«
»Das bin ich jetzt auch nicht mehr, Madam. Darf ich Ihnen noch einmal nachschenken? Sie hatten Kanarienwein in Ihrem Glas, nicht wahr?«
»Ich kenne nur drei Sorten von Wein, aber es war keiner von den dreien.«
»Dann war es bestimmt Kanarienwein. Ich habe mich hier nicht nur sehr gut erholt, sondern auch immer mit großer Bewunderung den Anblick dieser herrlichen Küstenlinie genossen –«
»Und Sie haben gar nicht nach Schmugglern Ausschau gehalten?«
»Nein, nein, Mrs Poldark, diesmal nicht. Sind denn immer noch welche hier? Ich dachte, ich hätte sie bei meinem letzten Besuch endgültig vertrieben.«
»Das ist nur zu wahr. Nach Ihrer Abreise waren wir alle ganz deprimiert.«
Der Schotte zwinkerte ihr humorvoll zu. »Diese Bemerkung kann man verschieden auslegen.«
Demelza warf einen Blick zum oberen Ende der Tafel und sah, dass Ross Elizabeth anlächelte. »Ich hätte nie gedacht, Hauptmann McNeil, dass Sie mich für eine Schmugglerin halten könnten.«
McNeils Lachen war laut genug, um die Anwesenden plötzlich zum Schweigen zu bringen. Mrs Frensham sagte lächelnd: »Falls dieser Scherz eine Wiederholung verträgt, so sollten Sie ihn nicht für sich behalten.«
»Oh«, antwortete Demelza, »ich habe gar keinen Scherz gemacht, Madam. Hauptmann McNeil versicherte mir, er sei diesmal nicht gekommen, um Schmuggler zu fangen, und ich antwortete ihm, ich wüsste nicht, was er hierzulande sonst fangen könnte.«
Sir Hugh Bodrugan knurrte: »Verdammich, und ob das ein Scherz ist.«
»Hauptmann McNeil war sehr krank«, sagte Mrs Frensham, »und er hat mir versichert, dass sein Aufenthalt hier völlig harmloser Natur ist. Andernfalls hätten wir ihn in seinem Zimmer eingeschlossen und einen Wachposten davor gestellt.«
»Ich glaube, Madam«, sagte Demelza, »Sie sollten das sofort tun«, und Sir Hugh und McNeil lachten.
Am andern Ende der Tafel hatte Sir John Trevaunance, nicht ganz unabsichtlich, eine abschätzige Bemerkung über den jungen Dwight Enys gemacht. Ellery war am Morgen dieses Tages gestorben, und Sir John war der Meinung, dieser Skandal solle öffentlich bekannt werden. Ellery, ein rüstiger Mann von sechzig Jahren … Enys habe so tief in den Kiefer gebohrt, dass die Wunde nicht mehr heilen konnte. Sein alter Freund Dr Choake würde ihn darin unterstützen. Unwissenheit und Nachlässigkeit. Doch Sir John musste feststellen, dass er sich in seiner Absicht verkalkuliert hatte, denn Caroline begann sofort, Dr Enys zu verteidigen, und wurde darin kräftig von Ross Poldark unterstützt. Ärgerlich nahm der Baronet – und mehr noch Unwin – zur Kenntnis, dass er gewissermaßen von zwei Seiten beschossen wurde.
Leise sagte Elizabeth zu Ross: »Sie ist schön, findest du nicht?«
»Ja, sehr apart. Aber Schönheit ist eine Frage des Geschmacks.«
»Sag mir, bist du auch der Meinung, dass das Herz nicht begehrt, was das Auge nicht bewundert?«
»O ja, zweifellos ist das so. Jedenfalls bei mir. Das solltest du wissen.«
»Ich weiß sehr wenig von dir, Ross. Wie oft haben wir uns in den letzten fünf Jahren gesehen? Ein Dutzend Mal?«
Ross schwieg eine Weile. »Ich habe nicht an die letzten fünf Jahre gedacht. Aber vielleicht hast du recht. Eigentlich weiß ich auch wenig von dir. Und du hast dich so sehr verändert – ich meine, innerlich.«
»Habe ich das? Sag mir doch, was ist das Schlimmste an dieser Veränderung?«
»Das nenne ich aber auf den Busch klopfen. Na schön, ich werde dir ein Kompliment machen: Du hast dich nicht zum Schlechten verändert, du bist einfach eine andere Elizabeth. Ich sehe nun ein, wie jung du noch warst, als du versprachst, mich zu heiraten.«
Elizabeths Finger strichen nervös über ihr Glas. »Ich hätte aber alt genug sein müssen, um meine Gefühle zu kennen.«
Der Ton, in dem sie das sagte, überraschte ihn. In ihrer Stimme schwang etwas wie Selbstverachtung. Sie hatte damit ihrem Gespräch eine ganz andere Richtung gegeben; es war nicht mehr die höfliche, scherzhafte Plauderei von eben.
Nachdenklich blickte er sie an. »Elizabeth … wir wollen uns darauf einigen, dass du sehr jung warst … und du dachtest ja auch, ich sei tot.«
Elizabeth warf einen Blick zu Francis, der sich gerade mit Ruth Treneglos unterhielt. Vielleicht hatte ihr Gefühl sie allzu unvermittelt überrumpelt. Vielleicht war sie auch der Meinung, ihr Verhalten sei schon zu oft entschuldigt worden. Mit kühler Stimme sagte sie: »Ich habe dich nie wirklich für tot gehalten. Ich glaubte, Francis mehr zu lieben.«
»Du glaubtest ihn zu lieben …«
Sie nickte. »Und dann entdeckte ich, dass ich mich geirrt hatte.«
»Wann?«
»Schon ziemlich bald.«
Seine Vernunft wehrte sich dagegen, das Gesagte in seiner vollen Bedeutung zu begreifen und anzunehmen, doch sein Herz klopfte heftig, und die Vernunft hatte darauf keinen Einfluss. Über zwanzig Menschen saßen an diesem Tisch. Demelza plauderte mit dem schnauzbärtigen Kavallerieoffizier, Sir Hugh wartete darauf, sich in das Gespräch einzumischen, und drüben saß George Warleggan, wortkarg, aber aufmerksam, und immer wieder huschte sein Blick von seinem Teller zu Elizabeth hinüber. War es denn möglich, dass Elizabeth einen derartigen Augenblick für ein derartig schwerwiegendes Geständnis wählte, nach neun Jahren? War es möglich, dass sie die Wahrheit sprach …
»Diese verdammten Bastarde, die überall herumstreunen«, sagte Lady Bodrugan heftig, »sie verderben einem die ganze Zucht. Sie sind da viel besser dran, John, da Sie nur mit Vieh zu tun haben. Was sagten Sie, was für einen Hund Sie haben, Miss?«
»Einen Mops«, antwortete Caroline. »Er hat ein schönes, schwarzes, lockiges Fell, und sein goldbraunes Gesicht ist nicht größer als das Innere dieses Tellers. Unwin begegnet ihm mit Zuneigung und großem Respekt – nicht wahr, Unwin?«
»Mit Respekt, ja«, antwortete Unwin, »denn seine Zähne sind nadelspitz.«
Ross sagte zu Elizabeth: »Erlaubst du dir einen Scherz mit mir?«
Elizabeth lächelte. »O ja, es ist ein Scherz, aber ein Scherz, den ich mir mit mir selbst erlaube, Ross. Wusstest du das nicht? Es wundert mich, dass du es nicht längst erraten hast.«
»Erraten …«
»Wenn du es nicht erraten hast, so wäre es netter von dir gewesen, wenn du mein Geständnis unterbrochen hättest. Ist es denn so erstaunlich, dass eine Frau, die ihren Sinn einmal geändert hat, ihn auch ein zweites Mal ändern kann? Nun, vielleicht ist es das tatsächlich, ich muss zugeben, es hat mich selbst erstaunt, und auch gedemütigt …«
Sie schwiegen. Dann sagte Ross: »Als ich dich damals zu Ostern, nach deiner Hochzeit, besuchte – da gabst du mir klar und deutlich zu verstehen, dass du nur Francis liebtest und sonst niemanden.«
»Hätte ich es dir denn damals sagen sollen? Nur wenige Monate nach meiner Hochzeit, als ich schon mit Geoffrey Charles schwanger war?«
Irgendjemand nahm Ross’ Teller fort und stellte einen neuen hin. An der Tafel ging es noch lauter zu als zuvor. Ross musste einen Impuls bekämpfen, seinen Stuhl zurückzuschieben und einfach fortzugehen.
»Und Francis?«, fragte Ross. »Weiß er es?«
»Ich habe schon zu viel gesagt, Ross. Es ist besser, du vergisst es.«
Weiter unten am Tisch – Francis, noch jugendlich, doch in seiner lebhaften Miene unübersehbar die ersten Spuren frühzeitiger Erschlaffung und Verlebtheit … Plötzlich blickte er auf, als wisse er, dass von ihm die Rede war, und blinzelte Ross zu.
Francis wusste es. Ross erkannte das nun ganz klar. Francis wusste es schon so lange, dass Desillusion und Enttäuschung schon längst hinter ihm lagen. Seine Eifersucht hatte sich längst erschöpft, und mit ihr vielleicht seine Liebe; es machte ihm nichts aus, Ross und Elizabeth zusammen zu sehen. Damit war plötzlich seine Streitsucht in früheren Jahren erklärt, sein ganzes rätselhaftes Benehmen. Was ihn betraf, so gehörte das alles der Vergangenheit an, war Teil einer Ära, die man am besten vergaß, hatte einer neuen Zeit der Toleranz und des guten Willens Platz gemacht.
Vielleicht war das auch der Grund, warum Elizabeth jetzt gewagt hatte, es ihm zu sagen – weil auch ihre Gefühle erloschen waren und sie das Gleiche von Ross glaubte.
Elizabeth hatte sich zu ihrem Nachbarn gewandt, der ihr eine Frage gestellt hatte, und es dauerte eine Weile, bis Ross ihr Gesicht wiedersah. Und obwohl sie seinen Blick mied, sagte ihm ein unerklärliches Etwas in ihrer Miene, dass er sich getäuscht hatte, dass ihre Gefühle noch keineswegs tot waren und dass sie das auch von ihm nicht glaubte.
Wenig später zogen die Damen sich zurück, und die Herren plauderten eine halbe Stunde bei einem Glas Portwein. Bei Tee und Kaffee trafen wieder alle zusammen.
Ross ging gerade an einem kleinen Gästezimmer vorbei, da hörte er jemanden zornig sprechen und erkannte die Stimme von Unwin Trevaunance. Gleich darauf hörte er, wie die Tür heftig zugeschlagen wurde; rasche Schritte erklangen hinter ihm, und er trat beiseite, um Caroline Penvenen zuerst in den Salon treten zu lassen. Sie war leicht außer Atem, und ihre Augen funkelten.
Da er Miene machte, sich zu entfernen, sagte sie: »Darf ich Sie bitten, mir eine Weile Gesellschaft zu leisten, Hauptmann Poldark?«
»Gern, so lange Sie wünschen.«
Sie stand neben ihm, hochgewachsen und anmutig, und betrachtete die andern Gäste mit scharfem Blick.
»Werden Sie diesen Sommer hier bei Ihrem Onkel bleiben?«
»Ich weiß noch nicht. Im Oktober werde ich einundzwanzig – und dann bin ich mein eigener Herr. Aber bis dahin ist es noch lange.«
»Vielleicht werden Sie vorher heiraten.«
»Aber tausche ich damit nicht einen Wächter gegen den andern ein?«
»Wenn Sie einen Ehemann als Wächter betrachten, ja.«
»Da ich bisher noch keinen hatte, weiß ich es nicht. Aber ich habe schon ziemlich viele beobachtet und halte diese Bezeichnung deshalb für recht zutreffend.«
»Aber sie trifft doch wohl nicht auf Ihren Onkel zu.«
Caroline lachte. »Wieso nicht? Er hat auf mich aufgepasst. Ist das nicht das Gleiche wie ein Wächter? Zwar hatte ich keine Gitter vor meinen Fenstern – nur die unsichtbaren Gitter der Konventionen und der Missbilligung. Ich glaube, ich wäre sehr gern für eine Zeitlang ein freier Mensch.«
Während sie miteinander plauderten, ging Unwin mit finsterem Gesicht an ihnen vorbei, und Caroline redete auf Ross ein, bis Unwin sich unter die Gäste gemischt hatte. Ross verkniff sich ein Lächeln, denn ihm war klar, dass Caroline ihn benutzte. Die Hoffnung, Caroline und Unwin bald verheiratet zu sehen, schien sich nicht zu erfüllen. Bald darauf verschwand Unwin und wurde an diesem Abend nicht mehr gesehen.
Als die Gesellschaft sich gerade aufzulösen begann, ergab es sich plötzlich, dass George Warleggan Francis allein gegenüberstand, und er ergriff sofort die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen.
»Guten Abend, Francis. Ich freue mich, dich nach so langer Zeit wiederzusehen.«
Francis blickte ihn ausdruckslos an. »Es tut mir leid, dass ich dieses Kompliment nicht zurückgeben kann, George.«
»Das bedaure ich sehr. Es müsste nicht so sein.«
»In diesem Punkt sind wir verschiedener Meinung. Ich habe meine Wahl schon vor langer Zeit getroffen. Ich habe gern saubere Hände.«
Georges Gesicht verdüsterte sich. »Diese Arroganz … von deinem Vetter erwarte ich keine Vernunft –«
»Nun, dann erwarte auch keine von mir.«
Wenn George ernsthafte Hoffnung auf eine Versöhnung gehegt hatte, so war sie hiermit erloschen. Er drehte sich um und stand plötzlich Ross gegenüber.
Einen Augenblick herrschte Schweigen. Ross blickte kalt auf George hinab. Dann sagte er: »Guten Abend, George.«
In Georges Gesicht zuckte ein Muskel unkontrolliert. »Guten Abend, Ross. Erstaunlich, dass wir uns hier treffen.«
»Wir sollten bei Gelegenheit zusammen essen.«
»Gern … ich hoffe, deine Mine floriert.«
»Das wird sie schon noch.«
»Ich beneide dich um dein Selbstvertrauen.«
»Musst du mich sogar darum beneiden?«, fragte Ross scharf.
George wurde rot und öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch Ross wandte sich ab. George schwieg. Und er brauchte nur weiterhin zu schweigen und zu warten; der Triumph war unausbleiblich.
Sie ritten heim; Francis und Elizabeth begleiteten Ross und Demelza auf einem Teil ihres Weges. Der Halbmond warf einen schwachen Glanz auf die betauten Felder und die Spinnweben in den Hecken. Die vier sprachen kaum. Elizabeth war nervös wegen des Geständnisses, das sie Ross gemacht hatte, denn Ross war unberechenbar. Francis war zu müde, um zu sprechen. Und Ross war tief in Gedanken versunken; er grübelte über die Vergangenheit und erging sich in Phantasien über die Zukunft.
Demelza hatte instinktiv erfasst, dass sich für Ross irgendetwas entscheidend verändert hatte. Undeutlich spürte sie, dass Elizabeth der Grund dafür war. »Ich hoffe, ich darf Sie einmal besuchen, Madam«, hatte Hauptmann McNeil zu ihr gesagt. Seine Bewunderung hatte ihr gutgetan. Von all den Männern, die sie bisher kennengelernt hatte, war Malcolm McNeil der einzige, den sie als Ross ebenbürtig empfand.
Kurz bevor sie sich trennen mussten, sagte Francis: »Stimmt es, dass die Schmuggler wieder einen erfolgreichen Coup gelandet haben?«
»Ja«, antwortete Ross, »das habe ich auch gehört.«
»Da werden Vercoe und seine Steuereinnehmer aber ziemlich schlechter Laune sein.«
»Zweifellos.«
»Es geht das Gerücht, dass du selbst an der Sache beteiligt warst.«
Schweigen. »Woher weißt du das?«, fragte Ross.
»Spielt das eine Rolle? Ich habe es vor einiger Zeit gehört, und ich glaube, es bezog sich auf die Landung im März.«
»Gerüchte um uns Poldarks hat es schon immer gegeben, Francis.«
Wieder Schweigen. »Nun ja, trotzdem bin ich froh, dass es nicht wahr ist.«
»Froh? Es ist mir ganz neu, dass du etwas für die Steuereinnehmer empfindest.«
»Tue ich auch nicht, Ross. Aber neuerdings empfinde ich wieder etwas für dich. Und mir gefällt es nicht, dass dieser Informant, dieser Spitzel, hier herumschnüffelt. Alle wissen, dass es ihn gibt. Aber niemand weiß, wer es ist. Wenn seine Identität bekannt würde, hätte er nichts Gutes zu erwarten. Aber solange er unerkannt herumschnüffelt, ist die Gefahr doppelt groß.«
Mittlerweile waren sie an der Kreuzung angelangt. Die vier Reiter hielten an.
»Ich wäre dir dankbar«, sagte Ross, »wenn du dieses Gerücht zum Schweigen bringen würdest, sowie sich eine Gelegenheit dazu bietet.«
»Das werde ich. Und ob ich das werde. Gute Nacht, ihr beiden.«
»Man kann auf verschiedene Art an diesem Handel beteiligt sein«, sagte Ross, »es muss nicht unbedingt eine unmittelbare Beteiligung sein.«
»Wenn ein Spitzel herumschnüffelt, ist jede Beteiligung gefährlich.«
»Stimmt. Aber unter Umständen muss man eben das Risiko gegen den Gewinn abwägen.«
»Ich glaube, ich möchte nichts mehr darüber hören. Ich wollte nur eine freundschaftliche Warnung aussprechen, nicht mich in deine Geheimnisse einmischen.«
»Offenbar kennst du das Geheimnis bereits. Und es ist wohl besser, wenn du auch die Einzelheiten erfährst. Vor einiger Zeit hat mich Mr Trencrom aufgesucht. Er war in einer Notlage, da der Spitzel ihm den Zugang zu den üblichen Landeplätzen unmöglich gemacht hatte. Er fragte mich, ob er in meiner Bucht anlegen dürfe. Zu diesem Zeitpunkt versuchten die Warleggans gerade, in meiner andern Mine, Wheal Leisure, Fuß zu fassen. Ich stimmte Trencroms Vorschlag zu, und so benutzt er nun meine Bucht und mein Land – doch nur zweimal im Jahr. Für jede Landung zahlt er mir zweihundert Pfund.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.