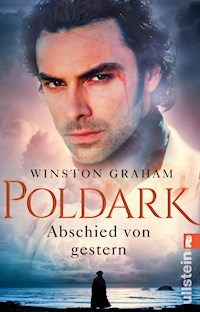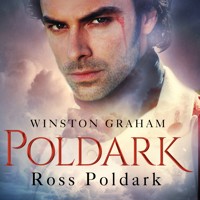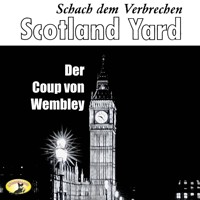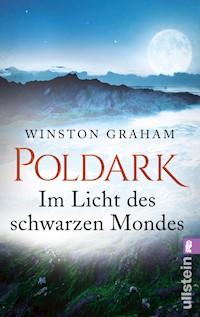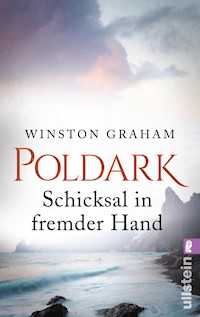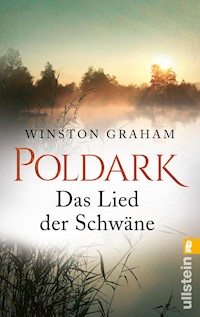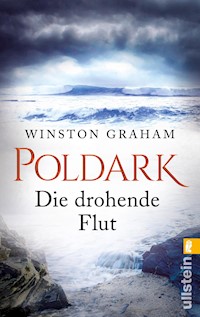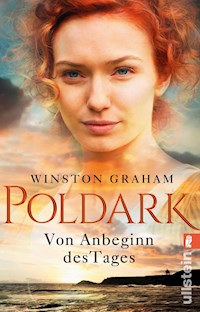
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Cornwall 1788-1790 Gegen alle Widerstände sind Ross und Demelza zwar gemeinsam glücklich. Allerdings haben weder Ross' Freunde noch seine Feinde ihm diese unstandesgemäße Heirat verziehen, und das junge Paar muss täglich um seine Ehe und seine Liebe kämpfen. Vor allem Demelza muss ihren ganzen Mut, aber auch ihren Charme und ihr liebevolles großes Herz einsetzen, um Vorurteile und Standesunterschiede endgültig zu überwinden. Und aufgeben wird sie nie ... »Vom unvergleichlichen Winston Graham …, der all das hat, was die anderen haben, und dann noch eine ganze Menge mehr« The Guardian Der zweite Roman der großen Poldark-Saga
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Cornwall, 1788 bis 1790: Demelza ist nicht wiederzuerkennen. Aus der halbverhungerten Tochter eines Minenarbeiters ist die Ehefrau von Ross Poldark und die Mutter einer kleinen Tochter geworden. Doch Demelza ist und bleibt eine Kämpfernatur – ein Talent, das sie zusammen mit ihrem Mut und ihrem Charme schon bald einsetzen muss. Denn ihre Umwelt hat Ross und Demelza die unstandesgemäße Heirat nicht verziehen, und in seinem Kampf für die Rechte der Minenarbeiter legt sich Ross mit dem mächtigen George Warleggan an. Kann ihre Liebe diese Hindernisse überwinden?
Der Autor
Winston Mawdsley Graham, geboren 1908 in Manchester, gestorben 2003 in London, hat über vierzig Romane geschrieben, darunter auch Marnie, der 1964 von Alfred Hitchcock verfilmt wurde. Er war Mitglied der Royal Society of Literature sowie des Order of the British Empire und lebte in London und Cornwall.
Die Poldark-Serie von Winston Graham ist in unserem Hause in chronologischer Reihenfolge erschienen:
Poldark – Abschied von gesternPoldark – Von Anbeginn des TagesPoldark – Schatten auf dem WegPoldark – Schicksal in fremder HandPoldark – Im dunklen Licht des MondesPoldark – Das Lied der SchwänePoldark – Vor dem Steigen der Flut
Winston Graham
Poldark
Von Anbeginn des Tages
Roman
Aus dem Englischenvon Hans E. Hausner
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN 978-3-8437-1236-1
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2016© Winston Graham 1946Titel der englischen Originalausgabe: Demelza (Pan Books, Pan Macmillan, London 2015; first published in 1946 by Werner Laurie Ltd.)Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München (nach einer Vorlage von Pan Macmillan)Titelabbildung: Eleanor Tomlinson: Photography Mike Hogan© Mammoth Screen Limited 2014
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Aller Rechte vorbehalten
Erstes Buch
1
Man hätte den Sturm, der sich bei Julias Geburt erhob, als Prophezeiung ansehen können.
Der Mai war nicht die Zeit für schwere Stürme, doch in Cornwall ist das Klima unberechenbar wie ein ausgelassenes Kind. Es war ein recht linder Frühling gewesen, lind wie auch der Sommer und der Winter, die ihm vorangegangen waren; ein mildes, heiteres, angenehmes Wetter; und schon lag lebendiges Grün über dein Land. Dann kam der Mai, regnerisch und windig, und hier und dort kam die Blüte zu Schaden, und das Heu suchte Beistand und Halt.
In der Nacht zum Fünfzehnten verspürte Demelza die ersten Wehen. Eine Weile umklammerte sie die Bettpfosten und überlegte, ob sie etwas sagen sollte. Sie hatte der Bewährungsprobe, die ihr bevorstand, bis jetzt ruhig und beherrscht entgegengesehen und Ross nie mit blindem Alarm beunruhigt. Sie wollte auch jetzt nicht damit anfangen.
Doch als ein Gefühl sie überkam, als ob jemand auf ihrer Wirbelsäule kniete und sie zu zerbrechen versuchte, erkannte sie, dass es so weit war.
Sie berührte Ross am Arm. Er wachte sogleich auf.
»Ja?«
»Ich glaube, du wirst Prudie holen müssen«, sagte sie.
Er richtete sich auf. »Warum? Was ist los?«
»Ich habe Schmerzen.«
»Wo? Du meinst …?«
»Ich habe Schmerzen«, wiederholte sie steif. »Ich glaube, es wäre gut, wenn du Prudie holen würdest.«
Rasch kletterte er aus dem Bett und zündete eine Kerze an. Flackerndes Licht erhellte den Raum: schwere Teakholzbalken, der Vorhang über der Tür, der sich sanft im Luftzug bewegte, die niedere, mit rosafarbenem Grogram behängte Fensterbank, die Schuhe, wie sie sie, eine Holzsohle nach oben, hingeworfen hatte, Joshuas Fernglas, Ross’ Pfeife, Ross’ Buch und eine über den Boden krabbelnde Fliege.
Er sah sie an, und sie lächelte blass, wie um sich zu entschuldigen. Er ging zum Tisch neben der Tür und schenkte ihr ein Glas Brandy ein.
»Trink das. Ich werde Jud nach Dr Choake schicken.« Er fing an, sich anzuziehen.
»Nein, nein, Ross! Schick ihn nicht. Es ist ja tiefe Nacht. Er wird schlafen.«
Über die Frage, ob Thomas Choake ihr in ihrer schweren Stunde beistehen sollte, herrschte schon seit einiger Zeit Unstimmigkeit zwischen ihnen. Demelza konnte nicht vergessen, dass sie noch vor zwölf Monaten eine Dienstmagd gewesen war, Choake aber, auch wenn er nur dem ärztlichen Stand angehörte, einen kleinen Besitz sein Eigen nannte. Gegenüber einem Arzt war man immer im Nachteil. Wenn die Schmerzen zu stark waren, würde sie fast sicher so fluchen, wie sie es von ihrem Vater gelernt hatte. Ein Baby zu bekommen und gleichzeitig vornehm zu tun, das war mehr, als Demelza versprechen zu können glaubte.
Und außerdem wollte sie keinen Mann dabeihaben. Das war nicht schicklich. Ihre angeheiratete Base Elizabeth hatte ihn zu sich gerufen, aber Elizabeth war eine geborene Aristokratin, und Aristokraten sahen diese Dinge anders. Die alte Betsy Triggs, die in Mellin Fische verkaufte und, wo es um Babys ging, eine besonders glückliche Hand hatte, wäre ihr weit lieber gewesen.
Ross aber war der Stärkere gewesen und hatte seinen Kopf durchgesetzt.
»Ross!« Sie rief ihn zurück. Im Augenblick fühlte sie keine Schmerzen.
»Ja?« Der Schein der Kerze fiel auf die eine Hälfte seines kräftigen, narbigen, in sich gekehrten Gesichtes; ein kupferner Schimmer lag über dem dunklen, dichten, zerrauften Haar; das Hemd war am Kragen offen. Dieser Mann – ein wahrer Aristokrat, dachte sie – dieser Mann, so zurückhaltend und andere zur Zurückhaltung nötigend, mit dem sie eine süße Vertrautheit verband …
»Würdest du …?«, fragte sie. »Bevor du gehst …?«
Er kam ans Bett zurück. So überraschend hatte ihn ihr Hilferuf aus dem Schlaf gerissen, dass ihm noch keine Zeit geblieben war, etwas anderes zu empfinden als Sorge um sie und die Hoffnung, dass es bald überstanden sein würde. Als er sie küsste, sah er ihre feuchte Stirn, und in seinem Innersten regten sich Angst und Mitgefühl. Er nahm ihr Gesicht in seine beiden Hände, strich das schwarze Haar zurück und starrte in die dunklen Augen seiner jungen Frau. Sie blickten ihn nicht schelmisch und heiter an wie sonst, aber es lag auch keine Furcht in ihren Augen.
»Ich bin gleich wieder da. Ich komme sofort zurück.«
Ihre Geste drückte Ablehnung aus. »Komm nicht zurück, Ross. Geh und sag es Prudie. Es wäre mir lieber … wenn du mich nicht in diesem Zustand sehen würdest.«
»Und was ist mit Verity? Du wolltest doch Verity um dich haben.«
»Sag es ihr morgen früh. Es wäre nicht recht, sie jetzt zu holen. Die Nachtluft ist kalt.«
Er küsste sie wieder.
»Sag mir, dass du mich liebst, Ross«, bat sie ihn.
Überrascht sah er sie an. »Du weißt doch, dass ich dich liebe.«
»Und sage, dass du Elizabeth nicht liebst.«
»Nein, ich liebe Elizabeth nicht.« Was sonst sollte er sagen, der er selbst die Antwort nicht wusste? Er war nicht der Mann, dem es leichtfiel, seine innersten Gefühle zu offenbaren.
»Nur du allein zählst«, sagte er. »Vergiss das nicht. Meine Familie und meine Freunde – und Elizabeth und dieses Haus und alles, was mein ist … für dich gäbe ich alles hin, das weißt du – das musst du wissen. Wenn du es nicht weißt, dann habe ich in all diesen Monaten versagt, und daran könnten meine Worte nichts ändern. Ich liebe dich, Demelza.«
Er küsste sie wieder, wandte sich um und zündete noch weitere Kerzen an. Dann nahm er eine und verließ das Zimmer; das heiße Wachs lief ihm über die Hand. Seit gestern hatte sich der Wind gelegt; nur ein Lüftchen war geblieben.
Er überquerte den Treppenabsatz, stieß eine Tür auf und ging den Gang hinunter, bis er den Raum erreichte, in dem Jud und Prudie schliefen. Die schlechtgeölte Tür öffnete sich mit einem lang gezogenen Knarren.
Er trat über die Schwelle, zog die Vorhänge auseinander und rüttelte Jud an der Schulter. Juds zwei große Zähne schimmerten wie Grabsteine. Heftig schüttelte er ihn ein zweites Mal. Jud verlor seine Schlafmütze, und ein Tropfen Wachs fiel auf die kahle Stelle seines Schädels. Er fing an zu fluchen; dann sah er, wer es war, setzte sich auf und rieb sich den Kopf.
»Was ist los?«
»Demelza ist krank.« Wie anders als Demelza sollte er sie einem Mann gegenüber nennen, der schon hier lebte, als sie, ein armes verlassenes, zerlumptes Ding, im Alter von dreizehn Jahren ins Haus gekommen war? »Ich möchte, dass du sofort Dr Choake holst. Und wecke Prudie. Auch sie werden wir brauchen.«
»Was ist denn los mit ihr?«
»Ihre Wehen haben begonnen.«
»Ach so. Ich dachte, sie sagten, sie wäre krank.« Mit gerunzelter Stirn betrachtete Jud das Stück Talg, das er auf seinem Kopf gefunden hatte. »Prudie und ich schaffen das auch allein. Prudie kennt sich gut aus. Ist ja auch nicht schwer zu lernen. Ich kann gar nicht verstehen, dass die Leute so ein großes Getue darum machen …«
Ross lief die Treppe hinunter. Er warf einen Blick auf die neue Uhr, die sie für das Wohnzimmer gekauft hatten. Es war zehn Minuten vor drei. Bald würde es dämmern. Bei Kerzenlicht sah alles viel schlimmer aus.
Im Stall sattelte er Darkie. Er versuchte sich damit zu beruhigen, dass das jede Frau durchmachte; es war etwas Alltägliches in ihrem Leben – gleich den Jahreszeiten folgte eine Schwangerschaft auf die andere. Jetzt musste er zusehen, dass Jud sich auf den Weg machte; wenn der Narr sich nicht ins Zeug legte, konnte es Stunden dauern. Er wäre selbst geritten, wenn er Demelza ruhigen Gewissens mit den Paynters hätte allein lassen können.
Unter dem Fliederbaum vor dem Haus knöpfte Jud seine Hose zu. »Hoffentlich komme ich nicht vom Weg ab«, sagte er. »Es ist ja stockdunkel. Eigentlich sollte ich eine Stange mit einer Laterne haben.«
»Steig auf, oder du kriegst die Stange über den Schädel.«
Als Jud Fernmore Thomas Choakes Besitz erreicht hatte und durch das Tor ritt, stellte er geringschätzig fest, dass der Bau kaum mehr als ein Bauernhaus war, obwohl der Arzt sich aufspielte, als ob er auf Schloss Blenheim residierte. Er stieg ab und klopfte an die Tür. Hohe Föhren standen um das Haus, und die Dohlen und Saatkrähen waren schon munter und zogen mit lärmendem Kreischen ihre Kreise.
»Was gibt’s, Mann? Was ist los? Was soll der Lärm?«
Stimme und Augenbrauen sagten Jud, dass er den richtigen Vogel aufgescheucht hatte.
»Captain Poldark hat mich geschickt, Sie zu holen«, brummelte er. »Die – Dings – der Mrs Poldark geht’s nicht gar so gut, und Sie werden gebraucht.«
»Was für eine Mrs Poldark, Mann? Welche Mrs Poldark?«
»Mrs Demelza Poldark. Oben auf Nampara. Ihre Zeit ist da.«
»Unsinn, Mann. Ich habe sie vorige Woche untersucht und Captain Poldark gesagt, dass es erst im Juni so weit sein wird.«
Der Arzt knallte das Fenster zu.
Drei Minuten später steckte Dr Choake wieder den Kopf heraus.
»Was ist los, Mann? Willst du mir die Tür einschlagen?«
»Man hat mir aufgetragen, Sie mitzubringen.«
»Du unverschämter Kerl! Dafür werde ich dich prügeln lassen!«
»Wo ist Ihr Pferd? Ich hole es aus dem Stall, während Sie sich fertig machen.«
Einundzwanzig Minuten später, in eisigem Schweigen, ritten sie los. Laut krächzend zogen die Saatkrähen immer noch ihre Kreise, und rund um die Sawle-Kirche erhoben sie ein großes Geschrei. Der Tag brach an.
Seine Überlegungen während des schweigsam zurückgelegten Rittes besänftigten wohl Dr Choakes verletzte Gefühle, denn als sie auf Nampara eintrafen, beschwerte er sich nicht, begrüßte Ross steif und stieg schwerfällig die Treppe hinauf.
Er stellte bald fest, dass es kein blinder Alarm gewesen war. Er blieb eine halbe Stunde bei Demelza sitzen, forderte sie auf, tapfer zu sein, und wiederholte immer wieder, dass es keinen Grund gäbe, sich zu fürchten. Weil sie ihm verkrampft schien und stark schwitzte, vermutete er ein leichtes Fieber und ließ sie zur Ader, um sicherzugehen. Alle Stunden ein Tässchen Borkentee würde ein Wiederaufflackern des Fiebers verhindern. Dann ritt er wieder nach Hause, um zu frühstücken.
Ross hatte sich unter der Pumpe abgespült und versucht, sich die Grillen der Nacht von der Seele zu waschen. Als er in die Küche kam und durch das Fenster eine untersetzte Gestalt das Tal hinaufreiten sah, wandte er sich an Jinny Carter, die jeden Tag zur Arbeit ins Haus kam.
»War das Dr Choake?«
Jinny beugte sich über ihr Kind, das sie auf dem Rücken mitgebracht und dann in der Küche in einen Korb gelegt hatte. »Ja, Sir. Er hat gesagt, das Baby käme frühestens nach dem Mittagessen, und er würde zwischen neun und zehn wieder da sein.«
Ross wandte sich ab, um seinen Missmut zu verbergen. Jinny sah ihn mit hingebungsvollen Augen an.
»Wer hat dir mit deinen Babys geholfen, Jinny?«, fragte er.
»Mutter, Sir.«
»Würdest du sie wohl holen gehen, Jinny? Ich glaube, ich habe mehr Vertrauen in deine Mutter als in diesen alten Esel.«
Sie errötete vor Freude. »Ja, Sir. Ich gehe gleich. Sie wird gern kommen.«
Ross trat in die Halle und blieb an der Treppe stehen. Die Stille irritierte ihn. Er ging ins Wohnzimmer, goss sich ein Glas Brandy ein und kehrte in die Küche zurück. Die kleine Kate hatte sich nicht gerührt; sie lag auf dem Rücken, strampelte und krähte und lachte ihn an. Das kleine Wurm war neun Monate alt und hatte seinen Vater nie gesehen – wegen Wilddieberei saß er im Gefängnis von Bodmin eine Strafe von zwei Jahren ab.
Niemand hatte an diesem Morgen Feuer gemacht, und von Frühstück war weit und breit nichts zu sehen. Ross schürte in der Asche, aber sie war kalt; er holte Anmachholz und zündete es an, während er sich ärgerlich fragte, wo Jud wohl stecken mochte. Er wusste, dass man heißes Wasser brauchen würde und Handtücher und Schüsseln – nichts war vorbereitet.
Als das Feuer aufflammte, kam Jud herein, und mit ihm der Wind, und brauste durch die Küche.
»Ein Sturm bricht los«, sagte er und sah Ross aus blutunterlaufenen Augen an. »Haben Sie die lange schwarze Dünung gesehen?«
Ross nickte ungeduldig. Schon gestern Nachmittag waren schwere Seen gegangen.
»Ja, es geht von allen Seiten los. So etwas habe ich noch selten gesehen. Es ist, als ob jemand das Wasser peitschen würde. Die Dünung ist fast verschwunden und das Meer so schäumend weiß wie Joe Triggs Bart.«
»Pass auf Kate auf, Jud«, sagte Ross. »Mach inzwischen das Frühstück. Ich gehe nach oben.«
In seinem Unterbewusstsein war Ross sich des Brausens des Windes bewusst, der in der Ferne das Meer aufwühlte. Als er einmal aus dem Schlafzimmerfenster sah, bestätigten ihm seine Augen, dass die Dünung tatsächlich auseinandergebrochen war.
Solange er im Zimmer weilte, bemühte sich Demelza ruhig zu bleiben, aber er merkte, dass sie ihn nicht bei sich haben wollte.
Bekümmert ging er wieder hinunter und kam gerade zurecht, um Mrs Zacky Martin, Jinnys Mutter, zu begrüßen. Plattnasig, bebrillt, niesend, ihrer Sache sicher erschien sie in der Küche, gefolgt von fünf kleinen Kindern, die sich an ihre Fersen hefteten. Während sie mit ihnen sprach und sie schalt, erklärte sie Ross, dass sie niemanden hatte, der auf die Kleinen aufgepasst hätte – es waren die zwei Ältesten von Jinny und ihre eigenen drei Jüngsten. Sie begrüßte Jud und fragte nach Prudie, genoss den Duft von brutzelndem Schweinespeck, erkundigte sich nach dem Befinden der Patientin – und verschwand die Treppe hinauf, bevor noch jemand den Mund auftun konnte.
Es schien, als säße auf jedem Küchenstuhl ein Kind. Wie Kegel auf einem Rummelplatz saßen sie da, so als warteten sie darauf, umgeworfen zu werden. Jud kratzte sich am Kopf, spuckte ins Feuer und fluchte.
Es war Viertel nach sechs.
An diesem Morgen sangen keine Vögel. Eben noch war ein Sonnenstrahl über die Wiese gefallen, um gleich wieder zu verlöschen. Ross blickte auf die Ulmen hinaus, die wie bei einem Erdbeben von einer Seite zur anderen schwankten. Die etwas geschützteren Apfelbäume neigten sich und drehten ihre Blätter nach oben. Schwere Wolken jagten am Himmel.
Er nahm ein Buch zur Hand. Sein Auge überflog die Seite, vermochte aber nicht den Sinn zu erfassen. Der Wind begann, durch das Tal zu brausen. Mrs Zacky sah kurz herein.
»Sie ist tapfer, Captain Ross. Prudie und ich, wir schaffen das schon, machen Sie sich bloß keine Sorgen.«
Unvermittelt erbebte das Haus unter einem wütenden Windstoß. Ross starrte auf das wilde Geschehen hinaus. Dem Sturm gleich stieg Wut auf Choake in ihm auf. Vergeblich versuchte er seinem Zorn Luft zu machen. Sein gesunder Menschenverstand sagte ihm, dass alles gutgehen würde, aber der Gedanke, dass seiner Frau die beste Pflege versagt bleiben könnte, war ihm unerträglich. Demelza war es, die da oben litt und als einzigen Beistand zwei ungeschickte alte Weiber bei sich hatte.
Den Wind, der immer noch an Gewalt zunahm, kaum beachtend, ging er in den Stall hinaus.
Vor der Stalltür warf er einen Blick nach Hendrawna hinüber und sah, dass Schaumwolken aus der See aufzusteigen begonnen hatten; wie Sand vor einem Sandsturm trieben sie davon. Hier und dort rauchten die Klippen.
Eben hatte er die Stalltür geöffnet, als der Wind sie ihm aus der Hand riss und ihn gegen die Wand stieß. Er hob den Blick und sah, dass es unmöglich sein würde, in diesem Sturm zu reiten.
Er machte sich zu Fuß auf den Weg. Es waren ja nur zwei Meilen.
Unten auf Fernmore setzte Dr Choake sich zum Frühstück.
Er hatte die gegrillten Nieren und den gebratenen Schinken verzehrt und überlegte, ob er ein Stück von dem geräucherten Dorsch nehmen sollte, bevor er ihn in die Küche zurückschickte.
Fast hätte das Brausen des Windes das laute Klopfen an der Eingangstür übertönt.
»Wenn jemand nach mir fragt, Nancy«, sagte er verdrießlich und zog die Augenbrauen zusammen, »ich bin nicht zu Hause.«
»Ja, Sir.«
Er entschloss sich, doch ein Stück Dorsch zu essen.
»Entschuldigen Sie, Sir. Captain Poldark …«
»Sagen Sie ihm …« Dr Choake blickte auf und sah im Spiegel eine große, völlig durchnässte Gestalt.
Ross trat ins Zimmer. Er hatte seinen Hut verloren und einen Ärmel zerrissen; Wasser hinterließ eine Spur auf Dr Choakes bestem türkischen Teppich.
Doch der Ausdruck in Ross’ Augen ließ nicht zu, dass Choake darauf achtete. Seit zweihundert Jahren waren die Poldarks kornische Edelleute; Choakes Abstammung aber war, trotz seiner feinen Allüren, eher zweifelhafter Natur.
Er erhob sich.
»Ich störe Sie wohl beim Frühstück«, sagte Ross.
»Wir … hm … Ist etwas geschehen?«
»Sie werden sich entsinnen«, entgegnete Ross, »dass ich Sie verpflichtet habe, meiner Frau bei ihrer Entbindung Hilfe zu leisten. Wo ist Ihr Umhang?«
»Mann, ich kann doch nicht in diesem Sturm ausreiten! Sehen Sie doch selbst! Es wäre unmöglich, auf einem Pferd zu sitzen.«
»Daran hätten Sie denken sollen, bevor Sie Nampara verlassen haben.«
Verdrießlich warf der Arzt seinen purpurrot getüpfelten Morgenrock ab und zog seinen Schoßrock an. Dann stapfte er aus dem Zimmer, um seine Tasche und seinen Reitmantel zu holen.
Der Wind blies ein wenig quer. Choake verlor Perücke und Hut, aber Ross bekam die Perücke zu fassen und schob sie unter seinen Mantel. Als sie die Anhöhe in der Nähe von Wheal Maiden erklommen, waren beide außer Atem und völlig durchnässt. Als sie das Wäldchen erreichten, erblickten sie eine schmächtige Gestalt in einem grauen Mantel vor sich.
»Verity«, tadelte Ross seine Base, die an einem Baum lehnte, »du hast heute nichts draußen zu suchen.«
Sie schenkte ihm ein breites gewinnendes Lächeln. »Du solltest wissen, dass du die Neuigkeit nicht geheim halten kannst. Auf ihrem Weg zur Grube hat Mrs Zackys Betty Jud und Dr Choake gesehen und es sogleich Bartles Frau berichtet.« Sie lehnte ihr nasses Gesicht an den Baum. »Der Sturm hat unseren Kuhstall davongetragen, und jetzt haben wir die zwei Kühe im Brauhaus. Das Kopfgestell von Digorys Grube ist eingestürzt, aber soviel ich weiß, ist niemand verletzt. Wie geht es ihr, Ross?«
»So weit ganz gut, denke ich.«
Sie holten Choake ein, als er über die gefallene Ulme kletterte. Auch zwei der Apfelbäume waren entwurzelt, und Ross fragte sich, was Demelza wohl sagen würde, wenn sie die Reste ihrer Frühlingsblumen sehen würde.
Als sie ins Haus traten, sahen sie Jinny mit einem Becken dampfenden Wassers die Treppe hinauflaufen. In ihrer Eile verschüttete sie ein wenig Wasser in der Diele. Sie hatte sie gar nicht kommen gesehen.
Dr Choake war so erschöpft, dass er ins Wohnzimmer ging und sich, nach Atem ringend, auf den ersten Stuhl fallen ließ. Er warf Ross einen finsteren Blick zu und sagte:
»Wenn ich meine Perücke haben dürfte.«
Ross füllte Brandy in drei Gläser. Das erste brachte er Verity, die ebenfalls auf einen Stuhl gesunken war. Ihr lockeres dunkles Haar hob sich von den feuchten Strähnen ab, wo die Kapuze sie nicht geschützt hatte. Sie lächelte Ross zu und sagte:
»Sobald Dr Choake bereit ist, gehe ich mit ihm nach oben. Wenn alles gutgeht, richte ich dir dann etwas zu essen.«
Choake stürzte seinen Brandy hinunter und streckte die Hand nach einem zweiten Glas aus. Ross wusste, dass Alkohol ihn zu einem besseren Arzt machte, und schenkte ihm nach.
»Wir werden zusammen frühstücken«, sagte Choake, den die Aussicht auf eine Mahlzeit milder gestimmt hatte. »Wir gehen jetzt hinauf und werden alle Gemüter beruhigen. Dann werden wir frühstücken. Was gibt es denn zum Frühstück?«
Verity erhob sich, und ihr Gesicht hatte plötzlich einen überraschten und verklärten Ausdruck, so als ob sie eine Vision gesehen hätte.
»Was hast du?«
»Ich glaube, ich hörte …«
Alle lauschten.
»Ach«, sagte Ross schroff. »In der Küche sind Kinder. In der Vorratskammer sind Kinder, und ich würde mich nicht wundern, wenn du auch im Kleiderschrank …«
»Pst!«, machte Verity.
Sie lauschten.
»Wir müssen uns um unsere Patientin kümmern«, sagte Choake, der plötzlich ein Unbehagen zu verspüren schien, und lächelte verschmitzt. »Wenn wir herunterkommen, können wir frühstücken.«
Er öffnete die Tür. Die anderen folgten ihm, hielten jedoch an.
Oben stand Prudie. Sie trug immer noch ihr Nachthemd, mit einer Jacke darüber, und ihre gedrungene Gestalt bauchte sich aus wie ein prall gefüllter Sack. Ihr langes, knolliges, rosiges Gesicht leuchtete, als sie sich zu ihnen hinabbeugte.
»Wir haben es geschafft!«, rief sie mit ihrer Orgelstimme. »Es ist ein Mädchen! Wir haben ein Mädchen für Sie. Das hübscheste kleine Ding, das ich je gesehen habe! Sie hat ein paar kleine Beulen im Gesicht abbekommen, aber sie ist frisch und munter wie ein junges Fohlen. Hört nur, wie sie schreit!«
2
Hätte Julia den Unterschied erkennen können – die Welt, in die sie geboren worden war, wäre ihr wohl recht seltsam erschienen.
Ein Gifthauch lag über dem Land. Der Sturm führte so viel Salz mit sich, dass es keine Rettung gab. Die jungen grünen Blätter der Bäume wurden schwarz und welkten, und wo der Wind durch das Laub fuhr, raschelten sie wie trockene Kekse. Selbst die Kuhblumen und die Nesseln wurden schwarz. Das Heu und die Kartoffeln erlitten schwere Schäden, und die Erbsen und Bohnen schrumpften und starben ab.
Auf Nampara aber, in der kleinen Welt aus vier Wänden und hellen Vorhängen und flüsternden Stimmen, triumphierte das Leben.
Nachdem sie sich ihr Baby gut angesehen hatte, entschied Demelza, dass dem Kind nichts fehlte, und dass es wunderschön anzusehen sein würde, sobald sein armes zerschundenes Gesichtchen geheilt war.
Niemand schien sagen zu können, wie lange das dauern mochte – privat war Ross der Meinung, dass sein Töchterchen bleibende Spuren zurückbehalten würde –, aber Demelza, die einer zuversichtlicheren Denkweise huldigte, besah sich die Beulen ihres Kindes und draußen die verwüstete Landschaft und entschied, dass die Natur in beiden Fällen, wann immer sie die Zeit für gekommen erachten mochte, Wunder wirken würde. Sie beschlossen, die Taufe auf Ende Juli zu verschieben.
Demelza hatte ihre eigenen Ideen, was die Taufe betraf. Zu Geoffrey Charles’ Taufe hatte Elizabeth eine Feier veranstaltet. Demelza hatte nicht daran teilgenommen, denn das war vor vier Jahren gewesen, als sie in den Augen der Poldarks noch weniger als nichts zählte. Aber sie hatte Prudies schwärmende Berichte nie vergessen: von den feinen Leuten, die eingeladen gewesen, von den großen Blumensträußen, die aus Truro gekommen waren, von der festlichen Tafel, vom Wein und von den Reden, die gehalten wurden. Jetzt, da sie, wie bescheiden auch immer, in diese Gesellschaft eingeführt worden war, sah sie nicht ein, warum sie nicht für ihr und Ross’ Kind eine ebensolche, wenn nicht eine schönere Party geben sollte.
Sie beschloss, zwei Feiern zu begehen, wenn sie Ross dazu überreden konnte.
Vier Wochen nach Julias Geburt, während das Kind im Schatten eines Fliederbaumes schlief, schnitt sie das Thema an. Sie saßen zusammen auf dem Rasen vor dem Eingangstor von Nampara und tranken Tee.
Ross musterte sie mit neckenden, spöttischen Blicken.
»Zwei Partys? Wir haben doch keine Zwillinge.«
Einen Augenblick lang begegneten Demelzas dunkle Augen den seinen, dann starrte sie in ihre Tasse.
»Nein, aber du hast deine Familie und ich die meine, Ross.
Die feinen Leute und das gemeine Volk. Es hat keinen Sinn, sie zu mischen – wie man auch Sahne und Zwiebel nicht mischen kann. Jeder für sich sind sie nette Leute.«
»Ich habe eine Schwäche für Zwiebeln«, entgegnete Ross, »und Sahne liegt einem schwer im Magen. Lass uns doch die Leute vom Land einladen: die Zacky Martins, die Nanfans und die Daniels. Sie sind mehr wert als die überfütterten Gutsherren und ihre vornehmen Damen.«
Demelza warf dem Hund, der neben ihr lag, ein Stück Brot hin.
»Die Balgerei mit Mr Treneglos’ Stier hat unseren Garrick nicht gerade verschönt«, bemerkte sie. »Sicher sind ihm noch ein paar Zähne geblieben, aber er schlingt sein Fressen hinunter wie eine Möwe und überlässt das Kauen seinem Magen.«
»Wir könnten eine nette Auswahl unter den Landleuten treffen«, meinte Ross. »Auch Verity würde kommen. Sie mag sie ebenso gern wie wir – oder würde sie mögen, wenn man sie ließe. Du könntest sogar deinen Vater einladen, wenn es dir Freude macht. Sicher hat er mir inzwischen verziehen, dass ich ihn in den Fluss geworfen habe.«
»Ich dachte daran, Vater und meine Brüder am zweiten Tag einzuladen«, sagte Demelza. »Der dreiundzwanzigste Juli wäre ein guter Tag. Das ist das Sawle-Fest, und die Bergleute würden freihaben.«
Ross lächelte in sich hinein. Es war schön, hier in der Sonne zu sitzen, und es störte ihn nicht, dass sie ihm etwas abschwatzen wollte. Es reizte ihn sogar, zu erfahren, was sie als Nächstes tun würde, um ihn herumzukriegen.
»Ob deine feinen Freunde wohl zu fein sind, als dass man ihnen ein Essen mit der Tochter eines Bergarbeiters zumuten könnte? John Treneglos würde eine Einladung wohl nicht ablehnen, nehme ich an. Und George Warleggan – du hast mir erzählt, dass sein Großvater Schmied war; er braucht also gar nicht so stolz zu sein, auch wenn er reich ist. Und Francis … Ich mag Vetter Francis. Und Tante Agatha mit ihren weißen Schnurhaaren und ihrer besten Perücke. Und Elizabeth und der kleine Geoffrey Charles. Eine Sippschaft, die sich sehen lassen kann. Und dann«, fügte sie hinzu, »könntest du ja vielleicht auch ein paar von deinen Freunden einladen, die du bei George Warleggan triffst.«
Die Schwierigkeit, wie man mit einer Frau disputiert, besteht darin, dachte Ross, dass man sich von ihrer Schönheit beeinflussen lässt. Dass Demelza vorübergehend hausmütterliche Allüren zeigte, minderte ihren Liebreiz in keiner Weise. Er erinnerte sich, wie Elizabeth, seine erste Liebe, nach Geoffrey Charles’ Geburt ausgesehen hatte – wie eine duftende Kamelie, anmutig und zart und makellos.
»Du kannst deine zwei Tauffeiern haben, wenn du willst«, sagte er.
Es war absurd, aber einen Augenblick lang schien Demelza verwirrt. Er wusste, wie rasch ihre Stimmung umschlagen konnte, und beobachtete sie amüsiert. Und dann sagte sie leise:
»Ach, Ross. Du bist so gut zu mir.«
Er lachte. »Kein Grund, in Tränen der Rührung auszubrechen.«
Sie sah ihn forschend an. »Die netten Dinge, die du mir gesagt hast, bevor Julia geboren wurde, hast du die ernst gemeint? Die Wahrheit, Ross!«
»Ich habe vergessen, was ich sagte.«
Sie löste sich von ihm und lief in ihrem hübschen Kleid hüpfend über den Rasen. Dann kam sie wieder zurück. »Komm, Ross, gehen wir baden.«
»So ein Unsinn. Wo du erst seit einer Woche wieder auf bist. Aber wir können zum Strand hinuntergehen.«
Sie sprang auf. »Ich will nur Jinny bitten, ein Auge auf Julia zu haben.«
Als sie zurückkam, gingen sie zur Gartengrenze hinunter, wo der Boden schon halb sandig war. Sich ihren Weg durch Disteln und Malvengewächse bahnend, durchschritten sie einen Flecken Ödland, und er hob sie über die zerbröckelnde Steinmauer. Sie wateten durch weichen Sand und erreichten den Strand von Hendrawna.
Es war ein linder Sommertag, und am Horizont waren weiße Wolkenregimenter angetreten. Die See war ruhig, und die kleinen Wellen, die an den Strand rollten, ließen zierliche weiße Arabesken auf dem grünen Wasser zurück.
»Es wäre nett, wenn Verity zu beiden Partys käme«, sagte sie.
»Sie braucht die Abwechslung und neue Interessen.«
»Ich hoffe, du hast nicht die Absicht, das Kind an zwei Tagen über das Becken halten zu lassen.«
»Nein, nein, nur am ersten Tag. Die hochgeborenen Herrschaften werden das sehen wollen. Den einfachen Leuten wird es nichts ausmachen, wenn sie nur reichlich zu essen bekommen. Und sie können zusammenputzen, was vom ersten Tag übrig geblieben ist.«
»Warum machen wir nicht auch eine Kindergesellschaft?«, fragte Ross. »Die können am dritten Tag aufputzen, was vom zweiten übrig geblieben ist.«
Sie sah ihn an und lachte. »Du machst dich über mich lustig, Ross. Du machst dich immer über mich lustig.«
»Das ist nur eine andere Art, dir Verehrung zu zollen.«
»Aber im Ernst, meinst du nicht, dass das eine nette Sache wäre, so eine Kindergesellschaft?«
»Ganz im Ernst«, erwiderte er, »ich bin bereit, auf deine wunderlichen Einfälle einzugehen. Genügt das nicht?«
»Dann wollte ich, du würdest mir auch noch in einer anderen Sache gefällig sein. Ich mache mir große Sorgen wegen Verity.«
»Was ist mit ihr?«
»Ross, sie sollte keine alte Jungfer werden. Sie hat so viel Wärme und Herzensgüte. Das weißt du doch auch. Das ist doch kein Leben für sie: Trenwith pflegen, Haus und Hof beaufsichtigen, sich um Elizabeth und Francis und Elizabeths Baby und die alte Tante Agatha kümmern, das Personal überwachen, Einkäufe machen … Wenn es ihr eigenes Leben wäre. Wenn sie verheiratet wäre und ihr eigenes Haus hätte, dann sähe die Sache anders aus. Als sie letzten September bei uns auf Nampara war, sah sie schon nach wenigen Tagen gleich viel besser aus, aber jetzt ist sie gelb wie Sattelleder und so mager. Wie alt ist sie, Ross?«
»Neunundzwanzig.«
»Nun, es ist höchste Zeit, dass etwas geschieht.«
Ross schwieg und warf mit einem Stein nach zwei zankenden Möwen. Nicht weit von hier, oben auf dem Felsen, standen die Häuser der Leisure-Grube. Nachdem er jahrelang darauf hingearbeitet hatte, war sie nun in Betrieb, gab sechsundfünfzig Männern Arbeit und warf einen hübschen Gewinn ab.
»Du bist weit genug gegangen«, sagte er. »Machen wir uns auf den Heimweg.«
Die Flut kam und fraß sich langsam in den Sand. Hier und dort wagte sich eine Welle weiter vor, zog sich wieder zurück und ließ einen schmalen Streifen seifigen Schaums zurück.
»Es ist noch keine neun Monate her«, sagte er belustigt, »da wolltest du von Verity nichts wissen. Um keinen Preis. Du hieltest sie für ein menschenfressendes Ungeheuer. Als ich dich mit ihr bekannt machen wollte, wurdest du steif wie ein Grubenstempel. Aber seitdem du sie kennst, hörst du nicht auf, mich zu quälen, ich soll ihr einen Mann suchen.«
»Du hast Captain Blamey vergessen.«
Er machte eine ärgerliche Geste.
»Ich habe ihn nicht vergessen und habe von der Sache schon langsam die Nase voll. Lass die Finger davon, Liebes.«
»Ich werde nie weise sein, Ross«, entgegnete sie nach einer kleinen Weile. »Ich glaube auch nicht, dass ich weise sein möchte.«
»Ich will dich auch gar nicht weise haben«, sagte er und hob sie über die Mauer.
Verity kam am nächsten Tag. In dem Regensturm vor einem Monat hatte sie sich arg erkältet, aber nun war sie wieder wohlauf. Mit zärtlichem Girren begrüßte sie das Baby, erklärte, die Kleine sähe beiden oder auch keinem von beiden ähnlich, hörte sich Demelzas Pläne für die Taufe an, billigte sie ohne zu zögern, versuchte tapfer, die eine oder andere Frage zu beantworten, die Dr Choake zu stellen Demelza nicht gewagt hatte, und brachte ein Taufgewand aus feinster Spitze mit, das sie für das Kind gemacht hatte.
Demelza küsste sie und dankte ihr. Dann sah sie sie mit so dunklen, ernsten Augen an, dass Verity, was sie selten genug tat, in Lachen ausbrach und wissen wollte, was Demelza im Sinn hatte.
»Ach, nichts. Wollen wir Tee trinken?«
»Wenn es an der Zeit ist.«
Verity lächelte. »Und jetzt sag mir, was du auf dem Herzen hast.«
»Dich, Verity.«
»Mich? Ach, du liebe Zeit. Sag mir sofort, womit ich dich gekränkt habe.«
»Du hast mich nicht gekränkt. Aber wenn … Ach, ich werde es sein, die dich kränken wird …«
»Solange ich nicht weiß, um was es sich handelt, kann ich mich dazu nicht äußern.«
»Verity«, begann Demelza, »nachdem ich ihm stundenlang in den Ohren lag, hat Ross mir erzählt, dass du einem Menschen einmal sehr zugetan warst.«
Verity bewegte sich nicht, doch das Lächeln um ihre Lippen verlor an Sanftheit.
»Es tut mir leid, dass dich das beunruhigt«, sagte sie.
Demelza war schon zu weit gegangen, um zurückzukönnen. »Ich frage mich, ob es recht war, dass man euch gewissermaßen auseinandergehalten hat.«
Eine leichte Röte überzog Veritys fahle Wangen.
Eine richtige alte Jungfer ist sie geworden und eingeschrumpft, dachte Demelza.
»Ich glaube nicht, dass wir das Verhalten anderer nach unseren eigenen Ansichten beurteilen können, meine Liebe. Es ist nun einmal so in der Welt. Mein … Vater und Bruder folgen festen und wohl überlegten Prinzipien, und nach diesen haben sie gehandelt. Ob es recht war oder unrecht, das zu entscheiden, steht uns nicht zu. Aber was geschehen ist, kann nicht mehr ungeschehen gemacht werden, und außerdem ist alles längst schon begraben und fast schon vergessen.«
»Hast du nie wieder von ihm gehört?«
Verity erhob sich.
»Nein.«
Demelza ging auf sie zu und blieb neben ihr stehen.
»Gemein ist das. Gemein«, sagte sie.
An diesem Abend traf Demelza Jud allein in der Küche an. Niemand hätte aus dem Verhalten dieser beiden ableiten können, ob sie sich gut miteinander verstanden oder in einem Zustand bewaffneter Neutralität verharrten.
»Jud«, sagte Demelza, nahm das Nudelbrett von der Wand und legte sich Mehl und Hefe zurecht. »Jud, erinnerst du dich an einen Captain Blamey, der Miss Verity zu besuchen pflegte?«
»Na, was denken Sie?«
»Ich muss damals schon im Haus gewesen sein«, fuhr sie fort, »aber ich erinnere mich nicht – überhaupt nicht.«
»Sie waren eine kleine Göre von dreizehn Jahren«, sagte Jud in düsterem Ton, »und steckten in der Küche, wo Sie auch hingehörten. Drum.«
»Du wirst dich wohl nicht mehr an alles erinnern«, meinte Demelza.
»Wie denn nicht, wo ich doch die ganze Zeit dabei war?«
Sie begann den Teig zu kneten.
»Was geschah, Jud?«
Die Luft durch seine zwei Zähne blasend, nahm er ein Stück Holz und fing an, mit seinem Messer daran zu schnippeln. Sein glänzender Kopf mit den Haarfransen gab ihm das Aussehen eines abgefallenen Mönchs.
»Er hat seine erste Frau getötet. Es war ein Unfall, nicht wahr?«, fühlte sie vor.
»Sie wissen ja sowieso schon alles.«
»Nein, nicht alles. Ich weiß etwas, aber nicht alles, Jud. Was geschah hier?«
»Nun ja, dieser Bursche, dieser Captain Blamey, war schon eine ganze Zeit hinter Miss Verity her. Captain Ross ließ es zu, dass sie sich hier trafen, weil sie doch sonst nirgendwo zusammenkommen konnten, und eines Tages kamen Mr Francis und sein Vater – den sie vorigen September eingegraben haben – herüber und fanden die beiden im Wohnzimmer. Mr Francis forderte ihn auf, vors Haus zu kommen, na, und dann griffen sie sich die Duellpistolen, die neben dem Fenster hingen, und stapften hinaus. Mich nahmen sie mit, denn es sollte alles seine Ordnung haben, wie man das ja auch erwarten konnte. Und noch bevor der Tag fünf Minuten älter war, schoss Mr Francis auf Captain Blamey und Blamey auf Francis. Eine saubere Arbeit, das muss man ihnen lassen.«
»Haben sie sich verletzt?«
»Verletzt kann man eigentlich nicht sagen. Blamey bekam einen Ritzer in der Hand ab, und seine Kugel blieb in Francis stecken. Es ging alles ganz korrekt zu, und Captain Blamey stieg auf sein Pferd und ritt davon.«
»Hast du seitdem etwas von ihm gehört, Jud?«
»Keinen Ton.«
»Wohnt er nicht in Falmouth?«
»Wenn er nicht auf See ist.«
»Jud«, sagte sie, »ich möchte, dass du etwas für mich tust.«
Mit seinen blutunterlaufenen Bulldoggenaugen musterte Jud sie misstrauisch. »Und zwar?«
»Ich möchte, dass du nach Falmouth reitest und nach Captain Blamey fragst und herausbekommst, ob er noch da lebt und was er treibt.«
Es herrschte Stille, während Jud aufstand und eindrucksvoll ins Feuer spuckte. Als das Zischen verklungen war, sagte er:
»Kneten Sie weiter Ihren Teig, Mrs Poldark. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Welt zu verbessern. Es hat keinen Sinn, es ist gegen die Natur, es ist nicht recht, und es ist nicht ungefährlich. Genauso gut könnte ich mit einem wütenden Stier anbändeln.
3
Es herrschte heiteres schönes Wetter am Tag der Taufe, und in der Kirche von Sawle drängten sich dreißig Gäste, um der Zeremonie beizuwohnen. Julia blinzelte voll Unbehagen, als ihr Vetter zweiten Grades, der Reverend William-Alfred Johns, Wasser auf ihre Stirn tropfen ließ. Anschließend begaben sich alle nach Nampara zurück; die einen zu Pferde, die anderen zu Fuß, zu zweien oder dreien, plaudernd und sich an der Sonne erfreuend; ein farbenfreudiger Zug, der über das verschrammte Land hinwanderte, gefolgt von den neugierigen und zum Teil auch ehrfürchtigen Blicken der Kleinhäusler und Bergarbeiter. Diese Menschen waren wahrhaftig aus einer anderen Welt.
Elizabeth und Francis waren gekommen und hatten den jetzt dreieinhalb Jahre alten Geoffrey Charles mitgebracht. Tante Agatha war seit zehn Jahren nicht aus Trenwith herausgekommen und hatte seit sechsundzwanzig Jahren auf keinem Pferd mehr gesessen. Mit mürrischem Gesicht hatte sie dann aber doch eine alte und sehr fromme Stute bestiegen, um an der Feier teilzunehmen. Ross ließ sie in einem bequemen Lehnsessel Platz nehmen und brachte ihr einen mit Holzkohle geheizten Fußwärmer; dann mischte er etwas Rum in ihren Tee, und bald besserte sich ihre Laune, und sie fing an, sich nach guten und schlechten Omen umzusehen.
Auch George Warleggan war gekommen – vermutlich weil Elizabeth ihn dazu überredet hatte. Mrs Teague und drei ihrer unverheirateten Töchter waren da, um zu sehen und gesehen zu werden, und Patience Teague, die vierte, weil sie hoffte, George Warleggan zu treffen. Verschiedene Beweggründe hatten John Treneglos, Ruth und den alten Horace Treneglos veranlasst, sich einzufinden: Interesse an Demelza, Gehässigkeit und der Wunsch nach gutnachbarlichen Beziehungen.
Sie hatten auch Joan Pascoe, die Tochter des Bankiers, eingeladen. Sie erschien in Begleitung eines jungen Mannes namens Dwight Enys, der wenig redete, sich aber als liebenswürdig und umgänglich erwies.
Ross sah seiner jungen Frau zu, wie sie die Honneurs machte. Er musste einfach Vergleiche ziehen zwischen Demelza und Elizabeth, die jetzt vierundzwanzig und ganz sicher nicht weniger liebreizend war als vor einigen Jahren.
Gewohnt, ein Leben der Muße zu führen, zu einem vornehmen und gebildeten Wesen erzogen, war sie vom Liebreiz anmutiger aristokratischer Fraulichkeit geprägt. Aber sie war auch für Ermüdung anfällig, so als ob ihr edles reines Blut schon ein wenig dünn durch ihre Adern flösse. Ihr gegenüber war Demelza ein Emporkömmling, ein verwahrlostes Kind in einem hochherrschaftlichen Salon, eine Straßengöre, die die Gelegenheit genutzt hatte, einen Blick in die Paläste der Reichen zu werfen: ein ungeschliffenes Geschöpf, ihre Gefühle und Handlungen ein gutes Stück mehr der Natur verbunden. Doch jede von ihnen hatte etwas, das der anderen fehlte.
Am anderen Ende der Tafel amüsierten sich einige der jüngeren Gäste über Francis’ Bericht, wie John Treneglos, um eine Wette zu gewinnen, vergangene Woche die Treppe zum Werry-Haus hinaufgeritten, vom Pferd gefallen und im Schoß der von ihren Hunden umgebenen Lady Bodrugan gelandet war.
»Das ist eine Lüge«, erklärte John Treneglos energisch inmitten des Gelächters und warf einen Blick auf Demelza, um zu sehen, ob sie der Geschichte einigermaßen Aufmerksamkeit schenkte. »Eine faustdicke, gemeine Lüge. Zugegeben, ich verließ für einen Augenblick den Sattel, und Connie Bodrugan bot mir Beistand an, aber schon eine halbe Minute später war ich wieder auf dem Gaul und die Treppe hinunter, noch bevor sie mit ihrer Schimpfkanonade zu Ende kommen konnte.«
»Eine Anzahl kräftiger Flüche haben Sie sich wohl anhören müssen, wie ich die Dame kenne«, sagte George Warleggan und befingerte seinen prächtigen Stehkragen, der jedoch die Kürze seines Halses auch nicht zu verbergen vermochte.
»Also wirklich«, protestierte Patience Teague, die Schockierte mimend, und warf ihm durch ihre Augenbrauen einen schiefen Blick zu. »Stellt Lady Bodrugan nicht ein für eine so nette Feier etwas unpassendes Thema dar?«
Abermals erhob sich Gelächter, und Ruth Treneglos, die ein wenig weiter weg saß, sah ihre ältere Schwester forschend an. Patience entwickelte sich, sie begann der autoritären Herrschaft ihrer Mutter die Stirn zu bieten – so wie sie selbst es getan hatte. Faith und Hope, die zwei Ältesten, waren jetzt schon hoffnungslose alte Jungfern, die Mrs Teague, einem griechischen Chor gleich, alles nachbeteten; mit Joan, der mittleren Schwester, war es nicht viel anders.
»Unter unseren jungen Leuten kleiden sich manche recht extravagant, finden Sie nicht?«, bemerkte Dorothy Johns, das Thema wechselnd, in gedämpftem Ton und musterte Ruth. »Sicher muss Mr Treneglos einen schönen Batzen Geld für die Toiletten seiner Frau hinlegen. Nur gut, dass er in der Lage ist, ihre Ansprüche zu befriedigen.«
»Ja, Ma’am, ich kann Ihnen nur zustimmen, Ma’am«, hauchte Mrs Reverend Odgers beflissen und befingerte ihr ausgeliehenes Halsband. Mrs Odgers verbrachte ihre ganze Zeit damit, jemandem zuzustimmen. Es war ihr Lebensinhalt.
»Sie ist ziemlich dick geworden, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe«, flüsterte Mrs Teague Faith Teague zu, während Prudie hinter ihr mit den Stachelbeertorten hantierte. »Und mir gefällt auch ihr Kleid nicht – was meinst du? Und es passt auch nicht zu einer, die erst seit so kurzer Zeit verheiratet ist. Sie zieht sich so an, um den Männern zu gefallen. Das sieht man doch.«
»Man versteht das ja«, vertraute Faith Teague ihrer Schwester Hope an und gab das Gespräch pflichtschuldigst einen Schritt tischabwärts weiter, »sie spricht eben einen gewissen Typus von Mann an. Sie besitzt jene Art von Charme, der bald welk wird. Allerdings, was Captain Poldark betrifft, bin ich einigermaßen überrascht, das muss ich schon sagen. Sie sind einander eben über den Weg gelaufen und …«
»Ein süßes kleines Äffchen hast du da«, sagte Tante Agatha, die nahe am Kopfende saß, zu Demelza. »Lass sie mich ein wenig halten, Spätzchen. Du hast doch keine Angst, dass ich sie fallen lassen könnte, oder? Ich habe schon so manches Baby auf meinen Knien geschaukelt. Ein richtiger kleiner Poldark ist sie. Ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Pass auf«, warnte Demelza, »dass sie dir nicht dein schönes Kleid besabbert.«
»Es wäre ein gutes Omen, wenn sie es täte. Da, ich habe etwas für dich, Spätzchen. Halt mal das Gör. Heute zwickt es mich wieder einmal gehörig, und der alte Klepper hat mich auch ganz schön durchgerüttelt … Da. Das ist für das Kind.«
»Was ist das?«, fragte Demelza.
»Getrocknete Vogelbeeren. Häng sie über die Wiege. Sie schützen vor bösen Geistern.«
»Nein, die Pocken hat er noch nicht gehabt«, sagte Elizabeth zu Dwight Enys und strich mit der Hand sanft über die Locken ihres kleinen Sohnes, der sittsam neben ihr auf seinem Stühlchen saß. »Ich habe mich schon oft gefragt, ob an diesen Impfungen etwas dran ist, ob sie einem Kind schaden können.«
»Nein, nicht wenn sie fachmännisch vorgenommen werden«, wurde sie von Enys beruhigt, den man neben Elizabeth gesetzt hatte und der außer an ihrer Schönheit an nichts Interesse zeigte. »Lassen Sie ihm von keinem Bauern Kuhpocken geben. Wenden Sie sich an einen verlässlichen Apotheker.«
Schließlich ging das Festmahl zu Ende, und weil es so ein schöner Tag war, schlenderten die Gäste in den Garten hinaus. Während die Gesellschaft sich verteilte, machte Demelza sich an Joan Pascoe heran.
»Habe ich richtig gehört, Miss Pascoe, Sie kommen aus Falmouth?«
»Ich bin dort aufgewachsen, Mrs Poldark. Aber jetzt lebe ich in Truro.«
Demelza sah sich um, ob jemand in Hörweite war. »Kennen Sie zufällig einen Captain Andrew Blamey, Miss Pascoe?«
»Ich habe von ihm gehört, Mrs Poldark, ich habe ihn auch ein- oder zweimal gesehen.«
»Lebt er denn noch in Falmouth?«
»Soviel ich weiß, läuft er den Hafen hin und wieder an. Er ist Seemann, wissen Sie.«
»Ich möchte gern einmal Falmouth besuchen«, sagte Demelza verträumt. »Es heißt, es wäre so ein hübsches Städtchen. Wann ist wohl die beste Zeit, um alle Schiffe im Hafen zu sehen?«
»Am besten ist es nach einem Sturm, nachdem die Schiffe dort Zuflucht gesucht haben. Der Hafen ist groß genug für alle, um auch den heftigsten Sturm heil zu überstehen.«
»Ja, aber ich nehme doch an, dass die Paketboote regelmäßig verkehren, ganz nach Fahrplan. Das Postschiff nach Lissabon zum Beispiel, habe ich gehört, segelt jeden Dienstag.«
»O nein, da sind Sie falsch informiert, Ma’am. Im Winter legt das Postschiff nach Lissabon jeden Freitagabend vom St. Just’s Pool ab, und in den Sommermonaten jeden Sonnabendmorgen. Das Wochenende ist die beste Zeit, um die Schiffe zu sehen, die den fahrplanmäßigen Verkehr abwickeln.«
»Liebste«, wendete sich Ruth Treneglos an ihre Schwester Patience, »wer kommt da das Tal herunter? Ist das etwa ein Leichenzug? Darin wird Tante Agatha sicher ein böses Omen erblicken.«
Nun wurden auch andere darauf aufmerksam, dass neue Gäste unterwegs waren. Angeführt von einem älteren Mann in einem glänzenden schwarzen Rock, schlängelten sich die Neuankömmlinge durch die Bäume auf der anderen Seite des Flusses.
»Heiliger Bimbam!«, rief Prudie, die am zweiten Wohnzimmerfenster stand. »Es ist der Vater des Mädchens. Er kommt am falschen Tag. Hast du ihm nicht gesagt Mittwoch, du nichtsnutziger Kerl?«
Jud sah erstaunt auf und schluckte ein großes Stück Johannisbeertorte hinunter. Er hüstelte verärgert. »Mittwoch? Natürlich habe ich Mittwoch gesagt. Warum sollte ich denn Dienstag sagen, wenn mir aufgetragen wird, Mittwoch zu sagen?«
Voller Entsetzen hatte auch Demelza die neuen Gäste erkannt. Sie sah die Katastrophe voraus und konnte doch nichts tun, um sie abzuwenden. Und auch Ross war in diesem Augenblick nicht an ihrer Seite; Großtante Agathas Wohlbefinden am Herzen, öffnete er gerade die Flügelfenster, um ihr eine gute Aussicht zu ermöglichen.
Dennoch war ihm der sich nähernde Zug nicht entgangen.
Sie kamen in voller Stärke angerückt: Tom Carne, stattlich und bieder – behäbig in seiner neuen Rolle als Respektsperson; Tante Chegwidden Carne, seine zweite Frau, mit ihrer Haube und ihrem spitzen Mund an eine Henne erinnernd; und hinter ihnen vier hoch aufgeschossene, spindeldürre Burschen, eine Auswahl von Demelzas Brüdern.
Betretenes Schweigen lastete auf der Gesellschaft. Nur der Fluss rauschte, und ein Dompfaff piepte. Die Prozession erreichte die mit Bohlen belegte Brücke und überquerte sie mit dem Aufschlag genagelter Stiefel.
Verity erahnte die Identität der Neuankömmlinge, entschuldigte sich bei dem alten Mr Treneglos und trat an Demelzas Seite.
Ross kam rasch aus dem Haus und erreichte, ohne den Anschein von Eile zu erwecken, in dem Augenblick die Brücke, da Tom Carne sie überquert hatte.
»Wie geht es Ihnen, Mr Carne?«, begrüßte er ihn und streckte ihm seine Hand entgegen. »Ich freue mich, dass Sie kommen konnten.«
Carne musterte ihn sekundenlang. Es war mehr als vier Jahre her, dass sie einander begegnet waren und ein Zimmer zu Kleinholz geschlagen hatten. Zwei Jahre der Besserung hatten den Älteren verändert; seine Augen waren klarer und seine Kleidung anständig und seriös. Aber immer noch hatte er seinen unduldsamen Blick. Auch Ross hatte sich in dieser Zeit verändert, hatte seine Enttäuschung überwunden; das Glück und die Zufriedenheit, die er bei Demelza fand, hatten seine Unduldsamkeit gemäßigt.
Carne, der keinen Sarkasmus in Ross’ Stimme entdecken konnte, ließ es zu, dass er seine Hand ergriff. Tante Chegwidden Carne kam als Nächste, schüttelte Ross ohne jede Befangenheit die Hand und ging weiter, um Demelza zu begrüßen.
»Wir haben in der Kirche gewartet, Mädchen«, sagte Carne grimmig zu seiner Tochter. »Du hast uns sagen lassen vier, und um vier waren wir da. Du hattest kein Recht, schon früher damit anzufangen. Wir wollten schon heimgehen.«
»Ich sagte morgen um vier«, entgegnete ihm Demelza in scharfem Ton.
»Jaja. Das hat uns dein Diener gesagt. Aber es war unser Recht, am Tag der Taufe hier zu sein, und er sagte, die Taufe fände heute statt. Dein eigen Fleisch und Blut hat mehr Recht, bei einer Taufe neben dir zu stehen, als alle diese feinen Leute.«
Eine entsetzliche Bitterkeit ergriff Demelzas Herz. Dieser Mann, der einst alle Zuneigung aus ihr herausgeprügelt und dem sie als verzeihende Geste eine Einladung geschickt hatte, war absichtlich an einem anderen Tag gekommen, um sie vor allen zu demütigen. Alle ihre Mühe war vergeblich, und Ross würde die Zielscheibe des Spottes des ganzen Bezirkes sein. Mit einem starren Lächeln, das die Verzweiflung in ihrem Herzen verbarg, begrüßte sie ihre Stiefmutter und ihre vier Brüder: Luke, Samuel, William und Bobby – Namen und Gesichter, die sie in jenem fernen, von Alpträumen erfüllten Leben, das nicht mehr das ihre war, geliebt hatte.
Mit allem Charme und aller Würde, deren er fähig war, wenn er wollte, begleitete Ross Tom Carne und Tante Chegwidden rund um den Garten und stellte sie unerbittlich den anderen vor. Die stahlharte Höflichkeit seines Gebarens schloss unerfreuliche Reaktionen aller jener aus, die es nicht gewohnt waren, mit dem gemeinen Volk Komplimente auszutauschen.
Die Zurschaustellung modischer Eleganz bei seinem Rundgang entlockte Tom Carne keine achtungsvolleren Blicke; mit immer härterem und grimmigerem Ausdruck reagierte er auf die Oberflächlichkeit, die diese Leute an einem so feierlichen Tag für angebracht hielten.
Endlich war es vorbei, und abermals setzte das Gespräch ein, wenn auch in gedämpfterem Ton. Eine leichte Brise kam auf, erfrischte die Gäste und hob hier ein Band und dort einen Rockschoß.
Ross gab Jinny einen Wink, Portwein und Brandy anzubieten. Je mehr die Leute tranken, desto mehr würden sie reden, und je mehr sie redeten, desto harmloser würde die Blamage ausfallen.
»Damit will ich nichts zu tun haben«, erklärte Carne. »Wehe jenen, die sich des Morgens früh erheben und sich geistigen Getränken zuwenden und bis zum Abend nicht davon lassen, bis der Wein ihr Blut in Wallung bringt! Lass mich das Kind sehen, Tochter.«
Steif und grimmig hielt Demelza Julia zur Ansicht hin.
»Mein erstes war größer«, äußerte Mrs Chegwidden Carne schwer atmend, »stimmt das nicht, Tom? Im August wird er ein Jahr alt sein. Ich will mein eigenes Kind nicht loben, aber er ist wirklich ein hübscher kleiner Kerl.«
»Was ist mit ihrer Stirn los?«, fragte Carne. »Hast du sie fallen lassen?«
»Es geschah bei der Geburt«, erwiderte Demelza zornig.
Julia begann zu weinen.
Carne kratzte sich am Kinn. »Ich hoffe, du hast dir die richtigen Taufpaten ausgesucht. Ich dachte daran, mich selbst zur Verfügung zu stellen.«
Unten am Fluss kicherten Mrs Teagues Töchter miteinander, aber ihre Mutter war auf ihre Würde bedacht und ließ, wie es ihre Art war, die Jalousien ihrer Augenlider sinken.
»Eine vorbedachte Erniedrigung für uns«, sagte sie, »einen Mann und eine Frau dieses Schlags hierherzubringen und sie uns vorzustellen!«
Aber ihre jüngste Tochter wusste es besser. Dies war keine Verschwörung, sondern einfach ein Missgeschick, das es zu nutzen galt. Sie nahm ein Glas von Jinnys Tablett und schlich sich hinter dem Rücken ihrer Schwester an George Warleggan heran.
»Meinen Sie nicht«, flüsterte sie, »dass wir unrecht tun, wenn wir uns so von unseren Gastgebern absondern? Ich war noch nicht bei vielen Taufen und kenne daher die Etikette nicht, aber der Anstand scheint mir doch zu gebieten …«
George blickte sekundenlang in ihre ein wenig orientalischen grünen Augen. In seinem Innersten hatte er die Teagues immer verachtet. Es war eine übertriebene Form jener Mischung aus Achtung und Herablassung, die er für die Poldarks und die Chynoweths und alle diese Landedelleute empfand, deren kaufmännische Fähigkeiten im umgekehrten Verhältnis zur Länge ihres Stammbaums standen.
»Solche Bescheidenheit ist bei einem so charmanten Wesen füglich zu erwarten, Ma’am«, sagte er, »aber ich weiß von Taufen auch nicht mehr als Sie. Halten Sie es nicht für angebracht, seine eigenen Interessen zu Rate zu ziehen und dem Weg zu folgen, den sie uns weisen?«
Eine Lachsalve ertönte hinter ihnen.
»Hör mal, Mädchen«, rief Francis gerade Jinny zu, die in der Nähe vorbeikam, »hast du noch von dem Kanarienwein? Ich nehme noch ein Glas. Du bist ein hübsches kleines Ding; wo hat Captain Poldark denn dich aufgelesen?«
Die Betonung war kaum merkbar, aber Ruths Lachen ließ keinen Zweifel daran, wie sie Francis’ Worte aufgefasst hatte. Jinny errötete bis an die Haarwurzeln.
»Ich heiße Jinny Carter, Sir. Martin war mein Mädchenname.«
»Ja, ja.« Francis’ Ausdruck veränderte sich ein wenig. »Jetzt erinnere ich mich. Du hast eine Zeit lang in der Grambler-Mine gearbeitet. Wie geht es deinem Mann?«
Jinnys Gesicht erhellte sich. »Recht gut, Sir, danke, soviel … soviel …«
»Soviel du weißt. Ich hoffe, die Zeit wird für euch beide schnell vorübergehen.«
»Sie zeigen aber recht wenig Interesse an Ihrem Patenkind, Francis«, versuchte Ruth ihn von seinem gönnerhaften und herablassenden Betragen abzubringen. »Sehen Sie nur, wie alle die Kleine anstarren! Sicher würde ihr ein Schluck Kanarienwein gut bekommen.«
»Es heißt, das gemeine Volk wird mit Gin aufgezogen«, bemerkte Patience Teague. »Und kommt nicht schlecht dabei weg. Ich habe erst kürzlich gelesen, wie viele Millionen Liter Gin im vergangenen Jahr getrunken wurden.«
»Aber doch nicht ausschließlich von Babys«, scherzte Treneglos.
Tom Carne richtete seinen starren, stechenden Blick auf Mrs Carne.
»Hier herrscht Gottlosigkeit, Frau«, sagte er durch seinen Bart hindurch. »Das ist nicht der passende Ort für ein Kind. Das ist keine ziemliche Gesellschaft für eine Tauffeier. Aber ich habe nichts anderes erwartet.«
Julia wollte nicht aufhören zu weinen, was Demelza als Vorwand diente, um mit ihr ins Haus zu gehen. Sie war von tiefer Verzweiflung erfüllt.
Sie wusste, dass dieser Tag, wie immer er enden mochte, einen schweren Misserfolg für sie bedeutete. Ein gefundenes Fressen für die Lästermäuler. Sie hatte versucht, eine der ihren zu werden, und hatte Schiffbruch erlitten. Sie würde es nie wieder versuchen. Sie wollte nur noch in Ruhe gelassen werden.
Tom Carne steuerte gerade auf Ruth und ihre Freunde zu.
»Ist einer von Ihnen der Pate des Kindes?«
Francis deutete eine Verbeugung an.
»Ich bin es.«
Tom Carne starrte ihn an.
»Mit welchem Recht?«
»Hm?«
»Mit welchem Recht stehen Sie für das Kind am Sitz der Gerechtigkeit vor Gott?«
Francis hatte in der vergangenen Nacht am Pharotisch hoch gewonnen und war daher nachsichtig gestimmt.
»Weil ich dazu aufgefordert wurde.«
»Aufgefordert?«, wiederholte Carne. »Ja, vielleicht wurden Sie aufgefordert. Aber wurden Sie auch gerettet?«
»Gerettet?«
»Ja, gerettet.«
»Gerettet wovor?«
»Vor dem Teufel und der Verdammnis.«
»Diesbezüglich habe ich keine Benachrichtigung erhalten.«
John Treneglos wieherte.
»Nun, darin liegt Ihre Schuld, Mister«, erklärte Carne. »Die ihre Ohren dem Ruf Gottes verschließen, haben ohne Zweifel auf den Teufel gehört. Vor dieser Wahl stehen wir alle. Entweder das eine oder das andere.«
»Wir haben einen Prediger in unserer Mitte«, bemerkte George Warleggan.
Mrs Carne zupfte ihren Mann am Ärmel.
»Komm weg, Tom«, sagte sie. »Lass sie. Sie wandeln im Tal der Schatten, und nichts wird sie davon abbringen.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.