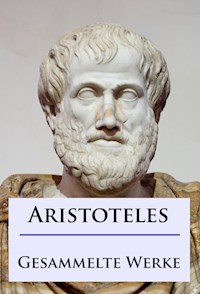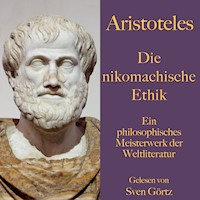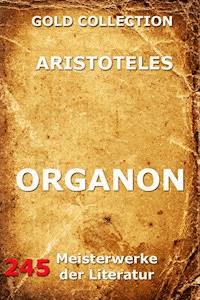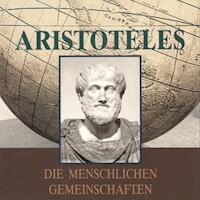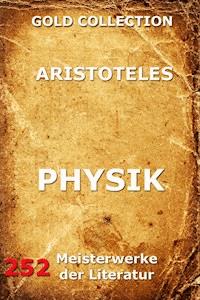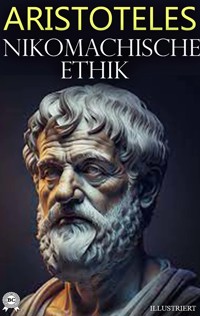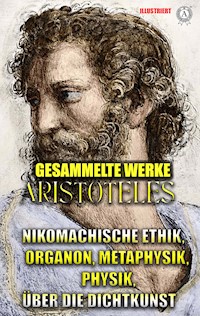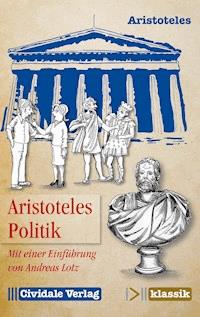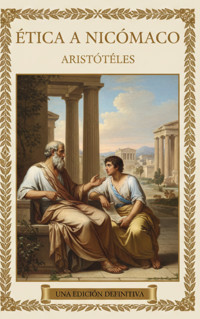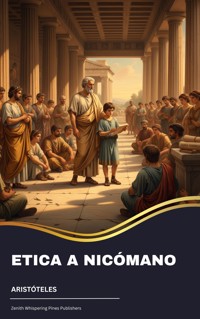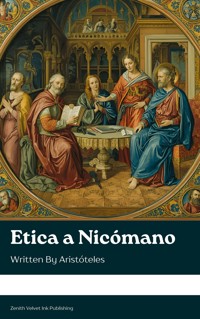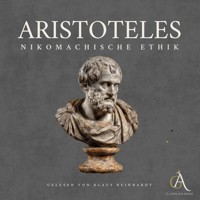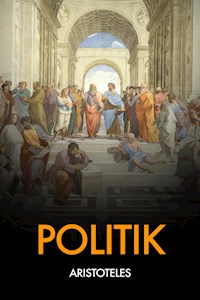
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Politik ist die wichtigste staatsphilosophische Schrift des Aristoteles. Das in acht Bücher aufgeteilte Werk behandelt hauptsächlich verschiedene real existierende und abstrakte Verfassungen.
In diesem Werk stellt Aristoteles vier Thesen auf, die „jahrhundertelang widerspruchslos anerkannt“ wurden. Sie lauten:
1 - der Mensch ist ein Zoon politikon – ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes und Gemeinschaft bildendes Lebewesen
2 - die Polis ist die vollkommene Gemeinschaft
3 - die Polis ist natürlich
4 - die Polis „ist von Natur aus früher als das Haus und die Individuen.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Politik
Aristoteles
Übersetzt vonJ. H. v. Kirchmann
Inhalt
Vorwort.
Erstes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Zweites Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Drittes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Viertes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Fünftes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Sechstes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Siebentes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Achtes Buch.
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Vorwort.
Die hier gegebene Uebersetzung der Politik des Aristoteles folgt dem griechischen Text nach der Becker'schen Schulausgabe, Berlin 1855, in welcher Becker den Text seiner Quartausgabe von 1832 in mehreren Stücken verbessert hat. Die späteren von anderen Herausgebern erfolgten Textrecensionen haben, trotz der dabei geübten Gelehrsamkeit und Sorgfalt, doch für den Zweck der vorliegenden Uebersetzung ihre Bedenken; denn sie gehen meist von der Voraussetzung aus, als müsse diese Schrift des Aristoteles möglichst von allen den Mängeln gereinigt werden, die sich irgend wie auf andere Schultern abwälzen lassen. Bei der ungeheueren schriftstellerischen Thätigkeit des Ar. war er offenbar neben seinen ausgebreiteten eigenen Studien und täglichen mündlichen Vorträgen nicht im Stande, die ersten Entwürfe seiner Schriften nochmals zu revidiren oder gar umzuarbeiten. Sie scheinen vielmehr neben streng durchdachten Hauptsätzen, welche er vielleicht schon für seine Vorträge sich schriftlich notirt hatte, nur weitere Ausführungen in freierer Art zu enthalten, wie dies ja noch heute von den Professoren bei ihren Lectionen geschieht, und bei diesen Ausführungen scheint Ar. sich gleichsam einer schriftlichen Improvisation überlassen zu haben, wo natürlich der Gedankengang und Styl nicht so correkt, wie bei jenen Hauptsätzen ausfallen konnte. Nur wenn man einen solchen Gesichtspunkt zulässt, werden die Mängel erklärlich, welche seinen Schriften, namentlich in Bezug auf Anordnung und Eleganz anhaften, und man ist dann nicht genöthigt Lücken anzunehmen, oder den Abschreibern oder Interpolatoren das zur Last zu legen, was nicht ganz den Anforderungen entspricht, die man von einem in voller Ruhe und Musse und mit aller Sorgfalt ausgearbeiteten und revidirten Werke erwarten kann. Dies dürfte sich namentlich gegen die neueste Textrecension von Susemihl geltend machen lassen. (Aristoteles' Politik, griechisch und deutsch, von Susemihl, Leipzig 1879 bei Engelmann.)
Die Politik des Ar. ist häufiger und in mehr moderne Sprachen übersetzt worden, als irgend ein anderes seiner Werke. Abgesehen von den lateinischen Uebersetzungen sind deutsche Uebersetzungen geliefert worden von Garve 1792, von Schlosser 1798, von Fülleborn 1799, von Stahr 1839, von Lindau (Oels) 1843, von Bernays 1872 und von Susemihl 1879. Die letzte ist mit grosser Sorgfalt und Genauigkeit gearbeitet, indess ist gerade dadurch die eigenthümliche Schreibweise des Aristoteles, seine prägnante Kürze des Ausdrucks und zugleich doch das Schleppende und Unbeholfene seines Periodenbaues sehr verdeckt worden, obgleich nach des Unterzeichneten Ansicht auch diese Mängel in der Uebersetzung wieder erscheinen müssen, so weit die deutsche Sprache es gestattet. Man muss insbesondere aus der Uebersetzung erkennen, dass man es mit einem alten Schriftsteller zu thun hat, der in der Ausdrucksweise seiner Gedanken uns sehr fern steht. Indem Schleiermacher gerade dies eingehalten, hat seine Uebersetzung der Platonischen Dialoge noch heute einen eigenthümlichen Werth; sie ist so treu, als möglich, und gerade dadurch fühlt der Leser sich dem alten griechischen Autor viel näher gerückt, als wenn der bei Ar. oft schleppende und nachlässige Styl in elegante Perioden umgewandelt und seine durch ihre Kürze oft dunklen Aussprüche mittelst breiter Umschreibungen oder Benutzung moderner, den Griechen noch fremder Begriffe verdeutlicht werden. Es wird immer besser sein, statt dieser Hülfsmittel lieber da, wo Dunkelheiten an sich bestehen, sie in kurzen, der Uebersetzung beigesetzten Noten zu erläutern, als den Text selbst zu verbessern.
An sich bietet diese Schrift des Ar. für eine deutsche Uebersetzung weniger Schwierigkeiten, wie irgend eine andere seiner philosophischen Schriften. Zu ihrem vollen Verständniss gehört allerdings eine gute Kenntniss der alten Geschichte überhaupt und der griechischen insbesondere, sowie eine Vertrautheit mit den griechischen Alterthümern, da Ar. in dieser Schrift mehr, als sonst, sich auf zahlreiche Beispiele aus der Geschichte Griechenlands und seiner Colonien bezieht und deshalb das Thatsächliche der griechischen Verfassungen und des griechischen Lebens in der Hauptsache dem Leser bekannt sein muss. Eben deshalb ist bei dem, im Band 85 gegebenen Erläuterungen zu dieser Schrift unterlassen worden, ausführliche geschichtliche Ergänzungen zu den, in der Sache meist nur kurz angedeuteten Beispielen zu geben. Das Nöthige hierüber kann aus den zahlreichen Handbüchern über Geschichte und Alterthümer Griechenlands mit Leichtigkeit entnommen werden; hier würden diese Erläuterungen einen viel zu grossen Raum eingenommen und das philosophische Interesse, was bei der Philosophischen Bibliothek die Hauptsache bleibt, sehr zurückgedrängt haben.
Die Aechtheit dieser Schrift, als eines Werkes von Aristoteles ist, wenigstens in allen seinen wichtigsten Stücken, nie bezweifelt worden. Dagegen wird von den Philologen schon seit langer Zeit über die richtige Anordnung der einzelnen Bücher gestritten. In der neueren Zeit hat man die alte Ordnung, wie sie in den wenigen, auf uns gekommenen Handschriften besteht, verlassen und hinter dem dritten Buche gleich das alte 7. und 8. Buch folgen lassen, und diese damit zu dem 4. und 5. Buche gemacht; dann hat man das alte 4. als sechstes und das alte 6. als siebentes und das alte 5. als achtes folgen lassen und damit die Schrift beschlossen. Bei diesem, von den Philologen geführten Streit ist zwar ausserordentlich viel Gelehrsamkeit und Scharfsinn entwickelt worden, allein das philosophische Interesse ist dabei ein sehr geringes. Auch das Verständniss der einzelnen Bücher wird dadurch nicht im mindesten erleichtert, ja vielleicht erschwert. Ar. selbst hat am Schlusse seiner Ethik den Plan für die Politik, die mit jener ein Werk bilden sollte, dahin skizzirt, dass darin die Abhandlung über die beste Verfassung erst nach der Darstellung und Beurtheilung der wirklich vorhandenen Verfassungen folgen solle, wie es bei der alten Ordnung auch der Fall ist. Da Ar. in dieser Schrift nicht deduktiv, sondern wesentlich induktiv verfährt, so entsprach es ganz dieser Methode, so wie dem leichteren Verständniss, diesen idealen Theil erst der Betrachtung des Wirklichen nachfolgen zu lassen. Um die in dieser Stelle enthaltene Bestätigung der alten Ordnung der Bücher zu beseitigen, war man genöthigt, diesen Schluss der Ethik für unächt zu erklären; allein die Gründe dafür drehen sich im Kreise, indem man vorweg behauptet, nur die neue Ordnung entspreche dem, was man von dem System einer Wissenschaft verlangen müsse. Da indess trotzdem Becker seine Ausgabe nach den neueren Vorschlägen geordnet hat, so hat dies auch in der Uebersetzung hier geschehen müssen, und eine weitere Erörterung dieser Frage kann um so mehr hier unterbleiben, als sie, wie gesagt, kein philosophisches Interesse hat. Auch werden einzelne weitere Bedenken gegen die neue Ordnung gelegentlich bei den betreffenden Stellen erwähnt werden; man hat sie meist damit zu beseitigen gesucht, dass man diese Stellen für spätere Interpolationen erklärte, womit man allerdings am schnellsten fertig wurde.
Was die in Band 85 folgenden Erläuterungen zu dieser Schrift des Ar. anlangt, so sind bei denselben die bisherigen in der Phil. Bibl. befolgten Grundsätze festgehalten worden; nur die historischen und antiquarischen Ergänzungen sind, wie erwähnt, hier meist weggeblieben, und wesentlich nur die philosophische Seite der Schrift im Auge behalten worden. Allerdings tritt das Philosophische in dieser Schrift überhaupt nur wenig hervor, insbesondere viel weniger, als selbst in der Ethik. Die Ursache liegt ziemlich klar vor. Trotzdem, dass Ar. in seinen Analytiken nur die deduktive, auf logische Schlüsse und die angeblich in der Vernunft enthaltenen allgemeinen Wahrheiten gebaute Darstellung als die wissenschaftliche und als die allein zur Wahrheit führende Methode hinstellt, hat doch sein praktischer Sinn in allen, dem Seienden zugewandten Disciplinen an diesem Ausspruch nicht festhalten können, sondern der induktiven, mit der Beobachtung des Wirklichen beginnenden Methode sich zugewendet. Schon in der Ethik (B. 68, S. 13) erkennt Ar. dies selbst an und erklärt es zwar für einen Mangel, aber doch für einen unvermeidlichen. Diese Methode wird dann in der Politik in noch überwiegenderem Maasse eingehalten.
Vor Ar. war dieses Gebiet nur bruchstückweise bearbeitet worden und selbst Plato hatte die wirklich vorhandenen Verfassungen in seinem Staate nur flüchtig behandelt; so fiel dem Ar. als nächste Aufgabe zu, den ungeheuren Reichthum innerhalb dieses Gebietes vorerst zu ordnen, d. h. auf bestimmte Arten und Gattungen zurückzuführen, die Begriffe dafür festzustellen und die hier sich ergebenden Gesetze hervorzuheben. Dies alles ist indess noch keine Philosophie, sondern bildet die Aufgabe der besonderen Wissenschaften, aus denen erst allmälig das Philosophische sich herausarbeitet und erst dann für sich dargestellt werden kann – ähnlich wie man im Gebiet der Natur die Naturgeschichte, die Naturwissenschaft und die Naturphilosophie heutzutage unterscheidet. Indem Ar. so vor allem noch mit Herstellung dieser besonderen politischen Wissenschaft zu thun hatte, musste schon deshalb der höhere philosophische Theil zurücktreten. Aber selbst da, wo er am Schlusse der Schrift zu diesem Theil, d. h. zu dem sogenannten Idealstaat übergehen will, zeigt sich die auffallende Erscheinung, dass er sehr bald wieder davon ablässt und in das Besondere zurückfällt. Von dem besten Staat wird nur wenig gesagt, vielmehr geht Ar. schnell wieder zu dem meistentheils besten und zu dem im gegebenen Falle besten über.
Genauer betrachtet liegt dies indess nicht in einer Flüchtigkeit des Ar.; auch nicht in dem Mangel an Vorarbeiten, die allerdings hier, von Plato abgesehen, fehlten, sondern offenbar darin, dass das Gebiet der Politik für die philosophische Behandlung weit weniger Stoff bietet, als die Gebiete der Natur, des Schönen und des logischen Denkens und Erkennens. Sowie man einsieht, dass in dem Gebiete der Ethik und Politik es kein sachliches Princip giebt, aus dem ein absolut und allgemein gültiger Inhalt sich ableiten lässt, sondern dass das Sittliche seinen Inhalt nur aus dem Gebiete der Lust entnimmt und seine, dem Treiben der Lust entgegengesetzte Kraft lediglich aus den Gefühlen der Achtung vor den Geboten erhabener Autoritäten empfängt, kann von einen absoluten, für alle Zeiten und alle Völker gültigen Inhalt der sittlichen Begriffe und Gesetze nicht mehr die Rede sein. Die verschiedenen Arten und Grade der Lust und der Empfänglichkeit für dieselben sind einer steten, allmäligen Veränderung unterworfen, welche bedingt wird, von den je nach den Ländern und Zeiten geschehenden Fortschritt in dem Wissen des Menschen und in seiner Macht über die Kräfte der Natur. Indem die jeweiligen Autoritäten, d. h. der Fürst, das Volk als Ganzes und die höchsten Priester diesen Inhalt in ihre Gebote aufnehmen, wird er für die Einzelnen zu einem Sittlichen. Deshalb hat das eine Land und die eine Zeit nicht mehr Recht, den Inhalt ihres Sittlichen für den allein wahren zu behaupten, wie jedes andere Land und jede andere Zeit den ihrigen. Damit ist denn eine Philosophie, welche einen absolut sittlichen Inhalt aufstellen will und soll, eine Unmöglichkeit; ihre Aufgabe liegt hier nur darin, diese eigenthümliche Natur des Sittlichen und die Wahrheit dieser Auffassung an jeder einzelnen sittlichen Gestaltung näher darzulegen. Von einem Idealstaat und einer idealen Sittlichkeit mit einem bestimmten Inhalt kann deshalb in der Philosophie nicht die Rede sein, so wenig wie von einem Ideal-Baume oder einem Ideal-Thiere in der Naturphilosophie und wenn die Philosophie dies dennoch versucht, so kommen, wie die Erfahrung lehrt, nur unausführbare Utopien heraus, oder Gestaltungen, welche der Verfasser lediglich nach den Principien der Sittlichkeit seines Landes und seiner Zeit aufgestellt hat und wo er anstatt ein Absolutes zu bieten, nur das zu seiner Zeit Bestehende je nach seinen persönlichen Neigungen und seinem beschränkten Gesichtskreise meist zu einer Carrikatur umgestaltet hat, welche ihm vielleicht für den Idealstaat gelten mag, aber welche weder das vermeinte Absolute enthält, noch irgend eine Verwirklichung, selbst nicht für seine Zeit und sein Land erreicht. Denn die hier wirkenden Kräfte kann der Einzelne, und noch dazu der Gelehrte weder in ihrer Vollständigkeit, noch in ihrer verhältnissmässigen gegenseitigen Stärke übersehen und wenn ja ein Versuch mit der Verwirklichung solcher Construktionen gemacht wird, so fallen sie bei dem ersten Windstoss, wie Kartenhäuser zusammen.
Bei Ar. bestand zwar diese bewusste und klare Einsicht in die Natur des Sittlichen noch nicht; er hielt im Ganzen, wie Plato, die Grundzüge des Sittlichen, wie sie in Griechenland bestanden für die absoluten, allein wahren und ewig gültigen; aber er war doch ein zu klarer, durch die Beobachtung geschulter Kopf, um sich in solche Staats-Ideale, wie das Platonische zu weit zu verirren. Der Einfluss seines grossen Lehrers liess ihn wohl noch an dem Begriff eines »besten Staats« festhalten, allein in der Ausführung desselben stockte ihm der Griffel; er kam nicht über einige vage Sätze hinaus und indem er dies selbst fühlte, ging er schnell wieder zu den Gestaltungen über, wo ihm die Wirklichkeit einen festeren Boden gewährte, nämlich auf die relativ besten Verfassungen und auf die aus der Erfahrung zu entnehmenden Mittel, wie dergleichen Verbesserungen bei den bestehenden Staaten zu erreichen seien.
Man kann deshalb die Politik des Ar. als eine Bestätigung jener philosophisch-realistischen Lehre von der Natur des Sittlichen ansehen, wie sie oben angedeutet worden und von dem Unterzeichneten in Bd. XI. der Phil. Bibl., sowie in seiner Uebersetzung von Hobbes Schrift: »Ueber den Bürger«, (Leipzig 1873 bei Brockhaus) und in den Verhandlungen der Phil. Gesellschaft zu Berlin, Heft 13 und 14 (Leipzig 1878 bei Koschny) ausführlicher entwickelt worden ist. Gerade dadurch, dass Ar. das Gegentheil dieser Lehre versuchte, aber auszuführen nicht vermochte, hat er wider Willen den besten Beweis dafür gegeben, dass es kein Absolut-Sittliches für den Menschen giebt und dass die von den Gelehrten entworfenen Staatsideale, wenn verwirklicht, grösseren Schaden anrichten würden, als selbst die schlechteste der bestehenden Verfassungen.
Indem Ar., wie gesagt, diese klare Erkenntniss noch nicht besass, sondern vielfach noch von den platonischen Ansichten beeinflusst war, erklären sich auch manche andere, in seiner Politik hervortretende Mängel. So z. B., dass er eine sittliche Staatsleitung fordert, welche auf der Tugend des einzelnen Bürgers beruht und mit derselben parallel geht. Das Irrige dieser Ansicht hat Ar. im Verlaufe seiner Schrift selbst anerkannt, indem er für jede der verschiedenen Arten von Staatsverfassungen eine besondere Art von Tugend verlangt, wo oft die der einen Verfassung der der anderen widerspricht. Will man die Staatsleitung durchaus als eine Tugend (ἀρετη) behandeln, so mag dies geschehen, aber dann kann unmöglich diese Tugend selbst in Arten zerfallen, welche das Entgegengesetzte vorschreiben.
Aus gleichem Grunde ist Ar. erst in dem letzten Buche zu der deutlicheren Einsicht gelangt, dass das Sittliche, wie es für das Privatleben gilt, nicht ohne weiteres auch für den Staatsmann als Pflicht bei der Leitung des Staats aufgestellt werden kann. Wesentlich ist hier, dass für den Staat das egoistische Princip anderen Staaten gegenüber das höchste ist, während für die Privatverhältnisse das Princip der Liebe für Andere gleiche Geltung verlangt.
Indem so in Wahrheit das staatliche Handeln weit mehr nach den Regeln der Klugheit, als der Sittlichkeit bemessen werden muss und selbst der Inhalt der abzufassenden Gesetze sich überwiegend nach dem Nutzen bestimmt, welcher daraus den Bürgern erwächst, wie die Motive und parlamentarischen Verhandlungen bei jedem Gesetzesvorschlage deutlich ergeben, so hat die Politik, insofern sie als Wissenschaft die Regeln dieses staatlichen Handelns feststellen will, noch mit weit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen, als sie schon bei der Privatmoral bestehen. Letztere hat wenigstens an den Aussprüchen der Autoritäten einen festen Halt, welcher sie von der Erwägung des Nutzens und Schadens bei der Erfüllung einer Pflicht befreit; allein wenn das staatliche Handeln, also z. B. die Frage, ob ein Krieg zu beginnen oder nicht, ob eine Colonie auszusenden, und wohin, welche Bestimmungen über Erziehung, Zulassung von Fremden, Beschränkung des Verkehrs, über Entrichtung von Steuern, über den Abschluss von Bündnissen u. s. w. lediglich nach dem Nutzen zu bemessen ist, welcher daraus für das eigene Volk erwartet wird, so sind offenbar diese Fragen viel schwerer zu beantworten, als die in der Privatmoral auftretenden.
In beiden entspringen diese Schwierigkeiten lediglich aus den gleichzeitigen Collisionen verschiedener Pflichten oder verschiedener Klugheitsregeln. Selbst die kleinste Handlung hat, je nach den Gesichtspunkten, ihre guten und ihre schädlichen Folgen und erscheint demnach bald als sittlich, bald als unrecht. In den meisten Fällen ist diese Vergleichung zwischen Nutzen und Schaden ausserordentlich complicirt und die grossen Staatsmänner würden nicht so selten sein, wenn diese Erwägungen, dieses Herausfühlen des entscheidenden Punktes so leicht wäre, wie man nach den Büchern über Politik es glauben sollte. Alle diese Bücher einschliesslich der Politik des Ar. können nur die einzelnen Gesichtspunkte aufzählen, nach denen das staatliche Handeln zu bemessen ist; und schon hier können sie bei der grossen Mannigfaltigkeit dieser Gesichtspunkte, nach welchen eine, nur halbwegs wichtige Maassregel zu prüfen ist, dieselben nur in einer Weise bieten, welche theils zu allgemein und unbestimmt ist, theils immer unvollständig bleibt. Noch schwerer, ja meist unmöglich ist es der Wissenschaft, die verhältnissmässige Wichtigkeit der einzelnen Bedenken bei einer staatlichen Maassregel gegen einander abzuwägen und gleichsam einen Gradmesser dieser Wichtigkeit aufzustellen; und doch kann ohne einen solchen der Entschluss in dem einzelnen Fall nicht nach diesen abstracten Regeln allein getroffen werden. So fühlt zuletzt ein Jeder, dass hier der geniale Blick des Staatsmannes durch keine Wissenschaft ersetzt werden kann.
Hieraus erklärt sich auch, weshalb die von Ar. in seiner Politik gegebenen Anweisungen auf einen Leser, der nur einigermaassen an der Leitung eines Staats praktisch betheiligt gewesen ist, einen so wenig befriedigenden Eindruck machen. Man wird bei ihm selten auf eine Regel stossen, der man in ihrer Isolirung nicht zustimmen könnte; allein die allein praktische Frage, welcher von diesen vielen, in dem einzelnen Fall gleichzeitig eingreifenden und doch einander widerstreitenden Regeln der Vorrang gebührt, vermag keine Wissenschaft zu lösen. So fühlt der Mann der Praxis, wie die politische Wissenschaft ihn gerade in diesem wichtigsten Punkte im Stich lässt, und so erklärt sich, wie alle diese einzelnen weisen Lehren ihn sehr kühl lassen.
Es ist nach der Ansicht des Unterzeichneten der Werth dieser Schrift des Ar. von jeher weit überschätzt worden; ja selbst das, was an ihr getadelt wird, verschwindet gegen das, was sie nicht leistet und überhaupt zu leisten nicht vermag. So sagt z. B. Zeller (Geschichte der griechischen Philosophie, Bd. II., Absch. 2, S. 672; dritte Ausgabe, 1879): »Wahrscheinlich wurde die Vollendung der Politik des Ar. durch den Tod ihres Verfassers unterbrochen; aber selbst in der auf uns gekommenen Gestalt sind die acht Bücher der Politik des Ar. eines von den bewunderungswürdigsten Werken, welche das Alterthum uns hinterlassen hat; in so seltener Vereinigung, so gleichmässig abgewogener Stärke treten uns in demselben die Eigenschaften entgegen, welche sich sonst in der Regel nur ungleich vertheilt finden: die umfassende Kenntniss des geschichtlichen Thatbestandes, die Beherrschung dieses Materials durch ein tiefdringendes, wissenschaftliches Denken und des einsichtsvollsten Verständnisses für die realen Bedingungen des Staatslebens«. Aehnlich sagen Becker (Staatslehre des Aristoteles, Leipzig 1878) und mit ihm Susemihl (Aristoteles' Politik, Leipzig 1879, Bd. I., S. 8): »Das richtige Verständniss der Schrift des Ar. hat sich erst mit der Entwickelung des modernen Staats allmälig dahin gebildet, dass man jetzt selbst bei ihrer unvollendeten Gestalt einstimmig in ihr das Grösste und Reichste erkennt, was wir aus dem Alterthume, und wenn man den Unterschied der Zeiten berücksichtigt, wohl das Grösste, was wir überhaupt auf dem Gebiete der politischen Theorie besitzen«.
In ähnlicher Weise fliesst das Urtheil der meisten Bearbeiter der Schrift über von Bewunderung derselben. Viel kühler urtheilt schon Hegel, trotzdem, dass er zu den grössten Verehrern des Ar. gehört. Er sagt (Geschichte der Philosophie, Bd. II., S. 400) nachdem er dargelegt, dass Aristoteles ebenso wie er, (Hegel) nicht den einzelnen Menschen, sondern den Staat für das Höhere erkläre, und dass der Staat die Substantialität des Einzelnen ausmache: »Hieraus erhellt, dass Ar. den Gedanken eines sogenannten Naturrechts nicht haben konnte. Im Uebrigen enthält seine Politik noch jetzt lehrreiche Ansichten der Kenntniss von den inneren Momenten des Staats und der Beschreibung der verschiedenen Verfassungen. Aber die bürgerliche Freiheit kannte er noch nicht; erst nachdem der Staat diese in sich empfangen, konnte die höhere Freiheit hervorgehen; das was die Alten geleistet haben, sind Naturspiele und Naturprodukte; Zufall und Laune des Einzelnen«.
Wenn dagegen jene vorerwähnten Männer diese Schrift des Ar. so überaus hoch stellen, so erklärt sich dies wohl aus dem Umstande, dass sie alle zu dem Stande der Gelehrten und Professoren gehören, welche an der Leitung der allgemeinen Staatsangelegenheiten niemals sich praktisch betheiligt haben. Nur in solchen beschränkten Verhältnissen kann man zu der Meinung gelangen, dass jene reiche Anzahl von Rathschlägen, welche Ar. in seiner Schrift dem Politiker giebt, und deren Güte als einzelne betrachtet, meist anerkannt werden muss, zureiche, um einen Staat zweckmässig und zum Heile seiner Bürger zu leiten. Dass diese Regeln meist viel zu allgemein lauten, dass sie beinah immer im einzelnen Fall mit einander in Collision gerathen, dass man nur mittelst Compromisse regieren kann, also alle diese Regeln für die zu treffende Entscheidung nichts helfen, wird in solcher Stellung selten bemerkt. Dazu kommt, dass die meisten dieser allgemeinen Rathschläge für einen, in öffentlichen Angelegenheiten halbwegs erfahrenen Mann auf der Hand liegen und dass heutzutage schon jeder aufmerksame Zeitungsleser dergleichen Lehren aus dem Stegreife zu Dutzenden hersagen kann. Sie sind überdem bei Ar. mit Privatmoral so verquickt, dass in ihrer Anwendung leicht fehl gegriffen werden kann, und nur da, wo sich Ar. von dieser Vermischung frei macht und das Politische rein nach dem Princip der Staatsklugheit bemisst, wie dies namentlich im letzten Buche geschieht, tritt die staatsmännische Einsicht deutlicher bei ihm hervor.
Vieles hat dagegen nur einen blendenden Schein: so die scharfe Gegenüberstellung der guten und der ausgearteten Verfassungen; während doch jeder wirkliche Staat seine guten und seine schlechten Seiten hat. Solche Gegensätze sind ebenso unwahr, wie der von guten und schlechten Menschen. Dergleichen gefällt dem Theoretiker, weil es nach seiner Meinung Ordnung in das Chaos bringt und das Urtheil erleichtert, aber in der Praxis verwandelt es sich zum Unwahren und Unbrauchbaren. Auch die Autarkie (das sich selbst Genugsein) des Staats, worin Ar. das Wesentliche desselben gegenüber den kleineren Verbindungen findet, erscheint zwar auf den ersten Blick als ein treffender Gedanke. Allein er ist nur dann wahr, wenn man die Ehen, die Familien, die Gemeinden, die wirthschaftlichen Organisationen und die mannigfachen freien Verbindungen Einzelner für besondere Zwecke, als integrirende Theile des Staats behandelt; dann erst kommt die Autarkie heraus, ja selbst dann muss noch die zu Zeiten nöthige Verbindung mit anderen Staaten hinzukommen. Eine solche Ausdehnung des Staatsbegriffs ist aber nicht zulässig; der Staat ist vielmehr nur der Schlussstein in den mancherlei Verbindungen der Menschen, welcher den niederen Verbindungen nur die letzte Sicherheit und eine gewisse Unterstützung gewährt; aber die innere Thätigkeit dieser niederen Verbindungen, wie der Familie, der Gemeinden, der Zünfte u. s. w. gehört nicht zur Thätigkeit des Staats. Die Omnipotenz des Staats, wie sie in den antiken Zeiten bestand, ist mit dem Fortschritt der Cultur immer mehr zurückgedrängt worden; in allen Staaten bestehen jetzt verfassungsmässige Grundrechte, welche selbst der Macht des Staats Grenzen setzen.
Auch was die Ordnung des Stoffes und die Aufstellung der Begriffe in der Lehre vom Staat anlangt, so ist das Verdienst des Ar. wohl überschätzt worden. Die Mannigfaltigkeit der Verfassungen war schon längst von ihm auf bestimmte Arten zurückgeführt und die Ergänzungen, welche Ar. hier versucht, sind nicht immer gelungen. Der falsche Gegensatz von guten und ausgearteten Verfassungen ist schon erwähnt; dazu kommt, dass Ar. von diesem Gegensatz im Fortgange seines Werkes wenig Gebrauch machen kann. Er kommt da auf die gebräuchlichen Eintheilungen von Oligarchien und Demokratien in den griechischen Staaten zurück und unterscheidet bei jeder von diesen die guten und die schlechten, während doch im III. Buche sie sämmtlich als ausgeartet gelten und die Aristokratie und der Freistaat (πολιτεια) ihnen als die guten Arten gegenübergestellt werden. Daher erklärt sich auch, dass die Begriffe dieser beiden letzten Arten schwankend bleiben und man schwer herausfinden kann, wie sich die Aristokratie von der besten Oligarchie und der Freistaat von der besten Demokratie unterscheidet. – Ebenso bedenklich ist die Aufstellung der Tugend (ἀρετη) neben dem Reichthum und der Armuth als ein unterscheidendes Element für die verschiedenen Klassen der Bürger. Wer soll über das Kriterium der Tugend entscheiden? und welche Tugend ist darunter zu verstehen? Schon die Betrachtung der einzelnen damals bestehenden Verfassungen hätte den Ar. lehren sollen, dass jede Staatsorganisation bestimmter äusserer Merkmale bedarf, an welche allein die politischen Rechte geknüpft werden können.
Neben diesen hier hervorgehobenen Mängeln finden sich noch manche andere, welche indess besser für die Erläuterungen der betreffenden Stellen aufgespart bleiben und dort eingesehen werden können. Es versteht sich, dass damit der Leser von dem Studium dieser Schrift nicht abgeschreckt werden soll; aber es war in seinem eigenen Interesse nöthig jene in's Maasslose gesteigerten Lobeserhebungen der Schrift auf ihr richtiges Maass zurückzuführen. Die Politik des Ar. ist weit wichtiger für den Geschichtschreiber, für den Volkswirth als für den Philosophen und für den praktischen Staatsmann. Sie war in Bezug auf die nächste Aufgabe der beginnenden Wissenschaft des Staats, d. h. für die Ordnung des Stoffes, für richtige Aufstellung der obersten Begriffe, für die nächstliegenden Regeln der politischen Klugheit sicherlich ein Schritt von grossem Werthe, aber seit der Entwickelung des parlamentarischen Lebens und der politischen Tagespresse in der neueren Zeit ist die Bildung und das Urtheil über die öffentlichen Verhältnisse so vorgeschritten, und selbst in die Mittelklassen der Gesellschaft so weit eingedrungen, dass ein Leser, der einigermaassen diesen Erörterungen mit Aufmerksamkeit gefolgt ist, schwerlich aus dieser Schrift viel Belehrung sich wird erholen können, selbst wenn man von den viel verwickelteren Verhältnissen absieht, mit denen die heutige Staatsleitung zu rechnen hat.
Will man die Schriften des Ar., so weit sie auf uns gekommen sind, nach ihrem philosophischen Werthe ordnen, so dürften nach der Ansicht des Unterzeichneten, die logischen des sogenannten Organons die erste Stelle verdienen; auf diese würde die Physik folgen müssen; die dritte Stelle würde die Metaphysik einnehmen können; die vierte das was von den Schriften über Rhetorik und Poetik auf uns gekommen ist; die fünfte die nikomachische Ethik und erst an letzter Stelle dürfte die Politik zu stellen sein, ohne dass damit ihr Werth für Geschichte, Alterthumskunde und die erste Begründung einer wissenschaftlichen Lehre über den Staat bestritten werden soll.
Berlin, im April 1880.
v. Kirchmann.
Erstes Buch.
Kapitel Eins
Da jeder Staat sich als eine Gemeinschaft darstellt, und jede Gemeinschaft wegen eines Gutes sich gebildet hat, (denn Alle handeln in Allem nur wegen Etwas, was sie für ein Gut halten) so erhellt, dass alle Gemeinschaften nach einem Gute streben und dass insbesondere die vornehmste und über allen anderen stehende Gemeinschaft nach dem vornehmsten Gute strebt; dies ist aber die Gemeinschaft, welche man den Staat und die staatliche Gemeinschaft nennt. Die, welche meinen, dass das Wesen des Verfassungsstaates und des Königthums und der Familie und des Verhältnisses zwischen Herrn und Sclaven ein und dasselbe sei, haben unrecht; sie glauben, dass hier nur ein Unterschied nach der grösseren oder geringeren Zahl der Personen bestehe, und kein Unterschied in der Art; wer also nur über Wenige gebiete, sei ein Herr über Sclaven, wer über Mehrere, sei ein Familienvater und wenn er über noch Mehrere gebiete, so sei ein Verfassungsstaat oder eine Königliche Gemeinschaft vorhanden, so, dass mithin ein grosses Hauswesen von einem kleinen Staatswesen nicht verschieden sei. Der Verfassungsstaat und das Königthum sollen sich danach nur so unterscheiden, dass, wenn Einer allein an der Spitze steht, es ein Königthum sei, wenn aber das Staatsoberhaupt nach den Grundsätzen der Staatswissenschaft theilweise herrsche, theilweise beherrscht werde, so sei ein Verfassungsstaat vorhanden.
Dies ist indess unrichtig, wie sich ergeben wird, wenn wir in der bisher geführten Weise die Untersuchung anstellen. Wie nämlich schon in anderen Gebieten das Zusammengesetzte bis zu dem Einfachen hin getrennt werden muss (was die kleinsten Theile des Ganzen sind), so muss man auch bei dem Staate untersuchen, woraus er besteht und man wird dann an seinen Bestandtheilen besser ersehen, wie sie sich von einander unterscheiden und ob es angeht, über jede der genannten Gemeinschaften Etwas wissenschaftlich festzustellen.
Kapitel Zwei
Wenn man also betrachtet, wie diese Gemeinschaften von Anfang ab geworden sind, so wird man hier ebenso, wie bei anderen Dingen, die richtigste Einsicht erlangen. Nothwendig müssen sich zunächst diejenigen zu Paaren zusammenthun, welche ohne einander nicht bestehen können; also ein Weibliches und ein Männliches der Fortpflanzung wegen. (Dies geschieht nicht aus Willkür, sondern, wie bei den Pflanzen und den übrigen Geschöpfen aus einem Naturtriebe, um ein solches Geschöpf, wie sie selbst sind, zurückzulassen.) Auch muss das von Natur Herrschende sich mit dem von Natur Beherrschten des Schutzes wegen verbinden; denn was vermöge seiner Einsicht das Kommende voraussehen kann, ist von Natur das Herrschende und Gebietende und was vermöge seines Körpers hierbei Etwas leisten kann, ist von Natur das Beherrschte und der Knecht; deshalb ist dasselbe Verhältniss für den Herrn und für den Sclaven nützlich.
Das Weibliche und das Sclavische ist nun von Natur geschieden; denn die Natur vollbringt Nichts in so dürftiger Weise, wie die Erzschmiede das Delphische Messer, sondern sie setzt für jeden Zweck ein Besonderes; denn jedes Werkzeug dürfte dann sein Werk am besten vollbringen, wenn es nicht zu vielen, sondern nur zu einem Werke dient. Bei den rohen Völkern hat das Weibliche dieselbe Stellung, wie der Sclave; die Ursache ist, dass diese Völker kein von Natur Herrschendes haben, sondern bei ihnen nur Sclavinnen mit Sclaven sich verbinden. Deshalb sagen die Dichter:
»Es ist billig, dass die Griechen über die Barbaren herrschen.«,
indem das Barbarische und das Sclavische dasselbe ist.
Aus diesen beiden Gemeinschaften entsteht zuerst die häusliche Familie und Hesiod sagt mit Recht in seinem Gedicht:
»Zuerst ein Haus und ein Weib und einen pflügenden Stier dann«;
Denn der Stier vertritt bei dem Armen den Sclaven. Die häusliche Familie ist sonach die, für das ganze tägliche Leben der Natur gemäss errichtete Gemeinschaft; Charondas nennt die ihr Zugehörigen Brotkorbgenossen und der Kreter Epimenides Troggenossen.
Die Gemeinschaft, welche sich zunächst des dauernden Nutzens wegen aus mehreren Hausgenossenschaften bildet, ist das Dorf. Das Dorf scheint hauptsächlich sich aus einer natürlichen Ansiedlung der Familie gebildet zu haben, und manche nennen die Mitglieder desselben Milchbrüder und Kindeskinder. Deshalb wurden die Städte mit ihren Landschaften anfänglich von Königen beherrscht, wie jetzt noch die fremden Völker; denn sie bildeten sich aus solchen, die nach Art des Königthums beherrscht worden waren, da jedes Hauswesen von dem Aeltesten in königlicher Weise beherrscht wird und eben so auch die ausgesandten Colonien, wegen der Stammesverwandtschaft. – In diesem Sinne sagt Homer von den Kyklopen:
»Ein jeder giebt das Gesetz für seine Kinder und Weiber.«
Denn diese wohnten zerstreut, wie dies überhaupt in alter Zeit statt fand. Auch die Götter sollen deshalb nach Aller Meinung unter königlicher Herrschaft stehen, da dies bei den Menschen theils noch gegenwärtig, theils in alter Zeit der Fall gewesen ist; denn so wie die Menschen die Gestalten der Götter sich selbst ähnlich machen, so thun sie es auch mit deren Lebensweise.
Die aus mehreren Dörfern sich schliesslich bildende Gemeinschaft ist der Staat, welcher so zu sagen das Ziel des vollständigen sich selbst Genügens erreicht hat. Er ist um des Lebens willen entstanden und bleibt um des guten Lebens willen bestehen. Deshalb ist jeder Staat ebenso, wie die früheren Gemeinschaften, natürlichen Ursprungs; denn der Staat ist das Ziel dieser Gemeinschaften und die Natur ist im Ziele enthalten; denn von jedem Dinge sagt man, wenn sein Werden vollendet ist, dass dies dann seine Natur sei, wie z. B. vom Menschen, vom Pferde, vom Hause. Auch ist der Zweck und das Ziel das Beste und das sich selbst Genügen ist das Ziel und das Beste.
Hieraus erhellt, dass der Staat natürlichen Ursprungs ist und dass der Mensch seiner Natur nach ein staatliches Wesen ist und dass ein von Natur, und nicht blos zufällig, ausserhalb des Staates stehendes Wesen entweder schlecht ist, oder übermenschlich, wie auch Homer einen solchen schimpflich als »fremden Stammes« und als einen »Recht- und Herdlosen« bezeichnet. Ein solcher verlangt auch von Natur nach dem Kriege, weil er ausserhalb aller Verbindung lebt, wie es bei den Vögeln vorkommt. Deshalb ist offenbar der Mensch ein staatliches Wesen und zwar mehr, als die Bienen und die in Herden lebenden Thiere. Denn die Natur macht, wie man sagt, nichts umsonst und der Mensch allein von allen lebendigen Geschöpfen besitzt die Sprache. Die Stimme ist nur ein Zeichen der schmerzlichen und der angenehmen Gefühle; deshalb haben auch die Thiere eine solche; denn die Natur ging bei ihnen so weit, dass sie Schmerz und Lust empfinden und dies einander zu erkennen geben können; die Sprache soll aber das Nützliche und Schädliche, und auch das Gerechte und Ungerechte offenbaren. Den Thieren gegenüber besteht das Eigenthümliche des Menschen darin, dass er allein von allen einen Sinn für das Gute und Böse, für das Gerechte und Ungerechte und Aehnliches besitzt und so führt die Gemeinschaft der Menschen zur Familie und zum Staate.
Auch ist der Staat seiner Natur nach früher, als die Familie und als der einzelne Mensch, da nothwendig das Ganze seinen Theilen vorhergehen muss; denn, nimmt man das Ganze weg, so giebt es weder einen Fuss, noch eine Hand, ausser nur dem Namen nach, wenn man etwa eine steinerne Hand auch eine Hand nennen wollte; denn nach dem Tode ist sie nur eine derartige. Alles wird nun ein Bestimmtes durch seine Wirksamkeit und durch sein Vermögen; Dinge, welche daher nicht dieser Art sind, dürfen auch nicht als dieselben, sondern nur als gleichnamige bezeichnet werden.
Dass nun der Staat der Natur nach früher ist, als der Einzelne, ist klar; denn, wenn der Einzelne allein sich nicht genügt, so wird er sich ebenso, wie die anderen Glieder zu dem Ganzen verhalten. Wer aber keine Gemeinschaft eingehen kann, oder einer solchen, weil er sich selbst genug ist, nicht bedarf, ist kein Glied des Staates, vielmehr entweder ein wildes Thier, oder ein Gott. In allen Menschen besteht nun ein natürlicher Trieb zu einer solchen Gemeinschaft und der, welcher sie zuerst errichtet hat, ist der Urheber der grössten Güter gewesen. Denn, so wie der Mensch in seiner vollendeten Entwickelung das vortrefflichste der Geschöpfe ist, so ist er auch ausserhalb des Gesetzes und Rechtes das schlechteste von allen; denn die bewaffnete Ungerechtigkeit ist die schlimmste und der Mensch besitzt von Natur an seiner Klugheit und an seiner Geschicklichkeit Waffen, die am meisten für das Entgegengesetzte gebraucht werden können. Deshalb ist der Mensch ohne Tugend das ruchloseste und wildeste Wesen und in Geschlechtslust und Gefrässigkeit das ausgelassenste. Dagegen ist die Gerechtigkeit dem Staate zugehörig, denn die Rechtspflege ist die Ordnung der staatlichen Verbindung und sie entscheidet über das Gerechte.
Kapitel Drei
Nachdem also klar ist, aus welchen Theilen der Staat sich gebildet hat, so habe ich zunächst über die häusliche Familie zu sprechen, denn jeder Staat besteht aus solchen Familien. Die häusliche Familie hat wieder Theile, aus denen sie sich zusammensetzt. Eine solche vollständige Familie besteht aus Sclaven und Freien. Da nun jede Sache zunächst in ihren kleinsten Theilen zu untersuchen ist und die ersten und kleinsten Theile der Familie der Herr und der Sclave, der Mann und die Frau, und der Vater und die Kinder sind, so habe ich diese drei Verhältnisse zunächst zu betrachten und zu ermitteln, was sie sind und wie sie beschaffen sein sollen. Sie sind also die Verbindung zwischen Herrn und Sclaven, die Verbindung durch Heirath, (denn die Verbindung zwischen Mann und Frau hat keinen besonderen Namen) und drittens die Kinder erzeugende Verbindung; denn auch diese wird mit keinem besonderen Namen bezeichnet. Dies sollen also, wie gesagt, die drei Verbindungen sein. Es giebt nun noch einen Theil, welcher nach Einigen die Hauswirthschaft ist und nach Anderen ist sie der wichtigste Theil derselben und es ist zu untersuchen, wie sich dies verhält; ich meine die sogenannte häusliche Erwerbsthätigkeit.
Zunächst will ich jedoch über den Herrn und Sclaven sprechen, um das kennen zu lernen, was zu dem nothwendigsten Bedarf gehört, und ob in Bezug auf die Erkenntniss dieses Verhältnisses vielleicht etwas Besseres, als die bisherigen Annahmen, zu erreichen ist. Manche halten die Herrschaft über den Sclaven für eine Art Wissenschaft und es soll, wie ich im Eingange gesagt, die Herrschaft in der Familie und über den Sclaven und die Herrschaft im Verfassungsstaate und im Königreiche ein und dieselbe sein; Andere halten dagegen die Herrschaft über den Sclaven für unnatürlich, und es soll nach ihnen nur vermöge des Gesetzes Sclaven und Freie geben, während die Menschen von Natur nicht verschieden seien und deshalb sei diese Herrschaft auch keine gerechte, sondern eine gewaltsame.
Kapitel Vier
Da nun das Vermögen einen Theil der häuslichen Familie und die Erwerbsthätigkeit einen Theil der hauswirthschaftlichen Thätigkeit bildet (denn ohne das Nothwendige kann man weder leben, noch gut leben), so wird ebenso, wie bei den besonderen Gewerben eigne Werkzeuge vorhanden sein müssen, wenn sie ihre Arbeiten fertigen wollen, dasselbe auch für die Hauswirthschaft gelten. Von diesen Werkzeugen sind nun welche leblos, andere lebendig; so ist für den Steuermann das Steuerruder das leblose und der Untersteuermann am Vordertheil des Schiffes das lebendige Werkzeug; denn der Gehülfe ist in den Gewerben eine Art von Werkzeug. So ist also das einzelne Besitzstück ein Werkzeug zum Leben und das Vermögen eine Menge von Werkzeugen und der Sclave ein lebendiges Besitzstück und jeder Diener ein Werkzeug statt vieler. Denn wenn es möglich wäre, dass jedes Werkzeug auf Geheiss oder vorbewusst sein Werk vollbringen könnte, wie angeblich die Statuen des Dädalos oder die Dreifüsse des Hephästos, von denen der Dichter sagt, dass sie von selbst sich in die Versammlung der Götter begeben hätten und wenn so auch das Weberschiff von selbst webte und die Zither von selbst spielte, so bedürften weder die Künstler der Gehülfen, noch die Herren der Sclaven.
Die hier genannten Werkzeuge sind nun verfertigende Werkzeuge; das Verfertigte dient aber dem Gebrauche. So wird von dem Webestuhl neben dem Gebrauche desselben noch etwas Besonderes; dagegen besteht bei dem Kleide und dem Bette nur ein Gebrauch derselben. Da ferner das Verfertigen sich der Art nach von dem Handeln unterscheidet und da beide der Werkzeuge bedürfen, so müssen auch diese sich darnach unterscheiden. Nun ist das Leben ein Handeln und kein Verfertigen und deshalb ist der Sclave ein Diener bei dem, was zum Handeln gehört. Von dem Besitzstücke gilt nun dasselbe, wie von dem Theile; denn der Theil ist nicht blos Theil eines anderen, sondern durchaus dem anderen angehörend. Ebenso ist es mit dem Sclaven, und deshalb ist der Herr nur Herr des Sclaven, aber gehört ihm nicht; der Sclave ist aber nicht blos Sclave des Herrn, sondern durchaus ihm angehörig. Hieraus erhellt, was die Natur und das Wesen des Sclaven ist; denn das, was von Natur nicht sich, sondern einem anderen zugehört, aber ein Mensch ist, das ist von Natur ein Sclave. Ein Mensch gehört aber einem anderen, wenn er als Mensch ein Besitzstück ist und ein solches ist auch ein für sich bestehendes Werkzeug für das Handeln.
Kapitel Fünf
Ob nun aber Jemand von Natur ein solcher ist, oder nicht, und ob es gut und gerecht ist, Jemandes Sclave zu sein, oder nicht, vielmehr alle Sclaverei gegen die Natur geht, soll in Folgendem untersucht werden. Es ist nun nicht schwer, dies sowohl aus dem Begriffe zu entnehmen, wie aus der Erfahrung zu ersehen. Denn das Herrschen und Berherrscht-Werden gehört nicht nur zum Nothwendigen, sondern auch zum Nützlichen, und gleich bei der Geburt ist manches zum beherrscht werden und anderes zum herrschen eingerichtet worden. Auch giebt es viele Arten von Herrschern und Beherrschten und immer ist die Herrschaft besser, wo die Beherrschten besser sind, z. B. die über Menschen, im Vergleich zu der über Thiere; denn das von den Besseren gefertigte Werk ist auch das bessere und wo der eine Theil herrscht, der andere beherrscht wird, da kommt ein Werk derselben zu Stande. Ueberall, wo aus Mehrerem, sei es zusammenhängend, oder getrennt, ein Gemeinsames sich zusammensetzt und entsteht, da zeigt sich auch ein Herrschendes und ein Beherrschtes. Dies findet sich in Gemässheit der ganzen Natur auch bei den lebendigen Wesen; ja selbst bei den leblosen Dingen besteht eine Art Herrschaft nach Art einer Uebereinstimmung. Indess ist dies mehr Gegenstand einer nicht hierher gehörenden Untersuchung; aber bei den lebendigen Geschöpfen findet es sich zuerst, dass sie aus einer Seele und einem Leibe bestehen, von welchen, deren Natur nach, das eine herrscht, und das andere beherrscht wird. Man muss indess das Natürliche mehr bei den in gutem Zustand Befindlichen, als bei den Verdorbenen erforschen, und deshalb muss man auch bei den Menschen denjenigen in Betracht nehmen, welcher an Leib und Seele am besten beschaffen ist, wo das Natürliche deutlich erkennbar ist; denn bei den schlechten oder in schlechten Zuständen sich befindenden Menschen dürfte oft der Körper über die Seele herrschen, weil sie sich in einem schlechten und unnatürlichen Zustande befinden. Es besteht also, wie gesagt, an den lebenden Geschöpfen sowohl eine Herrengewalt, wie eine staatliche Gewalt; die Seele herrscht nämlich über den Körper in der Art eines Herrn; die Vernunft aber über die Begierden in der Art des Herrschers in einem Verfassungsstaate oder in der Art eines Königs, und es zeigt sich, dass die Herrschaft der Seele über den Körper naturgemäss und nützlich ist und ebenso die Herrschaft über den begehrenden Theil der Seele von Seiten der Vernunft und des denkenden Theiles der Seele, während eine Gleichstellung oder umgekehrte Stellung derselben allen Theilen schädlich sein würde. Ebenso verhält es sich mit den Menschen und den Thieren. Die zahmen sind von Natur besser, als die wilden und für alle ist es am besten, wenn der Mensch die Herrschaft über sie hat; so bleiben sie bewahrt und erhalten.
Auch das Männliche verhält sich zu dem Weiblichen von Natur, wie das Bessere zu dem Geringeren und wie das Herrschende zu dem Beherrschten und dasselbe Verhältniss muss auch für alle Menschen gelten. Wenn bei denselben einzelne so weit von einander abstehen, wie die Seele von dem Körper und wie der Mensch von dem wilden Thiere (in dieser Weise verhalten sich nämlich die, deren Werk nur in einer körperlichen Leistung besteht und wo solche Leistung das Beste an ihnen ist), so sind diese von Natur Sclaven, für die es das Beste ist, wenn sie, wie die vorher genannten Geschöpfe, in dieser Weise beherrscht werden. Denn derjenige ist von Natur ein Sclave, welcher einem Anderen gehören kann (und deshalb auch einem Anderen gehört) und welcher an der Vernunft nur so weit Antheil hat, dass er ihre Stimme vernehmen kann, ohne die Vernunft selbst zu haben; denn die Thiere vernehmen nicht einmal diese Stimme, sondern dienen ihren Begierden. Auch der Gebrauch, der von beiden gemacht wird, ist nur wenig verschieden, denn die nothwendigen Dienste für den Körper werden von beiden geleistet, sowohl von den Sclaven, wie von den zahmen Thieren. Die Natur strebt auch den Körper der Freien von dem der Sclaven verschieden zu machen; die letzteren sollen einen starken Körper für die Beschaffung des Nothwendigen haben, und die Körper der Freien sollen aufgerichtet und zu solcher Arbeit nicht geschickt, dagegen für das öffentliche Leben geeignet sein; (und auch dies theilt sich wieder je nach dem Bedarf für den Krieg, oder für die friedlichen Zustände); indess kommt auch oft das Gegentheil vor; Manche haben nur den Körper eines Freien und Andere nur die Seele eines solchen. Nun ist so viel klar, dass, wenn der Unterschied unter den Menschen in Bezug auf ihren Körper nur so gross wäre, wie er den Bildsäulen der Götter gegenüber vorhanden ist, Alle dann sagen würden, dass die geringeren werth wären, jenen als Sclaven zu dienen. Ist dies nun schon in Bezug auf den Körper richtig, so ist es noch viel gerechter, wenn man solche Unterschiede auch bei der Seele macht; indess kann man die Schönheit der Seele nicht so leicht erkennen, wie die des Körpers. Somit ist also klar, dass von Natur die Menschen theils Freie, theils Sclaven sind, für welche letztere das Sclavensein nützlich und auch gerecht ist.
Kapitel Sechs
Indess ist leicht einzusehen, dass auch die, welche das Gegentheil annehmen, in einer gewissen Weise Recht haben; denn die Worte Sclaverei und Sclave werden in zwiefachem Sinne gebraucht. Es giebt nämlich auch Sclaven und eine Sclaverei vermöge des Gesetzes; dies Gesetz ist jene Art von Uebereinkunft, wonach das im Kriege Erorberte den Siegern zufällt. Dieses Recht klagen nun viele der Gesetzkundigen, gleichsam wie einen Redner, welcher unzulässige Gesetzesvorschläge eingebracht hat, der Gesetzesverletzung an, weil es empörend sei, dass Jemand Sclave dessen werden solle, weil dieser von grösserer Kraft sei und ihn zu bewältigen vermocht habe, so, dass der Bewältigte nun der Beherrschte sein solle. Selbst unter weisen Männern ist ein Theil dieser Ansicht und ein anderer Theil jener Ansicht. Die Ursache dieses Streites, vermöge deren Gründe für beide Ansichten ausgetauscht werden können, liegt darin, dass die Tugend, wenn sie mit den nöthigen Mitteln ausgestattet ist, auch am meisten bewältigen kann und dass das Mächtigere immer auf einem hervorragenden Guten beruht, so, dass die Gewalt nie ohne Tugend zu sein scheint, und man also nur noch über das Gerechte sich streitet. Hier gilt nun Manchem die wohlwollende Gesinnung für das Gerechte, während Andere gerade für gerecht erklären, dass der Stärkere herrsche. Was ausser diesen Gründen sonst noch von den Streitenden dafür vorgebracht wird, dass das an Tugend Vorzüglichere nicht herrschen und nicht Herr sein solle, hat weder Beweiskraft, noch ist es leicht zu verstehen. Dagegen treten Andere dem überhaupt entgegen, indem sie hier ein besonderes Gerechte annehmen, (denn das Gesetz sei ein solches) und demnach die Sclaverei in Folge des Krieges für gerecht erklären; indess behaupten sie gleichzeitig auch das Gegentheil; denn es ist ja möglich, dass der Krieg nicht gerecht begonnen wird, und dann wird Niemand behaupten, dass derjenige Sclave sein solle, der es nicht verdient, da es ja sonst sich treffen könnte, dass Männer von der edelsten Abkunft Sclaven würden und von Sclaven abstammten, wenn sie zufällig gefangen und dann verkauft würden. Deshalb wollen auch die Vertheidiger dieser Ansicht dies nicht von den Griechen, sondern nur von den Barbaren gelten lassen. Allein, wenn sie so sprechen, so gelangen sie ebenfalls auf Sclaven, die es von Natur sind, wie ich im Anfang gesagt habe. Dann müssen sie nothwendig zugestehen, dass Manche überall Sclaven sind und Andere nirgends. Ebenso verhält es sich mit der edlen Abkunft; sich selbst halten sie nicht blos in ihrer Heimath, sondern überall für edelgeboren; die Barbaren aber nur in deren Lande, so, dass also der Eine allgemein von edler Abkunft und ein Freier ist, der Andere aber nicht allgemein, wie die Helena bei Theodektas sagt:
»Aus göttlichem Stamme von beiden Eltern entsprossen
Wer wollte es wagen, mich eine Sclavin zu nennen?«
Wenn also Jene dies sagen, so unterscheiden sie damit den Sclaven von dem Freien und den edel Geborenen von dem niedriger Abkunft durch nichts Anderes, als durch die Tugend und die Schlechtigkeit; sie behaupten, dass wie von dem Menschen ein Mensch und von dem Thiere ein Thier entsteht, so auch ein Guter von dem Guten werde. Indess will zwar die Natur dies zu Stande bringen, aber vermag es oft nicht.
Es erhellt also, dass diese gegentheiligen Ansichten eine gewisse Berechtigung haben und dass Manche von Natur Sclaven, Andere von Natur Freie sind und auch nicht sind und dass bei dem Einzelnen dies sich danach bestimmt, ob ihm die Sclaverei, oder die Herrschaft zuträglich ist und dass es auch gerecht ist und sich gehört, dass der Eine beherrscht werde, der Andere herrsche und zwar in der von der Natur bestimmten Weise, so, dass er also auch die Herrschaft über Sclaven üben kann. Wird aber die Herrschaft schlecht geführt, so gereicht es beiden zum Nachtheile; denn ein und dasselbe nützt, wenn dem Theile, auch dem Ganzen und sowohl dem Körper, wie der Seele und der Sclave ist ein Theil des Herrn, und gleichsam ein lebendiges und von dem Körper abgetrenntes Glied desselben. Deshalb ist auch eine gegenseitige Freundschaft zwischen Sclaven und Herrn für solche nützlich, die von Natur dazu bestimmt sind, während das Entgegengesetzte für die gilt, wo das Verhältniss nicht auf dieser Weise, sondern blos auf dem Gesetze und der Gewalt beruht.
Kapitel Sieben
Hieraus ergiebt sich auch, dass die Herrschaft über Sclaven und die Herrschaft in einem Verfassungsstaate nicht ein und dasselbe sind und dass auch nicht alle Arten der Herrschaft einander gleich sind, wie Manche behaupten. Denn die eine besteht von Natur über Freie, die andere über Sclaven und die Herrschaft im Hause ist die Herrschaft eines Einzigen (denn jedes Haus wird von Einem beherrscht) und die Herrschaft im Verfassungsstaate ist eine Herrschaft über Freie und einander Gleiche. Der Herr über die Sclaven heisst nicht so wegen seiner Kenntnisse, sondern weil er der Herr ist; ebenso der Sclave und der Freie. Doch giebt es wohl auch eine Wissenschaft für Sclaven und eine für die Herren; erstere von der Art, wie Jemand bei den Syrakusen die Sclaven unterrichtete, indem er dort die jungen Sclaven gegen Lohn in den gewöhnlichen Dienstverrichtungen unterrichtete; ja es giebt hier auch wohl noch manches darüber hinaus zu lernen, z. B. die Kochkunst und andere ähnliche Arten des Dienstes; denn die Verrichtungen sind verschieden und die eine ist anständiger, als die andere, und die eine nothwendiger, als die andere; wie das Sprüchwort sagt: »Ein Sclave vor dem anderen und ein Herr vor dem anderen.« Während dies nun alles Wissenschaften für den Sclaven sind, so besteht die Wissenschaft für den Herrn in dem, wie er den Sclaven zu gebrauchen hat; denn der Herr zeigt sich nicht in dem Erwerben der Sclaven, sondern in deren Gebrauche. Solche Wissenschaft enthält indess nichts Grosses, noch Ehrwürdiges; denn was der Sclave zu verrichten verstehen muss, das muss der Herr zu befehlen verstehen. Wer also nicht selbst damit sich zu plagen braucht, der überlässt diese Ehre dem Aufseher und beschäftigt sich selbst mit den öffentlichen Angelegenheiten, oder mit den Wissenschaften. Die Wissenschaft über den Erwerb eines Sclaven ist von jenen beiden verschieden; so ist die, welche den gerechten Erwerb behandelt, eine Art Kriegs- oder Jagd- Wissenschaft. – In dieser Weise sei nun das Verhältniss zwischen Herrn und Sclaven bestimmt.