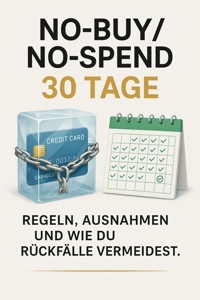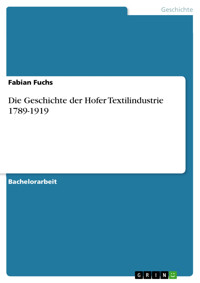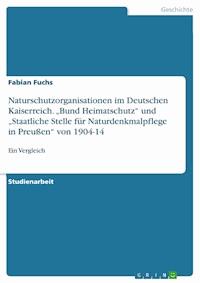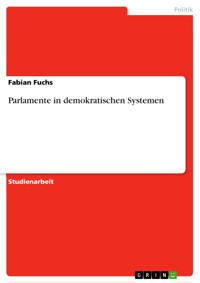15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Geschichte Europas - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,3, Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte unter Einbeziehung der Landesgeschichte), Veranstaltung: Feste in der spätmittelalterlichen Stadt, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Saubannerzug von 1477 war ein wilder, unkontrollierter Haufen, der eine Kriegskontribution aus den Burgunderkriegen von der savoyischen Stadt Genf eintreiben wollte, mit deren Zahlung diese schon lange in Rückstand war. Auch sollten die Berner Hauptleute für eine angebliche Verzögerung der Zahlung belangt werden. Außerdem forderte man von den Stadtorten einen gerechten Anteil der Burgunderkriegsbeute. Ziel dieser Arbeit soll es sein, die politisch-sozialen Elemente und die Aspekte der Volkskultur aufzuzeigen, die sich im Saubannerzug manifestierten. Dazu gehört z.B. die agrarische Gesellschaftsstruktur, die die Landorte der inneren Schweiz (Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug) zur damaligen Zeit prägte, die Familie und die Knabenschaften, die in den dortigen Gemeinschaften eine wichtige Rolle einnahmen, und diverse Kulte, wie z.B. Vegetations- und Totenkulte sowie die sog. „Heischezüge“. Erstens wird der gegenwärtige Forschungsstand dargestellt und auf die verwendeten Quellen, vor allem die Berner Chronik des Diebold Schilling, die wichtigste Quelle für den Saubannerzug, eingegangen und sie kritisch betrachtet. Dann folgt das Kapitel über den Saubannerzug von 1477. Zuerst wird die Entstehungsgeschichte beleuchtet: der Aufstieg des Hauses Burgund und die Burgunderkriege (1474-77), wobei der Kriegszug der Eidgenossen gegen Savoyen von 1475, der Hauptgrund für den Saubannerzug, besonders hervorgehoben wird. Infolgedessen wird der Saubannerzug selbst beschrieben: sein Zusammenfinden, die Teilnehmer, der Zug und das Resultat. Der dritte Punkt handelt von den kurz- und langfristigen Folgen des Zuges bis zum Stanser Verkommnis von 1481. Der dritte Teil behandelt schließlich die politisch-sozialen und volkskulturellen Aspekte des Saubannerzuges. Erstere Sachverhalte drehen sich vor allem um die gesellschaftliche Struktur der agrarisch geprägten Landorte der Innerschweiz (der Heimat der Saubannerzügler) im Vergleich zu den Stadtorten. Weiterhin werden verwandtschaftliche Aspekte wie Sippe und Familie, rechtliche Elemente (Volksjustiz) und der Status und die Rolle der sog. „Knabenschaften“ betrachtet. Die Merkmale der Volkskultur beleuchtet in den Knabenschaften verankerte Glaubensvorstellungen, etwa Vegetationskulte, „Heischezüge“, Toten- und Maskenkulte sowie die Fastnacht als Teil der „Verkehrten Welt“. Aufgrund der engen Verquickung von sozialen und volkskulturellen Elementen wird man die beiden Aspekte nicht immer völlig scharf voneinander trennen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Page 1
Otto-Friedrich-Universität Bamberg Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie Lehrstuhl für Historische Grundwissenschaften HS: Feste in der spätmittelalterlichen Stadt
WS 2011/12
Politisch-soziale und volkskulturelle
Aspekte des Saubannerzugs von 1477
Fabian Fuchs
MA-Studiengang Geschichte 1. Fachsemester
Page 3
1. Einleitung
„NächtlicherSaubannerzug verwüstet Gebenstorf“1, „Saubannerzugvon Schmerikon nach Eschenbach“2, diese Zeitungsmeldungen von 2011 und 2012 zeigen, wie sehr der Begriff des „Saubannerzugs“ noch im gegenwärtigen Sprachgebrauch und damit im Bewusstsein der Schweiz vorhanden ist. In den beiden erwähnten Fällen begingen Unbekannte mehrere Sachbeschädigungen, wie z.B. Demolierung von Verkehrsschildern, Verunstaltung von Kunstwerken und Zerstörung von Straßenlaternen.3
Auch die Teilnehmer des Saubannerzugs4von 1477 waren ein wilder, unkontrollierter Haufen, der eine Kriegskontribution aus den Burgunderkriegen von der savoyischen Stadt Genf eintreiben wollte, mit deren Zahlung diese schon lange in Rückstand war. Da das Gerücht umging, dass Berner Hauptmänner durch Erhalt von Bestechungsgeldern die Zahlung der Restkontribution verzögert haben sollen, wollte man diese auch zur Rechenschaft ziehen. Zudem hatte man von den Stadtorten (Bern, Luzern, Zürich, Basel) der Eidgenossenschaft einen zu kleinen Teil an der Beute aus den Schlachten der Burgunderkriege erhalten, das dritte Ziel war also die Einforderung eines höheren Beuteanteils. Ziel dieser Arbeit soll es sein, die politisch-sozialen Elemente und die Aspekte der Volkskultur aufzuzeigen, die sich im Saubannerzug manifestierten. Dazu gehört z.B. die
1http://www.aargauerzeitung.ch/aargau/baden/naechtlicher-saubannerzug-verwuestet-gebenstorf-111612466(Stand: 11.2.2012, 14:18 h).
2http://www.suedostschweiz.ch/vermischtes/saubannerzug-von-schmerikon-nach-eschenbach(Stand: 11.2.12, 14:17 h).
3Ebd.
4Vgl. zur Etymologie Würgler, Kolbenbanner, S.198-202. Seiner Meinung nach verwenden alle Chronisten des Zuges den Begriff „Kolbenbanner“, nie „Saubanner“. Letzterer Ausdruck kommt erst 50 Jahre nach dem Ereignis zum ersten Mal auf, wird in der folgenden Zeit eher bagatellisierend gebraucht und setzt sich seit dem frühen 17.Jahrhundert in der Historiografie durch.
Als weiteres Argument dient, dass das Tier auf dem Banner als Eber und nicht als Sau identifiziert wird (weidmännisch wird mit „Sauen“ ein Eber bezeichnet), was ergo gegen den Begriff „Saubannerzug“ spricht. Die Sau steht symbolisch für Schmutz und Unwürde und dient als Schimpfwort und Spottsymbol, was als Aufstandssymbol sicher unpassend wäre. (Ebd., S.200). Andererseits zeigt das Banner des „Großen, Allmächtigen und Unüberwindlichen Rates von Zug“, eine Muttersau mit Frischlingen, was gegen die Deutung als Eber spricht. Allerdings ist nicht erwiesen, ob dieser Rat wirklich aus dem Saubannerzug hervorging oder ob er sich parallel und unabhängig von ihm gründete.
Der dritte Ausdruck für den Saubannerzug ist „Torechtes Leben“. Hierbei bedeutet „torecht“ nicht etwa „dumm“ oder „närrisch“, sondern eher „verrückt“ oder „irrsinnig“. „Leben“ ist ein alter schweizerischer Ausdruck für „Zunft“ oder „Vereinigung“. Würgler nennt drei Argumente gegen diese Bezeichnung: erstens würde dieser Name die politischen Intentionen des Zuges nur lächerlich machen; zweitens enthält der Name keinen Bezug zu dem Banner, und drittens meint er, das der Berner Chronist Diebold Schilling den Begriff nur verwendet, um den politischen Charakter des Zuges zu verharmlosen und zu karnevalisieren. Daher kann auch angenommen werden, dass das „Torechte Leben“ vermutlich Eigenbezeichnung der Teilnehmer des Zuges ist, wie bei Schilling steht: Schilling, Berner-Chronik, Bd.2, S.128:…so gabent si ze antwurt: es were das torechtig leben, darin si zusamen als hoch und túre gelobt und gesworn hetten…“.(Würgler, Kolbenbanner, S.201). Auf der anderen Seite steht das Argument, dass der Begriff, wenn man ihn mit „wild“ übersetzt, seinen lächerlichen Charakter verliert und besser zu den politischen Intentionen des Zuges passt. Im weiteren Verlaufe der Arbeit werde ich jedoch den geläufigeren Begriff „Saubanner“ beibehalten.