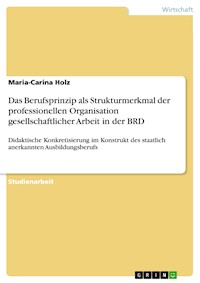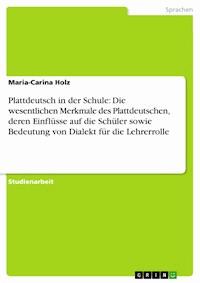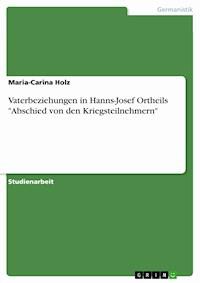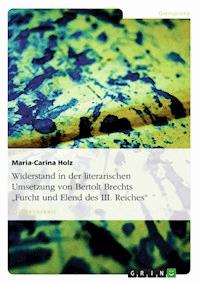36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche Literatur, Note: 1,0, Universität Konstanz, Sprache: Deutsch, Abstract: Bertolt Brecht ist neben Shakespeare bis heute einer der meist gespielten Autoren auf den Bühnen der Welt. Bekannt wurde er vor allem mit seiner Theatertheorie des epischen Theaters. Fast jedem ist der Begriff des V-Effektes geläufig. Brecht hat dazu unzählige Veröffentlichungen hervorgebracht, wobei es ihm nicht gelungen ist, den Nebel um die Begriffe Verfremdung, V-Effekt und epische Spielweise völlig zu lichten. Aber nicht nur seine Theatertheorien, sondern auch seine Dramen erregen bis heute Aufsehen in der Öffentlichkeit. Dies liegt an seiner unorthodoxen Darstellungsweise bestimmter Vorgänge auf der Bühne wie der rollende Wagen der Mutter Courage oder das „Spiel im Spiel“ in der Maßnahme. Auch die Inhalte seiner Dramen stoßen auf Widerstand. So wurde die Erschießung eines jungen Genossen durch seine Mitstreiter in dem Stück „Die Maßnahme“ aufs Heftigste diskutiert und verurteilt. Ebenso wird die Unbelehrbarkeit der Courage in „Mutter Courage und ihre Kinder“ kritisiert. Diese Beispiele zeigen, dass Brecht die Zuschauer polarisiert, was auf seine Hinwendung zum Marxismus zurückzuführen ist. Hiermit kann die unterschiedliche Interpretation seiner Werke in Ost- und Westdeutschland begründet werden. Die einen argumentieren mithilfe seiner Dramen für die Richtigkeit des Kommunismus, die anderen legen sie gegen diese aus. Dadurch ist eine umfassende und unvoreingenommene Beleuchtung seiner Stücke erst seit dem Ende des „Kalten Krieges“ möglich geworden. Weiterhin ist durch die Polarisierung, die seine Stücke hervorgerufen haben, erkennbar, dass er Themen aufgreift, die viele Bevölkerungsgruppen anspricht. Es wird klar, dass Brecht seine Dramen als politische Werke ansieht, mit denen er in der Welt etwas erreichen und verändern will. Fraglich ist, welche Ziele er sich dabei gesetzt hat. Des Weiteren ist problematisch, in welcher Art und Weise und mit welchen Inhalten er diese Absichten erzielen möchte. Die Beantwortung dieser Fragen ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Neben einer Abgrenzung des Politischen und des Dramas wird die Lehrstücktheorie und das epische Theater beleuchtet. Die Ergebnisse finden auf folgende Stücke Anwendung: „Die Maßnahme“ steht dabei als authentischstes Beispiel für Brechts Lehrstücktheorie, während „Mutter Courage und ihre Kinder“ und „Furcht und Elend des Dritten Reiches“ eher dem epischen Theater zugeordnet werden können
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1.0 Einleitung
2.0 Zum Begriff des Politischen und des Dramas
2.1 Zum Begriff des Dramas
2.2 Zum Verhältnis von Drama und Theater
2.3 Zum Begriff des Politischen
2.3.1 Das politische Theater - im engeren Sinne
2.3.2 Das politische Theater – im weiteren Sinne
2.3.3 Das politische Theater – eine dritte Definition im Hinblick auf Brechts Konzeptionen
3.0 Das politische Theater nach Bertolt Brecht
3.1 Eingreifendes Denken und politische Beeinflussung
3.2 Abriss über die Phasen der Entwicklung des epischen Theaters
3.3 Das epische Theater
3.3.1 Der Weg zum epischen Theater
3.3.2 Der Begriff „Episch“ bei Brecht
3.3.3 Verfremdung und V-Effekt
3.3.4 Das Publikum bei Brecht
3.4 Kritik am politischen Theater nach Brecht
4.0 Politische Dramen B. Brechts
4.1 Die Maßnahme
4.1.1 Die Lehrstücktheorie
4.1.2 „Die Maßnahme“ als Lehrstück
4.1.3 „Die Maßnahme“ als politisches Drama
4.1.4 Die Lehre vom Einverständnis
4.2 „Mutter Courage und ihre Kinder
4.2.1 Mutter Courage
4.2.2 Die Kinder und die Tugenden
4.2.3 Die Randfiguren
4.2.4 „Mutter Courage als episches Theater
4.2.5 Die Unbelehrbarkeit der Courage
4.3 „Furcht und Elend des Dritten Reiches“
4.3.1 Epische Elemente in „Furcht und Elend des Dritten Reiches“
4.3.2 Das Thema des Verrats
4.3.3 Die Thematik des Widerstands: Volksbefragung
4.3.4 Die Anpassung
5.0 Fazit
6.0 Bibliographie
7.0 Anhang
1.0 Einleitung
Bertolt Brecht ist neben Shakespeare bis heute einer der meist gespielten Autoren auf den Bühnen der Welt. Bekannt wurde er vor allem mit seiner Theatertheorie des epischen Theaters. Fast jedem ist der Begriff des V-Effektes geläufig. Brecht hat dazu unzählige Veröffentlichungen hervorgebracht, wobei es ihm nicht gelungen ist, den Nebel um die Begriffe Verfremdung, V-Effekt und epische Spielweise völlig zu lichten.[1] Aber nicht nur seine Theatertheorien, sondern auch seine Dramen erregen bis heute Aufsehen in der Öffentlichkeit. Dies liegt an seiner unorthodoxen Darstellungsweise bestimmter Vorgänge auf der Bühne wie der rollende Wagen der Mutter Courage oder das „Spiel im Spiel“ in der Maßnahme. Auch die Inhalte seiner Dramen stoßen auf Widerstand. So wurde die Erschießung eines jungen Genossen durch seine Mitstreiter in dem Stück „Die Maßnahme“ aufs Heftigste diskutiert und verurteilt. Ebenso wird die Unbelehrbarkeit der Courage in „Mutter Courage und ihre Kinder“ kritisiert. Diese Beispiele zeigen, dass Brecht die Zuschauer polarisiert, was auf seine Hinwendung zum Marxismus zurückzuführen ist. Hiermit kann die unterschiedliche Interpretation seiner Werke in Ost- und Westdeutschland begründet werden.[2] Die einen argumentieren mithilfe seiner Dramen für die Richtigkeit des Kommunismus, die anderen legen sie gegen diese aus. Dadurch ist eine umfassende und unvoreingenommene Beleuchtung seiner Stücke erst seit dem Ende des „Kalten Krieges“ möglich geworden. Weiterhin ist durch die Polarisierung, die seine Stücke hervorgerufen haben, erkennbar, dass er Themen aufgreift, die viele Bevölkerungsgruppen anspricht. Dies hängt mit Brechts Einstellung zur Kunst zusammen:
Kunst ist in jedem Detail – bei der Darstellung der Liebe ebenso wie bei der des unmittelbaren Kampfes – politische Arbeit, wie anders soll sie uns – die wir nur durch den politischen Kampf existieren können – nützlich sein? Kunst, die keinen Nutzen bringt […] in dem großen Bemühen, die Welt endlich bewohnbar zu machen […], ist keine Kunst.[3] [Hervorhebungen durch die Autorin]
Es wird klar, dass Brecht seine Dramen als politische Werke ansieht, mit denen er in der Welt etwas erreichen und verändern will. Fraglich ist, welche Ziele er sich dabei gesetzt hat. Des Weiteren ist problematisch, in welcher Art und Weise und mit welchen Inhalten er diese Absichten erzielen möchte. Die Beantwortung dieser Fragen ist Gegenstand der vorliegenden Arbeit.
Dafür wird in Kapitel 2.0 eine Bestimmung der Begriffe „Politisch“ und „Drama“ im Hinblick auf Brechts Verständnis dieser Bezeichnungen vorgenommen. Dadurch wird klar, wie das Politische und das Drama in dieser Arbeit Verwendung finden. Mithilfe der Beleuchtung dieser Abgrenzungen ist es möglich, eine Definition von politischem Theater im Allgemeinen und im Hinblick auf Brecht zu geben. Dies erleichtert das Verständnis der Dramentheorie des epischen Theaters, welches Brechts politisches Theater ist. Dies wird in Kapitel 3.0 erläutert. Zusätzlich wird eine Bestimmung seiner Lehrstücktheorie, die den Weg zum epischen Theater bildet, vorgestellt. Mit seinen speziellen Theaterformen unterstützt er die Vermittlung der politischen Inhalte in seinen Dramen. Die erarbeiteten Ergebnisse werden daraufhin in Kapitel 4.0 auf verschiedene Dramen angewandt. „Die Maßnahme“ steht dabei als authentischstes Beispiel für Brechts Lehrstücktheorie, während „Mutter Courage und ihre Kinder“ und „Furcht und Elend des Dritten Reiches“[4] eher dem epischen Theater zugeordnet werden können. Zusätzlich wird jedes der drei Dramen auf seine politischen Aussagen hin überprüft. Daneben folgen eine Erläuterung der angesprochenen politischen Themen sowie deren Darstellungsweise. Anschließend werden Brechts Stücke auf ihre Aktualität hin beleuchtet und in Vergleich gesetzt.
2.0 Zum Begriff des Politischen und des Dramas
Um den Blick auf die Dramen Bertolt Brechts richten zu können, die in dieser Arbeit diskutiert werden sollen, ist es vonnöten zunächst die Schlüsselbegriffe des gestellten Themas, den Terminus des Politischen und den des Dramas, zu erarbeiten. Diese werden bereits im Hinblick auf Brechts Theorie des epischen Theaters untersucht. Dadurch wird deutlich gemacht, wie die Begriffe Politisch und Drama in der vorliegenden Arbeit zu verstehen sind und wie sie hier Verwendung finden.
2.1 Zum Begriff des Dramas
Die Ursprünge des Dramas liegen im fünften Jahrhundert v. Chr. in der griechischen Antike.[5] Das Hauptkennzeichen der genannten Theaterform wird nach Aristoteles, der eine eigene Dramentheorie die „Poetik“ aufstellte, hauptsächlich durch die Darstellung der Handlung mit Dialogen gekennzeichnet. Er teilte das Drama in zwei wesentliche Gattungen: die Tragödie und die Komödie. Bei Ersterer wird häufig das Scheitern eines Helden dargestellt, wogegen in der Komödie ein innerer Konflikt oder eine äußere Verwicklung humorvoll gelöst wird. Diese Formen entwickelten sich im weiteren Verlauf der Jahrhunderte zu der Tragikomödie, zum Schauspiel und zum Lustspiel.
Nach den Bemühungen Aristoteles versuchten verschiedene Wissenschaftler wie F. Hédelin d’Aubignac mit seiner Literatur „La pratique du thèâtre“, N. Boileau-Despréaux mit „L’art poètique“ oder G. E. Lessing mit seiner „Hamburgischen Dramaturgie“ ein Regelwerk für das Drama und seine verschiedenen Formen zu entwickeln. Dieses untersteht jedoch einem stetigen Wandel, sodass sich neuere Formen wie das „Theater des Absurden“ herausbildeten, die nicht den jeweiligen Regelwerken der oben genannten Wissenschaftler entsprechen.[6] Daher existieren zum Terminus Drama viele verschiedene Definitionsversuche, die den Begriff dennoch in seiner Gesamtheit nicht umfassen.
Hier werden im Folgenden verschiedene Abgrenzungsversuche vorgestellt, um eine Sammlung geeigneter Kriterien zu erstellen, die die Verwendung des Dramenbegriffs in dieser Arbeit charakterisieren. Nach Robert Petsch bezeichnet Drama
die durch Rede und Spiel auf der Bühne unmittelbar vergegenwärtigte und zur stärksten Teilnahme (ja zum Personenaustausch zwischen den Zuschauern und den Figuren) herausfordernde Darstellung eines bewegten, unter dauernden Umschlägen zu einem bedeutenden Ziele aufsteigenden Vorganges.[7]
In dieser Definition werden zum einen die unvermittelte Präsentation und die Plurimedialität des dramatischen Textes als Kriterien für das Drama herausgestellt, zum anderen wird der Dramenbegriff durch die zusätzlichen Bestimmungen auf bestimmte historische Texte reduziert. Der Forderung nach einer identifikatorischen Wirkung des Dramas steht beispielsweise die Dramentheorie Bertolt Brechts mit seinem epischen Theater völlig entgegen[8], sodass Stücke Brechts nicht unter dieser Definition von Drama subsumiert werden können. Weiterhin ist es Theaterstücken mit einer anti-idealistischen Ideologie oder trivialen Stücken nicht möglich, das Prädikat des Dramas zu erhalten, weil diese nicht zur Bildung bestimmter Wertnormen, also ,,zu einem bedeutenden Ziele aufsteigenden Vorganges“,[9] aufrufen. Damit handelt es sich nachweislich um eine normativ wertende Gattungsbezeichnung und ist als Dramenbegriff für diese Arbeit nicht geeignet.
Die Große Sowjet-Enzyklopädie nennt einen anderen Definitionsversuch. Diese beschreibt das Drama als eine „Literaturgattung, die für die Bühne bestimmt ist und in unmittelbare Handlung, im Konflikt zwischen Charakteren, den Kampf entgegengesetzter gesellschaftlicher Kräfte ausdrückt“.[10] Dieser Dramenbegriff füllt das Kriterium des Konflikts mit gesellschaftlichen Inhalten, aufgrund derer wiederum eine normativ wertende Forderung ausgelöst wird. Demnach dürften nur Stücke als Drama bezeichnet werden, die eine direkte Konfliktstruktur aufweisen oder inhaltlich unmittelbar auf die realen gesellschaftlichen Verhältnisse verweisen. Nach dieser Definition könnte ein großer Teil der dramatischen Weltliteratur nicht mehr als Dramen betitelt werden.[11] Weiterhin tritt in dieser Terminusabgrenzung das Drama als plurimedialer Text in den Hintergrund, wobei die rein schriftliche Fixierung in den Vordergrund gerückt wird. Hierdurch wird die Zielrichtung des Dramas, nämlich die Aufführung auf dem Theater und dessen besondere Kommunikationssituation, ausgeklammert.
Anhand der beiden Definitionsversuche wird deutlich, dass es schwierig ist, eine einheitliche Abgrenzung des Terminus Drama zu finden. In dieser Arbeit wird daher ein eigenes Verständnis des Begriffs benutzt, der sich an die beiden erläuterten Definitionen anlehnt. Drama wird demzufolge als eine literarische Form verstanden, deren Hauptmerkmal der Dialog zwischen verschiedenen Figuren ist, wobei aber auch Monologe, Chöre, lyrische Einlagen oder epische Einschübe vorhanden sein können, die die jeweilige Dramenform unterschiedlich stark bestimmen.[12] Darüber hinaus besteht der Sinn und Zweck des Dramas darin, eine szenische Realisierung im Theater zu erfahren. Das Theater, als Ort an dem Dramen aufgeführt werden, beinhaltet eine besondere Kommunikationssituation für die Zuschauer, womit die Plurimedialität des dramatischen Textes herausgestellt wird.[13] Folglich sind der Text und die einzelnen Aufführungen voneinander zu unterscheiden, da Dramenaufführungen oft unbewusste oder bewusst gewollte Rückkoppelungseffekte beim Publikum auslösen können. Dies wird durch die dargestellte Gestik und Mimik der Schauspieler auf der Bühne und das Bühnenbild erreicht. Demnach ist der Dramenbegriff dieser Arbeit von dem des Lesedramas zu differenzieren, welches sich nur an den Leser als Adressaten und nicht an ein Publikum wendet. Infolgedessen schließt das Drama auch immer das Theater mit seiner besonderen Kommunikationssituation mit ein und kann somit als Theater mit Textgrundlage gesehen werden.[14] Dieses Verhältnis von Drama und Theater benötigt eine genauere Betrachtung, die in Punkt 2.2 näher erläutert wird.
2.2 Zum Verhältnis von Drama und Theater
Zwischen dem schriftlich fixierten Text eines Dramas und den jeweiligen Aufführungen besteht eine Trennlinie. So bietet die jeweils vorliegende Fassung mit seinen Haupt[15]- und Nebentexten[16] dem Regisseur und allen an der Produktion einer Aufführung beteiligten genügend Freiräume für eigene Interpretationen. Dieser Umstand führt zu unterschiedlichen Inszenierungen, welche wiederum verschieden auf die Zuschauer einwirken. Die Unterscheidung von Drama und Theater spiegelt sich auch in der Forschung wider. Um Erstere kümmert sich die Literaturwissenschaft, indem sie sich speziell auf den vor ihr liegenden Text bezieht und somit das reale Wirkungsfeld, das Theater, ausklammert. Dieses überlässt sie der Theaterwissenschaft, die einzig das theatrale Ereignis in ihren Blickpunkt zieht. Beide Ansätze für sich genommen greifen an sich zu kurz. So sind zweifellos Epochen vorhanden, in denen ein neuartig formuliertes Drama eine Neuorientierung des Theaters nach sich zieht. Ein Beispiel liefert das bürgerliche Trauerspiel im 18. Jahrhundert, dem eine neue Darbietungsform folgte, die sich von dem höfisch-klassizistischen Theater abgrenzte, bei dem der Fürst auf der Vorderbühne platziert wurde. Dies führte beim bürgerlichen Trauerspiel zu einer örtlichen Trennung von Zuschauer und Bühne. Hieran wird die Notwendigkeit des Dramas als Textgrundlage für das Theater deutlich, das neue Theaterformen nach sich ziehen kann. Dennoch lassen sich auch Gegenbeispiele finden, die trotzdem eine Verbindung von Drama und Theater unterstreichen. Dies sind beispielsweise die Experimente von Erwin Piscator in Richtung eines politischen Theaters in der Weimarer Republik, der, aufgrund eines Mangels an fortschrittlicher Dramatik, den technischen Apparat einer Bühnenvorstellung um Filmeinspielungen oder Bildprojektionen erweiterte. Pisators Neuerungen des Theaters finden ihren Ursprung in einem Mangel an geeigneten Theatertexten, wodurch wiederum deutlich wird, dass das Verhältnis von Drama und Theater dialektisch verschränkt ist.[17]
Daher bildet das Drama die Textgrundlage für die zu spielende Handlung auf dem Theater. Das heißt, dass es immer auf die szenische Umsetzung im Theater ausgerichtet ist. Erst dadurch kann es zu einer Interaktion von Bühne und Publikum kommen, die die Intention des szenisch-theatralischen Textes noch stärker hervorbringt. Die Begriffe Drama und Theater können daher nahezu gleichgesetzt werden, wodurch Drama als Theater mit Textgrundlage gesehen werden kann.[18] Dennoch dürfen ihre Unterschiede, wie die besondere Kommunikationssituation nicht außer Acht gelassen werden. Bertolt Brecht löst dieses Phänomen, indem sich bei ihm die Fachausdrücke Drama und Theater im epischen Theater auflösen. Diese spezielle Form von Theater entwickelte er aus seiner sozialistischen Dramatik, sodass ,,die nicht-aristotelische Dramatik das epische Theater zu ihrer Voraussetzung [hat], wie umgekehrt das epische Theater jene Dramatik zu der seinen“.[19]
Im Folgenden soll der Begriff des Politischen im Allgemeinen geklärt werden und wie er in dieser vorliegenden Arbeit verwendet wird. Dabei lehnt sich die Erklärung an den Terminus des politischen Theaters an, um eine genauere Differenzierung zu ermöglichen und das Verständnis dieses schwer abgrenzbaren Begriffs zu erleichtern. Weiterhin ist politisches Theater unter dem Aspekt der Dramendefinition in dieser Arbeit zu subsumieren, wonach dessen Eigenschaften ebenso für das politische Drama gelten. Zusätzlich wird diese allgemeine Abgrenzung durchgeführt, um die bestehenden Unterschiede zu Brecht darzustellen und um dadurch das Besondere des politischen Theaters nach seiner Theorie und damit auch das Besondere an seinen politischen Dramen kenntlich zu machen.
2.3 Zum Begriff des Politischen
Über das Politische bestehen ebenso wie beim Drama viele verschiedene Definitionen. So kann es als ein Widerstreit zweier verschiedener Pole verstanden werden, wobei es vor allem durch die Existenz eines Gegners, eines Gegensatzes zum Eigenen, als politisch definiert wird.[20] Von einem solchen Politikbegriff entfernt sich diese Arbeit jedoch, da beispielsweise Darstellungen vorhandener Gesellschaftsprobleme nicht erfasst werden könnten.
In einem anderen Verständnis wird das Politische nach N. Machiavelli und Thomas Hobbes ,,auf das Phänomen der Durchsetzung des Machtwillens reduziert und somit instrumentalisiert“.[21] Dieses Empfinden von Politik liefert ein negatives Konnotat, sodass politische Aktivitäten mit einem dubiosen oder schmutzigen Geschäft in Verbindung gebracht werden. Politik steht demnach in einem Gegensatz zur Kunst, welche das Edle und Schöne vertritt. Es erfolgt eine Trennung von Politik und künstlerischem Schaffen und daher auch von Politik und Theater, die den Bürger, der in einer sozial und politisch aktiven Umwelt agiert, als Adressaten verliert.[22] Dieses Politikverständnis stimmt deshalb nicht mit dem Begriff des Politischen in dieser Arbeit überein. Daher muss eine andere Begriffsabgrenzung gefunden werden, die diesen Terminus speziell im Hinblick auf Dramen festlegt. Aus diesem Grund wird im Folgenden zusätzlich auf das politische Theater eingegangen.
2.3.1 Das politische Theater - im engeren Sinne
Eine eng gefasste Definition betrachtet nur jene Stücke als politisch, die von aktuellen politischen Fragen oder von politischen Vorgängen im Zusammenhang mit einer staatlichen Institution handeln. Diese Begriffsbestimmung stellt eine funktionale Abgrenzung dar, die politisches Theater auf Stücke von oppositionellen Gruppen oder im Extremfall auf Propagandastücke beschränkt.[23] Bei Letzterem ist jedoch eine Modifikation vorzunehmen, da nicht alle Literaturwissenschaftler diese These unterstützen. Melchinger spricht Propagandastücken das Prädikat des politischen Theaters ab, mit der Begründung, dass diese in ihrer gesellschaftlichen Funktion stabilisierend wirken und somit nicht auf eine Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse gerichtet sind.[24] Um eine solche Veränderung der Verhältnisse herbeizuführen, ist es nötig, den Zuschauern zunächst die jeweiligen Zustände vor Augen zu führen. Mit dieser Aussage ist jedoch nicht eine inhaltliche Reduzierung des Theaters auf tagespolitische Themen gemeint. Ein solches politisches Theater kann nicht funktionieren, weil immer die Gefahr besteht, dass nur der gesellschaftliche Diskurs, den die Öffentlichkeit bereits erörtert, wiedergegeben wird.[25] Weiterhin würde der langwierige Produktionsprozess wie das Schreiben, Drucken, Planen des Theaterabends und die langwierigen Proben dafür sorgen, dass tagespolitisch gegenwärtige Geschehnisse bereits ihre Aktualität verloren hätten und somit nur noch das Stück an sich ohne jegliche Intention bleiben würde.[26]
2.3.2 Das politische Theater – im weiteren Sinne
Aus den oben genannten Gründen ist es nötig, einen weiter gefassten Begriff des Politischen ins Auge zu fassen. Tynan stellt die These auf, dass jede menschliche Tätigkeit, auch wenn es sich nur um Zigaretten holen handelt, soziale und politische Aspekte beinhaltet.[27] Ebenso wird eine Dramenproduktion nicht unbedingt unmittelbar politisch beeinflusst. Dennoch wirken auf den Entstehungsprozess und die Inszenierung soziale Einflüsse ein. Es kann daher gesagt werden, dass ,,das Politische ihm eingeschrieben [ist], durch und durch, unabhängig von seinen Intentionen“.[28] Dieser Aussage steht die Feststellung Goethes entgegen, dass Politik und Poesie und damit die Kunst nicht zueinander passen würden. Die Kunst solle im Gegensatz zur Politik tendenz- und zweckfrei bleiben. Der Grund dafür liegt darin, dass, nach Goethes Auffassung, das politische Themengebiet den unbefangenen und freien Blick des Künstlers trübe, weil dieser sich einer Partei hingeben müsse und damit in seinem Geiste nicht mehr frei sei.[29] Im freiwilligen Verzicht eines Autors auf eine Alternative sieht ebenfalls Norbert Kohlhase die Gefahr, dass die politischen Formeln die Oberhand in der Literatur gewinnen. Seiner Ansicht nach kann ,,Reine Parteilichkeit [..] zur Parteitheologie“[30] werden. Dieser Auffassung steht die Meinung Thomas Manns entgegen, der davon ausgeht, dass ein Dichter außerstande ist, „das Unlösliche zu lösen und die Verbindung aufzuheben, die zwischen Kunst und Politik, Geist und Politik unweigerlich besteht. Hier wirkt einfach die Totalität des Menschlichen, die sich auf keine Weise verleugnen läßt“.[31] Dieses Menschliche beinhaltet das Leben in einer politischen Gemeinschaft und damit einhergehend die kommunikativen und sozialen Beziehungen untereinander. Jeder Schaffensprozess eines Dramas und des Theaters wird von sozialen und politischen Bedingungen angefüllt, da auch der Autor in dieser Gemeinschaft agiert. Somit ist jedes Theater politisch.[32] Dies gilt vor allem auch für Theaterformen wie das absurde Theater, das für sich beansprucht völlig unpolitisch zu sein. Denn selbst das Schweigen über Politik wird von der Öffentlichkeit aufgenommen und als eine Äußerung im negativen Sinne über dieses Themengebiet verstanden: „Selbst die Poesie des Absurden, das sich ihm zu entziehen scheint, bestätigt das Politische des Theaters“.[33] Nach dieser Auffassung von politischem Theater und dem Begriff des Politischen kann darunter jedes Theaterstück und jedes Drama gefasst werden. Dem Vorwurf der parteilichen Stellungnahme entzieht es sich dadurch, dass es sich um ein Kunstprodukt auf der Bühne handelt. Jenes ermöglicht, das Politische dort aufzudecken, wo es sonst vom schablonisierten Diskurs öffentlicher Themenzentriertheit nicht vermutet wird.[34] Damit wirkt es wie eine gebrochene Linse, die die Wünsche und Bedürfnisse einer Gesellschaft zu einer bestimmten Zeit deutlich macht.[35] Brecht drückte dies treffender aus: ,,Kunst ist in jedem Detail – bei der Darstellung der Liebe ebenso wie bei der des unmittelbaren Kampfes – politische Arbeit, wie anders soll sie uns – die wir nur durch den politischen Kampf existieren können – nützlich sein?“.[36]
2.3.3 Das politische Theater – eine dritte Definition im Hinblick auf Brechts Konzeptionen
Da dieses Verständnis des Politischen sehr weit gefasst ist, bedarf es einiger Einschränkungen. Diese Arbeit schließt sich der Meinung Ismayrs an und spricht erst da von politischen Dramen, „wo die thematisierte Realität als veränderbar erscheint, wo die Intention (Tendenz) zur Veränderung der politischen Verhältnisse bzw. des moralisch-politischen Bewusstseins erkennbar wird – und sei es in der Negation“.[37] Dabei kann das Kriterium der Intention beziehungsweise der Tendenz nur als Richtwert verstanden werden, da die Absicht des Künstlers durchaus durch die Art der Aufführung und der Regieführung verfälscht werden kann. Ismayr unterscheidet weiterhin von der Tendenz des politischen Theaters her zwei Grundtypen: das ethisch-politische Theater, das nach Lessing als moralisch politische Anstalt bezeichnet wird, und das revolutionäre Lehrtheater, das von Bertolt Brecht geprägt wurde. Diese Unterscheidung bleibt nach Torben Ibs fragwürdig, da Ismayrs Trennung darauf beruht, dass die moralische Schaubühne im Sinne Lessings den Menschen ändern, Brechts Theater den Menschen zum Handeln bringen will. Eine Änderung des Menschen führe aber nach Lessing und Schiller ebenso zu einer Änderung ihrer Handlungen, wodurch beide Stilrichtungen dasselbe Ziel erreichen wollten. Brecht habe demnach mit seinen Lehrstücken und dem epischen Theater lediglich eine neue Ästhetik in das herrschende Theatermodell gebracht.[38] Eindeutig ist jedoch, dass Brecht ,,für ein total politisches Theater votierte“.[39] Er versuchte, Kunst und gesellschaftliche Praxis miteinander zu verknüpfen und dadurch seine Theorie vom „Eingreifenden Denken“ zu manifestieren. Als Ergebnis seines eigenen Empfindens von politischem Theater und mit seiner Hinwendung zum Marxismus entsteht sein episches Theater.
3.0 Das politische Theater nach Bertolt Brecht
Den aussagekräftigsten Satz, der Brechts politisches Theater am passendsten beschreibt, hat er selbst geäußert: „Ich wollte auf das Theater den Satz anwenden, daß es nicht nur darauf ankommt, die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verändern“.[40] Ausgangspunkt für diese Absicht bildet die Konzeption des eingreifenden Denkens, die schließlich zu seinen Theatertheorien führt. Diese stellen seine Art des politischen Theaters dar.
3.1 Eingreifendes Denken und politische Beeinflussung
Brechts Theaterkonzeptionen sind durch die Hinwendung zum Marxismus geprägt. Sie ermöglichte ihm eine neue Qualität seiner Stücke. Beeinflusst wurde er dabei vor allem durch die Theorien von Hegel und Marx, die ihm von seinen Bekannten Karl Korsch, Fritz Sternberg und Ernst Bloch näher gebracht wurden.[41] Damit begannen seine Überlegungen zu der Kategorie des „Eingreifenden Denkens“. Diese Zielsetzung entstand in den frühen dreißiger Jahren. Um sie verstehen zu können, muss zunächst die widersprüchliche Verbindung von „Eingreifen“ und „Denken“ beleuchtet werden. Unter „Denken“ wird eine Distanzierung von Subjekt zum Objekt verstanden. Es beschreibt eine Verbindung zu einem Objekt oder einem Ereignis, das analysiert und auf Logik überprüft wird. „Eingreifen“ ist das Gegenteil von „Denken“, da es eine Handlung charakterisiert, die vom Subjekt ausgeht. In Brechts Sinne meint das „Eingreifen“ eine Verhaltensweise, die auf das Objekt oder das Ereignis einwirkt, wodurch die Änderung der Welt möglich wird. Während in der Realität Kreativität von der Zuspitzung der Widersprüche am Leben gehalten wird, also durch dynamische Vorgänge, versucht Brecht durch „Eingreifendes Denken“ von einer solchen Dynamik zu distanzieren. Seine Konzeption ist eine Einstellung, die nach Erkenntnis und Bewusstwerdung der Wirklichkeit und der gesellschaftlichen Verhältnisse verlangt: „Erkannt zu haben, daß das Denken was nützen müsse, ist die erste Erkenntnis“.[42] Als Folge dieser Erkenntnisse soll es zu Anwendung und Wirkung in der Realität kommen. Dies versucht Brecht mit besonderen ästhetischen Formen hervorzubringen.[43] Dazu benutzt er zunächst seine andersartige Theorie der Lehrstücke, die den Weg zu einer spezielleren Form, das epische Theater, ebnen. Darin produziert er Widersprüche, die die Passivität des Publikums durchbrechen sollen und die umgebenden Verhältnisse beleuchten. Seiner Meinung nach ist eingreifendes Denken nur möglich, „wenn es [das Individuum] um sich selbst und das Verhalten der Umwelt Bescheid weiß. Aussichtsreich nur, wenn es imstand ist, die Umwelt zu beeinflussen“.[44] Somit versucht er in seinem politischen Theater, das Epische, diese Determinanten hervorzurufen: die Erkenntnis über die Realität und das Bewusstwerden von Handlungsmöglichkeiten. Das politische Theater Bertolt Brechts ist demnach in dem epischen Theater und den Lehrstücken zu finden.
3.2 Abriss über die Phasen der Entwicklung des epischen Theaters