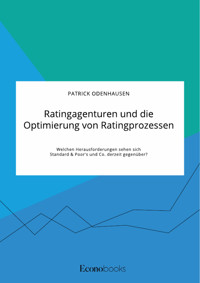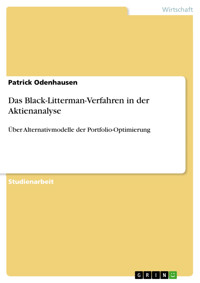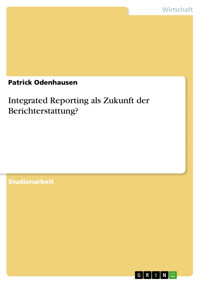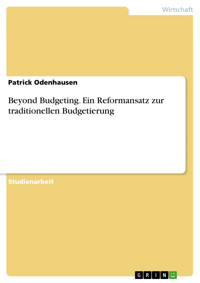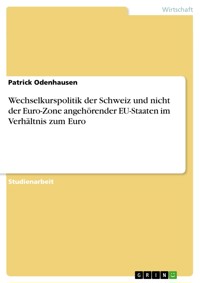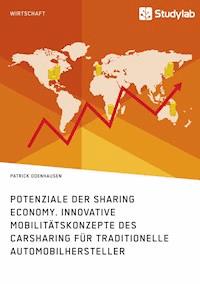
Potenziale der Sharing Economy. Innovative Mobilitätskonzepte des Carsharing für traditionelle Automobilhersteller E-Book
Patrick Odenhausen
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Sprache: Deutsch
Steigende Ressourcenknappheit, Klimawandel, wachsende Weltbevölkerung, Urbanisierung – dies sind nur einige Probleme, die uns global betreffen. Insbesondere zwingt es Automobilunternehmen zum Umdenken und zur Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen. Eine davon ist das Carsharing, eine Form der Sharing Economy. Doch was bedeutet dies für traditionelle deutsche Automobilhersteller im internationalen Vergleich? Worin bestehen die Chancen und Herausforderungen für die Branche sowie für uns als Kunden? In diesem Buch wird zu Beginn ein allgemeiner Gesamtüberblick über die aktuelle Ausgangssituation der deutschen Automobilbranche vermittelt. Der Autor Patrick Odenhausen geht dabei sowohl auf die Besonderheit und die Bedeutung der Automobilbranche für die deutsche Wirtschaft ein als auch auf die Relevanz des Carsharings für die deutsche Automobilindustrie – und den damit einhergehenden Wandel zum Mobilitätsdienstleister. Es werden spezifische Handlungsempfehlungen für Hersteller abgeleitet. Wird Carsharing das Auto als Eigentum in Zukunft ablösen? Aus dem Inhalt: - Automobilkonzern; - Car-Sharing; - Sharing-Economy; - Mobilitätsangebot; - Kundenbindung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2018 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Bachelorarbeit
2 Ausgangssituation
2.1 Die Automobilbranche in Deutschland
2.2 Relevanz des Carsharings für die deutsche Automobilindustrie
2.3 Wandel vom traditionellen Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister
3 Carsharing als Beispiel der Shared Mobility
3.1 Definition und Begriffsabgrenzung
3.2 Entwicklung des Carsharings in Deutschland
3.3 Angebote im Bereich des Carsharings
3.3.1 Verschiedene Formen der gemeinsamen Fahrzeugnutzung
3.3.2 Traditionelle Carsharing-Anbieter in Deutschland
3.4 Nutzungsmotive von Carsharing-Diensten
3.4.1 Ökonomische Aspekte
3.4.2 Ökologische Aspekte
3.5 Vor- und Nachteile des Carsharings aus Nutzerperspektive
4 Carsharing – Auswirkungen auf traditionelle deutsche Automobilhersteller
4.1 Situationsanalyse
4.1.1 PEST-Umfeldanalyse
4.1.2 Stärken- und Schwächen-Betrachtung der deutschen Automobilindustrie
4.1.3 Erstellung der SWOT-Analyse-Matrix
4.2 Chancen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren des Carsharings aus Sicht eines traditionellen Automobilherstellers
4.2.1 Chancen
4.2.2 Herausforderungen
4.2.3 Erfolgsfaktoren
4.3 Handlungsempfehlungen
5 Schlussbetrachtung
5.1 Zusammenfassung und Fazit
5.2 Ausblick
Anhang
Anhang 1: Fragebogen zum Thema Carsharing
Anhang 2: Auswertung Frage
Anhang 3: Auswertung Fragenach Wohnlage
Anhang 4: Auswertung Frage
Anhang 5: API Kennzahlen-Systematik
Anhang 6: Marktanteile ausgewählter Automobilhersteller in den USA im Jahr
Anhang 7: Kreuztabelle Frageund Altersklassen
Anhang 8: Vergleich der Bereitschaft zum Verzicht auf die eigene Mobilität zugunsten von Carsharing-Angeboten
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Kapitelübersicht der vorliegenden Arbeit
Abbildung 2: Aufteilung der Wege junger Erwachsener auf Verkehrsmittel
Abbildung 3: Integrierte Mobilitätslösungen in urbanen Gebieten
Abbildung 4: Entwicklung des Carsharings in Deutschland (1997 bis 2016)
Abbildung 5: Bekanntheit verschiedener Carsharing-Anbieter
Abbildung 6: Nutzungsmotive von Carsharing-Diensten
Abbildung 7: Kostenvergleich Carsharing und Mietwagen
Abbildung 8: Kostenvergleich Carsharing und Taxi
Abbildung 9: Vorgehen bei der Situationsanalyse
Abbildung 10: PEST-Umfeldanalyse
Abbildung 11: Beispiel einer SWOT-Analyse-Matrix
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Unterschiede von Carsharing zum Mietwagen und Taxi
Tabelle 2: Formen der gemeinsamen Fahrzeugnutzung
Tabelle 3: Größte Carsharing-Anbieter in Deutschland nach Kundenzahl
Tabelle 4: Vor- und Nachteile von Carsharing aus Nutzerperspektive
Tabelle 5: Stärken und Schwächen der deutschen Automobilindustrie
Tabelle 6: SWOT-Analyse-Matrix für traditionelle deutsche Automobilhersteller in Bezug auf Carsharing
1 Einleitung
Eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung erfordert eine grundlegende Veränderung bestehender Wirtschaftsformen. Der reine Fokus auf eine ökologische Produktgestaltung ist für diese Entwicklung unzureichend, es werden neue Geschäftsmodelle und Konsummuster benötigt. Insbesondere Dienstleistungen wie Miet- und Sharing-Systeme bieten aussichtsreiche Umweltentlastungs- und Innovationspotenziale.[1]
Innerhalb der letzten Jahre erfolgte ein bedeutsamer Wandel der Konsumgewohnheiten, weg vom Besitzdenken hin zur Nutzungsgesellschaft (Nutzen statt Kaufen). Infolgedessen nahmen die Verbreitung und das Interesse an Sharing-Angeboten deutlich zu. Die Sharing Economy hat in Form von innovativen Mobilitätskonzepten Einzug in das Geschäft traditioneller Automobilhersteller gefunden. Im Mittelpunkt steht dabei das Carsharing. Dadurch ergeben sich für Automobilhersteller neue Chancen und Geschäftsmodelle, bei denen die gemeinsame Fahrzeugnutzung eine bedeutende Rolle spielt.[2] Insgesamt ca. 220.000 Neukunden allein in Deutschland im Zeitraum 2015 – 2016 bestätigen das wachsende Interesse der Bevölkerung an alternativen Mobilitätsdienstleistungen wie Carsharing. Mit aktuell etwa 150 verschiedenen Anbietern und 1,26 Mio. registrierten Kunden kann von einer Randerscheinung kaum noch die Rede sein.[3]
Neben unabhängigen Anbietern wie Cambio oder Stattauto gibt es auch vermehrt Geschäftsmodelle von Transportunternehmen wie der Deutschen Bahn (Flinkster) oder von den traditionellen Automobilherstellern direkt, wie zum Beispiel (z. B.) Car2go (Daimler) oder DriveNow (BMW). Die Automobilhersteller haben in den letzten Jahren das hohe Potenzial von Mobilitätsdienstleistungen erkannt und werden zunehmend in diesem Segment aktiv. Aufgrund der Ergänzung ihres Kerngeschäfts durch Mobilitätsdienstleitungen wie Carsharing reagieren die Automobilunternehmen auf den aktuellen Wandel im Mobilitätsverhalten und entwickeln sich vom traditionellen Automobilhersteller zum vernetzten und digitalisierten Mobilitätsdienstleister.
1.1 Problemstellung
Globale Probleme wie eine steigende Ressourcenknappheit, der Klimawandel und die wachsende Weltbevölkerung mit einer einhergehenden zunehmenden Urbanisierung zwingen insbesondere Automobilunternehmen zum Umdenken und zur Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen. Speziell in Deutschland unterstreichen strikte gesetzliche Vorschriften wie die EU-Emissionsstandards oder staatliche Subventionsprogramme wie das Regierungsprogramm Elektromobilität der Bundesregierung die Notwendigkeit und das Verlangen nach innovativen Mobilitätslösungen. Im Rahmen der Sharing Economy ändert sich das Konsumverhalten der Bevölkerung, was sich auch auf das Mobilitätsverhalten auswirkt.
Speziell für junge Menschen ist das eigene Fahrzeug immer seltener ein Statussymbol, wodurch der Besitz an Bedeutung verliert und die Nachfrage nach alternativer Mobilität steigt.[4] Dies bezweckt, dass sich traditionelle Automobilhersteller im Wandel befinden, hin zum Mobilitätsdienstleister. Die Erwartungen an neue Mobilitätskonzepte sind hoch und reichen von ökologischen Motiven über Kostenersparnisse bis zur Bewältigung von Verkehrsproblemen in städtischen Gebieten.[5]
Die Sharing Economy, in Form von Carsharing, stellt für etablierte Automobilhersteller somit Chance und Herausforderung zugleich dar. Traditionelle Automobilhersteller müssen sich auf der einen Seite mit neuen Herausforderungen beschäftigen, dass zukünftig möglicherweise weniger Produkte über ihre klassischen Geschäftsmodelle verkauft werden. Auf der anderen Seite ergibt sich durch die zunehmende Teilnahme an der Sharing Economy auch die Chance, das traditionelle Automobilgeschäft um innovative Sharing-Angebote zu erweitern und dadurch neue Geschäftsmodelle und Märkte zu erschließen.[6]
1.2 Zielsetzung und Aufbau der Bachelorarbeit
Die Zielsetzung dieser Bachelorarbeit ist es, die Auswirkungen der Sharing Economy auf traditionelle deutsche Automobilhersteller am Beispiel von Carsharing zu untersuchen, um daraus mögliche Erfolgsfaktoren sowie Handlungsstrategien abzuleiten.
Zu Beginn der Arbeit wird dem Leser ein allgemeiner Gesamtüberblick über die aktuelle Ausgangssituation der deutschen Automobilbranche vermittelt. In diesem wird sowohl auf die Besonderheit und die Bedeutung der Automobilbranche für die deutsche Wirtschaft eingegangen, als auch auf die Relevanz des Carsharings für die deutsche Automobilindustrie und der damit einhergehende Wandel zum Mobilitätsdienstleister. Als theoretische Grundlage der vorliegenden Arbeit werden im dritten Abschnitt zunächst allgemein die Dienstleistung Carsharing und ihre bisherige Entwicklung näher erläutert. Im Fokus dieser Bachelorarbeit steht die Identifikation der Auswirkungen von Carsharing auf traditionelle Automobilhersteller. Im vierten Abschnitt werden die spezifischen Auswirkungen auf deutsche Automobilhersteller mittels einer Situationsanalyse untersucht. Diese umfasst sowohl eine Betrachtung der externen Einflussfaktoren (Umfeldanalyse) sowie eine Analyse der Stärken und Schwächen deutscher Automobilhersteller. Die erarbeiteten Ergebnisse der Situationsanalyse werden anschließend mithilfe einer SWOT-Analyse-Matrix verdichtet dargestellt. Im Folgenden dienen die gewonnen Informationen aus der SWOT-Analyse als Instrument zur Konkretisierung der Chancen, Herausforderungen und Erfolgsfaktoren sowie zur Ableitung spezifischer Handlungsempfehlungen.
Die Arbeit endet mit einer Schlussbetrachtung.
Abbildung 1: Kapitelübersicht der vorliegenden Arbeit
Quelle: Eigene Darstellung.
2 Ausgangssituation
2.1 Die Automobilbranche in Deutschland
Ende des 19. Jahrhunderts hat Carl Benz das erste Automobil hergestellt, seitdem verbindet Deutschland und die Automobilbranche eine lange und erfolgreiche Historie.[7] Heutzutage ist Deutschland, mit rund 6,03 Millionen (Mio.) produzierten Kraftfahrzeugen, nach China, USA und Japan der viertgrößte Automobilproduzent der Welt.[8] Auch national zählt die deutsche Automobilbranche zu den größten und wichtigsten Industriezweigen der deutschen Wirtschaft. Die Unternehmen der Branche beschäftigten im Jahr 2015 direkt etwa 792.618 Personen[9] und erwirtschafteten einen Gesamtumsatz von über 404 Milliarden (Mrd.) Euro.[10] Damit hat die Automobilbranche eine hohe Bedeutung für die Beschäftigung und den Wohlstand innerhalb Deutschlands.[11]