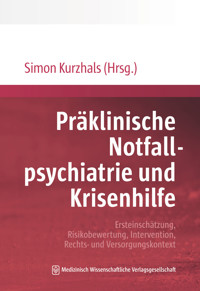
Präklinische Notfallpsychiatrie und Krisenhilfe E-Book
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Psychische Erkrankungen können sich bei Betroffenen in Symptomen äußern, die sowohl Angehörige wie auch professionelle Helfer aus unterschiedlichen Gründen rasch überfordern können. Zu nennen sind hier etwa nicht absehbare Verhaltensweisen, Gefährdungsaspekte für Betroffene und auch unbeteiligte Dritte sowie eine möglicherweise fehlende Erkrankungs- und Behandlungseinsicht. Jede akute psychische Krise ist hochgradig individuell und erfordert auf Seiten der Helfenden verschiedenster Institutionen neben der Kenntnis der verfügbaren Hilfestrukturen vor allem kommunikatives Geschick zur Herstellung einer Vertrauensbasis, die Fähigkeit zu umsichtiger und pragmatischer diagnostischer Einschätzung sowie ausreichende Sicherheit bei der Auswahl zur Verfügung stehender Interventionen. Das Buch vermittelt die Kenntnisse, Methoden, Konzepte und Fähigkeiten zur Notfall- und Krisenintervention bei psychiatrischen Notfällen und psychischen Krisen sowie das notwendige Basiswissen zu den Strukturen und Organisationen im Hilfesystem inklusive rechtlicher Fragen. Die Autoren beschäftigen sich seit vielen Jahren mit psychischen Ausnahmezuständen und deren Implikationen im präklinischen und klinischen Setting. Das Buch baut auf diese Erfahrung auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Simon Kurzhals (Hrsg.)
Präklinische Notfallpsychiatrie und Krisenhilfe
Ersteinschätzung, Risikobewertung, Intervention, Rechts- und Versorgungskontext
mit Beiträgen vonA.R. Baasner | A. Buchhorn | A. Forster | P. Heinz | M. Koll-Krüsmann | S. Kurzhals | T. Lindemann | P. Ristau | E. Sakellaridou | D. Scholz-Hehn | D. Stratmann alias C. Winkler | M. Weinert
Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft
Der Herausgeber
Simon Kurzhals
Evang. Kliniken Essen-Mitte gGmbH
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Unterbaumstr. 4
10117 Berlin
www.mwv-berlin.de
ISBN 978-3-95466-916-5 (eBook: PDF)
ISBN 978-3-95466-917-2 (eBook: ePub)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Informationen sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Berlin, 2024
Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Im vorliegenden Werk wird zur allgemeinen Bezeichnung von Personen nur die männliche Form verwendet, gemeint sind immer alle Geschlechter, sofern nicht gesondert angegeben. Sofern Beitragende in ihren Texten gendergerechte Formulierungen wünschen, übernehmen wir diese in den entsprechenden Beiträgen oder Werken.
Die Verfasser haben große Mühe darauf verwandt, die fachlichen Inhalte auf den Stand der Wissenschaft bei Drucklegung zu bringen. Dennoch sind Irrtümer oder Druckfehler nie auszuschließen. Der Verlag kann insbesondere bei medizinischen Beiträgen keine Gewähr übernehmen für Empfehlungen zum diagnostischen oder therapeutischen Vorgehen oder für Dosierungsanweisungen, Applikationsformen oder Ähnliches. Derartige Angaben müssen vom Leser im Einzelfall anhand der Produktinformation der jeweiligen Hersteller und anderer Literaturstellen auf ihre Richtigkeit überprüft werden. Eventuelle Errata zum Download finden Sie jederzeit aktuell auf der Verlags-Website.
Projektmanagement: Dennis Roll, Meike Daumen, Berlin
Copy-Editing: Monika Laut-Zimmermann, Berlin
Layout & Satz: zweiband.media, Agentur für Mediengestaltung und -produktion GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Zuschriften und Kritik an:
MWV Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, Unterbaumstr. 4, 10117 Berlin, [email protected]
Inhalt
1Relevanz psychischer Erkrankungen und Einordnung in den präklinischen VersorgungskontextSimon Kurzhals
2Differentialdiagnostik und Evaluation psychiatrischer NotfälleDeborah Scholz-Hehn und Simon Kurzhals
3Klinik psychiatrischer SyndromeDeborah Scholz-Hehn und Simon Kurzhals
4Kommunikation und Deeskalation im psychiatrischen NotfallMark Weinert
5Medikamentöse Behandlungsstrategien bei psychiatrischen NotfällenSimon Kurzhals
6Rechtliche Rahmenbedingungen bei der Behandlung psychischer ErkrankungenDeborah Scholz-Hehn und Simon Kurzhals
7Medizinethische Aspekte und Behandlungsplanung psychischer ErkrankungenSimon Kurzhals
8Peer-/GenesungsbegleitungDennis Stratmann alias Cordt Winkler
9Ambulante medizinische Hilfesysteme und weitere AnlaufstellenAlexander Baasner, Peggy Heinz, Tina Lindemann, Antje Buchhorn, Simon Kurzhals und Elina Sakellaridou
10Second-Victim-Phänomen und Prävention sekundärer TraumatisierungAndrea Forster, Marion Koll-Krüsmann und Alexander Baasner
11Zukunftsperspektiven der rettungsdienstlichen Versorgung psychischer ErkrankungenPatrick Ristau
Literatur
Das Autoren-Team
1Relevanz psychischer Erkrankungen und Einordnung in den präklinischen VersorgungskontextSimon Kurzhals
Der Großteil akuter psychischer Krisen findet außerhalb psychiatrischer Kliniken statt. Akuter Hilfebedarf wird oftmals von nicht-professionellen und von psychiatrisch unerfahrenen Personen erkannt. Viele psychisch bedingte Krisenzustände können zwar von Bezugspersonen aus dem unmittelbaren Umfeld unterstützend begleitet werden. In Abhängigkeit der Schwere der Krise können jedoch erhebliche Hilfebedarfe entstehen, sodass eine gründliche Untersuchung und Abwägung einer Behandlungsnotwendigkeit erfolgen muss (Lamberg 2020). Mangels hinreichender Befähigung im Umgang mit psychiatrischen Notfällen gelingt die Vermittlung geeigneter Hilfen durch nicht-psychiatrisch Tätige im Gesundheitswesen oder anderen Institutionen nicht immer reibungslos. In Anbetracht der Häufigkeit psychischer Erkrankungen und anzunehmender steigender Anzahl psychiatrischer Notfälle besteht an vielen Schnittstellen zum Gesundheitswesen die Notwendigkeit, sich Kenntnisse zu Erkennung und Versorgung entsprechender Erkrankungen sowie zum Umgang mit erkrankten Personen anzueignen.
1.1Unzureichende Befähigung
Der Ausbildungsstand beteiligter nicht-psychiatrischer Hilfskräfte im Gesundheitswesen, jedoch auch anderer Institutionen oder Behörden wie beispielsweise der Polizei, ist hinsichtlich Kenntnis, Einschätzung und Verfahrensweisen im Umgang mit psychischen Erkrankungen insgesamt heterogen. Ob und wie gut die Weiterversorgung psychisch erkrankter Personen erfolgen kann, liegt neben weiteren Faktoren in den Händen der involvierten Einsatzkräfte. Kommunikatives Geschick ist hier ebenso notwendig wie die Fähigkeit zur umsichtigen und pragmatischen diagnostischen Einschätzung psychiatrischer Syndrome (s. S2k-Leitlinie Notfallpsychiatrie 2019). Zudem sollten Kenntnisse zu Versorgungsstrukturen bestehen. Für einen sicheren Umgang mit entsprechenden Situationen im öffentlichen Raum bedarf es sowohl einer hinreichenden Befähigung der handelnden Personen als auch einer transparenten Wissensvermittlung. Die hierzu notwendigen Kenntnisse werden jedoch im Rahmen der entsprechenden Ausbildung weder bei Notärzten, noch im Rettungswesen (Pajonk 2004) oder bei der Polizei in hinreichendem Maß vermittelt (Lorey 2021). Gerade bei betroffenen Personen bei denen sich eine psychische Erkrankung durch aggressive Verhaltensweisen äußert führt in nicht unerheblichem Maß ein polizeilicher Kontakt zur Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik (Johnson 2022).
1.2Prävalenz psychischer Erkrankungen
Die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen aufgrund psychischer Erkrankungen ist ebenso wie die Krankheitskosten und die gesellschaftsökonomische Belastung in den letzten Jahrzehnten deutlich angestiegen (Rommel 2017). Die Lebenszeitprävalenz hinsichtlich des Auftretens einer beliebigen psychischen Erkrankung beträgt in Deutschland nahezu 50%, innerhalb eines Jahres bildet sich bei etwa einem Drittel der Bevölkerung eine psychische Erkrankung aus (Jacobi 2014). Der Großteil psychischer Erkrankungen entwickelt sich im Gegensatz zu somatischen Erkrankungen überwiegend in der zweiten bzw. dritten Lebensdekade. Ausnahmen stellen bestimmte Angsterkrankungen, die bereits in der Adoleszenz eintreten, oder im höheren Lebensalter auftretende neurodegenerative Erkrankungen dar. Angesichts des frühen Auftretens besteht also oft eine verhältnismäßig lange Erkrankungsdauer im Vergleich zu nicht- psychischen Erkrankungen. In absteigender Häufigkeit handelt es sich bei den häufigsten psychischen Erkrankungen um Angst- und affektive Störungen, Abhängigkeitserkrankungen, Zwangsstörungen, psychotische Störungen, Somatisierungs- und Traumafolgestörungen.
1.3Belastung durch psychische Erkrankungen
Die Kombination aus hoher Prävalenz, frühem Erkrankungsalter und hohem Grad der Chronifizierung allein steigert nicht nur das individuelle Leid, sondern auch die gesellschafts-ökonomischen Belastung. Dies zeigt sich unter anderem in einer Zunahme beruflicher Fehltage oder Arbeitsunfähigkeit, die in den letzten 10 Jahren um 48% zugenommen haben (Badura 2023). Zudem ist in den letzten 20 Jahren der Anteil von Erwerbsminderungsrenten aufgrund psychischer Erkrankungen von 24% auf 41% angestiegen. Nahezu jeder zweiten Berentung liegt somit eine psychische Erkrankung zugrunde (DRV 2021). Die Krankheitslast, gemessen an Indikatoren wie DALY (Disability Adjusted Life Years) oder YLD (Years lived with Disability), liegt bei psychischen Erkrankungen unter den zehn häufigsten Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronische Schmerzerkrankungen, Krebserkrankungen. Direkte Krankheitskosten nehmen mit 44 Mrd. EUR mehr als 13% der gesamten Krankheitskosten in Deutschland ein und folgen direkt auf Herz-Kreislauferkrankungen (Bombana 2022, Plass 2014). Psychische Erkrankungen sind und bleiben auch zukünftig ein erhebliches gesundheitsökonomisches Problem.
1.4Psychische Erkrankungen und deren Entwicklung
Der Begriff der psychischen Störung bezeichnet ein von der Normvorstellung abweichendes Erleben oder Verhalten einer Person. Neben einer abweichenden Wahrnehmung können Denken, Fühlen oder Verhalten von betroffenen Personen verändert sein. Die diagnostische Zuordnung psychiatrischer Störungsbilder erfolgt auf der Grundlage einzelner Symptome, die sich wiederum zu Syndromen zusammenfassen lassen (s. Kap. 2). Psychische Erkrankungen entwickeln sich, abgesehen von Intoxikationen mit psychoaktiven Substanzen, mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Vereinzelt können Symptome spät erkannt werden oder treten erst durch ein Zusammenspiel weiterer psychosozialer Belastungsfaktoren auf. Die Entwicklung einzelner Symptome psychiatrischer Erkrankungen verläuft ebenso wie deren Dauer und Intensität individuell und ist vielgestaltig. Gründe liegen neben der persönlichen, psychologischen und physischen Konstitution auch in unterschiedlichen sozial-ökonomischen oder kulturellen Lebensbedingungen betroffener Personen.
1.5Biopsychosoziales Modell
Seit dem Ende der 1970er-Jahre stellt das „Biopsychosoziale Modell von Gesundheit und Krankheit“ das am meisten anerkannte Krankheitsmodell dar (Stein 2010). Das Modell geht davon aus, dass Erkrankungen durch eine gestörte Interaktion körperlicher, psychischer und sozialer Faktoren entstehen. Das Modell verdeutlicht, dass der wechselseitigen Beziehung der einzelnen Faktoren mehr Bedeutung eingeräumt wird als dem bloßen mechanistischen Vorhandensein einer Erkrankung. Zu den biologischen Faktoren zählen beispielsweise genetische Dispositionen oder Krankheitserreger, während psychologische Faktoren die individuellen Kognitionen und Stressoren und soziale Faktoren u.a. die Umwelt-, Wohn- und Lebensbedingungen darstellen (Engel 1980).
1.6Vulnerabilitäts-Stress-Modell
Bei dem Vulnerabilitäts-Stress-Modell, synonym auch Diathese-Stress-Modell, handelt es sich um einen theoretischen Erklärungsansatz für Entstehung, Auftreten und Aufrechterhaltung psychischer Erkrankungen. Hierbei bezieht sich Vulnerabilität auf die individuelle biologisch-genetische oder auch biografische Anfälligkeit oder Disposition, eine psychische Erkrankung auszubilden. Faktoren wie anhaltender Stress, belastende Umstände, sich verändernde Lebenssituationen oder anderweitige Belastungen spielen hier eine Rolle. Anhand des Modells sind psychische Erkrankungen das Ergebnis der Wechselwirkung von Veranlagung und auslösender Faktoren wie Stress. Das Vorhandensein einer genetischen Belastung wiederum bedeutet nicht, dass sich zwingend eine Erkrankung entwickeln muss. Letztlich ist anzunehmen, dass der Großteil der Menschen trotz bestehender Veranlagung keine psychische Erkrankung entwickelt. Somit wird deutlich, dass es einem Zusammenwirken verschiedener Faktoren bedarf, um eine Erkrankung zu entwickeln. Bildhaft wird das Vulnerabilitäts-Stress-Modell anhand eines mehr oder minder gefüllten Wasserglases bildhaft dargestellt. Demnach stellt die individuelle Ausstattung der Menschen ein zu einem gewissen Grad gefülltes Wasserglas dar. Je mehr Wasser im Glas vorhanden ist, und je mehr Wasser im Sinne von zunehmender Belastung ins Glas strömt, desto eher läuft das Glas über. Das Überlaufen versinnbildlicht dann die Ausbildung einer Erkrankung (Wittchen u. Hoyer 2011).
1.7Einfluss psychischer Erkrankungen auf körperliche Gesundheit
Je früher psychische Erkrankungen auftreten, desto wichtiger ist eine rasche diagnostische Zuordnung, um eine spezifische Behandlung planen zu können. Eine insuffiziente oder fehlende Behandlung psychischer Erkrankungen erhöht das Risiko, somatische Krankheiten wie Adipositas, Herz-Kreislauferkrankungen, Diabetes Mellitus oder chronische Schmerzsyndrome zu entwickeln (Gaspersz 2018). Diese Zusammenhänge sind bis heute nicht gut verstanden, unterstreichen jedoch die Notwendigkeit einer qualifizierten psychiatrischen Versorgung für uns alle.
1.8Zusammenhang psychischer und somatischer Erkrankung
Unter Berücksichtigung der Komplexität des menschlichen Organismus lassen sich diagnostisch-therapeutische Aspekte nicht isoliert der Schublade „Psychische Erkrankung“ oder „Somatische Erkrankung“ zuordnen. Gerade schwere psychische Erkrankungen stellen oftmals, für sich allein genommen oder aufgrund biologischer Veranlagung, einen Risikofaktor für sowohl kardiovaskuläre als auch metabolische Erkrankungen dar. Personen mit bipolarer Störung haben ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle (Yuan 2022), diejenigen mit Depression weisen ein erhöhtes Risiko für Myokardinfarkte auf (van der Kooy 2007). Schizophrenieerkrankte haben ein erhöhtes Risiko, ein metabolisches Syndrom auszubilden (Mohd Ahmed 2024). Dies trifft sowohl für medikamentös behandelte als auch für unbehandelte Erkrankte zu.
1.9Insuffiziente Behandlung somatischer Erkrankungen
Non-Adhärenz, Stigmatisierung und Barrieren im Zugang zu medizinischer Behandlung stellen nur einzelne Faktoren dar, aufgrund derer die medizinische Versorgung insbesondere schwer psychisch erkrankter Personen bei weitem nicht dem qualitativen Anspruch gerecht wird, der hinsichtlich der medizinischen Erkenntnisse und Behandlungsmöglichkeiten angestrebt wird. Menschen mit psychischen Erkrankungen sterben im Durchschnitt 13 bis 30 Jahre früher als die Vergleichspopulation ohne psychische Erkrankung (Rosenbaum 2016). Andererseits besteht eine Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen, jedoch nicht mit der notwendigen Konsistenz und mitunter lediglich in niedrigschwelligen Settings wie beispielsweise Notaufnahmen. Es ist davon auszugehen, dass etwa die Hälfte der psychisch erkrankten Personen eine somatische Erkrankung aufweist. Subgruppen wie etwa von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen mit psychischen Erkrankungen weisen eine noch höhere Prävalenz von somatischen Erkrankungen auf (Mitchell 2018).
1.10Veränderungen der Versorgungsstruktur
Seit den späten 1980er-Jahren erfolgte ein fortwährender Abbau stationärer Behandlungskapazitäten. Einen der wesentlichen Gründe dafür stellte die Reform der Psychiatrie-Enquête von 1975 dar. Diese hatte das Ziel, die zum damaligen Zeitpunkt überwiegend im außerstädtischen Raum und innerhalb großer Landeskrankenhäuser untergebrachte Erkrankte wieder in deren Herkunftsgemeinden zurück zu integrieren. Das heißt, während vor einigen Jahrzehnten chronisch psychisch Erkrankte oft noch jahrelang in Landeskrankenhäusern „beheimatet“ wurden, setzte die Politik in den letzten Jahrzehnten eher auf ambulante Versorgung und kürzere stationäre Behandlungen. Die mit dem Bettenabbau notwendig werdenden alternativen ambulanten Behandlungsmöglichkeiten wurden jedoch speziell für schwerer erkrankte Personen nur unzureichend ausgeweitet. Aufgrund von Veränderungen in den Sozialgesetzbüchern sowie Verantwortlichkeiten von Kostenträgern besteht mittlerweile eine stark sektorisierte Versorgungslandschaft, welche in Zusammenwirkung mit zunehmender Verknappung ambulanter Behandlungsressourcen zur Diagnostik und Behandlung psychiatrischer Erkrankungen eine strukturelle Versorgungsproblematik mit sich bringt (Bramesfeld 2023).
1.11Ebenen der Versorgungsproblematik
In den letzten Jahren war ein deutlicher Anstieg psychiatrischer Notfälle zu verzeichnen, sodass fundierte Kenntnisse über psychische Erkrankungen und entsprechende Fertigkeiten in Einschätzung und Umgang mit Betroffenen von erheblicher Relevanz für im Gesundheitswesen tätige Personen sind (Pajonk 2001). Da die präklinische Notfallversorgung psychisch erkrankter Personen häufig auf der Grundlage unzureichender Informationen, unter Annahme möglicher Gefährdungsaspekte sowie mit beschränkten zeitlichen Ressourcen erfolgt, stellt der bei den beteiligten Strukturen entstehende Druck ein Versorgungshindernis dar. Mitunter fällt es akut psychisch Erkrankten schwer, bei sich eine Behandlungsbedürftigkeit zu erkennen, sodass Erstversorger sich auch mit juristischen Themen wie Freiwilligkeit und entsprechenden Rechtsgrundlagen auseinandersetzen müssen. Es ist damit zu rechnen, dass eine Versorgung von der betroffenen Person aufgrund krankheitsbedingter Wahrnehmung abgelehnt wird. Außerdem muss der Schutz eingesetzter Hilfskräfte berücksichtigt werden. Diese und weitere Umstände geben Anlass, auf eine Befähigung der handelnden Strukturen hinzuarbeiten, um neben einer qualitativ hochwertigen auch eine möglichst sichere Notfallversorgung psychisch erkrankter Personen, aber auch für die handelnden professionellen Kräfte zu ermöglichen.
1.12Gesellschaft und psychische Erkrankungen
Trotz der deutlichen Verbesserung der psychiatrischen Versorgungsmöglichkeiten sowie der zunehmenden gesellschaftlichen Wahrnehmung einzelner psychischer Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten erfahren gerade schwer erkrankte Personen weiterhin Ausgrenzung und einen erschwerten Zugang zum Hilfesystem. Andererseits werden Personen mittlerweile niedrigschwellig gegen ihren Willen in psychiatrische Kliniken eingewiesen, da störende Verhaltensweisen aus ordnungspolitischer Sichtweise scheinbar nicht anders adressiert werden können. Letztlich findet teilweise eine zunehmende Pathologisierung von Verhaltensweisen statt, die jedoch mit einer psychischen Erkrankung im engeren Sinne häufig nicht in Einklang zu bringen sind. So muss die Frage gestellt werden, ob nicht alternative Hilfestrukturen niedrigschwelligen Zugang liefern sollten, anstatt Personen ohne echten psychiatrischen Hilfebedarf kurzerhand in psychiatrische Kliniken zu verbringen (Schöttle 2023). Wohnungslose Personen weisen mit einem Anteil von bis zu 77% eine psychische Erkrankung auf (Schreiter 2017). Ein noch höherer Anteil an psychischen Erkrankungen findet sich bei inhaftierten Personen. Die Zahlen inhaftierter Personen steigen seit Jahren ebenso wie die Anzahl forensisch-psychiatrischer Unterbringungen stetig an.
1.13Fehlende Kenntnis von Hilfestrukturen
Einige der aufgeführten Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Initialversorgung psychiatrischer Erkrankungen vermehrt im präklinischen Setting durch Rettungswesen bzw. Notärzte, durch mehr oder minder interdisziplinäre Notaufnahmen oder den allgemein- bzw. hausärztlich niedergelassenen Bereich erfolgt (Sieber 2020). Tatsächlich wird der Großteil der Personen mit psychischen Erkrankungen von niedergelassenen Allgemeinmedizinern oder internistischen Fachärzten behandelt (Gaebel 2013). Der zielgerichtete und angemessene Umgang mit psychiatrischen Notfällen stellt also an alle in der Versorgung beteiligten Strukturen und Institutionen hohe Anforderungen. Die individuell beste Versorgung psychischer Erkrankungen findet nicht immer im stationären Sektor statt, Unterstützung kann auch durch nicht-stationäre Hilfesysteme geleistet werden (s. Kap. 9). Die Kenntnis der Strukturen regionaler Hilfesysteme ist daher von Vorteil.
1.14Risiko für Helfende
Das Phänomen des Second-Victim bzw. der sekundären Traumatisierung hat im Kontext der Arbeit im Gesundheitssektor im Laufe der Covid-Pandemie an gesellschaftlicher Wahrnehmung gewonnen (Strametz 2020). Angesichts belastender Einsätze besteht bei „helfenden Berufen“ im Gesundheitswesen, bei Feuerwehr oder der Polizei ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Traumafolgestörungen bei Hilfskräften (Schulten 2020). Hier bedarf es gezielter Strukturen, um Risiken zu identifizieren, entsprechende Interventionsansätze herauszubilden und Störungen bei Betroffenen zu erkennen. Zudem müssen Kontakt- und Anlaufstellen für betroffene Hilfskräfte etabliert werden. Gute und sichere Versorgung von Patienten beginnt mit einer hinreichend qualifizierten Ausbildung der beteiligten Hilfskräfte.
1.15Ziel des Titels
Die Autoren sind der Überzeugung, dass mit einer fundierten Befähigung im Umgang mit psychischen Erkrankungen sowohl die Behandlungsabläufe für betroffene Personen als auch die Prozessabläufe für beteiligte Professionen erheblich verbessert werden können. Den Autoren ist durchaus klar, dass aufgrund der mitunter erheblichen regionalen Unterschiede einzelner Versorgungssysteme die Entwicklung einer pauschalen Verfahrensweise für den Umgang mit psychisch erkrankten Personen ein unrealistisches Ziel darstellt. Vielmehr geht es darum, die gemeinsamen Schnittstellen und das Ineinandergreifen einzelner Maßnahmen sowie die verschiedenen Verantwortlichkeiten der beteiligten Kräfte auszuleuchten und unter konstruktiven Aspekten zu hinterfragen, um ein besseres Verständnis für die Prozessgestaltung entwickeln und letztlich mehr Handlungssicherheit herzustellen zu können. Die Autoren beschäftigen sich seit vielen Jahren mit psychischen Ausnahmezuständen betroffener Personen sowie deren Implikationen im präklinischen und klinischen Setting und wollen mit dem Titel zur transparenten Wissensvermittlung und praktischer Qualifikation von Einsatzkräften beitragen.
2Differentialdiagnostik und Evaluation psychiatrischer NotfälleDeborah Scholz-Hehn und Simon Kurzhals
2.1Diagnostische Limitationen
Unübersichtliche Situation, unklare Informationslage, unzureichend stabiler Kontakt zum Patienten; psychiatrische Notfallsituationen können die Zugangs- und Handlungsmöglichkeiten derart erschweren, dass diagnostische Zuordnung sowie gezielte Befunderhebung deutlichen Limitationen unterliegen. Weitere Gründe für erschwerte Untersuchungsbedingungen sind in Tabelle 1 aufgeführt. Das Vorliegen einer psychischen Erkrankung kann dazu führen, dass eine gezielte und symptomorientierte Untersuchung mitunter unmöglich werden kann. Umso wichtiger erscheint daher die Notwendigkeit der Evaluation einer möglicherweise zugrundeliegenden organischen Erkrankung als Genese psychiatrischer Symptomatik (Pajonk 2005).
Tab. 1 Unterschiedliche Untersuchungsbedingungen
2.2Verhaltensbeobachtung
Die Objektivierung psychopathologischer Auffälligkeiten stellt gerade im präklinischen Setting eine Herausforderung dar. Die häufig akute Symptomatik und ein oftmals nicht optimales Umfeld zur Anamneseerhebung stellen bereits erhebliche Einschränkungen der Untersuchungsbedingungen dar. Berücksichtigt werden muss zudem, dass es manchen Personen nicht möglich ist, schlüssige Angaben zu machen, was eine gezielte und systematische Befundung der Psychopathologie zusätzlich erschwert. Daher kann eine Verhaltensbeobachtung mitunter eine relevante zusätzliche Informationsquelle zur Abwägung von gefährdenden Aspekten darstellen. Relevante Fragestellungen für die weitere Vorgehensweise können sein:
Kann eine Exploration der betroffenen Person erfolgen?
Ist die Kontaktfähigkeit beeinträchtigt? (lässt sich auf ein Gespräch ein, nimmt Blickkontakt auf oder ignoriert eintreffendes Rettungspersonal)
Wie verhält sich die betroffene Person bei Ansprache? (reagiert kaum, nimmt Blickkontakt auf, ist dann aber schnell wieder abgelenkt, nimmt Kontaktangebot dankbar und freundlich an …)
Womit beschäftigt sich die betroffene Person zum aktuellen Zeitpunkt? (gedanklich mit einem Thema beschäftigt, Angst vor etwas …)
Bestehen Anzeichen für Eigen- oder Fremdgefährdung? (Selbstverletzung, ausgesprochene Drohungen, Abschiedsbrief …)
2.3Fremdanamnese
Fremdanamnestischen Angaben kommt bei psychiatrischen Symptomen eine besondere Bedeutung zu, da betroffene Personen mitunter nicht in der Lage sind, eine klare, detaillierte Anamnese abzugeben. Angaben von Angehörigen, nahestehenden Personen oder Vorbehandelnden sind ein unverzichtbarer Baustein der Anamnese (Sood 2009). Der Realitätsbezug betroffener Personen kann derart beeinträchtigt sein, dass valide Informationen durch Eigenanamnese allein nicht zu erhalten sind. Wichtige fremdanamnestische Informationen sind zum Beispiel, seit wann Auffälligkeiten bestehen, ob diese im zeitlichen Zusammenhang mit bestimmten äußeren belastenden Umständen aufgetreten sind oder ob eine psychische Erkrankung bereits bekannt ist.
2.4Psychopathologischer Befund
Die Erhebung des psychopathologischen Befundes erfolgt beschreibend und hat die Erfassung von Erleben und Verhalten zum Ziel, um Auffälligkeiten auf Symptomebene möglichst objektiv abzubilden. Eine Objektivierung psychopathologischer Auffälligkeiten ist gerade für nicht psychiatrisch tätige Professionelle im Gesundheitswesen oftmals nicht ohne weiteres möglich. Jedoch ist es auch im präklinischen Setting sinnvoll, Zustandsbilder anhand der Psychopathologie zu beschreiben und diese syndromal benennen zu können. So können diagnostische Einschätzungen schneller ermöglicht werden. Zudem wird der Informationsfluss im Rahmen von Übergaben erleichtert.
2.5Das AMDP-System
Mithilfe des AMDP-Systems lässt sich der psychopathologische Befund strukturiert erfassen und dokumentieren. Das von der Arbeitsgemeinschaft für Methodik und Dokumentation in der Psychiatrie erarbeitete System besteht aus einem Manual, welches psychopathologische Symptome aufführt und Ratingbögen für die Dokumentation psychischer und somatischer Symptome beinhaltet (Stieglitz 2017). Bei der ausführlichen Erhebung des psychopathologischen Befundes lassen sich so 100 Einzelsymptome des psychischen und 40 Einzelsymptome des somatischen Befundes beschreiben. Entsprechend der eingeschränkten zeitlichen Ressourcen im psychiatrischen Notfall wird anhand der Ausführlichkeit des AMDP deutlich, dass die Anwendung zur Befunderhebung im präklinischen Setting zeitlich weder sinnvoll noch umsetzbar ist. Dennoch erleichtert die Kenntnis des Befundungssystems das Erfassen psychiatrisch relevanter Symptome und ermöglicht es so, Zustandsbilder gezielt zu beschreiben und sich einer syndromalen Zuordnung zu nähern. Ausgewählte Symptome können auszugsweise der folgenden Auflistung entnommen werden.
Bewusstseinsstörungen:
Verminderung, Einengung oder Verschiebung des Bewusstseins
Orientierungsstörungen:
Orientierung zu Zeit, Ort, Situation und eigener Person
Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstörungen:
Konzentrations- und Auffassungsstörungen
Wahn:
Wahngedanken, Beziehungswahn, Beeinträchtigungs- und Verfolgungswahn, Größenwahn
Sinnestäuschungen:
Akustische und optische Halluzinationen, Illusionen
Formale Denkstörungen:
Verlangsamt, Eingeengt, Weitschweifig, Zerfahren, Ideenflüchtig
Antriebsstörungen, Störung der Psychomotorik:
Antriebshemmung oder -steigerung, Anspannung, Katatonie
Ich-Störungen:
Derealisations- und Depersonalisationerleben, Gedankeneingebung
Affektstörungen:
Deprimiert, Hoffnungslos, Ängstlich, Euphorisch, Gereiztheit, Verflachung
andere Störungen:
Sozialer Rückzug, Fehlendes Krankheitsgefühl, Suizidalität
2.6Medical Clearing
Der umstrittene Begriff des Medical Clearing beschreibt einen diagnostischen Vorgang, welcher sicherstellen soll, dass einer psychischen Erkrankung keine somatische Ursache zugrunde liegt (Beerhorst 2012). Letztlich unterliegt jedoch jede medizinische Untersuchung ihren Limitationen, da Screeninguntersuchung nicht darauf ausgelegt sind, alle denkbar bestehenden und möglicherweise gleichzeitig vorliegenden Erkrankungen zu erkennen.
Jegliche bestehende Psychopathologie kann neben verschiedenen psychischen Erkrankungen durch organische Erkrankungen bedingt sein.
2.7Medical Mimics
Viele somatische Erkrankungen können psychiatrische Symptome auslösen (s. Tab. 2). Orientierungs- und Merkfähigkeitsstörungen können im Rahmen eines Delirs oder Konzentrationsstörungen und Verwirrtheit bei Elektrolytstörungen auftreten (McKee 2016), auch im Rahmen von Intoxikationen entwickeln sich häufig psychiatrische Symptome (Testa 2013). Daher ist unter Notfallbedingungen eine Anamnese, körperliche Untersuchung sowie Messung der Vitalparameter unabdingbar, insofern es Sicherheitsbelange und das Verhalten von betroffenen Personen zulassen. Da psychiatrische Fachkliniken oftmals unzureichende Möglichkeiten der Überwachung und Behandlung akuter somatischer Erkrankungsbilder haben, sollte bereits präklinisch eine erste Einschätzung einer möglicherweise zugrundeliegenden körperlichen Ursache erfolgen.
Fallbeispiel
Der Rettungsdienst wird zu einer verhaltensauffälligen 63-jährigen Frau gerufen. Der Ehemann berichtet, dass seine Frau sich in den letzten Tagen zunehmend aggressiv zeige. Heute sei sie ins Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelaufen und habe sich nackt ausgezogen. Nachdem sie sich entkleidet hatte, lief sie auf die Straße und versuchte, Fahrzeuge anzuhalten. Sie verhalte sich zunehmend sexuell enthemmt und äußere sich obszön, was für seine Frau vollkommen untypisch sei. Eine psychische Erkrankung habe bisher nie bestanden. Laut Ehemann sei die Frau vor kurzem aus der Klinik entlassen worden, wo aufgrund der Erstdiagnose einer COPD eine Behandlung mit Kortison initiiert wurde. Bereits im Rahmen der stationären Behandlung sei gereiztes Verhalten bei seiner Frau beobachtet worden.
Tab. 2 Auswahl psychiatrischer Symptome und mögliche somatische Ursachen
2.8EXKURS: Katatonie
Die Katatonie wird psychopathologisch der Psychomotorik zugeordnet und äußert sich neben unzureichender Reaktion auf Ansprache durch herabgesetzte Beweglichkeit, Haltungs- und Verhaltensstereotypen oder psychomotorische Erregungszustände, die aufgrund der Möglichkeit somato-vegetativer Komplikationen wie konsekutiven Flüssigkeitsmangel, Blutdruck- und Herzfrequenzanstieg, Rhabdomyolyse und akuter Niereninsuffizienz einen gut behandelbaren Notfall darstellt. Anders als bis weit ins 20. Jahrhundert angenommen, stellt die Katatonie kein ausschließlich psychiatrisches Syndrom dar, es kann sich auch um den Ausdruck einer somatischen Erkrankung handeln, welche aufgrund unterschiedlicher Ursachen auftreten kann (s. Tab. 3), deren Grundlage medizinisch abgeklärt und dann sowohl kausal oder eben symptomatisch behandelt werden muss. Ähnlich dem deliranten Syndrom werden katatone Symptome, die in gradueller Intensität vorliegen können, häufig übersehen und nicht im hinreichenden Maß behandelt. Es wird davon ausgegangen, dass die Prävalenz katatoner Symptome bei stationär behandelten Personen bei 5–18% liegt, in Notaufnahmen sogar noch höher (Jaimes-Albornoz 2012).
Tab. 3 Mögliche Ursachen einer Katatonie
2.9Behandlungsbereitschaft
Inwieweit betroffene Personen eine wirksame Erklärung zur Bereitschaft der Behandlung abgeben können, ist von Faktoren wie Schwere der Erkrankung oder auch der bestehenden Einsichtsfähigkeit abhängig. Die gesetzlichen Regelungen des Psychisch-Kranken-Gesetzes erlauben als letztes Mittel eine Unterbringung gegen den geäußerten Willen von Betroffenen, insofern eine schwere psychische Erkrankung und eine entsprechende Gefährdungskonstellation vorliegt (Bohnert 2000).
2.10Eigen- und Fremdgefährdung
Psychische Erkrankungen können mit einer vitalen Gefährdung für die betroffene Person einhergehen. Anders als bei körperlichen Erkrankungen können jedoch auch andere Personen durch krankheitsbedingte Verhaltensweisen gefährdet sein. Daher ist in jedem Fall eine gezielte Exploration suizidaler Denk- und Verhaltensweisen notwendig, um sowohl bei Betroffenen eine Entlastung erzielen zu können als auch eine Risikoeinschätzung vornehmen zu können (s. Tab. 4) Ein psychotisches Syndrom kann sich beispielsweise in Form von Wahnerleben oder Halluzinationen, jedoch auch mit psychomotorischen Phänomenen wie Erregung oder Katatonie äußern. Die Symptomatik kann zu irrationalen Handlungen und aggressiven Verhaltensweisen führen. Auch Intoxikationen mit psychoaktiven Substanzen haben Einfluss auf Wahrnehmung, Verhalten sowie auf Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit betroffener Personen.
Tab. 4 Ausgewählte Faktoren für gewalttätige oder suizidale Verhaltensweisen
vorbekannte Gewalttätigkeit
psychische Erkrankung
junges Alter, männliches Geschlecht
Verfügbarkeit von Waffen
Substanzmissbrauch
Impulsivität
Suizid in Anamnese oder Familie
psychische Erkrankung
höheres Alter, männliches Geschlecht
körperliche Erkrankung, Schmerzen
Diskriminierung, Randgruppe
Krieg, Flucht, Naturkatastrophen





























