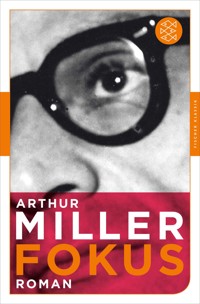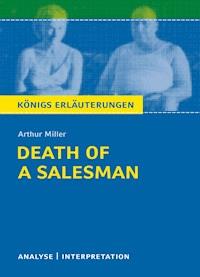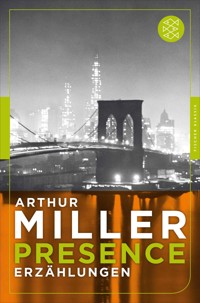
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Fischer Klassik Plus
- Sprache: Deutsch
Ein Band, der alle Erzählungen des großen Dramatikers und einfühlsamen Chronisten Amerikas versammelt. In seinen Stücken widmete sich Arthur Miller den großen Themen seiner Zeit, in seinen Stories galt seine Aufmerksamkeit den unauffälligen, intimen Ereignissen im Leben des Einzelnen. »Arthur Miller lebt und atmet in diesen Geschichten … Sie vervollständigen sein Werk. Mehr noch: Sie sind ein fesselndes Selbstporträt.« Jane Smiley
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Arthur Miller
Presence
Sämtliche Erzählungen
Über dieses Buch
Ein Band, der alle bisherigen Erzählungen in neuer Übersetzung und erstmals auf Deutsch die letzten Erzählungen des großen Dramatikers und einfühlsamen Chronisten Amerikas versammelt. In seinen Stücken widmete sich Arthur Miller den großen Themen seiner Zeit, in seinen Stories galt seine Aufmerksamkeit den unauffälligen, intimen Ereignissen im Leben des Einzelnen. Auch hier zeigt sich »seine Begabung, in einer klaren und knappen Sprache, Gefühle auf den Punkt zu bringen und Situationen auszuloten, wie sie für sein Schreiben charakteristisch sind«. The New York Times
»Arthur Miller lebt und atmet in diesen Geschichten … Sie vervollständigen sein Werk. Mehr noch: Sie sind ein fesselndes Selbstporträt.« Jane Smiley, The Guardian
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Arthur Miller wurde 1915 in New York City geboren. Er wuchs auf in Harlem und Brooklyn und studierte an der University of Michigan. Sein erstes Theaterstück schrieb er 1936. Den Durchbruch als Bühnenautor brachte ihm 1947 Elia Kazans Broadway-Inszenierung von ›Alle meine Söhne‹; ›Der Tod des Handlungsreisenden‹ trug ihm 1949 Weltruhm ein. Es folgte das von all seinen Stücken meistgespielte ,›Hexenjagd‹, und weitere Dramen. Für sein umfangreiches literarisches Werk, das außerdem zahlreiche Essays, einen Roman und Lebenserinnerungen einschließt, wurde er mit vielen Preisen ausgezeichnet. Arthur Miller verstarb 2005.
Uda Strätling lebt in Hamburg und hat u. a. Emily Dickinson, Henry David Thoreau, Sam Shepard, John Edgar Wideman, Aldous Huxley und Marilynne Robinson übersetzt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Coverdesign: buxdesign, München
Coverabbildung: Andreas Feininger/The LIFE Picture Collection/Getty Images
Erschienen bei FISCHER Taschenbuch
Frankfurt am Main, September 2015
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2009 unter dem Titel ›Presence, Collected Stories‹
bei Bloomsbury Publishing, London, New York and Berlin
Die Erzählung ›The Bare Manuscript‹ (Das entblößte Manuskript) wurde von Ulrich Blumenbach übersetzt
Deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403428-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort: Eine Frage der Distanz
Ich brauche dich nicht mehr
Ich brauche dich nicht mehr
Monte Sant’Angelo
Bitte nichts töten
Misfits
Jockey, Momentaufnahme
Die Wahrsagung
Ruhm
Schiffsschlossers Stunde
Suche nach einer Zukunft
Unansehnliche Frau, ein Leben
Unansehnliche Frau, ein Leben
I
II
III
IV
V
VI
Presence
Bulldogge
Der Auftritt
Biber
Das entblößte Manuskript
Die Terpentindestillerie
I
II
III
Presence
Vorwort: Eine Frage der Distanz
Die hier vorgelegten Geschichten sind alle in den letzten fünfzehn Jahren entstanden[1] und wurden, bis auf eine, zunächst in Zeitschriften veröffentlicht. Sie waren demnach nicht für einen Sammelband vorgesehen (obwohl ich, wenn ich sie jetzt zusammen lese, zu meiner Überraschung so etwas wie einen roten Faden entdecke). Ich habe sie zu meinem eigenen Vergnügen geschrieben, soweit man das überhaupt sagen kann, wenn man nicht für die Schublade arbeitet. Und Kurzgeschichtenschreiben bereitet, im Vergleich zur Entwicklung von Bühnenstücken, das größere Vergnügen, sofern man darunter etwas versteht, was in erster Linie Selbstzweck ist. Wir achten in diesem Land ja nicht sonderlich auf die Geschichten, die in Zeitschriften als Platzfüller zwischen Anzeigen dienen und eher unter ferner liefen rangieren, wie Bungalows in der Welt der Architektur.
Meinetwegen kann es bei dieser Haltung gern bleiben. Solange großen Formaten der Vorrang eingeräumt wird, bleibt dem Autor der Freiraum der kleinen Form, und die erlaubt ihm genau die Präzision, die sein Thema erfordert. Hier muss er nicht pro forma mehr sagen, als er weiß. Es gibt bei der Short Story eine Stimmlage, die es einem Erzähler inmitten der großsprecherischen Töne unserer Zeit noch gestattet, seine Wahrheit in einem Atemzug zu sagen oder herauszuposaunen. Wenn er von Haus aus Dramatiker ist, kommt ihm dabei manches entgegen; Sparsamkeit der Mittel und Erfüllung der Form – Qualitäten, die eine Kurzgeschichte zumindest aufweisen kann – bieten ein Vehikel für Gefühle und Geschichten, die in ihrer Dichte wahrhaftiger sind und dennoch aus diesem oder jenem Grund nicht auf die Bühne gehören.
Nun erwartet man von einem Dramatiker geradezu die Behauptung, er schreibe gern Kurzgeschichten, um sich der Schauspieler, Regisseure und des ganzen lästigen Theaterbetriebs zu entledigen, aber ich selbst habe, ehrlich gesagt, für Schauspieler und Regisseure eine Menge übrig. Und doch verspüre ich gelegentlich den Drang, Ereignisse und Entwicklung der Figuren nicht in dem Maß zu beschleunigen und einzudampfen, wie das beim Drama zwangsläufig der Fall ist, sondern vielmehr stillzustellen, um in aller Ruhe einzelne Aspekte in den Blick nehmen zu können; das ist aus meiner Sicht die wahre Stärke einer guten Short Story. Details, der Ort, das Wetter, Nuancen der Körpersprache – dergleichen spielt auf der Bühne, wo die Handlung das Geschehen vorantreibt und Wahrheit offenbar werden lässt, eine untergeordnete Rolle, während sich im Leben und in der Erzählung alles, der Schauplatz selbst, Beobachtungen, Stimmungen, plötzliche Anwandlungen von Angst oder Besorgnis, mitteilen und Gewicht haben kann.
Manche der hier versammelten Geschichten wären nie und nimmer etwas fürs Theater, einige möglicherweise schon. Aus den letztgenannten wurden teils deshalb keine Stücke, weil sie sich für mein Gefühl dem dramatischen Gestus verweigerten, der letzten Endes ja schamlos ist. Schließlich ist der Dramatiker ein verhinderter Schauspieler; eigenbrötlerische Denker schreiben keine Theaterstücke – zumindest keine spielbaren. Das mag auch der Grund sein, weshalb Dramatiker sich in mittleren Jahren oft der Literatur zuwenden und von dubiosen Maskeraden lieber lassen. Die ganze Welt ist Bühne, aber es kommt die Zeit, wo man lieber auf dem Boden der Realität und daheim bleibt. Ich selbst erreiche diesen Punkt mittlerweile ein bis zwei Mal pro Woche (ohne deswegen immer das Glück zu haben, ein Thema wirklich am Schlafittchen packen zu können), und genau dies sind die Momente, da es sich anbietet, Kurzgeschichten zu schreiben. Sagen wir es so: Man trägt eine andere Maske, wenn man sich hinsetzt, um eine Geschichte zu schreiben. Man kann seinen Gegenspieler – Publikum und Kritiker – im Wartezimmer beim Zahnarzt, im Zug, Flugzeug oder Badezimmer leichter überrumpeln. Er nimmt weniger übel. Paradox, aber wahr ist, jedenfalls für mich, dass mir Erzählungen, obwohl sie bei Erscheinen meist sang- und klanglos untergehen, während ein Stück stets von allerhand Tohuwabohu begleitet wird, größere Nähe zum Leser erlauben, zu Fremden. Stückeschreiben ist aggressiv; wenn es ein freundliches, familiäres Genre gibt, dann die Erzählung. Ich kenne Tschechow besser durch seine Kurzgeschichten, scheint mir, als durch seine Dramen, und Shakespeare durch seine Sonette, die in seinem Fall die Entsprechung zur Short Story sind. Hemingway ist in seinen Kurzgeschichten ohne Frage fassbarer als in seinen Romanen, weniger kalkuliert und professionell. Zwar reißen uns »Die Kosaken« oder »Der Tod des Iwan Iljitsch« sicher weniger mit als Krieg und Frieden, aber sie sind auch weniger unglaubwürdig. Vielleicht liegt darin der Reiz – in der Erzählung strapaziert man die Glaubwürdigkeit nicht so, wenn auch nur deshalb, weil die Deutungsbögen kürzer sind, weniger dem Konkreten entrückt; man fängt Staunen schneller mit Überraschung, darum geht es ja letztlich beim Schreiben – und Lesen.
Das soll natürlich kein Einwand gegen Dramen und das Theater sein, ich möchte lediglich ein paar Unterschiede aufzeigen. Mich hat zum Beispiel immer gewundert, dass mir Dialoge in Kurzgeschichten schwerer fallen als in Dramen, eine Kuriosität, für die ich immer wieder wechselnde Erklärungen heranziehen musste. Mal dachte ich: Vielleicht weiß ich ja, dass kein Schauspieler die Worte je sprechen wird, also kommt es mir absurd vor, sie hinzusetzen. Dann wieder vermutete ich einen nur halbbewussten Widerstand dagegen, Dialoge in eine Prosaform einzuführen, die sie nicht zwingend erfordert, und folglich ein hinderliches Gefühl von Willkür. Inzwischen glaube ich eher, dass es um einen Maskenstreit geht, einen Widerstreit der Register. Gesprochener Text ist »Rede«, ist an eine Zuhörerschaft gerichtet, muss auf ganz eigene Art emphatisch und klar sein und verlangt unausgesprochen eine Antwort; Rede und Gegenrede eines Bühnendialogs sind zwei Seiten eines dialektischen Widerstreits. Versetzt man aber Dialogpassagen einer Erzählung in eine ähnliche Spannung, verzerrt dies das ganze Textumfeld. Das ist so, als würde ein Freund, der einem von einem Vorfall berichtet, plötzlich aufspringen, den Blick in die Ferne richten und seine Schilderung mit verteilten Rollen geben. Die plötzliche Überformung nach solchen Vorgaben gleicht geradezu einem Einsatzzeichen. Vielleicht ist es deshalb unmöglich, Dialoge aus erzählenden Texten für die Bühne zu übernehmen. Sie mögen auf dem Papier bühnenreif erscheinen, und gelegentlich sind sie es sogar, aber meist zielen die Dialoge eines Prosaautors aufs Auge, nicht aufs Ohr; gesprochen wirken sie nicht. Umgekehrt verlangen Erzähldialoge klanglich Zugeständnisse an das Auge. Und auch das hat für den Dramatiker seinen Reiz, denn wenn man Dialoge fürs Auge schreibt, staunt man zwangsläufig von neuem über das Wunder der Vorgänge auf der Bühne, und es drängt einen wieder, Stücke zu schreiben und auf sprechbare Weise erzählen zu dürfen. Eine Ironie des Lebens, scheint es, denn als Schüler fühlte ich mich umso mehr zu Büchern hingezogen, je mehr Dialog sie beim ersten kursorischen Blättern zu bieten versprachen. Bücher, glaubte ich, würden um der Dialoge willen geschrieben; jedenfalls wurden sie um der Dialoge willen gelesen. Denn nur in den Dialogen, fand ich, hörte der Autor auf zu schwätzen und sich einzumischen: Sein laufender Kommentar verhielt sich zum Dialog wie ein Leitartikel zur Nachricht.
Eine recht schlichte Vorstellung, zugegeben, aber sie enthält trotzdem ein Körnchen Wahrheit. Alle tradierten Erzählformen – Kurzgeschichte, Roman, Drama – sind Ausdruck der unterschiedlichen Distanz, die ein Autor jeweils gegenüber dem gefährlichen Publikum einzunehmen hat, das er bezirzen, bedrohen und auf irgendeine Weise zähmen muss. Der Dramatiker stellt sich auf der Bühne dem Monster fast leibhaftig, der Prosaautor dagegen, wie dürftig seine Deckung auch sein mag, ist in dieser Hinsicht am besten geschützt, dafür allerdings außer Hörweite des Applauses, außer Sichtweite der unzähligen Zuschauer, die gebannt im Theater sitzen, hineingesogen in seine Erfindungen. Wenn ein Prosaautor sich daher an ein Bühnenstück wagt, beziehungsweise ein Dramatiker an eine Erzählung, verringert, beziehungsweise vergrößert er die Distanz zum beängstigenden Zentrum des Bühnengeschehens. Gelegentlich tritt ein Dickens, ein Mark Twain – im Bemühen, alle Masken herunterzureißen – persönlich als Redner auf oder ein Sinclair Lewis als Mitglied des Schauspielerverbands, Hemingway als Charakterkopf jenseits des Werks. Aber es gibt der Masken kein Ende; hinter der, die wir ablegen, kommt nur die gegenwärtig getragene zum Vorschein. Entscheidend ist daher nicht Wahrhaftigkeit – wer wollte da für sich selbst die Hand ins Feuer legen? Es geht vielmehr um die Darstellung einer bestimmten Vision aus der angemessenen Distanz, die Findung des richtigen Tons für die Sicht auf einen Gegenstand, eine Figur, ein Ereignis. Keine Erzählform kann für sich allein alles leisten; die hier vorgelegten Erzählungen sind schlicht das, was ich aus einer anderen Distanz gesehen habe.
A.M.
November 1966
Fußnoten
[1]
Arthur Miller bezieht sich mit dieser Zeitangabe auf die ersten beiden Sammlungen seiner Erzählung und nicht auf PRESENCE, seine letzten Erzählungen, die hier zum ersten Mal auf Deutsch veröffentlicht werden.
Ich brauche dich nicht mehr
Zum Gedenken an Pascal Covici
Ich brauche dich nicht mehr
Wiederholt war er in den letzten Tagen weniger gewarnt als auf ziemlich allmächtige Art belehrt worden, dass Gott diese Woche Freitag das Schwimmen verbot. Und heute war Freitag. Er hatte sich das Meer jeden Tag viele Male beguckt, und es war tatsächlich rauer und rauer geworden und die Farbe des Wassers ganz komisch. Nicht grün oder blau, sondern irgendwie grau und an manchen Stellen sogar schwarz, und jetzt, wo das Wasser vor Sünden kochte, hauten die Wellen so hart auf den Sand, dass der Kantstein, auf dem er saß, bis ganz in seinen Rücken rauf bebte. Irgendeine Verbindung kam unter dem Strand durch und verlief sich hier am Ende der Straße.
Die Wellen schlitterten heran wie große, trunkene Häuser, dann fielen sie platt aufs Gesicht und zerspritzten auf dem harten Sand. Er hielt in den schwellenden Fratzen der Brecher weiter Ausschau nach den bärtigen Sünden, die da draußen, wie er wusste, herumtrieben wie Seetang, und manchmal erhaschte er einen kurzen Blick. Sie waren wie Bärte, nur meterlang, und das Gesicht des Mannes, aus dem sie wuchsen, sah man nicht. Es waren irgendwie mehrere Bärte, aber sie gehörten alle zu demselben Gesicht. Als würde dort ein Mann knapp unter Wasser treiben, dann schnell wie ein Fisch verschwinden und wieder an einer anderen Stelle treiben. Weil nämlich heute und morgen Tischa beAv oder Rosch ha-Schana oder Jom Kippur oder einer dieser Feiertage war, von denen Grandpa und die anderen alten Männer irgendwie immer wussten, wann sie da waren – Tage, an denen sich alle herausputzten und er diesen Tweedanzug und eine Fliege und neue Schuhe tragen musste und alle den ganzen Tag lang nichts essen durften außer ihm, weil er noch keine sechs war und noch keine Hebräischstunden hatte. Wenn er erst sechs wäre, würde er außerdem Klavier- oder Geigenstunden haben, und sobald er mit Klavier oder Geige angefangen hätte, würde er an einem Feiertag wie diesem auch nichts essen dürfen, genau wie sein Bruder nicht. Bis dahin aber durfte er seinen Bruder und den Vater in der Synagoge besuchen, musste aber nicht. Es zu tun war zwar richtig, aber wenn er ungeduldig wurde und raus wollte an die frische Luft, dann konnte er gehen, ohne dass ihm jemand Vorwürfe machte oder ihn auch nur beachtete. Er durfte praktisch alles, weil er immer noch erst fünf war.
Heute Morgen nach dem Frühstück, das er ganz allein an dem mit Wachstuch bespannten Küchentisch eingenommen hatte, nachdem sein Vater und sein Bruder zum Beten gegangen waren, hatte er beschlossen, danach den ganzen Tag keinen einzigen Bissen mehr zu sich zu nehmen. Aber um elf hatte seine Mutter ihm wie immer draußen ihr Marmeladenbrot hinterhergetragen und, als er es nicht essen wollte, gemeint: »Nächstes Jahr …«, und da hatte er ihr zuliebe ein Auge zugedrückt und gegessen. Es hatte gut, aber nicht köstlich-gut geschmeckt, und prompt war er böse geworden, weil sie es ihm aufgedrängt hatte. Dann war sie mittags wieder aufgetaucht, um ihn zum Essen zu rufen, und missmutig hatte er schon wieder gegessen. Und jetzt wünschte er sich hier auf seinem Kantstein, während er auf das Meer hinausstarrte und dem Donnergebrüll lauschte, wirklich sehr, sein Vater oder sein Bruder hätten ihm klipp und klar verboten, überhaupt zu essen. Das hätte er gekonnt. An der Seite seines großen Vaters und seines guten Bruders hätte er sogar den ganzen Tag ohne Wasser überstanden. So, wie er jetzt zum Beispiel nicht im Traum daran dachte, ins Meer zu gehen, obwohl ihn der Tweedanzug im Nacken und an den Schenkeln pikste und obwohl er es sich nicht verkneifen konnte, sich vorzustellen, wie prima sich das Wasser auf der Haut anfühlen würde. Seine Mutter hatte gesagt, es wäre in Ordnung, wenn er statt des Anzugs Baumwollshorts anzöge, aber er dachte gar nicht daran, das piksige Ding abzulegen. Ein Feiertag war ein Feiertag. Er versuchte, aus seinem Gedächtnis zu tilgen, dass er zu Mittag gegessen hatte. Er versuchte, Mordshunger zu haben, konnte sich aber an das Gefühl nicht genau erinnern. Wenigstens war er seit dem Mittagessen nicht wie sonst auf ein Glas Milch in den Bungalow zurückgekehrt. Er zählte nach und tröstete sich, halb überzeugt, damit, dass er heute immerhin schon dreimal gefastet habe, dann wischte er etwas Sand von seinen Schuhen, um ganz rein zu sein. Gleich darauf aber fühlte er sich schon wieder rastlos; allein konnte er an nichts glauben, und er wünschte, sein Bruder oder sein Vater wäre da, um zu sehen, wie rein er war. Dann fiel ihm plötzlich ein, dass er, ohne sich groß beherrschen zu müssen, schon den ganzen Tag nicht in der Nase gebohrt hatte, und fühlte um sich Silberglanz. Nur war keine Menschenseele da, es zu sehen.
Das Meer donnerte weiter. Der Strand war weiß wie Salz und menschenleer. Es gab kein Eiswagenbimmeln, kaum mehr Autos vor den Bungalows an der Straße, weil schon September war, und die kleinen Veranden, eine genau wie die andere, waren fast alle leer. Es standen auch so gut wie keine Mülltonnen draußen. Wenn er in der Tasche die Hand an seinen Schenkel drückte, spürte er das verrostete Taschenmesser, das er letzte Woche im verlassenen Bungalow der Levines erbeutet hatte. Es war der beste Schatz, den er je zu Saisonende gefunden hatte, wenn er den anderen Jungen auf ihren Raubzügen folgte. Er fragte sich beiläufig, warum Mütter eigentlich immer so viele Haarklammern und haarige Seifenstücke zurückließen. Bei den Vätern waren es Rasierklingen, aber die steckten nicht in den Ritzen der Schubladen und unter Matratzen. Er fragte sich, warum Mütter verstummten oder das Thema wechselten, wenn er ein Zimmer betrat. Unter ihren Röcken war es dunkel. Väter redeten munter weiter, beachteten einen kleinen Jungen, der hereinschneite, so gut wie gar nicht, und bei ihnen war einfach mehr Licht.
Eine neue Seltsamkeit auf dem Meer zerstreute solche Erinnerungen. Er sah die Oberfläche sich aufrichten. Weit, weit draußen erhob sich ein Kamm so breit wie das Meer selbst, und es kündigte sich ein neues Grollen an, das tiefer war als alles, was er bisher gehört hatte. Er schoss herrlich erschreckt hoch, bereit, die Flucht zu ergreifen. Höher und höher wuchs der Kamm, bis da eine einzige, gerade Wand fast schwarzen Wassers stand. Niemand sonst sah sie, begriff er, nur er und der Sand und die leeren Veranden. Und jetzt kippte die Wand, schwer und steinhart, und er hörte sie fast vor sich hin kreischen, als sie kopfüber aufschlug und die Gischt hochspritzte wie fünfzig Gartenschläuche auf einmal. Er wandte sich ab, froh, dem Tod entronnen zu sein, und machte sich auf den Weg nach Hause, um zu berichten. Die freudigen Worte formten sich schon in seinem Mund. »Das Wasser ist ganz, ganz hart geworden, wie die Straße, und dann ging es hoch in die Luft, bis ich den Himmel gar nicht mehr sehen konnte, und dann, stell dir vor, dann hab ich den Bart gesehen!« Er blieb abrupt stehen.
Er war sich nicht sicher, plötzlich, ob er den Bart gesehen hatte. Er erinnerte sich, ihn gesehen zu haben, aber er war sich nicht sicher, ob er ihn wirklich gesehen hatte. Er stellte sich seine Mutter vor; sie würde ihm glauben, wenn er es ihr sagte, wie sie immer alles glaubte, was er von seinen Erlebnissen erzählte. Doch gleich beschlich ihn ein trauriges Gefühl und machte ihn unschlüssig, weil ihm einfiel, dass sie in letzter Zeit weniger begeistert war von dem, was er ihr erzählte. Zwar nannte sie ihn nicht einen Lügner, wie es sein Bruder Ben tat, oder fragte ihn aus wie der, bis unstimmige Details alles verdarben. Aber in letzter Zeit war etwas an ihr wie nicht genau zuhören, nicht wie sonst immer. So dass er selbst bei ihr neuerdings ausschmücken musste, damit sie ihm überhaupt noch zuhörte, mit Sachen, von denen er wusste, dass sie nicht stimmten. Wie das mit dem Pferd vom Milchmann und der zertretenen Fliege. Es hatte wirklich eine Fliege zertreten, aber als sie zu seinem Bericht nur genickt hatte, hatte er außerdem gesagt, dass das Pferd dann noch mal den Huf gehoben, auf den Boden gesehen, gewartet und eine zweite Fliege zerstampft hatte, und sogar eine dritte. Sein blasses Gesicht verdüsterte sich. Wenn er ihr jetzt mit der Sache vom Meer kam, würde er wahrscheinlich sagen müssen, dass er unter Wasser nicht nur den Bart, sondern auch das Gesicht gesehen hätte, und womöglich die Augen beschreiben. Im Geiste sah er die Augen ganz deutlich – sie waren blau mit fetten weißen Lidern, und sie konnten durchs salzige Wasser glotzen, ohne zu blinzeln –, aber das war nicht dasselbe wie wissen, dass er die Augen wirklich gesehen hatte. Wenn sie es glaubte, dann hatte er sie wahrscheinlich wirklich gesehen, aber wenn sie nur nickte, wie sie es in letzter Zeit tat, ohne vor Staunen nach Luft zu schnappen, dann käme er sich am Ende lumpig und schlecht vor, weil es eine Lüge wäre. Mit ihr war es langsam fast so, wie seinem Bruder was zu erzählen. Er bekam eine Wut auf sie, während er dastand und danach lechzte, ihr wenigstens von der Welle zu erzählen. Für ihn geschah nur, wovon er erzählen konnte, und in letzter Zeit war es schwierig geworden, noch irgendwas zu erzählen.
Er ging an die Bungalowtür und betrat bitter vor Unschlüssigkeit das kleine Wohnzimmer. Er sah sie drüben in der Küche mit Töpfen hantieren. Sie warf ihm einen Blick zu und sagte: »Trink ein Glas Milch.«
Milch! Wo sein Vater und sein Bruder in diesem selben Moment in der Synagoge standen und mit rissigen Lippen und gelb vor Hunger zu Gott beteten. Er gab keine Antwort. Er konnte sich nicht einmal überwinden, in die Küche zu gehen, an den gesegneten Ort, wo er so gern mit dem Kinn auf dem kühlen Wachstischtuch saß, ihr beim Kochen zusah und von den erstaunlichen Dingen erzählte, die er draußen in der Welt gesehen hatte. Er hievte sich auf einen Stuhl am Esstisch, an dem er noch nie ganz allein gesessen hatte.
Nach kurzem Schweigen drehte sie sich um und entdeckte ihn dort. Ihre Brauen hoben sich, als sähe sie ihn unter der Decke schweben. »Was machst du da?«, fragte sie.
Als wüsste sie das nicht ganz genau! Verbittert senkte er den Blick auf die Tischplatte. Jetzt kam sie aus der Küche und blieb ein paar Schritte entfernt verdutzt stehen. Er sah sie nicht an, aber er konnte sie sehen, und wieder fiel ihm wie zum ersten Mal ein, dass sie in letzter Zeit komisch aussah, das Gesicht irgendwie schwammig. Ja, und sie bewegte sich anders, so wie jemand in einer sich langsam vorwärtsschiebenden Menschenschlange.
Sie blickte weiter mit gerunzelter Stirn wortlos auf ihn herab, und plötzlich wurde ihm bewusst, dass er der Einzige in der ganzen Familie war, einschließlich Vettern, der abstehende Ohren hatte. »Zieh die Ohren ein, Martin, wir fahren durch einen Tunnel!« Seine Onkel sahen mit einem Grinsen auf ihn runter – »Wo habt ihr den denn her? Nach wem kommt der denn?« Er ähnelte niemand, wurde ihm dort bei seiner Mutter klar. Da wurde das Gefühl noch stärker, dass er und seine Mutter sich ständig aus großer Entfernung sahen, an die er sich von früher nicht erinnern konnte. »Bist du krank?«, fragte sie schließlich und legte ihm die Hand auf die Stirn.
Er stieß ihre Hand weg und traf dabei seitlich mit dem Finger ihren Bauch. Sofort wurde der Finger ganz heiß, und der Schreck bohrte sich ihm in den Magen wie ein Glassplitter. Sie hielt sich den Bauch, sog scharf die Luft ein, und beinahe konnte er hören, wie sie innerlich zusammenzuckte, dann drehte sie sich weg, um wieder in die Küche zu gehen. Er riskierte einen Blick in ihr schon halb abgewandtes Gesicht. Es war still verschlossen, und still kehrte sie an den Herd zurück. Sie schrie ihn in letzter Zeit nicht einmal mehr an, begriff er plötzlich, und sie zog sich auch nicht mehr an, wenn er bei ihr im Schlafzimmer war, sondern ging dazu ins Ankleidezimmer und sprach mit ihm durch die fast geschlossene Tür. Er wusste, dass er das nicht merken durfte, so wenig wie Ben und Papa. Und da wurde ihm klar, dass er auch nicht merken durfte, dass sie ihn gar nicht mehr anschrie, und er glitt von seinem Stuhl und wusste nicht, wohin mit sich und der Gänsehaut dieser heimlichen Erkenntnis.
»Willst du nicht mal deine Shorts anziehen?«, rief sie aus der Küche.
Ein Schluchzen verknotete ihm den Bauch. Shorts! Ausgerechnet jetzt! Wo Ben und Papa in der Synagoge in ihren Wollanzügen tausendmal aufstehen und sich wieder setzen mussten! Wenn es nach ihr ginge, dürften die Leute tun, was immer sie wollten – wo doch der lange Bart im Wasser trieb, das Meer so rau und so wild war! Sie sollte mal wagen, Papa und Ben vorzuschlagen, in ihre Shorts zu schlüpfen!
»Mach doch, Schatz«, sagte sie, »sie liegen in der obersten Schublade deiner Kommode.«
Der Stuhl, auf dem er gesessen hatte, schlitterte und schrappte über den Fußboden. Er hatte offenbar nach ihm getreten und schielte nun zur Küchentür hinüber; sie hatte sich umgedreht, im Blick erschreckte Belustigung.
»Was hast du nur?«, fragte sie. Ihre Falschheit sirrte wie Mücken um sein Gesicht.
Er schlurrte zur Bungalowtür und stieß sie so heftig auf, dass die Feder jaulte.
»Martin?« Sie schoss schneller durchs Wohnzimmer, als er gedacht hatte, aber obwohl er am liebsten weggerannt wäre, stolzierte er voll Hochmut über die Veranda. Er fühlte sich sehr gerecht, weil er ihr gegenüber auf den Regeln beharrte. Hinter ihm jaulte die Türfeder, und gerade, als er die erste Stufe nahm, packte sie mit einem raschen Griff seine Schulter. »Martin!« Ihre Stimme war gleichermaßen Klage wie Anklage, drang in seine stillsten Gedanken und zerschmetterte seine Rechtschaffenheit. Er versuchte, sich ihr zu entwinden, aber sie hielt ihn am Kragen und zog, bis ihm der Jackenknopf unterm Kinn saß. »Martin!«, schrie sie ihm jetzt ins Gesicht.
Hell empört über die Demütigung und darüber, wie respektlos sie den Anzug behandelte, den er so sorgsam trug, schlug er mit aller Kraft nach ihrem Arm. »Lass mich los!«, schrie er.
Sein Schlag entfesselte ihren Zorn. Sie packte sein Handgelenk und hieb auf die ungezogene Hand ein, wieder und wieder, bis es brannte und er im Versuch, sich zu befreien, stolperte und auf dem Po landete. »Du kriegst von Papa was mit dem Gürtel!«, kreischte sie ihn an, mit Tränen in den Augen.
Papa! Sie würde es Papa sagen! Seine Verachtung rückte ihr zeterndes, verzerrtes Gesicht kilometerweit weg, und vor ihm tat sich ein seelenruhiger Weg voll Licht auf. Mit bebendem Kinn, die schwarzen Augen vor Hass verengt, schrie er: »Ich brauche dich nicht mehr!«
Ihre Augen weiteten und weiteten sich, ein Skandal. Er staunte; auch jetzt fand er die Worte nicht schlimm, nur wahr: wenn sie ihn nicht brauchte, brauchte er sie auch nicht. Aber da stand sie mit offenem Mund, die Hand an der Wange, und blickte mit einem Entsetzen auf ihn herab, das er sich bei einem Menschen im Traum nicht hätte vorstellen können. Er verstand es nicht; nur Lügen waren entsetzlich. Sie wich einen Schritt zurück, sah ihn an, als wäre er vollkommen fremd, zog die Tür auf und verschwand leise im Haus.
Hinter sich hörte er das Meer tosen, ein Geräusch, das ihm vertraut auf den Rücken klopfte. Er rappelte sich hoch, seltsam erschöpft. Er lauschte, hörte aber von ihr keinen Mucks, kein Weinen. Er stieg die Stufen hinunter und ging die paar Meter Gehweg zum Sand weiter, zögerte, weil es ihm widerstrebte, seinen Glanz zu verderben, betrat aber dann trotzdem den Strand. Er wusste, dass er schlecht war, aber nicht, warum. Er näherte sich dem verbotenen Wasser. Es schien ihn zu sehen.
Hier war er für sich. Die steife Brise würde ihre Stimme abschneiden, wenn sie nach ihm rief, außerdem fiel ihm ein, konnte sie gar nicht mehr hinter ihm herrennen. So wie sie nicht mehr mit ihm um den Tisch tanzte oder ihn morgens zu sich aufs Elternbett springen ließ, und wenn er sich wie früher von hinten an sie heranschlich, um sie zu umarmen, dann entwand sie sich rasch seinem Klammergriff. Nur hatte außer ihm niemand ihr neues Benehmen bemerkt, und das Wissen war irgendwie gefährlich. Papa wusste es nicht, Ben auch nicht, und während er am Rand des nassen Sands entlangging, geborgen im Brüllen der sich überstürzenden Wellen, presste er eines seiner Ohren an den Kopf und sprach stumm seinen Wunsch aus: Wenn er nur wie sein Vater und sein Bruder aussähe! Dann würde er nicht wissen, was er nicht wissen durfte. Seine Ohren waren schuld. Weil er so anders aussah, sah er andere Sachen als sie und hatte Kenntnis von Dingen, die ein guter Junge nie hätte. Wie das mit dem Zahnarzt.
Harte Brocken im Hals schnürten ihm die Luft ab, so sehr wehrte er sich gegen die Erinnerung an jenen schrecklichen Tag. Ein unerwartet langer Wellenausläufer umspülte seinen Schuh, er sprang zurück. Dann bückte er sich und war erst einmal damit beschäftigt, den Schuh mit der Hand abzuwischen. Wobei ihm klarwurde, dass er das üble Wasser tatsächlich angefasst hatte. Er roch an seiner Hand. Es roch nicht schlecht. Vielleicht ging es ja darum, dass Gott heute im Wasser war und keiner zu ihm hinein durfte, also nicht, dass das Wasser stinkend schlecht war, nur eben verboten. Er wich ein paar Meter vom Wasser zurück und setzte sich in den Sand, wo sich das Bild vom Zahnarzt mit dem Schauder darüber, das Wasser berührt zu haben, vermischte und er sich einer Art lustvoller Angst hingab.
Ganz deutlich hatte er den Gehweg vor ihrem Wohnblock in der Stadt vor Augen – seine Mutter auf dem Heimweg, er dicht an ihrer Hüfte –, hörte die braune Papiertüte mit den Lebensmitteln auf ihrem Arm knistern. Er erinnerte sich noch gut, wie es war, mit ihr zu gehen und nicht darüber nachdenken zu müssen, wo er abbiegen, wann er stehenbleiben, wann er sich beeilen oder langsamer werden sollte. Sie waren wie verbunden, und er einfach da. Und dann, plötzlich, waren sie stehen geblieben. Beim Hochblicken hatte er das Gesicht des Fremden nah bei ihrem gesehen. Und von der Wange des Mannes fiel eine Träne an Martins Nase vorbei. Sie hatte irgendwie so komisch halblachend gesprochen, mit einer gepressten Erregung, und sich dabei sehr gerade gehalten. Und der Fremde hatte sie beim Vornamen genannt. Hinterher, in der Lobby, als sie auf den Aufzug warteten, hatte sie mit demselben atemlosen Lachen gesagt: »Ach, der war ja so in mich verliebt! Ich hätte ihn beinahe geheiratet, stell dir vor! Aber Grandpa hat ihn weggeschickt. Er war bloß Student. Ach, die Bücher, die er mir immer gebracht hat!«
Trotz der brüllenden Wellen hörte er über sich ihre erregte Stimme genau so, wie sie in der Lobby des Wohnblocks geklungen hatte. Und er wurde wieder rot vor Scham, einer Demütigung, die nicht von einem Gedanken oder dem Ereignis selbst kam. Er konnte sie sich nicht wirklich mit dem Zahnarzt verheiratet vorstellen, weil sie doch Papas Frau war, sie war Mama. Genau genommen konnte er sich kaum wirklich an etwas erinnern, was sie an jenem Tag gesagt hatte, nur an ihr Lachen und an die Erregung in ihrem Atem, als sie sich vom Zahnarzt verabschiedet und die Lobby betreten hatten. Er hatte ihre Stimme so noch nie gehört, und er hatte daraufhin sofort beschlossen, sich niemals anmerken zu lassen, dass er den neuen Ton und die ziemlich seltsame Frau, von der er kam, bemerkt hatte. Hinter seiner Scham lauerte der Schrecken, dass sie Gedanken hatte, die Papa nicht hatte. Seit jenem Tag sah er sich als kleiner Hirte, der große Tiere zu hüten und sie vor sich selbst und vor dem Wissen um ihre eigentliche Kraft zu schützen hatte. Und auch wenn er mal außer Sichtweite spielte oder sogar mit ihnen herumalberte und rangelte, vergaß er doch nie, dass seine Flöte im Grunde nichts ausrichten könnte gegen ihre schlummernde Gewalt, wenn sie erst begriffen, dass sie nicht ein und dieselbe Person, sondern verschiedene waren, nicht eines Sinnes, wie sie glaubten, sondern in der Lage, ganz anders zu reden und zu atmen, sobald sie einander aus dem Blick verloren. Er allein wusste das, und es war allein seine Aufgabe, sie vor diesem Wissen zu schützen und darüber im Unklaren zu halten, dass sie nicht mehr die waren, die sie gewesen waren, bevor der Zahnarzt Mama auf der Straße ansprach.
Und wie immer, wenn er an den Fremden dachte, musste er an den Tag danach denken, den Sonntag, als die ganze Familie spazieren gegangen war und er, kaum dass sie diese gewisse Gehwegplatte erreicht hatten, den Atem anhielt, überzeugt, dass, sobald Papas Schuhsohle aufsetzte, ein Brüllen und Donnern die Luft zerschmettern würde. Aber Papa war unbekümmert über die Platte spaziert, hatte gar nichts gemerkt, und Mama auch nicht, so dass Martin klar seine Pflicht erkannte: Er war ausersehen, über sie zu wachen. Denn obwohl Mama sich gegenüber dem Fremden ja wirklich so benommen hatte, war sie sich der wahren Bedeutung irgendwie nicht bewusst, nicht so wie er. Von nun an durfte er sie zu keiner Zeit in irgendeiner Weise die wahre Bedeutung dessen, was sie getan hatte, erkennen lassen: dass sie nämlich, statt bei der Bemerkung: »Der war ja so in mich verliebt! Ich hätte ihn beinahe geheiratet« erregt zu lachen, hätte schreien und zetern und ganz schlimm erschrecken müssen. Aber das würde er ihr niemals sagen.
Und nun flackerte und verschwamm ihm wie immer alles vor den Augen, wenn er zum letzten Teil kam, nämlich der Vorstellung, was passieren würde, wenn Papa jemals herausfand nicht nur, was sich ereignet hatte, sondern dass er, Martin, das Geheimnis kannte. Papa würde aus seiner vollen Größe auf ihn herabsehen und vor Schmerz und Schrecken brüllen: »Mama hätte beinahe den Zahnarzt geheiratet? Was bist du nur für ein schlimmer Junge, dass du dir so etwas ausdenkst! Waaaaaahhh!« Und er würde von dem Brüllen verschlungen werden. Dieser quälende Gedanke brachte ihn schnell auf die Beine.
Er ging am Meer entlang, hob winzige Schneckenhäuser auf und zerrieb sie zu Pulver, er warf Steine und Stecken, aber eine böse Vorahnung blieb. Langsam holte ihn die Erinnerung wieder ein, dass er seine Mutter noch nie so entsetzt gesehen hatte wie eben. Er hatte sie viele Male in den Wahnsinn getrieben, aber nicht so, nicht mit so einem Ausdruck in den Augen. Er hatte ihre Zähne gesehen, als sie ihn schlug. Das hatte es so bisher noch nie gegeben – mit Zähnen.
Die sichtbaren Zähne und dazu die geweiteten Augen … Er sah aufs Meer hinaus. Vielleicht lag es daran, dass heute ein heiliger Tag war? Er glaubte ohnehin, dass seine Schlechtigkeit eine Art unsichtbaren Strahl aussandte, eine Botschaft, die jenseits seiner Familie in eine Finsternis gelangte, weit weg; nicht, dass er ständig daran dachte, er hatte es bloß schon immer gewusst. Und aus dieser entlegenen Finsternis würde die Vergeltung ihn treffen, ein unerschütterliches Urteil, das weder aufgehalten noch gemildert, noch abgewendet werden konnte. Das bedeutete, dass ihre vorhin so schockierten Augen sich seinetwegen geweitet hatten, aus Angst vor dem, was er aus der Finsternis auf sich herabbeschwor. Sie war auf der Veranda nicht einfach auf ihn wütend gewesen, sie hatte um ihn gebangt. Er musste zu ihr etwas gesagt haben, was nicht nur für sie persönlich eine Beleidigung war, sondern Sünde. Aber er konnte sich nicht erinnern, was es war. Sein Unvermögen, sich zu erinnern, war für sich schon erschreckend und verhieß viel Ungutes.
Der Zahnarzt! Sein Herz krampfte sich zusammen; hatte er ihr aus Versehen gesagt, dass er wusste, wie sie sich dem Fremden gegenüber benommen hatte? Oder vielleicht dachte sie, er hätte es inzwischen Papa gesagt? Am liebsten wäre er auf der Stelle zurückgelaufen und hätte ihr geschworen: »Mama, ich habe Papa von dem Zahnarzt nie ein Wort gesagt!« Sobald er es sich aber ausmalte, war schon wieder Schluss, denn er sah ein, dass er auch ihr nicht sagen durfte, was er wusste. Und wenn er es Ben anvertraute, würde der entsetzt sein, dass er so etwas überhaupt sagen konnte. Er schlurrte am leeren Strand entlang, so einsam, wie seine Pflicht es war, teilte unwissentlich sein Geheimnis mit dem bärtigen Meer, in dessen verbotenen Tiefen Augen waren, die sahen, die ihn sahen, durch seinen Schädel hindurchsahen. Und im Gehen wurde ihm wieder klar, wie es sein würde, unsichtbar zu werden; wenn Papa jemals erfuhr, was er wusste, und brüllte, würde er langsam verschwinden. Nur wäre das nicht das Ende. Er würde trotzdem da sein, alles hören und sie die ganze Zeit sehen, aber sie würden ihn nicht mehr sehen können. Plötzlich war ihm zum Weinen zumute, weil sie ihn dann verloren hätten, und schnell korrigierte er das Bild. Er würde vielmehr sichtbar sein, solange sie ihn ansahen, aber unsichtbar, sobald sie ihm den Rücken kehrten. Ja, das war prima. Nachts zum Beispiel könnte er aus dem Bett klettern, unsichtbar in ihr Schlafzimmer schleichen und dort ganz bequem sitzen, ohne dass sie es jemals mitkriegten. Und wenn er müde wurde, weil es sehr spät war, dann konnte er sich einfach zwischen sie ins Bett legen, und alle würden gut schlafen. Nur – ergänzte er – würde er daran denken müssen, nicht ins Bett zu machen, sonst würden sie es am Morgen bemerken und sich gegenseitig beschuldigen und streiten.
Er hatte innegehalten und starrte aufs Meer hinaus. Als wäre es ein uralter, ihn ständig begleitender Gedanke, sah er, dass er ins Wasser gehen und ertrinken könnte. Daran war im Augenblick keine Furcht und keine Hoffnung gebunden, nur das angenehme Empfinden fehlenden Verlangens. Und da fiel ihm der frühere Tag in diesem Sommer ein, als er und sein Bruder vor dem Frühstück ins Wasser gegangen waren, als noch niemand am Strand war. Sie hatten eine Weile im Wasser herumgealbert, und als es Zeit wurde, umzukehren, konnte er nicht. Der Sog hatte ihn genauso stark zurückgehalten, wie er dagegen anzuschwimmen versuchte. Da hatte er, schon spuckend, die Richtung gewechselt und war mit dem Strom geschwommen. Wie leicht das ging, wie schnell! Er wäre im Nu in Europa gewesen. Als Nächstes aber lag er dick eingemummt im Bett, der Doktor war da, und alle sagten, er wäre wahrscheinlich ertrunken, wenn ihn der Milchmann nicht zufällig gesehen hätte.
Er hatte ihnen nie offen widersprochen. Aber als er jetzt dastand, wusste er genau, dass er gar nicht wahrscheinlich ertrunken wäre. Er hätte es bis nach Europa geschafft, weil er nämlich geheime Kräfte besaß, von denen niemand wusste. Und plötzlich fiel es ihm wieder ein: »Ich brauche dich nicht mehr!« Seine eigenen Worte kehrten zu ihm zurück, schrill und rot vor Zorn. Was war daran so schlimm? Er brauchte sie nicht. Er konnte jetzt selbst seine Schnürsenkel binden, er konnte unendlich weit gehen, ohne müde zu werden … Sie wollte ihn nicht, warum musste er so tun, als wollte er sie? Das Entsetzen darüber war ihm unbegreiflich. Nur war es offenbar trotzdem entsetzlich, auch wenn er nicht wusste, warum. Wenn er doch nur wüsste, was entsetzlich und was bloß schlimm war! Wie prima wäre es, jetzt im Meer zu versinken, dachte er. Wie würde sie sein totes Gesicht mit den geschlossenen Augen anflehen, etwas zu sagen. Ben würde auch durchdrehen, und Papa … Papa würde wahrscheinlich im Hintergrund bleiben, dem Arzt nicht im Weg sein wollen, warten, bis man ihm sagte, was los war. Und dann würde er, Martin, ein kleines bisschen die Lippen bewegen, und sie würden alle aufschreien. Sie würden rufen: »Er spricht!« Und er würde die Augen aufschlagen und sagen: »Ich ging am Meer entlang. Ich habe eine Welle gesehen und in der Welle den Bart. Der war lang wie ein ganzer Häuserblock. Ganz grau. Und dann habe ich das Gesicht gesehen. Es hatte blaue Augen, wie Grandpa, nur viel größer. Und es hat eine sehr, sehr tiefe Stimme, wie Wale, die unten am Meeresgrund tuten. Es ist Gott.«
»Es ist Gott!«, staunt seine Mutter und klatscht ganz wie früher in die Hände.
»Wie kann das Gott sein?«, fragt Ben, den seine Lügen anwidern.
»Weil er mich geküsst hat.«
»Beweis es!«, sagt Ben und lacht herzlich.
Und da macht er den Mund auf, und alle sehen hinein, so wie sie es getan haben, als er zu Neujahr Zahnweh hatte und sie bei so vielen Zahnärzten anrufen mussten. Und sie sehen in seinem Mund den ganzen Ozean, und dort dicht unter der Oberfläche sehen sie die blauen Augen und den schwebenden Bart, und dann kommt aus seinem Mund ein gewaltiges, dumpfes Donnergrollen, genau wie vom Meer. Aus dem Augenwinkel sah er eine Bewegung. Da war ein Mann ganz in Schwarz.
Er wagte nicht, sich ganz umzudrehen, aber selbst beim ersten, flüchtig erhaschten Blick hatte er gleich gesehen, dass der Mann blankgewienerte schwarze Schuhe trug, um die Schultern einen weißen Gebetsschal aus Seide und auf dem Kopf eine schwarze Kippa.
Schließlich zwang er sich, sich dem Mann zuzuwenden; Panik ließ seine Zunge einen Fingerbreit in den Hals zurückschnellen, aber sofort fasste er sich wieder – der Mann war wirklich da, weil nämlich eine kleine Schar weiterer Männer hinter ihm stand. Sie waren so weit weg, wie er einen Ball werfen konnte. Der Wind peitschte die weißen Fransen ihrer Gebetsschals. Sie hatten sich dem Meer zugewandt, beteten laut aus den schwarzen Gebetsbüchern in ihren Händen und schaukelten dringlicher vor und zurück, schien ihm, als er es sie bisher in der Synagoge hatte tun sehen, und er entdeckte unter ihnen auch seinen Vater und seinen Bruder. Wussten sie, dass er hier stand? Keiner würdigte ihn auch nur eines Blickes, sie sprachen einfach weiter mit der Luft über dem Meer.
Noch nie hatte er so viele Männer mit blankgewienerten schwarzen Schuhen am Strand gesehen. Nie hatte er Gebetsschals im Licht der Sonne gesehen. Das störte die Ordnung, pulste leise wie eine Warnung. Er bangte um sie, die das taten, als hätte man das Dach von der Synagoge gehoben und Gott könnte leibhaftig erscheinen, nicht bloß die Rolle aus dem Schrein. Sie standen Ihm gegenüber, also musste Er wohl sehr nah sein, und das war schlimm. Ob sie mit ihren nach innen stierenden Blicken gar nicht merkten, fragte er sich, dass sie nur einen Meter von der rauen See entfernt standen? Vielleicht sollte er leise zu Papa hinschleichen und es ihm sagen, dann würde Papa von seinem Buch hochsehen, merken, wo er war, und rufen: »Was haben wir nur getan! Wie sind wir aus der Schul nur hierhergelangt!« Und dann würden sie alle kehrtmachen und schnell, mit wehenden Gebetsschals, zur Synagoge zurücklaufen und ihm danken, dass er sie davor bewahrt hatte, Gott ins nackte Gesicht zu schauen.
Aber vielleicht durfte er das alles gar nicht mitkriegen, wie letztes Jahr in der Synagoge, als sein Großvater gesagt hatte: »Jetzt darfst du nicht gucken« und er sich die Augen hatte zuhalten müssen. Und trotzdem hatte er ganz kurz zwischen den Fingern durchgelugt und dort oben, auf der erhöhten Plattform, Schlimmes gesehen. Der Kantor oder Rabbi oder jedenfalls jemand mit langem Bart hatte sich, wie noch drei oder vier andere alte Männer, mit dem seidenen Gebetsschal das Gesicht bedeckt. Er hatte keine Schuhe angehabt, nur weiße Socken. Alle hatten weiße Socken, und dann hatten sie begonnen, verrücktes Zeug zu singen und dann zu tanzen! Und zwar nicht einen schönen Tanz, sondern einen Altmännertanz, hauptsächlich auf und ab und steif von einem Bein auf das andere, schwankend wie Zelte, die sich in Marsch setzten, und unter den Schals waren Gequake und Geheul und spitze Schreie hervorgekommen. Dann hatten sich alle dem Schrank mit der Rolle zugewandt, erst ein Knie gebeugt, dann das andere, und hatten sich schließlich wie Häuser, die umfallen, sogar platt aufs Gesicht gelegt und lang hingestreckt. Direkt dort oben auf dem Altar, wo sonst der Rabbi oder der Kantor, oder wer immer das war, so steif stand und überhaupt niemanden anschaute. Die Vorstellung tanzender alter Männer war ihm peinlich.
Keiner aus der versammelten kleinen Schar sah ihn an, nicht einmal Ben eine Sekunde lang, und Papa auch nicht. »Die wissen, dass ich damals beim Kantortanzen geguckt habe«, dachte Martin, also wussten sie, dass er nicht mehr zu retten war; es war daher ganz egal, ob er jetzt hierbei zusah, denn er war kein guter Junge. Vielleicht waren sie sogar alle hergekommen, um ihn zu betrauern, weil er so ein Gauner war. Wäre jetzt ein guter Junge hier, wie einer seiner Vettern mit normalen Ohren, würden sie wahrscheinlich herbeistürzen und ihn zwingen, sich die Augen zuzuhalten und nicht zu gucken. Er wandte das Gesicht von den Männern ab und konzentrierte sich auf das brüllende Meer, gab sich alle Mühe, nicht mal ihr Beten zu hören. Aber die Belohnung blieb aus und blieb aus, und plötzlich stieg die Stimme des Kantors, des Mannes, den er zuerst gesehen hatte, hoch und immer höher hinauf in den Wind, bis sie wie eine Mädchenstimme klang und Martin einfach hinsehen musste.
Alle beteten jetzt lauter und schrien auf beängstigende Weise den Wellen etwas zu, und der Kantor wie auch die anderen Männer hinter ihm schlugen sich mit Fäusten an die Brust. Die Schläge tönten wie einzelne, unter der Erde verteilte Trommeln und brachten die Männer dazu, wieder und wieder übers Wasser zu grunzen und ächzen, und dann sah Martin etwas Glitzerndes in hohem Bogen aus der Hand des Kantors in eine Welle fliegen. Eine tote Sardine? Oder war es nur aufblitzende Gischt? Jetzt herrschte Stille. Keiner rührte sich. Alle Lippen öffneten und schlossen sich, aber es gab nur ein tiefes Brummen, das in das Brüllen der Wellen überging.
Martin wartete, und plötzlich schreckte ihn die Vorstellung, der Kantor könnte, wie er es letzte Woche in der Synagoge getan hatte, das krumme Widderhorn hervorholen und hineinstoßen: »Duuuuuuah!« Martin kribbelte die Haut bei der Erinnerung an das rohe Tierblöken, das bitte nicht, nicht gerade jetzt kommen durfte, wo Gott so nah war, dass Ihm der Lärm direkt ins Ohr dröhnen und Ihn aus dem Meer hochjagen würde, um sie alle mit Seinem blauen Blick zu verglühen. O was würde für eine gischtende Säule Schaum aus dem Meer steigen, was würden für grüne Sturzbäche den gewaltigen Wasserfallbart hinabschießen!
Ohne Vorwarnung schüttelten sich nun alle die Hand. Alle redeten nun ganz entspannt und vertraulich, lachten, nickten, legten ihre seidenen Gebetsschals zusammen, klappten die Bücher zu, klangen wie Nachbarn. Martin spürte in sich ein Singen darüber, dass Gott geblieben war, wo Er hingehörte. Gott sei Dank war Er nicht erschienen! Er rannte hinüber und schob sich durch die Menge auf seinen Vater zu, vergaß vollkommen, dass er vielleicht gar nicht hätte zusehen dürfen. Zuerst entdeckte er Ben und rief aufgeregt seinen Namen, während er versuchte, zu ihm durchzudringen. Ben sah ihn, zupfte den Vater am Ärmel, und Papa drehte sich um und sah ihn auch, und beide lächelten stolz, wie er fand, auf ihn herab. Und ohne zu überlegen, rief er: »Ben! Ich habe es gesehen! Ich habe gesehen, wie er es ins Wasser geworfen hat!« Wie prima, ein Wunder gesehen zu haben, und nicht allein! »Ich habe es in die Wellen fliegen sehen!« Er fühlte sich so rein und gut wie Ben, ohne etwas im Innern für sich zurückzubehalten.
»Was ins Wasser?«, fragte Ben verwirrt.
Panik schnickte Martin ans Auge. Bens Abfuhr trieb ihm das Blut in die Wangen, aber er konnte sich nicht zügeln. »Der Kantor – was er eben geworfen hat!« Er suchte rasch bei seinem Vater Bestätigung, doch der lachte ihn bloß freundlich an, herzlich, überrascht, verständnislos, aber voll Liebe.
Mit einem Kopfschütteln wandte sich Ben an den Vater. »Junge, Junge«, sagte er, »kann der phantasieren!«
Papa lachte, aber halb gläubig immerhin, fand Martin, und von dem Glauben zehrte er ein paar Sekunden, während er mit ihnen über den Strand Richtung Bungalow ging. Wenigstens zum Lachen gebracht hatte er Papa. Dabei hatte er wirklich etwas ins Meer segeln sehen – warum gaben sie es nicht zu? Ihn beschlich ein flaues Gefühl. Seine Ohren schienen weiter und noch weiter abzustehen, und er ertrug die Einsamkeit nicht, zurückgeworfen in die Arme seiner Geheimnisse. »Ich hab’s gesehen, Ben«, beharrte er und wollte Ben zurückhalten. »Pa? Ich habe ihn was werfen sehen, ich schwör’s!«, brüllte er plötzlich.
Sein Vater sah bestürzt, wie ihm schien, auf ihn herab, voll gütiger Verständnislosigkeit und in dem Wunsch nach erfreulichem Benehmen. »Er wirft nur die Hand hoch, Marty. Wenn er sich schlägt.«
Das war immerhin etwas. »Aber was hat er in der Hand? Er hat etwas geworfen, ich hab’s gesehen.«
»Er wirft seine Sünden, Blödmann«, sagte Ben.
»Genau«, sagte Papa, »die Sünden kommen alle ins Meer.«
Martin spürte im Ton seines Vaters einen scheuen Humor. Er fragte sich, ob es daran lag, dass darüber eigentlich nicht gesprochen werden durfte. Und dann fragte er sich, ob es daran lag, dass Papa nicht so ganz an Sünden in der Hand des Kantors glaubte.
»Und die leuchten, nicht, Papa?«, fragte er begierig. Er wünschte sich über alles, Papa Ja sagen zu hören, damit sie zusammen etwas gesehen hätten und er nicht mehr so allein wäre mit dem, was er wusste.
»Tja –«, fing Papa an und verstummte. Er seufzte. Er lachte zwar nicht, aber er war auch nicht richtig ernst.
»Leuchten sie nicht?«, wiederholte Martin bange.
Papa schien antworten zu wollen, tat es aber nicht, und Martin konnte diesen schweigenden Schlusspunkt nicht ertragen. »Ich habe so was …« – seine innere Warnglocke schrillte, aber er konnte nicht aufhören – »… wie eine Sardine wegfliegen und reinfallen sehen.«
»Eine Sardine!« Sein Vater prustete.
»O Gott!«, stöhnte Ben und schlug sich selbst die Faust auf den Kopf.
»Ja, aber nicht lebendig! Ich meine tot!«, besann sich Martin verzweifelt.
»Aha, tot gar!«, lachte Ben. »Weißt du, was er letzte Woche gesagt hat, Pa?«
»Sei still!«, brüllte Martin, der wusste, was jetzt kam.
»Das Pferd vom Milchmann …«
Martin packte seinen Bruder am Ärmel und versuchte, ihn in den Sand zu werfen, aber Ben fuhr unbeirrt fort.
»… erlegt mit dem Huf Fliegen!«
Martin schlug rabiat auf seinen Bruder ein, trommelte mit den Fäusten auf seinen Rücken.
»Hey, hey!«, rief Papa mit der krächzenden Stimme, die genau wie die von Ben war.
»Ich hab’s gesehen!« Martin riss an den Armen des Bruders, trat nach seinen Beinen, während ihr Vater sie zu trennen versuchte.
»Na gut, meinetwegen hast du’s eben gesehen!«, schrie Ben.
Papa zog Martin sachte von seinem Bruder weg. »Schluss jetzt, hör auf. Sei ein Mann«, sagte er und ließ ihn los. Und Martin schlug noch rasch nach dem Arm seines Vaters, der aber nichts dazu sagte.
Sie gingen über den Strand weiter. Martin unterdrückte in seinem Hals den Schrei, der entschlüpfen wollte. Ehe er sich versah, platzte er mit einem Schluchzen heraus: »Auf einem Pferd gibt es viele Fliegen.«
»Geschenkt«, sagte Ben angewidert, beließ es aber dabei.
Martin ging brodelnd vor Wut neben ihm weiter. Eine Frau mit Schürze stand am Ende ihrer Straße und spähte nach der kleinen Schar Männer, die sich langsam zerstreute, wahrscheinlich nach ihrem Mann. Beim Anblick der Frau drängte sich Martin näher an seinen Vater, damit sie vielleicht annahm, auch er hätte den ganzen Tag in der Synagoge gefastet und am Strand mit den anderen gebetet. Die Frau streifte sie, als sie die Asphaltstraße erreichten, mit einem Blick und sagte respektvoll: »Gut Jontef.«
»Gut Jontef«, erwiderten Papa und Ben zusammen bedeutsam. Als Martin es auch sagen wollte, war es zu spät; seine Stimme allein würde jetzt nackt klingen und vielleicht lächerlich, weil er doch den ganzen Tag so oft gegessen hatte. Sie stiegen die Stufen zu ihrem Bungalow hinauf, und plötzlich wurde ihm ganz schwach vor Sorge, nicht dazuzugehören.
Die Türfeder jaulte, sein unschuldiger Vater hielt für Ben die Tür auf, dann drückte er Martin seine große Hand in den Rücken, der warm wurde vor Stolz. Erst als die Tür hinter ihm zuschnellte, fielen ihm die sichtbaren Zähne und geschockten Augen seiner Mutter wieder ein.
»Ma?«, rief Ben.
Es kam keine Antwort.
Der Herd dampfte unbeaufsichtigt. Martins Vater ging in die Küche, rief in fragendem Ton ihren Namen und erschien dann im Wohnzimmer, und Martin sah in seinem Gesicht aufkeimende Ratlosigkeit und Sorge. Martin wurde rot vor Schreck, etwas zu wissen, was der Vater nicht wusste. Und er malte sich aus, dass sie für immer weggegangen war, verschwunden, so dass sie, die drei Männer, sich in Ruhe setzen und in Frieden essen könnten. Und dann würde auch Ben gehen, und nur er und Papa blieben übrig, und wie brav und folgsam würde er dann sein! Wie vollkommen ernst würde er immer mit seinem Vater sein, der mit ihm richtig diskutieren würde, wie er es mit Ben tat, bis er Glanz bekäme an den Samstagen, wie ihn Ben besaß, und sich mit ihm über Feiertage unterhalten, damit er immer lange vorher Bescheid wüsste und nicht erst am Tag davor, dass Rosch ha-Schana oder Tischa beAv oder was immer war, und sie würden zusammen das Wissen teilen, was jeweils gegen oder nicht gegen das Gesetz war.
Die Badezimmertür ging auf, und Mama erschien. Er sah sofort, dass sie es nicht vergessen hatte. Ihre Augen waren rot wie damals, als Onkel Karl gestorben war, weil er sich gebückt hatte, um ein Telefonbuch aufzuheben. Martins Nacken prickelte angesichts der Unerbittlichkeit ihres aktuellen Kummers. Das hier war nicht zum Lachen, das sah er – Papa hatte richtig Angst, und Ben machte große Augen.
»Was ist passiert?«, fragten sie sie, schon jetzt erstaunt.
Mamas Blick wanderte von ihnen bis zu Martin, die Augen glasig vor hilflosem Unverständnis und dem Kummer geflossener Tränen. »Dass ich das erleben muss«, sagte sie und wandte sich wieder Martins Vater zu.
Noch immer konnte Martin nicht fassen, dass sie ihn bei Papa verpetzen würde. Zwar konnte er sich schon wieder nicht richtig erinnern, was es zu petzen gab, aber dass sie überhaupt etwas verriet, was zwischen ihnen beiden gewesen war, entsetzte ihn irgendwie und würde ihn hilflos den aufgehenden Augen seines Vaters und Bens ausliefern, einem Donnern und Schreien, das ihn pulverisieren würde.
»Weißt du, was er zu mir gesagt hat?«
»Was?«
»›Ich brauche dich nicht mehr.‹ Das hat er gesagt!«
Es war, als könnten sie alle nicht atmen. Ben machte ein so verletztes und verblüfftes Gesicht, dass er halb ohnmächtig schien. Martin wartete auf das dicke Ende, darauf, dass sie das letzte Wort über ihn sprach: Es würde wie ein Stein oder ein kleines Tier aus ihrem Mund fallen, und bei seinem Anblick würden sie alle wissen und würde er wissen, was er war.
Aber mehr sagte sie nicht. Das war alles! Martin hatte keine rechte Vorstellung davon, was sie noch hätte sagen können, aber das letzte, meerbrüllende Übel wurde nicht ins Zimmer gelassen, und sein Herz wurde leichter. Jetzt sprach sie wieder, aber nur darüber, dass er sie geschlagen habe, und obwohl Papa dastand und den Kopf schüttelte, begriff Martin, dass er in Gedanken schon woanders war.
»So etwas darfst du nicht sagen, Marty«, meinte er und verschwand im Schlafzimmer, um sein Jackett abzulegen. »Lasst uns essen«, sagte er von dort drinnen.
Er hätte zu seinem Vater rennen und ihn küssen mögen, aber irgendetwas hielt ihn zurück: eine leise Enttäuschung, das Verlangen nach einem letzten Showdown und die Furcht davor.
Und plötzlich kreischte seine Mutter: »Hörst du nicht, was ich sage? Er treibt mich Tag für Tag in den Wahnsinn!«
Papas Schritte näherten sich aus dem Schlafzimmer. Jetzt, jetzt käme er vielleicht, der Donnerschlag väterlichen Ekels von oben. Er stand im Hemd auf der Schwelle, riesig, unverrückbar. »Jetzt setzt es was, junger Mann«, sagte er und fasste an seine Gürtelschnalle.
Martin durchzuckte es freudig, und er machte sich bereit, um den Tisch zu flitzen. Manchmal zog Papa den Gürtel heraus – dann musste Martin ausbüxen und sich ein, zwei Minuten auf der anderen Seite des Esstischs in Sicherheit bringen. Aber in Wirklichkeit schlug Papa nie zu, und einmal war ihm sogar die Hose heruntergerutscht, und da hatten sie alle lachen müssen, sogar Mama und Papa.
Als er aber nun den Gürtel aufschnallte, schossen Martin vor Mitleid mit dem Vater die Tränen in die Augen. Ihm tat es leid, dass der Vater einen so unwürdigen Sohn hatte, er wusste, weshalb er jetzt Schläge bekäme, und fand es nur gerecht, denn es war widerlich, wenn ein Junge wusste, was er wusste. Er wich vor dem Vater zurück, nicht, weil er Angst hatte, dass ihm etwas angetan würde, sondern um seinem Vater den Schmerz solcher Grausamkeit zu ersparen.
»Ich habe es nicht so gemeint, Mama!«, flehte er. Vielleicht würde sie Papa vom Haken lassen.
»Du bringst mich noch um!«, rief sie.
Und prompt wusste Martin, dass er gerettet war. Dass Papa die Gürtelschnalle aufgemacht hatte, reichte ihr, sie ging mit einer Hand auf dem Bauch in die Küche, um einen klappernden Topfdeckel abzuheben.
»Sei ein Mann«, sagte Papa, schnallte seinen Gürtel wieder fest, ging an die Anrichte, füllte ein winziges Glas mit Whisky, trug es zum Schaukelstuhl am Fenster und ließ sich mit einem Seufzer nieder.
Das Tischtuch und das Besteck funkelten. Martin fiel plötzlich auf, dass Ben verschwunden war, und er fragte sich, ob er hinausgegangen war, um zu weinen. Die Sache war noch nicht ausgestanden, er ahnte es.
Papa hob sein Glas Richtung Küche und meinte: »Na? Ein neues Jahr!«
Mama rief vom Herd herüber: »Fil Glick!« Dann schloss sie kurz die Augen. Martin machte in solchen Momenten keinen Mucks, weil er wusste, dass sie für ein nicht sichtbares Ohr sprachen.
Papa leerte sein Glas in einem großen Zug und stieß hörbar die Luft aus. »Ich kann dir sagen«, bemerkte er zum Kücheneingang, »der Kantor ist stark wie ein Pferd.« Martin sah den Kantor mit dem langen Bart vor den Karren des Milchmanns geschirrt. »Hat sich den lieben langen Tag nicht ein einziges Mal gesetzt. Keine fünf Minuten Pause hat der Mann uns gegönnt.«
»Weil er kein Schwindler ist. Er ist ein frommer Mann.«
»Na ja«, gab Papa widerstrebend zu, »schließlich kann er sich das ganze restliche Jahr erholen.«
»Pass bloß auf, du.«
»Wenn ich im Jahr nur zwei Tage Arbeit hätte, würde ich auch stehen.« Martin sah den warmen Humor in den Augen seines Vaters, das friedliche Blinzeln.
»Was redest du!«, sagte Mama. »Die können tot umfallen, wenn sie den ganzen Tag singen ohne was im Leib, nicht mal ein Glas Wasser.«
»Der fällt nicht um«, sagte Papa. Immer kannte er den rechten Gang der Dinge, fand Martin, so, wie die Dinge wirklich ausgehen würden, und er betete darum, gut zu sein. »Sein Boss sorgt für ihn.«
»Werd bloß nicht unverschämt«, sagte Mama, und sie hob die Brauen und schloss kurz die Augen, um Gott zu bitten, auf das, was Er sich gerade anhören musste, nicht zu achten.
»Da hätte ich auch nichts dagegen – ein Zweitagejahr.«
»Jetzt hör schon auf«, sagte Mama mit einem kleinen, widerstrebenden Lächeln. Sie trug Papas großen, goldumrandeten Suppenteller herein, in der die gelbe Hühnerbrühe und dicke Matzeknödel schwammen. »Iss«, sagte sie und kehrte in die Küche zurück.
Papa stand auf, zog seine Hose hoch und machte den langen braunen Gürtel zwei Löcher weiter. Rasch lief Martin an seinen Platz, kletterte auf den Stuhl und setzte seine Kippa auf. Papa nahm am Kopfende Platz und setzte ebenfalls seine Kippa auf. Mama trug Bens Suppe herein und ging wieder in die Küche.
»Wer ist denn sein Boss?«, fragte Martin.
»Wer?«
»Der vom Kantor.«
Papa hob die Achseln. »Gott. Wer weiß?« Dann tauchte er seinen Löffel in die Suppe, rührte und murmelte ein Gebet.
»Kann er Gott sehen?«, fragte Martin. Durch sein Herz flog die Hoffnung, dass der Kantor und vielleicht auch Papa den Bart im Meer auch gesehen hatten, dann könnte er nämlich erzählen, wie er ihn selbst da draußen hatte treiben sehen, und wenn dieses eine Geheimnis gelüftet wäre, würde es irgendwie alle anderen Geheimnisse mitnehmen.
»Wo steckt Ben?«, fragte Papa. Sein Löffel war noch nicht ganz an den Lippen.
Sofort tauchte Mama aus der Küche auf. »Wieso? Wo ist Ben?« Erschrocken sah sie Martin an, dem der Mund offenblieb und das Blut in den Kopf schoss.
»Ich weiß es nicht. Ich habe ihm nichts getan«, sagte er.
»Ben?«, rief Mama, eilte zum Schlafzimmer und spähte hinein. »Ben?«
Papa sah ihr mit erhobenem, tropfendem Löffel nach. »Immer mit der Ruhe, Herrgott«, sagte er unwillig. Aber auch ihm schwante nichts Gutes, und Martin bekam Angst, er könnte Ben irgendwas angetan und es vergessen haben.
»Wie bitte?«, meinte sie empört. »Er ist nicht da!« Sie eilte zum Badezimmer und sah, dass die Tür verriegelt war. »Ben? Ben!«, forderte sie bange, und mit Schrecken erkannte Martin, was für ein Verlust Ben wäre.