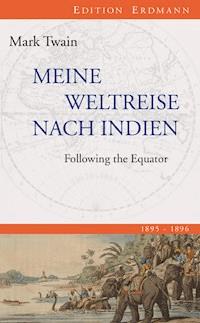Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mehrbuch
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte spielt Mitte des 16. Jahrhunderts und handelt von zwei Jungen, die einander so ähnlich sehen wie eineiige Zwillinge, aber unter völlig unterschiedlichen Bedingungen aufwachsen: dem Bettelknaben Tom Canty und dem Sohn Heinrichs VIII.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prinz und Bettler
Vorwort.
Mit vorliegendem Buche hat Mark Twain (Samuel Langhorne Clemens, geb. 1835) seinen Kindern das Beste und Anmutigste gewidmet, was sein schöpferischer Geist hervorbrachte, ein Werk, welches Verstand, Phantasie und Herz gleicherweise anzuregen geeignet ist. Um dieser Vorzüge willen haben wir uns entschlossen, die reizende Erzählung, die ein zärtlicher, geistvoller Vater für seine Kinder gut genug fand, auch der deutschen Jugend in passender Bearbeitung darzubieten.
Von den leider noch überwiegenden, bloßen Abenteuerromanen, welche den rohen Naturtrieben der Jugend zu schmeicheln sich nicht entblöden, ihre Einbildungskraft überreizen und ihr Gemüt verrohen, unterscheidet sich diese ansprechende Gabe des berühmten amerikanischen Humoristen durch den großen sittlichen Gehalt, vor allen durch den Geist einer reinen, versöhnenden christlichen Menschenliebe.
Eine weitere Anziehungskraft verleiht dem Buche die geschichtliche Unterlage, auf der die Handlung aufgebaut ist. Fast sämtliche Hauptpersonen der Erzählung sind historisch und nehmen teilweise eine hervorragende Rolle in den Blättern der englischen Geschichte ein. Ebenso beruht das reichliche kulturhistorische Material auf wirklichen Tatsachen. So ist auch in der Darstellung der damaligen grausamen Strafgesetzgebung nichts übertrieben. Gab es doch nicht weniger als zweihundertdreiundzwanzig Vergehen, die nach englischem Gesetz mit dem Tode bestraft wurden. Der Verfasser hat bei seiner ganzen Schilderung der Zustände jener Zeit nur englisches Quellenmaterial und die besten englischen Geschichtschreiber zu rate gezogen.
Dabei wird er niemals langweilig und trocken, sondern weiß in höchst geschickter Weise damalige Sitten und Gebräuche, das ganze Hofzeremoniell so in den Gang der Handlung zu verflechten, daß derselbe dadurch nur anschaulicher, lebendiger und interessanter wird.
Dazu bricht der köstliche Humor des Verfassers immer wieder durch und erhöht den Genuß der ohnehin reizvollen Lektüre.
Einer weiteren Empfehlung bedarf ein Buch wie das vorliegende nicht, um seinen Platz im Bücherregal der Jugend zu erobern und zu behaupten, zumal es auch an spannender Darstellung hinter den interessantesten und beliebtesten Jugendschriften in keiner Weise zurücksteht. Die Erzählung atmet echt deutsche Gemütlichkeit und verdient auch aus diesem Grunde ein Lieblingsbuch in deutschen Landen zu werden.
Die Handlung beginnt zu Ende der Regierungszeit Heinrichs des Achten (1509-1547). Der Held der Dichtung ist dessen Sohn, der später, ein zehnjähriger Knabe, als Eduard der Sechste (also direkter Namensvorgänger des jetzigen Königs von England) das englische Zepter ergriff. Die sechsjährige Herrschaft des jungen Regenten (1547-1553) zeichnete sich, im Gegensatze zu der vorherigen seines Vaters und der nachherigen seiner Stiefschwester Maria der Blutigen, durch eine große Milde aus. Wie der König zu dieser seiner humanen Denkungsart kam, wird in unserem Buche recht anschaulich geschildert.
Gleich von Anfang an wird der jugendliche wie der gereiftere Leser sich für den Prinzen sowohl wie für den Bettlerjungen erwärmen und beiden kleinen Helden seine lebhafteste Teilnahme bis zum Schlusse nicht versagen können.
Etwaigen Bedenken vorzubeugen, bemerken wir, daß trotz der Schilderung der damaligen rohen Zustände auch nicht eine Spur von Anstößigem sich findet, und somit das Buch jedem Kinde anstandslos in die Hand gegeben werden darf. Aber auch der Erwachsene wird die Erzählung mit hohem Genuß und derselben Befriedigung zu Ende lesen.
In der Bearbeitung haben wir uns tunlichst an das Original gehalten und uns bemüht, die dem Verfasser eigentümliche Darstellungsweise möglichst getreu, aber in einem leichten, angenehmen Stil wiederzugeben.
Und so lassen wir das Buch vertrauensvoll hinaus wandern in die deutschen Gaue, mit dem Wunsche, es möchte, dem Wunsche des Verfassers und des Bearbeiters entsprechend, ein Körnchen beitragen zu anregender Belehrung und Veredlung der deutschen heranwachsenden Jugend.
Rittergut Lupken (Ostpr.) im Sommer 1905. Rudolf Brunner, Professor.
Erstes Kapitel. Wie beide geboren und von der Welt aufgenommen werden.
An einem Herbsttage im zweiten Viertel des 16. Jahrhunderts wurde in London einer armen Familie, namens Canty, ein Knabe geboren, der ihr recht unerwünscht kam. Am selben Tage wurde aber auch einer reichen Familie, namens Tudor, ein Kind geboren und jubelnd aufgenommen. Und nicht nur seine Eltern, sondern ganz England begrüßte freudig seine Ankunft. Nach diesem Kinde, das auch ein Knabe war, hatte sich das Volk so sehr gesehnt, daß es bei seinem Erscheinen beinahe närrisch vor Freude ward. Leute, die sich nur vom Hörensagen kannten, umarmten und küßten einander auf offener Straße. Hoch und niedrig, reich und arm, alle waren in festlicher Stimmung. Tag und Nacht hörte der Jubel in den Straßen nicht auf. Flatternde Fahnen grüßten von jedem Hause, und Prunkaufzüge bewegten sich durch die Straßen. Nachts lohten und leuchteten Freudenfeuer auf jedem Platze, und fröhliche Menschen wimmelten darum. Alle aber sprachen nur von dem neugeborenen Kinde, von Eduard Tudor, dem ersehnten Kronprinzen Eduard VI. wurde geboren am 12. Oktober 1537 als Sohn Heinrichs VIII. und der Johanna Seymour.. Dieser lag indessen, eingehüllt in Seide und Atlas, in seiner Wiege, umgeben von hohen Herren und Damen, und ahnte nichts von all dem Jubel, den seine Geburt in ganz Altengland wachrief. Er würde sich auch schwerlich etwas daraus gemacht haben, wenn er es gewußt hätte.
Tom Canty aber, das andere Kind, lag in armselige Lumpen eingewickelt, in einem Winkel auf Stroh, und niemand sprach von ihm, als die arme Familie, der das Kind so ungelegen gekommen war.
Zweites Kapitel. Wie Tom seine Kindesjahre verlebte.
Eine Reihe von Jahren ist seither vergangen. London war fünfzehnhundert Jahre alt und nach damaligen Begriffen eine große Stadt. Sie zählte hunderttausend Einwohner oder mehr. Die Straßen waren noch sehr eng und krumm und schmutzig, besonders dort, wo Tom Canty wohnte, unweit der Londoner Brücke. Die Häuser waren aus Holz gebaut. Das zweite Stockwerk ragte über das erste vor, und das dritte streckte die Elbogen über das zweite hinaus. Die Balken waren rot oder blau oder schwarz bemalt, je nach dem Geschmack des Eigentümers, was den Häusern ein sehr malerisches Aussehen gab. Die Fenster waren klein, mit Butzenscheiben, und öffneten sich nach außen.
Das Haus, worin Toms Eltern lebten, lag in einer kleinen schmutzigen Sackgasse, die Unrathof hieß und beim Puddinggäßchen einmündete. Es war klein, verfallen und wackelig, aber vollgepfropft mit elendarmen Familien. Cantys Stamm bewohnte eine Kammer im dritten Stock. Mutter und Vater besaßen eine Art Bettstelle in der Ecke. Tom aber, seine Großmutter und seine beiden Schwestern Netty und Betty waren auf keine Ecke beschränkt, denn sie hatten den ganzen Fußboden für sich und konnten darauf überall schlafen, wo sie wollten. Einige Bündel altes, schmutziges Stroh lagen umher, und ein paar Fetzen von Decken waren auch noch da. Betten konnte man sie aber doch nicht gut nennen. Sie wurden jeweilen des Morgens in einen Haufen zusammengeworfen, und abends nahm jeder das beste davon, das ihm in die Hände fiel.
Netty und Betty waren Zwillinge von fünfzehn Jahren. Es waren gutmütige Mädchen, aber unsauber, zerlumpt und unwissend. Ihre Mutter war auch nicht anders, aber der Vater und die Großmutter waren sehr bösartig. Sie betranken sich, so oft sie konnten und dann prügelten sie einander, wenn ihnen nicht sonst jemand in den Weg kam, an dem sie gemeinsam ihre Fäuste erproben durften. Sie fluchten und schworen immer, ob sie nüchtern oder betrunken waren. Johann Canty war ein Dieb und seine Mutter eine Bettlerin. Aus den Kindern machten sie gleichfalls Bettler, aber zum Diebstahl waren sie nicht zu haben.
Mitten unter dem schrecklichen Gesindel im Hause lebte auch ein guter alter Priester, den der König seines Amtes entsetzt und mit wenigen Hellern Pension entlassen hatte. Dieser pflegte die Kinder beiseite zu nehmen und sie insgeheim rechte Wege zu lehren. So lernte Tom bei Vater Andreas sogar Latein und lesen und schreiben. Auch seine Schwestern hätten bei dem guten alten Manne lernen können, aber sie scheuten das Gelächter und den Spott ihrer Gefährtinnen, welche eine solche merkwürdige Vervollkommnung an ihnen nicht geduldet hätten.
Der ganze Unrathof war ein ebensolcher Ameisenhaufen wie Cantys Wohnhaus. Trunkenheit, Händel und Zank waren hier alltägliche und allnächtliche Dinge. Und doch fühlte sich der kleine Tom nicht unglücklich. Er hatte ein elendes Leben, aber er wußte es nicht, weil er nie ein besseres gekannt hatte. Alle Jungen im Unrathof teilten sein Schicksal. Daher glaubte er, dieses Leben sei das richtige und bequemste. Kam er abends mit leeren Händen nach Hause, so wußte er, daß sein Vater fluchen und ihn durchdreschen würde. War der Vater müde, so kam die Großmutter, fluchte auch und drosch ihn noch einmal durch, und sie verstand das beinah noch besser als ihr Sohn. In der Nacht aber, wenn alle schliefen, kam jeweilen seine hungernde Mutter mit einer elenden Krume Brot, die sie am eigenen Munde abgespart hatte, verstohlen zu ihm geschlichen. Oft aber wurde sie bei dieser Art Verrat von ihrem Manne ertappt und erbärmlich durchgebleut.
Tom beklagte sich also weiter nicht, im Sommer ging es auch ganz erträglich. Er bettelte nur gerade soviel, um sich vor den häuslichen Prügeln zu retten, denn die Gesetze gegen die Bettelei waren streng und die Strafen schwer. Einen guten Teil seiner Zeit verbrachte er bei Vater Andreas, der ihm herrliche alte Geschichten von Riesen und Feen, Zwergen und Elfen, verzauberten Schlössern, mächtigen Königen und schmucken Prinzen erzählte.
Mit der Zeit wurde sein Kopf ganz voll von diesen wunderbaren Dingen. Gar oft in der Nacht, wenn er im Dunkel auf seinem elenden, rauhen Stroh lag, müde, hungrig und mit zerschlagenen Gliedern, ließ er seiner Phantasie freien Spielraum. Dann vergaß er bald seine Schmerzen und Leiden über den köstlichen Bildern, die er sich selbst vorzauberte von dem reizenden Leben eines verhätschelten Prinzen in seinem Königspalast. Ein Wunsch kam immer wieder und plagte ihn Tag und Nacht: wenn er nur einmal, mit eigenen Augen, einen wirklichen Prinzen sehen könnte! Er sprach einmal davon zu seinen Kameraden im Unrathof. Diese aber lachten ihn aus und verhöhnten ihn so unbarmherzig, daß er fortan froh war, seine Träume für sich allein behalten zu können.
Aber immer wieder las er in den alten Büchern des Priesters. So kam es, daß sein Träumen und sein Lesen beinahe unmerkbar gewisse Veränderungen in ihm bewirkten. Seine Traumgestalten waren so schön, daß er anfing, seine schäbige Kleidung und sein schmutziges Aussehen zu beklagen. Zwar spielte er weiter mit seinen Kameraden im Straßenstaube und freute sich daran. Aber wenn er in der Themse herumplätscherte, so tat er es nicht mehr des bloßen Vergnügens halber, sondern auch, um sich und seine Lumpen zu reinigen.
Wachend und träumend beschäftigte er sich so stark mit seinem ersehnten Prinzen, daß er endlich unbewußt anfing, das Benehmen desselben, so wie er es in den Büchern geschildert fand, nachzuahmen. Seine Reden und seine Gebärden wurden merkwürdig zeremoniell und höflich, zur großen Verwunderung und Belustigung seiner Kameraden.
Sein Einfluß auf die anderen Jungen aber wuchs täglich. Schließlich schaute man zu ihm, wie zu einer Art höheren Wesens auf. Er schien aber auch soviel zu wissen! Ganz wunderbare Dinge konnte er erzählen. Die Jungen hinterbrachten es ihren Eltern, und bald fingen auch die Erwachsenen an, Tom mit anderen Augen anzusehen und ihn als ein höchst begabtes, außergewöhnliches Geschöpf zu betrachten. Seine Antworten waren so klug und sein Urteil so verständig! Nur seine eigene Familie merkte nichts von den Veränderungen, die in Tom vorgingen.
Insgeheim gründete Tom sogar einen Hofstaat. Er war der Prinz. Aus seinen besseren Kameraden bildete er Leibwachen, Kammerherren, Marschälle, Hofbeamte aller Art, sowie die Königliche Familie.
Täglich gab er unter ausgesuchten Zeremonien Audienz und besprach mit seinen Kabinettsräten die wichtigen Angelegenheiten seines Phantasiereiches. Täglich erließ er Verordnungen und Befehle an seine erdichtete Armee, seine Marine und seine Statthalter.
Nach Erledigung dieser Geschäfte ging er in seinen Lumpen wieder auf die Straße, erbettelte ein paar Heller, aß seine armselige Krume Brot, nahm die gewohnten Püffe und Schläge entgegen und streckte sich schließlich auf seine Handvoll elende Streue, wo ihn die Träume bald wieder in sein Königreich entführten. Aber der Wunsch, einmal einen wirklichen Prinzen von Fleisch und Blut zu sehen, wurde immer lebendiger in ihm, bis er zuletzt alle anderen Wünsche übertäubte und beinahe zur Leidenschaft wurde.
An einem Januartage machte er seine gewohnte Bettelstreife und trottelte dahin, barfuß und frierend. Begierig sog er den aus den Garküchen strömenden Duft ein und schaute mit sehnsüchtigem Verlangen nach den Leckerbissen in den Auslagen. Ein feiner, kalter Regen durchdrang seine Kleider, die Luft war trübe; es war ein melancholischer Tag.
Nachts kam Tom so naß und müde und hungerig nach Hause, daß sein Vater und seine Großmutter nach ihrer Weise gerührt sein mußten. Sie gaben ihm denn auch gleich eine tüchtige Tracht Prügel und hießen ihn schlafen.
Hunger und Schmerz und das Fluchen und Zanken seiner Quälgeister hielten ihn noch lange wach. Zuletzt aber schwanden seine Gedanken wieder sachte hinweg in ferne, romantische Länder, und er schlief ein in Gesellschaft schöner, juwelengeschmückter Prinzen in einem prächtigen Palast, umgeben von goldstrotzenden Dienern, die seinen Schlaf bewachten. Und dann träumte er, wie gewohnt, er sei selbst ein Prinz.
Die ganze Nacht erglänzte die Sonne der königlichen Pracht über ihm. Er bewegte sich unter großen Herren und Damen, in blendendem Schimmer, atmete Wohlgerüche, sog die herrliche Musik ein und dankte mit leichtem Neigen der ehrerbietig sich verbeugenden Menge, die sich teilte, um ihn durchzulassen.
Drittes Kapitel. Wie Tom mit dem Prinzen zusammenkam.
Tom erhob sich hungernd und hungrig schlenderte er hinweg. Seine Gedanken beschäftigten sich immer noch mit dem goldenen Zauber seines nächtlichen Traumes. Er wanderte dahin und dorthin, achtete nicht auf den Weg, noch auf das, was um ihn vorging. Die Leute stießen ihn an und gaben ihm rauhe Worte, aber er merkte es kaum. Immer weiter kam er von Hause weg, bis er endlich die Mauern der Stadt hinter sich hatte.
Er kam in ein Dorf und ruhte hier ein wenig. Dann ging er weiter und bog in eine schöne, ruhige Straße ein, an deren Ende ihm ein ungeheures Gebäude entgegenwinkte. Tom starrte in heller Verwunderung nach den mächtigen Pfeilern des Gebäudes, den ausgedehnten Flügeln, den drohenden Bastionen und Türmen, dem gewaltigen steinernen Torweg mit dem vergoldeten Gitter und der prachtvollen Reihe von granitenen Löwen und anderen Zeichen und Symbolen des Königtums. Sollte sich der Wunsch seines jungen Lebens endlich erfüllen? Hier, ja hier mußte der Palast des Königs sein! Der Himmel hatte sich sicherlich erbarmt und wollte das Sehnen eines armen Knaben stillen.
Zu jeder Seite des vergoldeten Hauptportals stand eine lebende Statue, eine stramm, stattlich und bewegungslos dastehende Schildwache, von Kopf zu Fuß in glänzender Stahlrüstung. Vor ihnen in achtungsvoller Entfernung gruppierten sich neugierige Leute vom Lande und aus der Stadt. Prächtige Wagen mit glänzenden Herren und Damen fuhren durch verschiedene andere Portale des gewaltigen Baues ein und aus.
Der arme kleine zerlumpte Tom kam mit pochendem Herzen näher und schlich sich scheu und langsam hinter die Schildwachen. Und seine Hoffnung wurde nicht getäuscht. Durch die vergoldeten Gitterstäbe hindurch bot sich ihm ein Schauspiel, über das er beinahe vor Freude gejauchzt hätte.
Drinnen im Schloßhof stand ein hübscher, von der Sonne leicht gebräunter Knabe, der ganz in Seide und Atlas gekleidet war und von Juwelen schimmerte. An seiner Hüfte hing ein kleiner, mit Edelsteinen besetzter Degen. Seine Füße staken in zierlichen Halbstiefeln mit roten Fersen. Seinen Kopf schmückte ein karmesinrotes Mützchen mit wallenden Federn, die ein blitzender Stein festhielt. Mehrere prächtig gekleidete Herren standen herum, ohne Zweifel seine Diener. O das war ein Prinz, ganz ohne Frage, ein lebendiger Prinz, ein wirklicher Prinz!
Tom wagte beinahe nicht zu atmen, und seine Augen vergrößerten sich vor Verwunderung und Entzücken. Alles drängte sich bei ihm in einen Wunsch zusammen: dem Prinzen nahe zu kommen und ihn gehörig zu betrachten. Bevor er wußte, was er tat, hatte er schon sein Gesicht fest an die Gitterstäbe gepreßt. Im nächsten Augenblick aber schleuderte ihn auch schon die Hand einer Schildwache roh hinweg, so daß er taumelnd unter die gaffende Menge flog.
»Nimm dich in acht, du junger Bettler!« rief ihm der Soldat nach.
Die Menge johlte vor Vergnügen. Der junge Prinz aber hatte den Vorgang bemerkt, sprang mit gerötetem Gesicht ans Portal und rief mit blitzenden Augen der Schildwache zu:
»Wie kannst du es wagen, einen armen Burschen so zu behandeln! Öffne das Tor und laß ihn herein!«
Ha, wie da die Hüte von den Köpfen flogen und wie die Menge schrie: »Lang lebe der Kronprinz!«
Die Soldaten präsentierten mit ihren Hellebarden, öffneten das Tor und präsentierten wieder, als der kleine Traumprinz in seinen flatternden Lumpen hereinkam, um dem wirklichen Prinzen die Hand zu schütteln.
Eduard Tudor sagte: »Du schaust müde und hungrig aus. Du bist schlecht behandelt worden. Komm mit mir!« Ein halbes Dutzend der umstehenden Diener sprangen herbei. Der Prinz aber winkte sie mit königlicher Gebärde hinweg, und sie standen wieder stockstill wie Bildsäulen.
Eduard führte Tom in ein prächtiges Gemach im Palast, das er sein Kabinett nannte. Auf seinen Befehl wurde ein Mahl gebracht, wie es Tom selbst in seinen Büchern so herrlich nicht gefunden hatte. Mit zartem Taktgefühl sandte der Prinz die Diener hinweg, damit sein Gast durch ihren kritischen Blick beim Essen nicht in Verlegenheit geriete. Dann setzte er sich nahe zu ihm und fragte, während Tom aß:
»Wie ist dein Name, Junge?«
»Tom Canty, Herr.«
»Ein sonderbarer Name! Wo wohnst du?«
»In der Altstadt, Herr. Im Unrathof, draußen im Puddinggäßchen.«
»Unrathof! Wieder ein merkwürdiger Name! Hast du Eltern?«
»Eltern habe ich, Herr, und auch eine Großmutter, aber die ist von fraglichem Werte für mich. Gott verzeihe mir, wenn es eine Sünde ist, daß ich es sage. Auch Zwillingsschwestern habe ich, Netty und Betty.«
»Dann ist also deine Großmutter nicht allzu gütig gegen dich, nehme ich an.«
»Gegen andere auch nicht, Herr. Sie hat ein böses Herz und sinnt auf Böses all ihre Lebtage.«
»Mißhandelt sie dich?«
»Es gibt Zeiten, wo ihre Hand ruht, wenn sie schläft oder ganz betrunken ist. Wenn sie aber ihren Verstand wieder klar hat, holt sie die versäumten Prügel gehörig nach.«
Des kleinen Prinzen Augen funkelten zornig, er rief:
»Was, Schläge?«
»O ja, gewiß, Herr.«
»Und du bist so schwach und schmächtig! Höre: bevor die Nacht kommt, soll sie im Turm sein. Der König, mein Vater ...«
»Aber, Herr, du vergißest ihren niedrigen Stand. Der Turm ist doch nur für die großen Herren.«
»Wirklich, du hast recht. Ich dachte nicht daran. Ich will aber über ihre Bestrafung nachsinnen. Ist dein Vater gut zu dir?«
»Nicht besser als die Großmutter, Herr.«
»Die Väter sind wohl alle gleich Heinrich VIII. war ein gewaltiger und gewalttätiger Herrscher. Schon äußerlich von stattlicher Gestalt, vereinigte er in sich die glänzendsten Gaben. Er war ebenso ausgezeichnet in Gelehrsamkeit wie in ritterlichen Künsten. Seine Herrschaft war eine unumschränkte; das Parlament war ihm sklavisch gehorsam. Vor nichts schreckte der König zurück, wenn er seinen Willen durchsetzen wollte, der ihm einzig maßgebend war. Bekannt ist Heinrich auch durch seine Schrift gegen Luther » Adserito septem sacramentorum«, worauf Luther mit einer Gegenschrift » Contra Henricum regem M. Lutherus« antwortete, die aber der König nicht mehr erwiderte, wiewohl er vom Papst für seine erste Schrift den Titel » Defensor fidei« (Verteidiger des Glaubens) erhalten hatte. Später überwarf er sich bekanntlich mit dem Papst und gründete die Anglikanische Kirche, zu deren Oberhaupt er sich ernennen ließ. Von nun an wütete er ebenso gegen Katholiken wie gegen Protestanten. Erst später neigte er dem Protestantismus zu. Obwohl er selbst auch nicht immer auf demselben Standpunkt in seinen Anschauungen blieb, verfolgte er Andersdenkende stets bis an sein Lebensende mit grausamer Unversöhnlichkeit.. Meiner hat auch kein Puppentemperament. Er läßt nicht mit sich scherzen, mich aber verschont er. Mit Worten freilich ist er auch nicht immer zart gegen mich. Wie behandelt dich deine Mutter?«
»Sie ist gut, Herr, und immer lieb zu mir, auch Netty und Betty.«
»Wie alt sind diese?«
»Fünfzehn Jahre, Herr.«
»Fräulein Elisabeth, meine Schwester, ist vierzehn und Fräulein Johanna Grey, meine Base, ist so alt wie ich und hübsch und liebenswürdig. Aber meine Schwester Marie mit ihrer düsteren Miene, die ist strenge. Höre nur: verbieten deine Schwestern auch ihren Dienerinnen zu lächeln, damit nicht die Sünde ihre Seele verderbe?«
»Meine Schwestern? Ja, glaubst du denn, Herr, sie haben Dienerinnen?«
Der Prinz betrachtete den kleinen Armen einen Augenblick ernst und sagte dann:
»Aber warum denn nicht? Wer hilft ihnen denn nachts sich auszuziehen? Wer zieht sie denn morgens an, wenn sie sich erheben?«
»Niemand, Herr. Sollten sie denn nachts ihre Kleidung ausziehen und ohne dieselben schlafen, wie die Tiere?«
»Ihre Kleidung? Haben sie denn nur eine?«
»Ach, Herr, was sollten sie denn mit mehr als einer Kleidung anfangen? Sie haben doch auch nur einen Körper.«
»Das ist ja köstlich. Entschuldige, ich wollte nicht lachen. Aber deine Schwestern Netty und Betty sollen Kleider und Dienerinnen genug erhalten und das bald: mein Schatzmeister wird dafür sorgen. Nein, du brauchst mir nicht zu danken; es ist nicht der Rede wert. Du sprichst übrigens recht gut und mit einer gewissen Anmut. Hast du viel gelernt?«
»Ich weiß nicht, Herr. Der gute Priester, den man Vater Andreas nennt, war so gütig, mich aus seinen Büchern zu lehren.«
»Kannst du Latein?«
»Nicht gar viel, fürchte ich.«
»Lerne, Junge, wenn es auch zuerst schwer fällt. Das Griechische ist schwieriger; aber keine von beiden Sprachen macht Fräulein Elisabeth und meiner Base viel Mühe. Du solltest nur die beiden Fräulein dabei hören! Aber erzähle mir etwas vom Unrathof. Hast du ein vergnügliches Leben dort?!«
»Eigentlich ja, Herr, wenn nur das Hungern nicht wäre. Es gibt da allerhand Buden mit dressierten Affen, so drollige, komische Geschöpfe. Und dann das Kasperltheater, wo sie schreien und auf einander losschlagen, bis alle tot sind. Es ist so schön anzusehen und kostet nur einen Heller. Aber freilich ist es oft gar schwer, einen Heller zu ergattern.«
»Erzähle mir mehr.«
»Wir Burschen vom Unrathof treiben allerlei hübsche Spiele und kämpfen auch in Reih und Glied mit einander.«
Die Augen des Prinzen glänzten und er rief:
»Meiner Treu, das wäre etwas für mich. Erzähle mir noch mehr.«
»Sodann laufen wir um die Wette, um zu sehen, wer am schnellsten laufen kann.«
»Das gefiele mir auch. Weiter!«
»Im Sommer, Herr, waten und schwimmen wir in den Kanälen und im Fluß und jeder duckt seinen Nachbar ins Wasser, so tief er kann, oder bespritzt ihn und dann lachen wir und schreien, tauchen unter und strampeln und plätschern und ...«
»Herrlich! Ich gäbe meines Vaters Königreich darum, wenn ich auch einmal dabei sein könnte! Bitte, fahre weiter.«
»Wir tanzen und singen um den Maibaum; wir spielen im Sande und vergraben einander darin, und manchmal machen wir auch Schlammpasteten. O dieser herrliche Schlamm! wie köstlich ist es, sich darin herumzuwälzen!«
»Ach, bitte, nicht weiter, das ist ja glorios! Wenn ich mir nur solche Kleider anziehen könnte, wie du hast und mit bloßen Füßen im Schlamme schwelgen, einmal, nur einmal, ohne daß mich jemand deshalb tadelte oder es mir verböte, mich dünkt, ich könnte auf die Krone verzichten!«
»Und ich, wenn ich mich nur einmal so kleiden könnte, wie du, lieber Herr, nur einmal ...«
»Oho, das möchtest du? Dann mag es ja so sein! Ziehe deine Lumpen aus und hülle dich in diesen Glanz, Junge! Es ist zwar ein kurzes Glück, aber deshalb nicht weniger süß. Wir wollen es genießen, solange wir können. Dann aber müssen wir unsere Kleider wieder wechseln, bevor uns jemand in die Quere kommt.«
Wenige Minuten später war der kleine Kronprinz in Toms zerfetzte Lumpen und der kleine Prinz der Armut in königlichen Glanz gehüllt. Beide standen nebeneinander vor einem großen Spiegel, und siehe da! welch ein Wunder! Sie starrten einander an, dann in den Spiegel und schließlich jeder noch einmal den andern. Endlich stieß der kleine Prinz hervor:
»Wie erklärst du dir das?«
»Ach, lieber Herr, erlaß mir die Antwort. Es ist nicht geziemend, daß einer meines Standes es ausspricht.«
»Dann will ich es aussprechen. Du hast dasselbe Haar, dieselben Augen, dieselbe Stimme und Haltung, dieselbe Gestalt, das gleiche Gesicht wie ich. Hätten wir beide keine Kleider an, so könnte niemand sagen, wer du bist und wer der Kronprinz. Jetzt aber, da ich gekleidet bin, wie du es warst, glaube ich dir noch besser nachfühlen zu können, was du empfandest, als dich der rohe Soldat ... ei, sieh, da hast du ja eine Schramme an der Hand!«
»Ja, aber es hat nichts zu bedeuten, und du weißt, Herr, daß der arme Soldat ja nur ...«
»Still! das war schändlich und grausam!« rief der kleine Prinz und stampfte mit seinem nackten Fuß. »Wenn der König ... doch halt! rühre dich keinen Schritt, bis ich wieder komme! Ich befehle es dir.«
Mit einem schnellen Griff hob er einen großen, goldschimmernden Gegenstand, der auf einem Tische lag, auf und legte ihn beiseite. Dann eilte er zur Tür hinaus und flog in seinen flatternden Lumpen mit heißem Gesicht und zornsprühenden Augen durch den Palast. Wie er an das große Portal kam, ergriff er die Gitterstäbe, rüttelte daran und rief:
»Öffnet! Auf mit dem Tor!«
Der Soldat, welcher Tom mißhandelt hatte, öffnete rasch. Wie aber der Prinz in königlichem Zorn durch das Portal gestürzt kam, versetzte ihm die Wache eine schallende Ohrfeige, so daß der Prinz wirbelnd auf die Straße flog, und rief dabei:
»Nimm das, du Bettlerjunge, für das, was du mir von seiner Hoheit eingetragen hast!«
Die Menge brüllte vor Lachen. Der Prinz erhob sich rasch vom Boden, stürzte wild auf die Wache los und schrie:
»Ich bin der Kronprinz, meine Person ist heilig, und du sollst hängen, weil du Hand an mich gelegt hast!«
Der Soldat präsentierte spöttisch mit seiner Hellebarde und sagte wütend: »Jetzt packe dich aber, du verrückte Brut!«
Die wiehernde Menge schloß sich um den kleinen Prinzen, drängte ihn die Straße hinunter und schrie: »Platz für seine königliche Hoheit! Platz für den Kronprinzen!«
Viertes Kapitel. Die Irrsale des Prinzen beginnen.
Stundenlang verfolgte die hartnäckige Menge den kleinen Prinzen. Solange er sich wehrte und raste und drohte und in herrischem Tone befehlen wollte, bot er dem Pöbel unerschöpflichen Anlaß zu Spott und Gelächter und war daher sehr unterhaltend. Mit der Zeit aber wurde er müde und still und verlor somit auch seine Anziehungskraft für die Menge, die allmählich von ihm abließ. Endlich fand er sich allein und frei, aber die Gegend um ihn herum war ihm gänzlich unbekannt. Ziellos ging er weiter. Die Häuser wurden immer spärlicher und die Vorübergehenden seltener. Er badete seine blutenden Füße in einem Bache, ruhte eine kurze Weile und wanderte weiter. So kam er auf einen großen Platz, worauf nur wenige vereinzelte Häuser und eine mächtige Kirche standen. Diese Kirche war ihm bekannt. Hohe Gerüste waren aufgerichtet und Schwärme von Arbeitern hantierten herum, denn die Kirche sollte ausgebessert werden. Der Prinz faßte wieder Mut; seine Leiden mußten ja nun zu Ende sein. Er sagte sich: »Das ist doch die frühere Kirche der grauen Mönche Den Grund und Boden, worauf das Kloster der Grauen Mönche stand, schenkte Heinrich der Gemeinde London, welche dort eine Heimstätte für obdachlose, verwahrloste Knaben und Mädchen schuf., die der König, mein Vater, den Mönchen genommen und zu einem Heim für arme, verlassene Kinder gemacht hat. Christuskirche, glaube ich, heißt sie jetzt. Gewiß werden die, an denen mein Vater so edelmütig gehandelt hat, gerne seinem Sohne behilflich sein, zumal dieser nun selbst so arm und verlassen ist, wie nur je einer, der hier Obdach findet.«
Bald stand er mitten unter einer Menge von Jungen, die herumliefen, hüpften, Ball und Laubfrosch spielten und großen Lärm vollführten. Alle waren gleich gekleidet. Jeder trug eine ganz kleine, flache, schwarze Mütze auf dem Kopfe, scheinbar mehr zur Zierde als zum Schutz. Darunter hing das Haar ungescheitelt bis auf die Mitte der Stirn herab, wo es ringsum abgestutzt war. Ein dicht anschließendes Obergewand fiel bis auf die Kniee oder noch tiefer herunter. Die Beine umhüllten hellgelbe Strümpfe, die ob dem Knie zusammengehalten wurden. Der Fuß stak in niedrigen Schuhen mit großen metallenen Schnallen. Die Hüfte umschloß ein breiter roter Gürtel, und die Ärmel waren weit und lose. Schön konnte man das Ganze kaum nennen.
Die Jungen hielten in ihrem Spiel inne und scharten sich um den Prinzen, der mit angeborener Würde sagte: »Gute Burschen, meldet eurem Meister, Eduard, der Kronprinz, wünsche ihn zu sprechen.«
Ein großes Geschrei erhob sich bei diesen Worten, und ein roher Bursche rief: »Bist du etwa der Bote Seiner Gnaden, du lumpiger Schlingel?«
Alles Blut schoß dem Prinzen ins Gesicht, und seine Hand fuhr rasch an die Hüfte.
Ein lautes Gelächter entstand, und ein Junge sagte: »Habt ihr gesehen? Er glaubt, er trage einen Degen an der Seite. Vielleicht ist er der Prinz selbst.«
Dieser Ausfall reizte noch mehr zum Lachen. Der arme Eduard richtete sich stolz auf und sagte: »Ich bin der Prinz, und es steht euch schlecht an, mir so zu begegnen, da ihr doch von der Güte meines Vaters lebt.«
Homerisches Gelächter belohnte diesen vermeintlichen Scherz. Der Junge, welcher zuerst gesprochen hatte, rief seinen Kameraden zu:
»Heda, ihr Schweine, ihr Sklaven, ihr Pensionäre seines königlichen Vaters, sind das eure Sitten! Nieder auf eure Kniee, ihr alle, und erweist seiner königlichen Haltung und seinen königlichen Lumpen Ehrerbietung!«
Mit stürmischem Jubel fielen alle zusammen auf die Kniee und verbeugten sich spöttisch vor ihrem Opfer. Der Prinz stieß den Sprecher mit dem Fuß an und sagte zornig: »Nimm das vorläufig; morgen werde ich einen Galgen für dich errichten lassen.«
Ah! das war schon kein Scherz mehr, das ging über den Spaß hinaus. Das Lachen hörte sofort auf, und wilde Wut ergriff die Burschen. Alle schrieen durcheinander: »Jagt ihn fort! Zur Pferdeschwemme mit ihm! Schlagt ihn tot! Wo sind die Hunde? Heda, Pluto! Hierher, Wolf!«
Dann folgte etwas, was England noch nicht erlebt hatte. Die heilige Person seines Thronerben wurde von Pöbelhänden gepufft und mit Hunden gehetzt ...
Als endlich der Tag zu Ende ging, war der Prinz fern von der Stätte seiner Demütigung in einem dicht bebauten Teile der Stadt. Sein Körper war zerschlagen, seine Hände bluteten und seine Lumpen waren mit Schlamm beschmiert. Weiter und weiter wanderte er. Immer elender ward ihm zu Mute, und so müde und schwach war er schon, daß er kaum noch einen Fuß vor den anderen setzen konnte. Er fragte niemand mehr, da er statt Auskunft und Hilfe doch nur Beleidigungen als Antwort bekam. Ein anderer Gedanke war in ihm aufgestiegen. »Unrathof«, murmelte er vor sich hin, »so sagte er doch. Wenn ich ihn nur auffinde, bevor es mit meiner Kraft zur Neige geht, dann bin ich gerettet. Seine Angehörigen werden mich in den Palast zurückbringen und beweisen, daß ich der wahre Prinz bin, und alles wird wieder gut sein.«
Dann und wann kehrten seine Gedanken wieder an den Ort zurück, wo man ihn so schmählich behandelt hatte, und er sprach bei sich: »Wenn ich König bin, sollen sie nicht nur Brot und Obdach haben, sondern auch Belehrung und Erziehung, denn ein voller Magen taugt wenig, wenn der Geist hungert und das Herz. Ich will daran denken, damit die Lehre dieses Tages an mir nicht verloren gehe und mein Volk darunter leide. Ja, mein Hofmeister hat recht: Bildung mildert die Sitten und macht sanft und mitleidig.«
Schon begannen vereinzelte Lichter zu flimmern; es fing an zu regnen, der Wind erhob sich, und eine rauhe, stürmische Nacht brach herein. Der obdachlose Prinz, der heimatlose Erbe des englischen Thrones wanderte immer noch weiter, tiefer hinein in das Labyrinth der schmutzigen Gäßchen, wo die schwärmenden Bienenstöcke der Armut und des Elendes sich zusammendrängten.
Plötzlich packte ihn ein langer, betrunkener Kerl beim Kragen und schrie ihn an: »Was! so spät in der Nacht lungerst du noch umher und bringst gewiß wieder keinen Heller nach Hause, ich wette. Wenn es so ist und ich breche dir nicht alle Knochen in deinem elenden Leibe, so will ich nicht Johann Canty sein!«
Der Prinz machte sich frei und rief eifrig: »O du bist also sein Vater? Dem Himmel sei Dank! Dann wirst du ihn holen und mich zurückbringen!«
»Sein Vater? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nur, daß ich dein Vater bin, was ich dir bald beweisen ...«
»O scherze nicht, zögere nicht! Ich bin zerschlagen, verwundet, ich kann nicht mehr. Bringe mich zum König, meinem Vater und er wird dich reich machen, so reich, wie du in deinen kühnsten Träumen nicht warst! Glaube mir, Mann, glaube mir! ich sage keine Lüge, sondern die reine Wahrheit! Nimm deine Hand von mir weg und rette mich; Ich bin wirklich der Kronprinz!«
Der Mann starrte verdutzt auf den Burschen, dann schüttelte er den Kopf und murmelte: »Verrückt geworden, ganz und gar verrückt!« Dann faßte er ihn nochmals am Kragen und sagte mit rohem Lachen und einem wilden Fluche: »Aber verrückt oder nicht verrückt, ich und deine Großmutter Canty, wir werden schon noch herausfinden, wo die weichen Stellen in deinen Gebeinen liegen, oder ich will kein Mann sein!«
Fünftes Kapitel. Wie es Tom inzwischen erging.
Tom Canty benutzte den Weggang des Prinzen, um sich ausgiebig vor dem großen Spiegel zu bewundern. Er nahm die vornehme Haltung des Kronprinzen an, spazierte hin und her und betrachtete