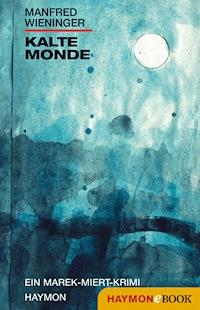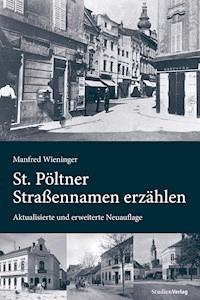Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marek-Miert-Krimi
- Sprache: Deutsch
Marek Miert, schwergewichtiger Hinterhof-Detektiv aus Harland, ist nicht gerade vom Erfolg verwöhnt. Die trostlosen Jobs, mit denen er sich über Wasser hält, sind nicht gut fürs Renommee. Den verschwundenen Liebhaber eines verzweifelten Mädchens zu suchen, gehört da schon zu den besseren Aufträgen. Doch dann stolpert Miert über eine Leiche, die dem Gesuchten zum Verwechseln ähnlich sieht, und schon sitzt der Diskont-Detektiv mit Hang zu Mozartkugeln, Mannerschnitten und tiefgründigen Rotweinen selbst in der Bredouille. Wenn es aber gilt, einem Mädchen zu helfen, dem übel mitgespielt wurde, kommt Marek Miert in Fahrt und schreckt auch vor kriminellen Mitteln nicht zurück - schon gar nicht, wenn es um den Harlander Rotlichtkaiser und seine Machenschaften geht. Manfred Wieningers Marek-Miert-Krimis verbinden die Tradition amerikanischer Hard-Boiled-Novels mit einem kritischen Blick auf die österreichische Kleinstadt-Provinz - und einer guten Portion Ironie. Sein sympathisch-cholerischer Anti-Held glänzt auch in seinem sechsten Fall mit einer großen Klappe und zupackendem Engagement im Kampf für die Schwachen und Benachteiligten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Manfred Wieninger
Prinzessin
Rauschkind
Ein Marek-Miert-Krimi
„Vier/fünf sieht aber nicht gut aus, gar nicht gut“,
murmelte Dr. Muratovic. Sein Akzent war so dezent wie das Glitzern des Geldes in den Augenwinkeln eines Weltbankpräsidenten. „Da werden wir wohl um klitzekleine Wurzelbehandlung nicht herumkommen, mein Lieber.“
„Weil ich mich auch immer so in meine Fälle verbeiße …“, antwortete ich.
Ich lag im Behandlungszimmer 3 von Dr. Muratovics Ordination. Seit jeher weigerte ich mich beharrlich, in 1 oder 2 unter die Bohrer zu kommen. Denn in Zimmer 3 hing an der Wand links von der Patientenliege ein Foto von Dr. Muratovics fröhlich Zähne putzendem, zehn- oder zwölfjährigem Sohn. Die Aufnahme beruhigte mich immer ein wenig, auch wenn ich sie für gewöhnlich gar nicht sah, da ich meine Augen ab dem Zeitpunkt, da ich mich auf der Behandlungsliege niederließ, fest geschlossen hielt und meinen Nacken gegen die abgenutzte, schwarzgrüne Kunstlederpolsterung drückte. Auf rätselhafte Weise beruhigte mich das Foto, auch wenn der Filius längst eine eigene, orthopädische Ordination in Simmering betrieb und eine ganze Menge seiner putzigen Zähne bei einer Rauferei in einem Studentenwohnheim verloren gegangen waren. Er hatte es eben nicht mehr ertragen, dass einige seiner Kommilitonen seinen Vornamen geradezu systematisch durch die Bezeichnung „Tschusch“ ersetzt hatten. Ordination 3 also. Drei hielt ich sowieso für so etwas wie meine Glückszahl. Dreimal hätte ich fast geheiratet. Dreimal ist in meiner Laufbahn als Detektiv schon auf mich geschossen worden und mittlerweile gab es in Harland drei Konkurrenz-Detekteien, darunter sogar einen Franchise-Betrieb von Pinkerton’s, dessen junge, absolut dynamische, aber schwer unterbezahlte Mitarbeiter weiße Hemden, schwarze, dünne Krawatten und dunkelblaue Firmungsanzüge trugen wie Mormonenmissionare. Die meisten von ihnen kauten auch im Außendienst permanent verzweifelt auf Zahnstochern oder irgendwelchen Lollis herum, weil sie zur amerikanisch-puritanischen Firmenphilosophie der totalen Nikotin-Abstinenz vergattert worden waren und Angst davor hatten, von Kollegen oder Kunden verpfiffen zu werden. Ich dagegen gönnte mir seit jeher den Luxus, mannhaft zu meinen diversen Süchten zu stehen, hauptsächlich zu Mozartkugeln und Manner-Schnitten, tiefgründigen Rotweinen und doppelten Portionen.
„Spritzerl?“, fragte Dr. Muratovic sachlich.
„Zwanzig Euro?“
„Siebenundzwanzig. Alles ist teurer geworden.“
„Gibt es denn eine Alternative?“
„Meinetwegen können Sie sich für irgendeinen Tapferkeitsorden vorschlagen lassen, aber bei Ihnen habe ich da so meine Zweifel …“
„Überredet“, meinte ich. Dann schloss ich wie immer fest die Augen, um Dr. Muratovics flinke, kleine Hände ja nicht sehen zu müssen, nicht die Spritze, nicht meine Schuhspitzen, die am unteren Ende der Behandlungsliege auf und ab zuckten, mit den Fersen auf das abgewetzte Kunstleder schlugen, nicht den weißen Glaskasten mit den Medikamenten, Pasten, Lösungen, Zahnzementen und -prothesen und nicht den uralten, jugoslawischen Fremdenverkehrsprospekt mit einer zuckerlbunten Ansicht von Sarajevo, der gerahmt über der Spüle hing. Ebenso wenig wie ich all die Instrumente und Werkzeuge, die Bohrer und Bohrköpfe, Zangen und Haken, Messerchen und Skalpelle, Küretten und Schaber sehen wollte, die rechts von mir griffbereit für den Doktor auf einem großen Tablett auf einem Rollkästchen lagen. Irgendwo über mir schwebte bereits der Kranarm des Zahnarztstuhls mit seinem penetrant surrenden Elektromotor.
„Tut gar nicht weh, nur bisserl! Genießen Sie es, Sie bezahlen ja schließlich dafür“, murmelte Dr. Muratovic und dann spürte ich auch schon den Stich und meine gesamte Muskulatur verspannte sich von den Ohrmuscheln bis zu den Zehenstreckern. Kerle wie ich erhielten nur höchst selten Einladungen zu Kuschelpartys und konnten auch was vertragen, aber beim Zahnarzt schmiss ich für gewöhnlich derart meine Nerven weg, dass es mir selbst schon ein wenig peinlich war. Wie schafften es all meine harten Kollegen aus den Filmen und Büchern bloß, niemals zum Zahnarzt zu müssen? Und wenn doch einmal, dann steckten sie die Spritzen, Bohrer, Meißel und die übrigen Folterwerkzeuge so locker weg wie nichts, wie den Stich einer gerade erst flügge gewordenen Baby-Gelse.
Muratovic, dachte ich, war ein guter Mann. Er hatte mir schon zweimal einen gebrochenen Unterkiefer zusammengeflickt, weil in meinem Beruf Schlägereien gelegentlich unvermeidlich waren, aber seine Vorstellung von Leidensvermögen entstammte einer völlig anderen Welt. Er war Bosnier und hatte zusehen müssen, wie die Tschetniks das elterliche Dorfwirtshaus plünderten und seine Mutter mit einem Besenstiel vergewaltigten. Als sie endlich fertig waren, hatten sie auch noch die restlichen Vorräte an Speise- und Heizöl, die sie nicht abtransportieren konnten, in den beiden Schankräumen und in der Wirtswohnung vollständig ausgeleert.
„Damals hätte ich Teufel meine Seele dreimal für Gewehr gegeben, aber meine Regierung hat immer auf Diplomatie gesetzt, und so gab es keine Gewehre, jedenfalls nicht auf unserer Seite.“
Muratovic wusste genug von mir und meinem Beruf, um mir gelegentlich solche Sachen zu erzählen, aber ein bisschen verachtete er dabei meine mitteleuropäische, vielleicht auch nur phäakisch-österreichische Wehleidigkeit. Wortlos verließ er mich, um in den beiden anderen Behandlungsräumen an Patienten weiterzubohren, bis das Lokalanästhetikum in meinem Kiefer seine Wirkung tat. Dr. Muratovics plump tänzelnden Schritt würde ich selbst in diesem nervösen Halbschlaf erkennen, in dem ich darauf wartete, dass das bitter schmeckende, aber doch unendlich süße Gift sich endlich ausbreitete, meine Lippen, meine Mundschleimhaut, meinen Kiefer ertauben und monströs anschwellen ließ und mir die Fähigkeit des Quasselns weitgehend nahm, die einzige Gabe, die ich von meinem Schöpfer in überreichem Maße erhalten hatte. Nur als eine Art sabbernder Glöckner von Notre-Dame blieben einem die banal-gemeinen Schmerzen einer Wurzelbehandlung erspart.
Die Welt, dachte ich im Einnicken noch, wird wahrscheinlich nicht durch die Liebe zusammengehalten, sondern eher durch die Bosheit. Eigentlich ist es nur der Hass, der Stabilität und langjährige „Beziehungen“ stiftet und die Vereinzelung des Individuums aufhebt. Seinen Peiniger vergisst man nicht, der Hauch einer Sommerliebe verfliegt dagegen bald wie Küchendunst.
***
„Heute stünden die Sterne günstig, sagt meine Nachbarin, ein Sternenfenster sei offen. Ich müsste mich am Abend nur ins Freie begeben und seinen Namen ins Universum rufen, dann würde er mir antworten. Was meinen Sie? Sie sind doch Detektiv und haben Erfahrung in so Sachen“, sagte eine sehr junge, weibliche Stimme irgendwo rechts neben mir, während ich mit immer noch krampfhaft geschlossenen Augen völlig verspannt auf der Liege in Dr. Muratovics Ordination lag und das Gefühl hatte, als wäre der rechte Teil meiner Ober- und Unterlippe gerade auf das Fünf- bis Achtfache der normalen Größe angeschwollen. Die leichtfüßigen, schnellen Schritte der Person, die mich da eben angesprochen hatte, waren mir völlig unbekannt. Wer auch immer sich da in den Behandlungsraum 3 eingeschlichen hatte, ich wollte sie nicht sehen, ich wollte nicht mit ihr sprechen. Ich presse meine Augen noch fester zusammen.
Was für Sachen denn, dachte ich, Sterngucken? Ufoschauen?
„Waassch“, war aber zunächst so ziemlich alles, was ich herausbrachte, um diese Fragen zu verbalisieren, der Rest des Satzes verschallte an den diversen veritablen Schwellungen in meinem Mund. Hilflos blubberte ich mit meinen Lippen, die wahrscheinlich hässlich angeschwollen waren. Auch diese Lippen würde ich jetzt keineswegs sehen wollen. Ich musste mich erst daran gewöhnen, dass ich momentan wohl einen Rachen wie ein Elefantenmensch hatte oder jedenfalls etwas, das sich so anfühlte.
„Wie man so hört, riskieren Sie doch sonst immer eine dicke Lippe. Sie könnten also jetzt wenigstens den Mund aufmachen, wenn ich Ihnen schon mein Innerstes offenbare!“, meinte die junge, weibliche Stimme ein wenig gereizt. Sie schien jetzt viel näher zu sein, etwa einen halben Meter von meinem rechten Ohr entfernt. Plötzlich spürte ich, wie mir ein kleiner Notizblock und ein Plastik-Kugelschreiber unter die rechte Handfläche geschoben wurden.
Meine ganze mühsam aufgebaute Konzentration zur potenziellen Schmerzminderung bei der bevorstehenden Wurzelbehandlung war mit einem Mal dahin. Entnervt öffnete ich die Augen. Vor mir stand eine hochaufgeschossene, anämische Blondine in einem weißen Kittel mit traurigen, hellblauen Basedow-Augen und einer kreidehellen, großporigen Haut. Irgendwie sah sie aus wie eine Prinzessin Diana für Arme. Vom Alter her hätte sie meine Tochter sein können. Ich hatte mir schon gedacht, dass die Stimme der neuen, zweiten Sprechstundenhilfe von Dr. Muratovic gehören könnte, die meines Wissens in einem kaum briefmarkengroßen Kammerl die Buchhaltung machte und den Einkauf für die Praxis erledigte.
„Sie sind doch Marek Miert, der Diskont-Detektiv? Ich kenne Sie doch aus der Zeitung!“, gab die junge Frau keine Ruhe.
Nein, dachte ich, momentan bin ich nur ein Bündel von tausend Ängsten, das entnervt auf den Beginn einer Wurzelbehandlung wartet. Ich schloss erneut die Augen, um die lästige Erscheinung ignorieren zu können. Aus dem Behandlungsraum 2 nebenan war das höllische Surren eines hochfrequenten Bohrers zu hören und das schmerzliche Aufheulen eines offenbar älteren Mannes. Beim nächsten Mal, dachte ich, werde ich mit Ohropax hier antanzen oder gleich eine Vollnarkose verlangen.
Plötzlich hatte ich eine Eingebung. Ich griff in die Brusttasche meines schweißnassen Hemds und holte die Visitenkarte hervor, die mir der Installateur heute Vormittag gemeinsam mit einer mehr als stolzen Rechnung von 170 Euro überreicht hatte, obwohl der gute Mann keine Viertelstunde gebraucht hatte, um meine Gastherme zu reparieren. Ich klemmte das Kärtchen zwischen Zeige- und Mittelfinger meiner rechten Hand und schwenkte meinen Arm aus wie ein Industrieroboter. An einem winzigen Ruck spürte ich, wie mir der dünne Karton aus den Fingern gezogen wurde. Dann war immerhin zwei, drei Sekunden Ruhe, während derer ich versuchte, in meine fast schon zen-buddhistische Zahnarztstuhl-Meditation zurückzufallen.
„Glauben Sie, ich hätte meine Hausaufgaben nicht ge-macht, bevor ich jemanden engagiere?“, beschwerte sich die Sprechstundenprinzessin.
Ich vermeinte zu hören, wie der Karton der Visitenkarte zweimal auseinandergerissen wurde.
Engagiert ist gut, dachte ich, ich werde mein Geschäftsfeld aber partout nicht auf Ufosichtungen und Überwachung Außerirdischer erweitern. Nolens volens öffnete ich wieder die Augen, um die junge, lästige Frau endlich abzufertigen.
„Was hätte ich schon davon, wenn ich Ihnen zuhöre?“, schrieb ich auf den Notizblock. Natürlich könnte man auch mit einer örtlichen Betäubungsspritze im Mund noch sprechen, wenn auch undeutlich und vernuschelt wie Hans Moser, und so wollte ich nicht sprechen.
„Die heutige Spritze gratis. Und künftige sowieso. Ich mache hier nämlich die Verrechnung“, antwortete der Quälgeist.
„Worum geht es eigentlich“, kritzelte ich auf das Papier und fügte drei Fragezeichen hinzu.
„Ich habe in einer Dreiviertelstunde hier Schluss, wir treffen uns am Würstelstand vor dem Hauptbahnhof!“
Diese Frau, die gleichsam in Rufzeichen sprach, während ich eher ein Mann der Fragezeichen war, duldete offenbar keine Widerrede, so jung und unbedeutend sie auch sein mochte.
„Worum geht es hier, verdammt noch ein… “, schrieb ich, aber da war die Sprechstundenhilfe schon leichtfüßig wie eine erbrechsüchtige, englische Adelige aus dem Zimmer geeilt und Dr. Muratovic im Türrahmen erschienen.
Ich schrieb ein ganz großes Fragezeichen in den Notizblock und stecke ihn zusammen mit dem Kugelschreiber in die Brusttasche meines klatschnassen Hemdes.
„Wie geht’s?“, fragte Dr. Muratovic.
„Alles in deutscher Hand“, antwortete ich und schloss gottergeben die Augen.
***
Was wird schon groß passiert sein, dachte ich, während ich vor Dr. Muratovics Ordination etwas Blut auf die Fahrbahn der Maximilianstraße spuckte, außer dass ihr wahrscheinlich gerade der Freund abhanden gekommen ist und sie in dem Alter ist, wo man den Verflossenen noch verzweifelt suchen lässt oder ihm selber nachspürt oder beides. Wenn man älter wurde, ließ man das schön langsam bleiben und tröstete sich beim Badeurlaub in Tunesien mit einem netten Zahlkellner oder einer Gourmet-Reise durch das Elsass. Liebe war sicherlich mehr als Reibung, aber vielleicht alles in allem doch nur Selbstbetrug, und die einzige Freiheit, die uns letztlich wirklich blieb, war die Freiheit des Konsums. Wenn du gerade beim Zahnarzt warst, Miert, bist du wirklich nur schwer zu ertragen, dachte ich. Oder sie war einfach eine Gläubigerin, die sich mit meiner Hilfe auf die Spur eines Schuldners setzen wollte. Das wäre wenigstens kein romantischer Schwachsinn, sondern etwas Reelles. Immerhin hatte ich einmal eine Zeitlang für eine Leasingfirma gearbeitet und denen zig Autos von zahlungsunwilligen oder betrügerischen Kunden zurückgeholt, für die meistens nicht einmal eine einzige Leasingrate berappt worden war. Mit diesen Gedanken und gelegentlich ein bisschen Blut und Schleim spuckend spazierte ich langsam quer durch mein Viertel in Richtung Bahnhof. Ich war noch immer etwas high von der Spritze, aber die Schwellung meiner Lippen ging bereits spürbar zurück.
Das Viertel hinter dem Hauptbahnhof war in der Gründerzeit in die Felder nördlich der Westbahn hineingewachsen wie die Sporen eines aggressiven Pilzes in die Zimmerwand einer schlecht gelüfteten Altbau-Gemeindewohnung. Hastig hochgezogene, wuchtige Mietskasernen mit winzigen Zimmern und rattenkäfigähnlichen Kleinstwohnungen für die slowakischen und ruthenischen Wanderarbeiter, die einst in den Fabriken der Stadt malochten für meist nicht viel mehr als ein bisschen Brot und ein Bett und dann und wann ein Hemd. Dazwischen hin und wieder eine Branntweinstube, wo man sich das Hirn wegsaufen konnte, einfachste Läden, die auch und sowieso den Fabriksbesitzern gehörten, Hinterhofwerkstätten, Gerbereien, Abdeckereien, deren Gestank und Abwässer schon zu Kaisers Zeiten keinem anderen Stadtteil zuzumuten gewesen waren. Die schlammbedeckten Straßen zwischen den Elendsquartieren hatten die klangvollen Namen vergangener Regenten, Erzherzöge, Erbprinzen und Hofmaler bekommen, ein Zeichen dafür, dass man den im Gemeinderat sitzenden Fabrikanten einen gewissen Sinn für Zynismus nicht absprechen konnte. Mittlerweile waren viele Fabriken geschlossen, die zum Großteil aus Ziegeln mit unter den Lehm gemischtem, gehäckseltem Stroh errichteten Mietskasernen abgenutzt wie Duftsteine, die hundert Jahre in einem Urinal gelegen hatten, oder zusammengebrochen unter der Last des landläufigen Unglücks, und dazwischen hatten die amerikanischen und russischen Bomben des letzten Krieges auch noch Lücken gerissen wie die Karies in ein Gebiss. In diesen Löchern hatte man seit jeher Bauschutt abgelagert und Schlimmeres oder bestenfalls ein paar Verkaufsbuden aus Blech, Eternit und Sperrholz aufgestellt, weil sich wirkliche Investitionen schon seit dem Attentat von Sarajevo nicht mehr gerechnet hatten. Nicht einmal für reservierte Dauer-Parkplätze auf den Trümmergrundstücken fand sich genügend Kundschaft. Nur der Teufel hatte in dieses Grätzel gelegentlich ein bisschen Zeit und Mühe investiert, aber auch kein Geld. Dafür bezahlte man hier nur sehr wenig Miete oder gar keine, weil die vielen Abbruchhäuser längst ein diskretes, wenn auch keineswegs stilles und sehr gemischtes Publikum angezogen hatten. Verkommene, versulzte Hagestolze, ältere Alkoholiker, die ihre letzten Monate und Jahre nicht in einem trockenen, kirchlich geführten Obdachlosenheim oder in einem staatlichen Seniorenwohnheim verbringen wollten, in dem das Aufregendste der dort ausgeschenkte Früchtetee war, Flüchtlinge und Asylanten aus aller Herren Länder, vor allem Tschetschenen, Kurden und Afghanen, die aus der Bundesbetreuung gefallen waren und jahrelang auch keine Arbeitserlaubnis erhielten, jugendliche Ausreißer, die in den verfallenen Hinterhöfen die pflanzliche Basis ihrer Kiffe anbauten, kaputte, irrwitzig gewordene Geheimprostituierte, die in keinem Bordell im weiten Umkreis mehr unterkamen, durchreisende Einbrecherbanden aus Moldawien und weiß Gott wo, und nicht zuletzt eine ansehnliche Menge an ganz gewöhnlichen Verlierern wie ich, die den Offenbarungseid schon mehr als einmal geleistet hatten. Ich weiß nicht, wann dieses Viertel endgültig vor die Hunde gehen wird, dachte ich, ich weiß nur, dass ich hier wahrscheinlich nicht mehr herauskommen werde, mein Lebtag lang. Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, aber manche Dinge bringt nicht einmal der liebe Gott zustande. Zum Beispiel, dass beim nächsten Derby zwischen dem SC Harland und Sturm 19 beide Mannschaften gewinnen.
***
Den ganzen Nachmittag lang war es schon so kühl gewesen wie bei einem Familientreffen der Windsors. Trotzdem entdeckte ich in einem Schanigarten vor einem Albaner- oder Kosovaren-Beisel an der Einmündung einer Seitengasse in die Daniel-Gran-Straße, der aus nicht mehr als zwei großen, dunkelblauen, umgedrehten Plastiktonnen, auf deren Boden man Gläser und Teller abstellen konnte, und einem ausgebleichten Visa-Sonnenschirm bestand, Vickerl Vavra, einen stadtbekannten, alten Pseudo-Achtundsechziger. Seine kurze, gedrungene Gestalt steckte in einem dunkelgrünen, verwaschenen Jeansanzug und ein schwarzgrauer, dünner Pferdeschwanz, wohl sein ganzer Stolz, hing ihm fast bis in die Gegend des Kreuzbeins. Geschleckte, aber irgendwie schiefmäulige Visage mit einer Strandsonnenbrille von Bulgari. Wenn man ihn nicht näher kannte, hätte er durchaus als berufsjugendlicher Moderator bei irgendeinem Radiosender durchgehen können oder als alternder Kurator für aktionistische Kunst. Ich wusste von ihm eigentlich nur, dass er sich Ende der Sechzigerjahre als Sechzehn- oder Siebzehnjähriger am Morgen vor einer Französisch-Nachprüfung am ganzen Körper zitternd geweigert hatte, aus dem Bett aufzustehen und seiner alleinerziehenden Mutter erklärt hatte, dass er der Schule und natürlich auch einer eventuellen Lehre, die sie für ihn eventuell im Auge hätte, in Hinkunft fernbleiben werde. Dazu passend war er in eine kurze, aber offenbar beeindruckende Ohnmacht gefallen. Seine besorgte Mama, eine beamtete Putzfrau in der Bezirkshauptmannschaft, hatte ihn darauf zeit ihres Lebens gehegt und gepflegt, ernährt und unterhalten, umsorgt und ausgestattet, nicht zuletzt mit ebenso coolen wie teuren Sonnenbrillen. Leider war sie vor einigen Jahren beim Stadtfest an einer gegrillten Flugentenbrust erstickt, sodass der Sohnemann sich spät, aber doch zu irgendeinem Erwerb durchringen musste. Vickerl hatte sich vernünftigerweise auf das Einzige geworfen, von dem er wirklich etwas verstand, nämlich auf Rohypnol, Valium, Substitol und das weite, lohnende Geschäftsfeld der Morphine. Darüber hinaus konnte man bei ihm dem Vernehmen nach eine Vielzahl rezeptpflichtiger Medikamente en gros und en detail erwerben. Er musste, dachte ich, auch über ziemlich gute Beziehungen nach oben verfügen, weil er, soviel ich wusste, immer wieder darum herumgekommen war, länger einzusitzen. Mehr als insgesamt ein paar Wochen Untersuchungshaft hatte er wohl nicht hinter sich, und das war in seiner Branche durchaus ungewöhnlich. Vor sich hatte er ein großes, gut gefülltes Wasserglas stehen, auch der Ouzo war sein Ding, nicht nur die Pulver und Tabletten, die er verhökerte. Das einzig Positive, das sich über den Kerl sagen ließ, war, dass er sein Zeug nicht an offensichtliche Kinder abgab. Jedenfalls erzählte man sich das im Viertel, aber vielleicht war das auch nur ein von ihm selbst gestreutes Gerücht, um ein paar Gutpunkte zu sammeln.
Auf jeden Fall trat ich kurz entschlossen von der Gasse auf ihn zu. Vielleicht hatte ich Blut am Kinn und an Hemd und Jacke, denn der Bursche brachte sofort eine der Mülltonnen zwischen sich und mich und umklammerte sein Ouzo-Glas, als wolle er es im nächsten Moment nach mir werfen.
„Bist gerade entlassen worden, Compañero?“, fragte er mit einer Stimme, die nach kubanischen Zigarren, Klo am Gang und Feigheit klang.
„Ich weiß nicht, was man genau zu Ihnen sagen muss, um eine schön starke Schmerztablette zu bekommen, aber ich hätte jetzt so eine Pille nötig.“
„Kennen wir uns?“ Vickerl Vavra hatte die Sonnenbrille in die Stirn hochgeschoben, um mich besser betrachten zu können. Er hatte grüne Augen und violette Augenringe und hätte glatt ohne Maske in einer rumänischen Science-Fiction-Fernsehserie mitspielen können.
„Ich habe vor ein, eineinhalb Jahren einen Stammkunden von Ihnen eine Zeitlang beschattet und weiß daher, dass Sie so ein Zeugs und dazu noch ein paar andere Pulver verscherbeln.“
„Wenn du Schmerztabletten einwerfen willst, dann geh doch in die nächste Apotheke, Compañero!“
„Die Leute sagen Ihnen, was Sie wollen, und Sie verlassen kurz den Schanigarten, gehen um die Straßenecke bis zu einer blechbeschlagenen Holzkiste mit einem schweren Vorhängeschloss, in dem die Straßenkehrer Sand, Schotter und ein bisschen Streusalz für den Winterdienst im Grätzel lagern. Da drin haben Sie Ihre Ware, und Sie haben sich natürlich einen Schlüssel nachmachen lassen.“
Nicht ungeschickt der Bursche, dachte ich, auf diese Weise konnte nie jemand mehr als die paar Pulver, die er gerade einstecken hat, in seinem Besitz vorfinden, die Kiste gehört ja der Stadtgemeinde.
„Ist das jetzt Versteckte Kamera oder was?“
„Ich habe mich immer gefragt, was Sie eigentlich im Winter machen, wo ja die Straßenkehrer diese monströse Kiste öfter mal aufschließen müssen, um Streugut zu entnehmen.“
„Mann, hörst du schlecht? Bist du taub? Glaubst du echt, dass ich hier allein stehe? Ich habe mal so einen Typen gekannt, einen großmäuligen, verwirrten Wandschrank genau wie du, der ist auf fünf Polizisten, die ihn bereits umstellt hatten, mit einem Käsemesser losgegangen. Die haben ihm dann einfach eine Niere und die Hoden weggeschossen. Suicide by Cop, wenn du weißt, was ich meine! Und du begehst hier gerade Suicide by Albaner, Compañero!“
„Was wetten wir, dass sich Ihre Albaner einfach einen neuen Grüßaugust suchen, wenn Ihnen etwas passiert? Also, wenn Sie nicht sofort ein, zwei Schmerztabletten rüberwachsen lassen, zeige ich Sie an. Und wenn du mich noch einmal duzt, zeige ich dich sowieso an. Haben wir uns?!“, sagte ich völlig ruhig.
Vickerl Vavra schien einen Moment zu überlegen, soweit das sein chronisch vergiftetes Hirn überhaupt zuließ. Dann schob er die Sonnenbrille in einer theatralischen Geste über die Augen und meinte: „Schon gut, wir sind im Geschäft.“
„Aber mach dalli! Und glaub ja nicht, dass du für das Zeug auch nur einen Cent von mir siehst! Das hier läuft unter Nachbarschaftshilfe!“
Das nächste Mal, dachte ich, wenn ich wieder mal nicht einschlafen kann, werde ich vielleicht nächtens hierher zurückkommen, mich von der Seitenstraße zu seiner Wunderkiste schleichen, sie aufbrechen und auf seine Ware pinkeln. Auch Spaß muss sein.
***
„Gratuliere, der Würstelstand war ja echt eine enorm gute Wahl von Ihnen! Eine Viertelstunde darf ich noch nichts trinken, eineinviertel Stunden nichts essen – was können Sie mir empfehlen?“, fragte ich die Sprechstundenhilfe, die sich als Silvia Sladki vorgestellt hatte und grüne Jeans und ein knallbuntes, viel zu großes T-Shirt der L. A. Lakers trug. Außerdem hatte sie eine dieser riesigen, goldpaillierten Leinen-Handtaschen dabei, die einem in 1-Euro-Shops nachgeworfen wurden.
„Dass di glei wieder schleichst, Schwindlicher, und deine deppatn Schmäh woanders probierst. Hamma uns?“, mischte sich der Standler ein, ein grobschlächtiger, unrasierter Mann in einem langärmeligen, weiten Rapid-Leiberl und einer ebenfalls tiefgrünen Kellnerschürze. Er roch nach Bratenfett und Kanal und jener Art von verschwitzter Vorstadt-Ritterlichkeit, die gerade noch in einer Provinzstadt wie Harland für nonchalant gehalten wurde.
Na, geht der jetzt mit der Gurkenzange auf mich los oder was, fragte ich mich.
„Ist schon gut, Ferry“, beruhigte Frau Sladki den Mann, „eh alles in Ordnung.“ Offenbar war sie Stammkundin, obwohl sie eher nicht hierher passte. Man hat halt so seine Vorstellungen, dachte ich, wie Prinzessinnen sich ernähren.
„Weil’s wahr ist!“, fauchte der Kerl, wandte sich dann aber wieder den diversen Würsteln zu, die hinter ihm auf einer riesigen Grillplatte brutzelten.
„Billig und sättigend – seit Lászlo fort ist, schwimme ich nicht gerade im Geld“, sagte Silvia Sladki leise und wandte sich wieder mir zu. Irgendwie hatte sie, überlegte ich überrascht, meine Gedanken gelesen oder auch nur meinen Gesichtsausdruck.
„Ich habe nichts gegen die traditionelle Esskultur hierzulande, gegen die Unmengen an fettem, hormon- und antibiotikaverseuchtem Schweine- und Rindfleisch, die wir so verschlingen, ganz im Gegenteil. Ein gutes Schweinsbratenrezept, das ist jedenfalls meine Meinung, kann für eine Kultur ungleich wertvoller sein als ein schlechtes Opernlibretto“, versicherte ich.
„Dann sind wir ja auf einer Linie!“, freute sich die Sprechstundenhilfe.
„Ja, in einem winzigen Detail, aber in der Hauptsache …“, meldete ich meine Zweifel an. „Ich bin jetzt gut eine halbe Stunde vor dem Bahnhof auf und ab gegangen und weiß überhaupt nicht, warum.“
„Schauen Sie, ich habe Sie ja nicht zum Spaß hierher bestellt.“
„Nicht?“
„Ich meine es ernst, ich meine alles im Leben ernst. Ich bin ein Rauschkind, müssen Sie wissen. Mein Vater hat meine Mutter vierzehn Jahre lang jeden Tag geschlagen. Nur die letzten zwei Jahre hat er sie weitgehend in Ruhe gelassen, da war er mehr mit seinem Sterben beschäftigt. Er ist schließlich an seinem eigenen Blut aus der Speiseröhre erstickt.“
„Ich möchte etwas über den Mann aus dem Universum wissen“, sagte ich leise.
„Ich habe ihn geliebt“, antwortete Silvia Sladki, „fast zwei Jahre lang. Bis zum 2. März dieses Jahres. An diesem Tag ist er um Viertel nach sieben noch vor die Tür gegangen, um Zigaretten zu holen vom Automaten. Seitdem habe ich nie wieder etwas von ihm gehört.“
„Mehr als sieben Monate …“, überlegte ich laut.
„Seither habe ich unsere Wohnung verloren, unser Auto, unser Bankkonto und meine ganze Zuversicht.“
„Wo haben Sie gewohnt? Wo ist er verschwunden?“
„In der Kremser Landstraße 42. Genau gegenüber auf 43 ist der Zigarettenautomat, vor einem Blumenladen. Er hat Fuchsien geliebt, ihre Farben, ihr Vielfalt.“
„War er vielleicht ein Falter, den es halt, weil er nicht anders kann, von Blume zu Blume zieht?“
„Vor ein paar Monaten hätten Sie mich mit dieser Frage noch beleidigt, aber mittlerweile …“
„Ich bin wirklich alles andere als ein Bürokrat, aber schön langsam könnten Sie mir der Ordnung halber seinen vollen Namen verraten.“
„Lászlo Zsigmund. Zsigmund mit zs.“
„Ein Ungar?“
„Nein, ein Chinese! Mit dem Namen!“, nutzte Silvia Sladki meine aufgelegte Elferfrage für einen halben Scherz, ihren ersten und einzigen übrigens, den ich jemals von ihr hören sollte. Sonst war sie trotz ihres flotten Outfits innerlich wohl eher eine trauerumflorte Persönlichkeit, eine zugleich schmerzlich und aggressiv trauernde Witwe wie aus einem Lorca-Drama.
Auf jeden Fall hielt sie mir plötzlich ein Foto hin, nach dem ich mechanisch griff. Es war eine postkartengroße, schwarzweiße Porträtaufnahme eines etwa dreißigjährigen Mannes. Ein regelmäßiges, gepflegtes, glatt-hübsches Gesicht, penibel rasiert wie der Pudel der Queen, mit langweiliger, aber modischer Kurzhaarfrisur. Genau der Typ Mann, dachte ich, der garantiert jedes Vorsprechen für eine Modevorführung in einem Tullner Kleiderhaus gewinnt.
„Bestimmt haben Sie das plötzliche Verschwinden auch der Polizei gemeldet und das BKA führt Ihren Lászlo längst in der Vermisstenkartei“, bemerkte ich.
„Sicher. Aber die Polizei hat bloß gemeint, dass es einen Lászlo Zsigmund, geboren am 1. April 1978, in Österreich gar nicht gibt. Der Lászlo Zsigmund mit diesem Geburtsdatum, der Lászlo Zsigmund, der 1999 nach Harland gekommen ist und ein paar Jahre in der Daniel-Gran-Straße 16 gewohnt hat, ist vor etwas mehr als drei Jahren wieder nach Ungarn zurückgegangen, er hat sich jedenfalls ordentlich abgemeldet. Hat man mir erklärt. Laut Polizei habe ich es also zwei Jahre lang mit einem Phantom gehalten, habe ich mit einem Geist zusammengelebt!“
Keine zwei Meter neben dem Würstelstand am südlichen Portal des Hauptbahnhofs blieben immer wieder Linienbusse stehen und spuckten Dieselwolken und Passagiere aus, meistens Wiener, die tagsüber in Harland die besseren, die qualifizierteren Jobs besetzt hielten und nun ihren Zügen zustrebten, um endlich nach Hause zu kommen und ihre abendliche Abovorstellung im Theater in der Josefstadt oder in der Volksoper nicht zu verpassen. Die Busse fuhren weiter in die Remise und bliesen beim Anfahren noch einmal Milliarden Rußpartikel aus. Die Reste des Anästhetikums, der Ruß und all das Kohlenmonoxid machten meinen Kopf schwer und immer schwerer. Ich konnte Frau Sladkis Geschichte kaum mehr folgen und wollte es auch nicht mehr. Eigentlich sprach alles dafür, dass sich dieser Zsigmund oder wie auch immer er hieß, einfach vertschüsst hatte, als die Romanze erkaltet war.
„Eigentlich kann ich Ihnen auch kaum etwas zahlen“, sagte Silvia Sladki, „Sprechstundenhilfen werden nicht so wahnsinnig gut entlohnt, daneben mache ich zwar noch Aushilfe in der Fischhandlung, aber allein für das viele Duschgel und die Lotions, um den Fischgeruch wieder wegzubringen, gebe ich alles in allem wahrscheinlich mehr aus, als mir der Job einbringt.“
„Sie machen mir den Auftrag ja richtig g’schmackig …“
***
„Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte“, sagte ich und Ferry, der ritterliche Standler, der unserer Unterhaltung ungeniert und mit voller Aufmerksamkeit zuhörte, musterte mich misstrauisch.
„Ah ja?“, meinte die verlassene Sprechstundenhilfe zweifelnd.
„Also, vor ein paar Jahren fährt ein Hiesiger, ein pensionierter hoher Beamter, katholisch bis in die Zehenspitzen, gemeinsam mit zwei, drei Freunden, seinen Haberern, zu Ostern nach Lourdes, Mutter Gottes schauen und auch spirituell und so. Natürlich Tausende Pilger, stundenlanges Anstellen, es ist der kleinen Gruppe aus Harland nicht einmal möglich, einen noch so kurzen Blick in die berühmte Grotte zu werfen, in der die Gottesmutter dem Hirtenmädchen erschienen ist. Da fängt der ehemalige Spitzenbeamte plötzlich am ganzen Körper wie wild zu zucken an, verzieht grässlich das Gesicht und lässt sich auf die Seite hängen, dass man Angst haben muss, er könne jeden Moment umfallen. Seine Haberer in der Warteschlange stützen ihn und können sich die Sache im Übrigen nicht recht erklären. Höchst besorgt tippen sie schließlich auf einen Schlaganfall und zücken hektisch ihre Handys, um die Rettung zu rufen, aber nur einer von ihnen hat sein Handy für das Ausland freischalten lassen und keiner kann genug Französisch, um einen der Einheimischen zu irgendetwas zu bewegen. Da bemerkt ein Angestellter des Heiligtums, ein professioneller Fremdenführer für Schwerinvalide, deren letzte Hoffnung Lourdes ist, den zuckenden Hofrat, holt flugs einen Rollstuhl, setzt den offensichtlichen Spastiker hinein und fährt ihn an den Warteschlagen vorbei zur Grotte, ja sogar in die Grotte. Der Hofrat ist – ruckzuck im wahrsten Sinn des Wortes – am Ziel seiner Wünsche angelangt und natürlich ereignet sich, als er alle Attraktionen von Lourdes im Rollstuhl ausgiebigst besichtigt hat und während seine Kumpel noch immer Schlange stehen, eine erstaunliche Spontanheilung, sprich ein Wunder.“
Ich habe mich eigentlich immer gefragt, dachte ich, was dieser Betrug eines an sich Gläubigen in spiritueller Hinsicht bedeutet, ob diese Pilgerreise dort oben zählt oder nicht.
Ferry starrte mich an wie eine Erscheinung und wandte sich dann achselzuckend ab und seinen Würsteln zu.
„Und? Was ist der Sinn hinter der Geschichte? Was wollen Sie mir damit sagen? Dass ich nach Lourdes fahren soll, damit mir Lászlo erscheint?“, fragte Silvia Sladki genervt. Sie war jung, sie wollte sich nicht mit Dingen und Geschehnissen außerhalb ihres Lebenskreises beschäftigen.
„Keine Ahnung, für Sinnfragen bin ich von Berufs wegen nicht zuständig. Ich habe die Erzählzeit eigentlich nur gebraucht, um mir darüber klar zu werden, dass ich es mir einfach nicht leisten kann, einen Auftrag anzunehmen, bei dem höchstens mal dann und wann eine Gratisspritze bei Dr. Muratovic herausschaut. Sie haben ja selbst gesagt, dass Sie kaum Geld haben. Als Diskont-Detektiv bin ich zwar billig, aber so billig auch wieder nicht. Schließlich bin ich nicht die Caritas …“
Ich habe mich, dachte ich, lange genug als Wohltäter der Menschheit aufgespielt, jetzt wäre es mal an der Zeit, Geld zu verdienen. Dieser Gedanke gefiel mir, obwohl ich ehrlich gesagt keinerlei Ahnung hatte, womit in Zeiten wie diesen richtig Geld zu verdienen wäre. Mit meiner Ein-Mann-Hinterhof-Detektei sicherlich nicht.
„Ich könnte Ihnen noch etwas anbieten …“, sagte Silvia Sladki leise.
„Was?“
„Mich.“ Die Stimme der anämischen Blondine war nur mehr ein Hauch. Ein Zeichen dafür, dass sie solche Angebote nicht jeden Tag machte. Schon gar nicht einem Diskont-Detektiv, der breiter als ein Schaufelbagger und auch nicht wesentlich attraktiver als ein solcher war.
„Hören Sie, Fräulein: Für einen, der Geld für Leberkässemmeln, Benzin und Anzüge von der Stange braucht, ist das keine gültige Währung. Noch dazu, wo ich bei meinen letzten Fällen nicht gerade wahnsinnig viel verdient habe. Außerdem könnten Sie meine Tochter sein …“, lehnte ich ohne groß zu zögern ab.
Plötzlich trat in Silvia Sladkis junges, glattes Gesicht eine erschreckende Leere. Wie wenn eine, dachte ich, von einer Sekunde auf die andere Alzheimer entwickelt, den Kontakt zur Außenwelt verliert und in sich, in den eigenen, verwirrten Geist zurückfällt, in ein Zentrum ohne Peripherie. Sie drehte sich wortlos und wie in Zeitlupe um und machte einen Schritt in Richtung Innenstadt. Keine Verabschiedung, kein Gruß, nicht einmal eine Beschimpfung oder ein Fluch. Mir wäre alles lieber gewesen als dieser schräge Zusammenbruch von einer Sekunde auf die andere. Als sie schon längst um die Ecke der Brunngasse gebogen war, bemerkte ich erst, dass ich noch immer das Foto ihres verschwundenen Lebensgefährten in der Hand hielt. Ich drehte es um. Auf der Rückseite standen in einer blassblauen, kindlichen Schrift sein Name und sein Geburtsdatum. Das Leben, dachte ich, ist halt ungerecht, nicht unähnlich einer Mafia-Lotterie. Ich steckte das Foto in die Brusttasche meines Sakkos und ging Richtung Bahnhof. Dahinter lag mein Wohnbüro, in dem wohl niemand auf mich warten würde, meine Couch mal ausgenommen. Die Schmerzen hatten ein wenig nachgelassen, aber ich fühlte mich müde und ausgelaugt. Meinen Traumberuf, Versuchsperson in einem Schlaflabor, hatte ich einst klar verfehlt, aber man musste kein Profi sein, man konnte auch als Amateur auf einer guten Couch reüssieren.
Die violettgelbe Tablette von Vickerl Vavra fischte ich aus dem Hosensack und warf sie in einen Gully. Wer weiß, dachte ich, was mir der Kerl da gegeben hat. Außerdem waren es zwar hundsföttische Schmerzen, aber es waren eben meine Schmerzen.
***