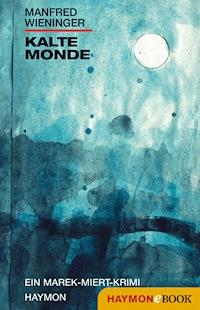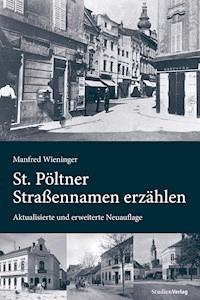Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Haymon Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Marek-Miert-Krimi
- Sprache: Deutsch
DER NEUE KULT-KRIMI VON MANFRED WIENINGER: MAREK MIERT, DIE UKRAINISCHE MAFIA, EIN PSYCHOPATHISCHER POLIZEIOBERST ? UND ÜBER ALLEM DIE LANGEN SCHATTEN DER VERGANGENHEIT. Manfred Wieninger inszeniert in seinem fünften Marek-Miert-Krimi den ganz normalen Wahnsinn allgegenwärtiger Kriminalität vor der Kulisse einer österreichischen Provinzstadt. Sein sympathischer Privatdetektiv gerät dabei nicht nur einmal beinahe unter die Räder, und nur ein böser Zufall bewahrt ihn davor, seine Prinzipien im Strudel der Ereignisse über Bord zu werfen. SPANNEND, IRONISCH UND ABGRÜNDIG In Harland, der tristesten aller Landeshauptstädte im Osten Österreichs, hat die ukrainische Mafia Fuß gefasst und kontrolliert Drogenszene und Rotlichtmilieu. Oberleutnant Gabloner, der unberechenbare Chef der Harlander Kriminalpolizei, hat der Organisation den Kampf angesagt und schreckt dabei vor unlauteren Methoden nicht zurück. Und dann ist da noch ein Buchhändler, der in privater Mission die Überreste eines Zwangsarbeiterlagers aus der Nazizeit erforscht und damit offenbar schlafende Hunde weckt. Und zwischen allen Fronten: Marek Miert, chronisch erfolgloser Privatdetektiv mit rauer Schale und starkem Hang zu Übergewicht, ein Schrank von einem Mann mit ruppigen Umgangsformen. Weitere Marek-Miert-Krimis: - Der Mann mit dem goldenen Revolver - Prinzessin Rauschkind - Kalte Monde - Der Engel der letzten Stunde
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wieninger : Rostige Flügel
Manfred Wieninger
ROSTIGE FLÜGEL
Ein Marek-Miert-Krimi
Wir danken der Siebenpunkt Verlags GmbH für die freundliche Genehmigung, den gleichnamigen Song „Rostige Flügel“ als Buchtitel verwenden zu dürfen.
© 2008HAYMON verlagInnsbruck-Wienwww.haymonverlag.at
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
ISBN 978-3-7099-7469-8
Umschlaggestaltung: Haymon Verlag/Stefan RasbergerSatz: Haymon Verlag/Petra Rieser
Dieses Buch erhalten Sie auch in gedruckter Form mit hochwertiger Ausstattung in Ihrer Buchhandlung oder direkt unter www.haymonverlag.at.
„Meine Ehe ist in Gefahr“, sagte Frau Frischauf leise und seufzte dezent wie ein magenkrankes Eichhörnchen.
„Tja …“, antwortete ich vorsichtig und unbestimmt.
Wenn die mich mit einem Eheberater verwechselt, dachte ich, überschätzt sie meine sozialen Fähigkeiten aber ganz gewaltig. Ein Diskont-Detektiv wie ich mit leichtem Hang zum Autismus gab keinen guten Therapeuten ab. Den hätte ich höchstens selbst nötig gehabt. Außerdem, dachte ich, ist heutzutage sowieso schon praktisch jede Ehe gefährdet.
Else Frischauf war eines Morgens unangemeldet in meinem Empfangszimmer erschienen. Sie war kaum größer als ein Kind, aschblond und zum Zerbrechen zierlich mit einer Haut wie verschüttete Milch. Ungeachtet der Tageszeit trug sie ein kleines Schwarzes mit einer feingliedrigen Perlenkette über dem Dekolleté wie für eine abendliche Cocktailparty. Genau der Typ Frau, dachte ich, auf den ich immer wieder hereinfalle. Aber ihre Augen, so schien es mir jedenfalls einen Moment lang, waren so hart wie der Kern eines dunklen, kalten Planeten.
Ich nahm meine Mahlzeiten meistens im Empfangszimmer ein; einfach weil dort der einzige brauchbare Tisch stand, den ich besaß. Statt mit Akten war dieser Schreibtisch jetzt mit einer Lage Butterbrotpapier bedeckt, auf der ich zu Gabelfrühstückszwecken ein großes Stück doppelt geselchter Blunzen, einen nicht unerheblichen Restvorrat an Hirschschinken, ein Glas Marchfelder Essiggurkerl und einen halben Laib Roggenbrot ausgebreitet hatte. Mein Tafelsilber bestand barbarischerweise nur aus einem Hirschfänger aus dem Nachlass von Opa Miert und eben dem Butterbrotpapier. Die pipifeine Erscheinung von Frau Frischauf passte dazu wie der Papst in ein Bordell. Irgendwie bewunderte ich ihren Mut, sich in einem solchen Aufzug in diese Gegend zu trauen. Sie war bei der Tür hereingeschneit wie ein neurotischer, blutarmer Engel, hatte sich hastig vorgestellt und war dann sofort auf ihre Eheprobleme zu sprechen gekommen. Ehezwistigkeiten waren zwar einer der Hauptumsatzträger meines Berufsstandes, aber ich hatte mich bisher immer beharrlich geweigert, mich um Bettlaken-Fälle zu kümmern. Nur waren halt die Zeiten inzwischen nicht rosiger geworden. Also hatte ich mit dem Hirschfänger auf den Besucherstuhl gezeigt und die unvermutete, potenzielle Klientin damit für meine Verhältnisse formvollendet eingeladen, Platz zu nehmen. Meine Rustikalität, um es einmal positiv zu formulieren, hatte mir zwar schon ganze Legionen an Kunden vergrault, aber Frau Frischauf ließ sich durch das fettige, alte Messer in meiner riesigen, ebenfalls fettglänzenden Pranke nicht abschrecken, sondern folgte ein wenig zögerlich, aber doch meiner Einladung. Wahrscheinlich war es der Nimbus des Diskont-Detektivs, der mich für manche Kunden unwiderstehlich machte. Oder die Dame steckte wirklich tief in der Bredouille.
„Retten Sie meine Ehe!“, flehte sie.
Ich hatte eine große Scheibe der Blutwurst noch nicht ganz hinuntergekaut und war daher nicht sehr gesprächig. Aber irgendwelche Redebeiträge von mir waren im Moment sowieso nicht gefragt.
„Wissen Sie, meine Ehe ist das Einzige in meinem Leben, auf das ich stolz sein kann! Mein Mann ist alles, was ich habe!“
Ich grunzte voller Anteilnahme, so gut das eben mit vollem Mund ging.
„Er hat sich so in diese Sache verbissen, dass es noch ein schlimmes Ende nehmen wird! Helfen Sie ihm!“
Menschen, die permanent in Rufzeichen sprachen, strapazierten meine Nerven. Genauso musste ich auch ausgesehen haben, denn Frau Frischauf redete rasch weiter, wie wenn sie eine drohende negative Antwort meinerseits wegplaudern wollte.
„Sehen Sie, wenn mein Mann sich daranmacht, eine Thunfischdose zu öffnen, ist er in Gefahr, sich eine Fingerkuppe wegzuschneiden. Wenn mein Mann Suppe kocht, endet das vermutlich mit einer Explosion. Wenn mein Mann sein Fahrrad putzt, klemmt er sich möglicherweise ein Ohr in den Speichen ein. Wenn mein Mann eine Glühlampe wechselt, gibt es höchstwahrscheinlich einen Kurzen oder Schlimmeres. Mein Mann braucht einfach Rückendeckung bei dieser Sache! Einen Leibwächter!“
Wenn die noch ein paar Sätze mit „Mein Mann“ beginnt, dachte ich, beiße ich in die Tischplatte oder drehe sonst wie durch. Außerdem hatte ich wegen meiner total verkalkten Kaffeemaschine noch kein einziges Milligramm Koffein in den Adern und war daher noch kein Mensch.
„Sie sollten Ihrem Mann vielleicht ein bisschen mehr zutrauen …“
Nicht einmal Gerti Senger, dachte ich, hätte etwas Banaleres von sich geben können.
„Mein Mann, wie soll ich sagen – Sie kennen ihn nicht!“
Gott sei Dank, dachte ich, muss das ein Warmduscher sein.
„Mein Mann darf aber auf keinen Fall wissen, dass er jetzt einen Beschützer bekommt! Er würde das ablehnen! Ganz entschieden! Sie müssen es diskret machen!“
Den letzten Satz sagte sie so, als würde sie etwas ganz anderes damit meinen. Zusätzlich verdrehte sie auch noch vielsagend die Augen, was ich doch etwas übertrieben fand. Außerdem hatte sie den Besucherstuhl einen halben Meter zurückgeschoben, vielleicht um ihre Beine besser zur Geltung zu bringen. Es waren weiße, dünne Beine, die mir eigentlich gar nicht so gefielen. Daran konnten auch die teuren Netzstrümpfe nichts ändern. Irgendwie wurde ich das ungute Gefühl nicht los, dass mich Frau Frischauf anmachte. Dabei passte das ganz und gar nicht zu all dem, was sie verbal von sich gab, überlegte ich eher ratlos. Aus irgendeinem Grund entschloss ich mich aber, ihr seltsames Psycho-Spiel mitzuspielen, auch wenn ich die Motivation dahinter noch nicht verstand. Auf jeden Fall strengte sich die Dame ganz gewaltig an, um einen billigen Hinterhof-Detektiv wie mich an Bord zu holen. Dabei wäre das gar nicht nötig gewesen. Ich bin, dachte ich, genauso käuflich wie alle anderen, ein simpler Auftragnehmer, eine gewöhnliche Mietkraft, die jeden Job erledigt. Für ein paar Euro trainierte ich, wenn es denn sein musste, Quasimodo für die nächste Mister-Universum-Wahl, für ein paar Euro mehr leistete ich sogar schier Unmögliches wie etwa die Produktion koscherer Grammelknödel. Nicht verzagen, dachte ich, Miert fragen.
„Ich mache es immer diskret, gnädige Frau“, sabberte ich. Nur das mit dem Augenverdrehen brachte ich mangels Übung in letzter Zeit nicht so gut hin.
Frau Frischauf schien einigermaßen zufrieden zu sein, sie hatte mich da, wo sie mich haben wollte. Aber in Wirklichkeit, dachte ich, ist das noch kaum einem Klienten von mir, bei dem ich schon beim Erstgespräch leicht ziehendes Bauchweh hatte, restlos gelungen.
„Haben Sie ein Foto von ihm?“, versuchte ich wieder etwas mehr Sachlichkeit in dieses Kundengespräch zu bringen. Am Anfang einer Ermittlung, dachte ich, kann man sich ja noch schön einbilden, dass man Herr des Verfahrens sei; später kommt in der Regel eh alles anders, und man ist wieder der Wurstel.
„Ja, natürlich.“
Umständlich begann sie in den Tiefen und Untiefen ihrer Handtasche zu kramen. Während der Wartezeit begann ich sämtliche Witze über Damenhandtaschen zu rekapitulieren, die ich kannte. Dann wickelte ich die Reste meines frugalen Mahls in das Butterbrotpapier und verstaute alles in einer Schreibtischschublade.
„Hier, bitte.“
Sind wir endlich so weit, dachte ich, nahm das Foto entgegen und legte es mit der Bildseite auf die Schreibtischplatte.
„Beschreiben Sie ihn.“
„Aber …“
„Beschreiben Sie ihn!“
„Er trägt starke Brillen. Er besitzt eine rote und eine blaue, Designerbrillen, aber nachgemachte. Manchmal habe ich das Gefühl, dass er sich dahinter versteckt. Wegen seiner Augen hat er einen etwas sonderbaren Gang, er kann Entfernungen nur schlecht einschätzen, auch die seiner Fußsohlen zum Boden. Messerhaarschnitt alle drei, vier Wochen, darauf legt er Wert. Außerdem auf seine grauen Nadelstreifanzüge mit den roten Krawatten in allen Schattierungen. Er zieht die Schale praktisch nur zum Schlafen aus. Mittelgroß, etwas untergewichtig, schmale Schultern und lange Hände. Gepflegt, insgesamt eine sehr gepflegte Erscheinung. Er spricht hochdeutsch, weil er Buchhändler ist.“
Eine wunderbar sachdienliche Beschreibung, dachte ich, aber jede meiner Exfreundinnen zum Beispiel würde mich wohl fundamental anders beschreiben. Vielleicht nicht unbedingt freundlich, aber jedenfalls nicht so von außen, so neutral, so verdammt sachlich wie ein Polizist.
„Wie alt ist er?“, hakte ich nach.
„Er ist knapp über fünfzig und, so fürchte ich, nicht besonders zufrieden mit seinem Leben.“
„Na ja, wer ist das heutzutage schon?“, versuchte ich Trost zu spenden. Nicht gerade eine meiner größten Stärken.
„Ist er so unzufrieden, dass er demnächst vielleicht einmal einen Baumarkt aufsuchen könnte, um sich dort mit einer Nagelmaschine durch das rechte Auge zu taggern? Entschuldigen Sie, aber ich muss das fragen.“
„Mit der Buchhandlung geht es rasant bergab. Es ist zwar eine alteingesessene Firma, aber halt ohne den Rückhalt einer Kette. Dazu kommt, dass heutzutage schon jeder Schimpanse Bücher im Internet bestellen kann, so einfach ist das inzwischen. Hermann hat sich zwar spezialisiert, ist vor allem dank eigener Weiterbildungsbemühungen eine wirklich versierte Kraft für die österreichische Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts und für das angeschlossene Antiquariat, aber genau mit dem Geschäftsbereich geht es von Jahr zu Jahr immer weiter bergab. Die Leute lesen lieber, wenn sie überhaupt noch lesen, schludrig übersetzte, angloamerikanische Schinken, lieblos produzierte Taschenbuch-Kiloware. Ein bisschen Horror, ein bisschen Gerichtsmedizin, ein bisschen Fantasy, Hokuspokus und fauler Zauber, und damit hat es sich auch schon. Die Literatur dieses Landes ist – marketingmäßig gesprochen – tot, mausetot. Hermann ist mittlerweile der längstdienende Verkäufer in der Buchhandlung und verdient halt auch entsprechend. Wer weiß, wie lange ihn die Besitzerin noch hält.“
Es wird zunehmend ungemütlich hierzulande, dachte ich, niemand ist mehr sicher, niemand hat mehr etwas sicher, die Demontage des Status quo hat längst begonnen.
Ich drehte das Foto um. Es war wohl ein Urlaubsschnappschuss, der Hermann Frischauf an einem Restauranttisch zeigte. Vor sich hatte er einen gigantomanischen Eisbecher in allen BASF-Lebensmittelfarben mit Hütchen, Schirmchen, Ananasscheiben, Cocktailkirschen und weiteren Früchten. Er trug ein weißes Hemd, eine blaue Brille und lächelte nicht. Die Brillengläser hatten den Fotoblitz außerdem so massiv zurückgespiegelt, dass sein Gesicht wie eine helle, opake Maske wirkte. Der Mann auf dem Foto, dachte ich, könnte fast jeder sein.
„Wo ist das aufgenommen worden?“
„Faaker See. Voriges Jahr.“
Warum trägt er, dachte ich, keinen Nadelstreif?
„Ich habe es ihm verboten, im Anzug an den Strand zu gehen. Das wollten Sie doch fragen, oder?“, hatte Else Frischauf meine Gedanken gelesen.
„Sie verblüffen mich. – Haben Sie eben meine Gedanken gelesen?“
„Bei Männern fällt mir das nicht so wahnsinnig schwer“, antwortete Frau Frischauf spontan und lächelte nervös.
Sind wir wirklich so einfach gestrickt, wunderte ich mich.
„Wie sind Sie auf mich gekommen?“, lenkte ich das Gespräch auf vermeintlich Angenehmeres.
„Wollen Sie die Wahrheit hören?“
Also doch der Diskont-Detektiv, dachte ich.
„Nur zu, ich kann schon was vertragen“, antwortete ich mit einem etwas sauren Lächeln, Marke Heinrich Himmler.
„Hermann braucht einen richtigen Beschützer. – Ich habe Ihr Foto einmal in der ‚Harlander Woche‘ gesehen, da hatten Sie Hände groß wie Klodeckel.“
Und die Realprobe hält, dachte ich, was die Zeitung versprochen hat. Meine Hände waren ja wirklich nicht zum Anschauen, für die Pranken bekam ich schon seit Jahren in keinem Geschäft mehr Handschuhe. Die nächste Anzuggröße, die ich demnächst benötigen würde, war Minivan. Dafür konnte ich aber auch noch weit nach Mitternacht selbst in diesem Viertel herumflanieren, ohne befürchten zu müssen, dass mir einer wegen ein paar Euro für das nächste Pulver einen Ziegelstein über den Kopf zog.
„Na gut, jetzt hätten wir vorab eigentlich nur mehr das Finanzielle zu klären. Keine Schecks, keine Kreditkarten, keine Zlotys, sprich keine Fremdwährungen.“
„Wie lange reichen Ihnen 1.200 Euro?“
„Drei, höchstens vier Tage, wenn ich die Spesen niedrig halten kann, die Sie extra im Nachhinein bezahlen müssen. Wenn er beispielsweise morgen nach Sevilla fliegt, werden Sie aber sofort etwas nachschießen müssen. Die Spesen hängen also von seinem Aktionsradius ab, normalerweise verrechne ich einen Euro fünfzig pro Kilometer.“
Anstatt zu antworten begann sie wieder in ihrer Handtasche zu kramen. Eine fast neue Gucci, wie ich bemerkte, und vielleicht sogar keine nachgemachte. Der Buchhandel, in dem Jammern genauso zum Geschäft gehört wie in jeder anderen Branche, dürfte ja doch etwas abwerfen, jedenfalls mehr, als wenn man herumschnüffelte und sich in die Angelegenheiten fremder Leute mischte, die einen eigentlich nichts angingen. Aber ich steckte halt in meinem Beruf fest wie ein Wal in einer Mineralwasserflasche. Mit anderen Worten: Ich hatte nichts anderes gelernt, als im Dreck zu wühlen und fragilen, anämischen Blondinen dabei zuzusehen, wie sie an ihren Handtaschen verzweifelten. Ich stellte mir Frau Frischauf in schwarzer Wäsche vor, mit Handschellen an ein Messingbett gefesselt, aber das brachte mich auch nicht weiter.
„Wo kann ich Sie erreichen?“, fragte ich.
„Ich arbeite tagsüber in Wien, in einem Front-Office-Büro, und mein Chef und die Kunden sehen es nicht so wahnsinnig gerne, wenn ich privat telefoniere. Und abends ist ja Hermann … Ich schaue in zwei, drei Tagen wieder bei Ihnen vorbei. Ich rufe Sie vorher an.“
Endlich hatte sie einen Briefumschlag aus ihrer Tasche gewurschtelt, den sie mir auch gleich reichte. Es waren zwölf nagelneue Hundert-Euro-Scheine darin. Frau Frischauf hatte sich selbst keinerlei Verhandlungsspielraum gelassen, das sprach eindeutig für sie – und gegen mich.
„Sie unterschätzen die Effektivität, Funktionalität und Universalität einer Damenhandtasche sträflich …“
„Also, langsam werden Sie mir unheimlich mit der Gedankenleserei“, meinte ich und fischte eine Visitenkarte mit meiner Handynummer aus der obersten Schreibtischlade.
„Dann wäre ja alles geklärt …“
„Noch ist überhaupt nichts geklärt. Jetzt wäre es nämlich an der Zeit, dass Sie mir mal die Hauptsache verraten: Was ist eigentlich los? Warum machen Sie sich solche Sorgen um Ihren Mann?“
„Zuerst sind die Anrufe gekommen, oft mitten in der Nacht. Die Anrufer haben immer aufgelegt, sobald wir abgehoben haben“, erzählte Frau Frischauf.
„Mir hat schon mal jemand einen Drohbrief geschickt, der mit Osama bin Laden unterzeichnet war. Leider war der Wisch nicht in Arabisch, dann hätte ich den Schmarren nämlich nicht einmal gelesen“, bemerkte ich.
„Dann sind ein paar Filme verschwunden, harmlose Familienfotos, mein Mann und ich im Urlaub, auf Ausflügen und so. Ich gebe sie immer in dieselbe BIPA-Filiale zur Ausarbeitung. Ich habe natürlich reklamiert, aber die Fotos waren nicht mehr auffindbar. Meinem Mann habe ich nichts davon erzählt, um ihn nicht noch zusätzlich aufzuregen, er hat es eh schon schwer genug in der Arbeit“, erzählte Frau Frischauf.
„Na ja, ein bisschen eine Schlamperei soll schon mal vorgekommen sein in diesem Land“, wandte ich ein.
„Genau das habe ich eigentlich auch gedacht, bis ich heute das im Briefkasten vorgefunden habe!“
Frau Frischauf war plötzlich echauffiert wie ein Badewannen-Kapitän, dem man seine Quietschente entführt hatte, und begann wieder in ihrer erstaunlichen Handtasche zu kramen. Was sie schließlich zum Vorschein brachte, war eine flache, kleine Schachtel aus braunem Karton, die sie mir heftig über den Schreibtisch schob. Das Ding roch ein bisschen streng, fand ich, eigentlich mehr als ein bisschen, wie ein alter, wasserscheuer Hund etwa.
„Die haben Ihnen irgendein totes Vieh geschickt, oder?“
„Woher wissen Sie das?“, fragte Frau Frischauf verblüfft.
Vorsichtig hob ich den Deckel.
„Erfahrung, Gefühl – wie Sie wollen, Einfühlungsvermögen halt in so Scherzkekse.“
„Scherzkekse? Ich finde, Sie unterschätzen die Sache!“
Es war ein Tableau mit einem toten Spatzen, mit einem Nagel durch seine Brust auf ein dünnes Brettchen geheftet, die Flügel gespreizt und ebenfalls mit Nägeln fixiert. Ein gekreuzigter Singvogel, dachte ich, mit blutverschmiertem Gefieder und einem Blutstropfen auf der Schnabelspitze – die sind echt pervers.
„Wie sind die bloß an den Vogel gekommen?“, überlegte ich laut.
„Das ist alles, was Sie dazu zu sagen haben?“
„Na ja, ich denke mir, um diese Jahreszeit muss es ganz schön schwer sein, sich einen Spatzen zu beschaffen. Es sei denn bei einem privaten Züchter, denn in den hiesigen Zoogeschäften bekommt man nur tropische und subtropische Vögel. Diese Überlegung ist also so etwas wie ein erster Hinweis auf den oder die Absender.“
„Können Sie nicht Fingerabdrücke von der Schachtel nehmen?“
„Fingerabdrücke von solch einem raufasrigen Karton? Oder noch besser – von den Federn? Außerdem kann ich hier mit einer Fingerabdruck-Kartei nicht dienen, da müssten Sie schon zur Polizei gehen und förmlich Anzeige erstatten. Wenn die allerdings den Täter bei so einer Lappalie fassen …“
„Lappalie?“
„Ich habe jetzt halt wie ein Polizist formuliert“, antwortete ich, „ich war lange genug einer.“
„Ja dann …“
„Also, wenn die Polizei den Täter bei so Kinkerlitzchen fasst, was so unwahrscheinlich ist wie eine Geburt durch ein Ohr, dann kriegt der maximal wegen Tierquälerei eine Geldstrafe von sagen wir zwei-, dreihundert Euro.“
„Wer tut so etwas?“, fragte mich Frau Frischauf.
„Die Frage ist vor allem auch, was tut so einer noch? Hat Ihr Mann nennenswerte Feinde?“
„Niemanden, außer sich selbst vielleicht. Jedenfalls, bis er diese Inserate aufgegeben hat.“
„Was für Inserate denn?“
„Er hat vor ein paar Monaten in den Lokalzeitungen Inserate geschaltet, in denen er Zeitzeugen aufgerufen hat, sich bei ihm zu melden. Damit hat er sich in die allererste Reihe gestellt, in die Öffentlichkeit, sich selbst und seine Familie, das heißt mich!“
„Zeitzeugen wofür?“
„Leute, die hier in Harland vor 1945 Kontakt mit Zwangsarbeitern hatten.“
„Bisher habe ich ehrlich gesagt nicht einmal gewusst, dass es bei uns in Harland überhaupt so etwas wie Zwangsarbeiter gegeben hat!“
„Das ist es ja eben. Niemand hat das gewusst!“
Außer diejenigen, dachte ich, welche die Zwangsarbeiter beschäftigt haben. Und diese Sklavenhalter haben wohlweislich die Goschen gehalten.
„Auch die hiesigen Lokalhistoriker haben über sechzig Jahre lang noch nicht einmal das Wort Zwangsarbeiter niedergeschrieben“, sagte Frau Frischauf noch.
„Und?“
„Was und?“
„Na, haben sich denn Zeitzeugen bei Ihrem Gatten gemeldet?“
„Ja, ein paar steinalte Leutchen, die irgendetwas gesehen oder erlebt haben wollen in der Zeit damals, ein paar unzurechnungsfähige Greise, die das hohe Alter redselig und mürbe gemacht hat.“
Klingt ja nicht gerade, dachte ich, als ob sie sich mit dem Projekt ihres Mannes voll identifizieren würde, klingt ganz und gar nicht danach.
„Wer und wie viele?“
„Mein Mann hat Tonbandaufnahmen mit den alten Leutchen gemacht und arbeitet jetzt die Hinweise im Gelände, im Stadtarchiv und weiß Gott noch wo ab. Im Übrigen erzählt er nicht viel davon, weil er das Gefühl hat, dass ich mich nicht allzu sehr dafür interessiere.“
„Ist er sonst noch bedroht worden?“
„Mir hat er jedenfalls nichts davon erzählt.“
Worüber sprechen die dann, überlegte ich weiter, obwohl die ganze Chose für ihn so zentral ist, dass er sich lieber bedrohen lässt, als die Recherche aufzugeben.
„Wie findet er überhaupt neben der Arbeit Zeit für diese Forschungen?“
„Jetzt nennen Sie den Kram auch schon Forschung! Dafür bezahle ich Sie nicht!“
Mein Beruf wäre an sich ja ganz passabel, dachte ich, wenn nur die Kundschaft nicht wäre.
„Also gut, woher nimmt er die Zeit für den ganzen … Kram?“
„Er hat in der Buchhandlung eine ziemlich lange Mittagspause, jeden Tag von zwölf bis fünfzehn Uhr. Außerdem komme ich oft später aus Wien. Die Westbahn ist zunehmend eine Zumutung, nur mehr Verspätungen, ausgefallene Heizungen, verdreckte Abteile und allgemeine Unbequemlichkeit.“
„Wie ist er überhaupt auf die Sache mit den Harlander Zwangsarbeitern gekommen?“, fragte ich Frau Frischauf.
Sie antwortete zwar darauf, Belangloses, aber wusste die Antwort nicht. Seltsame Ehe, dachte ich, aber andererseits, welche Ehe heutzutage ist das nicht.
Der Abschied von Frau Frischauf war rasch und unsentimental vonstatten gegangen. Sie hatte dann doch darauf verzichtet, mich zu verführen, höchstwahrscheinlich nicht einmal ungern. Die 1.200 Euro allein hatten völlig ausgereicht, um mich als Babysitter für ihren Göttergatten zu engagieren. Dank Frau Frischauf war ich wieder im Geschäft, und ich hatte bis jetzt nichts dafür tun müssen, als mein Gabelfrühstück abrupt zu unterbrechen. Im Übrigen fragte ich mich, wie sie in dem Aufzug durch das Bahnhofsviertel zurück in die Zivilisation, sprich in einen Railjet nach Wien kommen würde, war aber andererseits auch zu faul oder zu wenig Kavalier, um sie zu begleiten. Außerdem war es mit einem guten dreiviertel Kilo Blutwurst im Magen relativ schwierig, aus den Startlöchern und in den ersten Gang zu kommen. Wahrscheinlich, dachte ich, hat sie eh ihren Wagen vor der Haustür stehen, und von meiner Wohnungstür bis dorthin kann sie höchstens von einem Stück brüchiger Jugendstil-Ornamentik erschlagen werden, dagegen hilft auch kein Leibwächter, nicht einmal eine Brieftaube, die über einem schwebt wie der Heilige Geist.
Bis zum Beginn der Mittagspause der Buchhandlung waren noch etwa dreieinhalb Stunden totzuschlagen beziehungsweise mit Nichtigkeiten auszufüllen. Ich war höchst zuversichtlich, das locker zu schaffen. Frau Frischauf hatte mich jedenfalls mit meiner Post allein gelassen, die ich in aller Früh schon vom Postkasten geholt und in einer Schreibtischlade deponiert hatte, um mir den Genuss für später, für die Zeit nach der Mahlzeit aufzusparen. Ich war eben einer jener leicht zwanghaften Charaktere, die ihre gesamte Post penibelst durchlasen, auch die Werbung. Eigentlich bekam ich ja praktisch nur Werbesendungen, und ich schaute sie wie gesagt alle Blatt für Blatt durch, nicht nur die Damenwäsche-Angebote. Mangels Unterhaltung durch Frau, Freundin, Kinder, Freunde, Kollegen oder allzu viele Kunden waren Prospekte für mich durchaus eine Alternative und nicht einmal eine unkomische. Heute teilte mir zum Beispiel eine IHL-Rechtsabteilung mit einer Postfachadresse im noblen 1. Wiener Gemeindebezirk in einem ebenso nobel gelayouteten Brief mit, man habe mich schon einige Zeit leider vergeblich zu erreichen versucht, nun drohe mein 100.000-Euro-Bargewinnanteil zu verfallen. Schock, schwere Not, dachte ich, und las amüsiert weiter. Absolut schleunigst, hieß es in dem Schreiben, sollte ich mich unter der Wiener Telefonnummer 14 92 45 melden, es sei höchste, allerhöchste Zeit, mindestens so dringlich wie eine Sturzgeburt. Nun freute ich mich schon auf das Kleingedruckte, in dessen ausgedehnten Bleiwüsten ich schließlich herausfand, dass die angegebene Nummer mit vier Euro pro Minute ganz schön heftig kostenpflichtig war. Außerdem stellte sich in gewundenen Juristensätzen heraus, dass der Super-Mega-100.000-Euro-Bargewinn unter allen Gewinnern, sprich Anrufern aufgeteilt zur Auszahlung gelangen würde und dass Gewinnanteile unter hundert Euro nicht ausbezahlt würden. Wenn sich also relativ viele Leute, was so wahrscheinlich war wie Magendrücken nach dem Weihnachtsessen, unter der angegebenen Nummer meldeten, gab es für jeden Einzelnen weniger, bis schließlich die ganze Chose unter den besagten Hunderter fallen würde und damit überhaupt kein Gewinn ausbezahlt werden brauchte. Willkommen in der New Economy, dachte ich, so eine Wirtschaft. Irgendwie lustig fand ich auch das anonyme Schreiben eines offenbar älteren, ziemlich schizoiden Herrn aus dem Landbezirk, der mir mittels eines fotokopierten Zettels Schauderhaftes mitteilte, nämlich dass in Harland derzeit gerade eine russische Geheimapparatur namens Elipton zum Einsatz komme. Auch Polizei, Staatspolizei und das lokale Finanzamt verfügten bereits über derartige Wunderwaffen, die das Innenleben von Gebäuden, ja sogar von einzelnen Zimmern mittels unbekannter Strahlen sichtbar machen konnten. Schluss also, so der anonyme Briefschreiber weiter, mit jeglicher Privatsphäre, denn Elipton durchdringe auch die dicksten Mauern, selbst solche aus Stahlbeton, und kehre das Innere zuäußerst, ja die Durchleuchtung mache, so jedenfalls der Briefschreiber wörtlich, „nicht einmal vor dem Sexleben halt“. Nur gut, dachte ich, dass ich derzeit keines hatte. Besonders erheiterte mich die schlichte, aber ergreifende Zeichnung auf der Rückseite des Zettels, welche die Konstruktion und Wirkungsweise des Elipton anschaulich machen sollte. Für mich bestenfalls das Innenleben eines Wasserkochers oder einer Espressomaschine. Ich wunderte mich nur, dass der verrückte Anonymus nicht gleich auch ein selbst gestricktes Gerät mitpromotete, mit dem die Elipton-Strahlen abgeblockt werden konnten. Eindeutig ein Marketingversäumnis, dachte ich, der Spinner könnte noch reich werden damit.
Als Nächstes widmete ich mich dem Werbeprospekt eines Lebensmittelmarktes, der rumänisches Kartoffelpüree, moldawische Hühnerkeulen, georgisches Mineralwasser, weißrussisches Weißbrot, litauische Dauerwürste, deutsche Essiggurkerl und chinesische Socken konkurrenzlos billig anbot, wobei die Lebensmittel ähnlich schmecken mochten wie die Socken, der aber in seiner Werbung gebetsmühlenartig darauf pochte, vor allem heimische Qualität zu führen. Beim Essen war ich immer schon, dachte ich, ein furchtbarer Nationalist. Weniger Spaß machte mir der Katalog eines stylischen Mode-Versandhauses, da ich auch als notorischer Nicht-Kunde praktisch jeden Tag ein, zwei Sendungen dieser Firma erhielt. Noch weniger Freudenausbrüche entlockte mir schließlich die allmonatliche Miet- und Betriebskostenvorschreibung meiner Hausverwaltung, die inzwischen fast die Höhe eines durchschnittlichen Monatsgehaltes des Bundespräsidenten erreicht hatte. Die Hausverwaltung versuchte seit fast einem Jahr so ziemlich alles, um mich als letzten Mieter im Haus aus der Wohnung zu ekeln. Der ganze Jugendstilkasten sollte abgerissen werden. Für noch ein Fachmarktzentrum oder noch ein Bürohaus oder noch eine Park&Ride-Anlage oder noch ein Fun- und Wellnessbad oder für was auch immer. Ich setzte dem hartnäckigen Widerstand entgegen und zahlte per Dauerauftrag keinen Cent mehr Miete, als in meinem Mietvertrag stand. An Betriebskosten überwies ich ihnen den durchschnittlichen Monatssatz des vorigen Jahres plus ein Prozent. Mochten sie mich auch ruhig pfänden, bei mir war sowieso nicht viel mehr zu holen als unbezahlte Rechnungen. Und bevor sie nicht eine annehmbare Abfindung herausrückten, so viel war klar, würde ich mein breites Gesäß nicht aus dieser Wohnung lüpfen.
Der Rest der Post waren Werbezettel und -prospekte für diverse Vitaminpräparate, Schlagbohrer, Autowachse, Gartenmöbel, Feng-Shui- und Heimwerker-Seminare, Society- und Wellness-Zeitschriften, für den Moped-Führerschein im zweiten Bildungsweg, für den Pensionistenausflug der Landeshauptstadt Harland und für eine eurasisch-amerikanische Sekte namens Chau Cheng, die ich nicht einmal dem Namen nach kannte und auch nicht kennenlernen wollte.
In den Nächten hörte man sie in den Straßen Red-Bull-Dosen kicken, Verkehrszeichen umtreten und leere Wodkaflaschen in die Fenster schmeißen. Sie brachen hin und wieder Zigarettenautomaten auf, Autos, die Rollläden der letzten kleinen Geschäfte im Grätzel und lieferten sich mit großem Genuss Verfolgungsjagden mit der einzigen Funkstreifenbesatzung, die sich für diese Gegend nächtens noch zuständig fühlte. Vor zwei Wochen hatten sie einem jüngeren, besonders laufstarken Beamten ein Schlüsselbein gebrochen. Sie hielten es außerdem für ihr gutes Recht, jederzeit in jeden Hausflur, in jedes Lokal und überhaupt in jede Ecke, die ihnen gerade in den Sinn kam, zu pinkeln oder zu kotzen. Ebenso leichten Herzens und voll unschuldiger Bosheit schlugen sie zu dritt oder viert Sandler, Betrunkene oder ältere Passanten zusammen und nahmen diese Aktionen mit ihren Handys auf, um die Szenen gegen Gebühr ins Internet zu stellen. Tagsüber, speziell am Vormittag, waren sie aber kaum je präsent im Viertel hinter dem Bahnhof, da schliefen sie in ihren Skaterhosen und Snowboard-Jacken aus dem Ausverkauf in irgendwelchen Löchern oder auf der Bürocouch ihres Sozialarbeiters ihre Räusche und Visionen aus. Ich war daher überrascht, als ich zwei von ihnen gegenüber meinem Haustor auf der anderen Straßenseite herumlungern sah, lemurenhafte Gestalten mit jeder Menge bad vibrations, zwei magere, blasse, ungewaschene Siebzehnjährige mit schwarzen Baseball-Kappen, grünbraunen Military-Hosen mit Tarnmuster und schweren Bomber-Stiefeln, ohne Ausbildung, ohne Arbeit, ohne Perspektive und scharf wie ungepflegte Rasiermesser aus Koreastahl.
Ich schlenderte über die Straße, direkt auf die beiden verwahrlosten Kinder zu, deren desaströse Eltern sie wohl schon vor Wochen, Monaten oder Jahren hinausgeworfen hatten. Bissige Straßenköter ohne Hoffnung, die für den Flash lebten, jedes Pulver nahmen, das ihnen in die Finger geriet. Ich kannte sie nicht, die beiden waren neu in der Gegend und mit den Regeln noch nicht vertraut.
„In der Nacht gehört die Straße euch, jetzt schert euch aber weg!“, fuhr ich sie an, im Angriff liegt klingendes Spiel. Außerdem war ich kein Sozialarbeiter und nicht gerade für sozial reversible Äußerungen berühmt.
Sie hatten rote Augen, gelbbraune Tränensäcke, violette Wangen und ein verdammt schlechtes Karma und sahen mich nicht einmal richtig an.
„Oida, was regst dich auf!“, keiften sie los, blieben aber unbewegt wie Bauklötze auf dem Gehsteig stehen.
„Ich rege mich auf, wann es mir passt! Okay?!“
„Oida, reg dich nicht auf!“
„Geht’s zu eurem Betreuer oder aufs Sozialamt, verschwindet’s! Aber dalli!“
„Oida!“
Sie waren so bekifft, dass nicht mehr aus ihnen herauszubringen war. Nicht einmal ein Gran Aggression. Und ich hatte so früh am Morgen irgendwie auch keine Lust, als Morgensport eine Schlägerei anzufangen. So endete der nette, kleine Plausch unentschieden und ich wandte mich Richtung Bahnhof. Der Jänner war vorbei, und der Winter hatte sich bis jetzt noch nicht blicken lassen. In der Stadt war es warm wie in der Speiseröhre einer Kuh, und durch die Abluft der uralten Chemiefabrik, die den Cord für die meisten europäischen Autoreifen erzeugte, roch es auch annähernd so.
Den Ford Granada ließ ich einstweilen vor dem Haustor stehen. Einen derart bejahrten Klassiker, dessen Fond eher einer Müllhalde als einem Fahrgastraum glich, brachen nicht einmal diese kaputten Typen auf.
Das vierstöckige, abgewohnte Zinshaus, in dem sich mein Wohnbüro befand, lag nicht weit hinter dem Hauptbahnhof zwischen einer kroatischen Grillstube und einer pleite gegangenen Peepshow, die jetzt albanischen Marktfahrern oder Hehlern als Lager für ihren Kram diente. Vielleicht hatten es die beiden bekifften Burschen ja auf dieses Magazin abgesehen. Drei Häuser weiter in Richtung Bahnhof befand sich jedenfalls die sogenannte „Pension Miramar“, ein ehemaliges Wohnheim für ÖBB-Lokführer, das mit dem karg-kantigen Plattenbau-Charme der Sechzigerjahre seinem hochtrabenden Namen gewaltig spottete. Nächtens diente es denjenigen Asphaltblüten des Reviers, deren Freier sich mehr als nur die Autositze leisten wollten, als Verkehrsknotenpunkt. Dabei war Prostitution in Harland durch ein Landesgesetz verboten, aber das steigerte den Reiz nur noch. Außerdem war in Österreich sowieso schon immer unendlich mehr verboten als erlaubt, sodass man, um ein halbwegs normales Leben führen zu können, pro Tag Dutzende und Aberdutzende Verbote, Verordnungen und Gesetze einfach ignorieren musste. Das „Miramar“ entging jedenfalls seit Jahren seiner behördlichen Schließung nicht nur, wie ich vermutete, durch regelmäßige Zahlungen seiner ukrainischen Eigentümer an diverse höhere Kader von Verwaltung und Polizei, sondern auch dadurch, dass es zusätzlich eine Art Tagesbetrieb als bürgerliches Seitensprunghotel hatte. Dieser Tagesbetrieb hieß Madame Sybilla und spendierte mir ab und zu eine Melange, wenn meine Kaffeemaschine zu Hause wieder einmal völlig verkalkt oder ich einfach zu faul war, um mir selber Kaffee zu machen. Ich hatte es mir angewöhnt, jeden zweiten, dritten Vormittag einen Sprung im „Miramar“ vorbeizuschauen. Schließlich konnte es nicht schaden, sich mit der Mafia gut zu stellen. Auch nach Frau Frischaufs Besuch hatte ich Koffein nötig, war aber zu bequem, um vorher erst noch zeitaufwendig die Maschine zu entkalken, die nur mehr Kalkwasser produzierte, aber keinen richtigen Kaffee. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob ich die ausgegangenen Filter, Größe 105, nachgekauft hatte. Es war sowieso schon schwer genug, nach ein paar Wochen des reinen Nichtstuns, die wie eine penibel aneinandergestellte Reihe von leeren Kaffeedosen gewesen waren, wieder hochzukommen. Ich war spät und immer später schlafen gegangen wie ein Schichtarbeiter und kannte bald alle Serien aller Sender, zumindest jeweils ein paar Folgen davon. Außerdem hatte ich mir so viele Nachrichtensendungen angeschaut, dass ich locker zum Pressesprecher jedes Staatspräsidenten taugen würde. Fünfmal hatte ich mir „Hausboot“ angesehen, viermal „Hallo Dienstmann“ und immerhin noch dreimal „Flammendes Inferno“. Niemand hatte mich in dieser Zeit gebraucht, niemand hatte angerufen, niemand hatte mit mir gesprochen – außer eben manchmal die einen Meter fünfzig kleine, vielleicht sechzigjährige Managerin eines provinziellen Stundenhotels, die in ihrem Leben an weiß Gott wie vielen Verbrechen beteiligt gewesen war.
Madame Sybilla sah aus wie eine dieser kindhaften, rumänischen Hochleistungsturnerinnen der Siebzigerjahre nach dreißig vergeblichen Diäten, drei gescheiterten Ehen, zwei Alkohol-Entgiftungskuren und einer Karriere voller Pleiten, Pech und Pannen, die sie in ihre jetzige tolle Position geführt hatte. Ihr Haar war unbarmherzig blond gefärbt und ebenso unbarmherzig steil in die Höhe toupiert, sie trug meistens eine teuer aussehende Glitzerbluse und einen schwarzgrauen Businessblazer, dazu allerdings fast immer eine fusselige, orangerote oder rosa Trainingshose und grüne Turnschuhe.
„Ich weiß nicht, die Freier werden auch immer perverser – fast die Hälfte der Bettlaken, die Heza heute gewechselt hat, waren blutig. Was machen diese Wichser bloß?“, begrüßte mich Madame Sybilla an diesem denkwürdigen Tag, der mich wieder ins Geschäft gebracht hatte. Bei manchen der von ihr gebrauchten Wörter vermeinte ich einen leichten, allerdings undefinierbaren Akzent herauszuhören.
Heza war das Zimmermädchen, eine verschleierte, mollige Frau in den Fünfzigern, die jeden Morgen schnell, sprachlos und mit Augen voller Hass die Zimmer wieder auf Vordermann brachte. An den Abenden und in den Nächten gab es auch noch einen weißblonden, ukrainischen Henker, der Madame Sybilla assistierte, sprich in der winzigen Lobby stundenlang eine Playstation malträtierte. Mehr Personal schien nicht vorhanden zu sein, aber vielleicht logierte unter dem Dach ja noch eine ganze Kompanie Mafiasoldaten, grimmige Kerle mit narbigen Händen in schlecht sitzenden Anzügen. Madame Sybilla selbst, hatte ich jedenfalls den Eindruck gewonnen, schien im Hotel nicht nur zu arbeiten, sondern auch zu wohnen.
Das alles, von den blutverschmierten Laken bis zu den angestellten Henkern, will ich aber gar nicht so genau wissen, dachte ich.
„Kaffee?“
„Wenn Sie mich wieder zum Leben erwecken wollen …“
„Auf jeden Fall.“
Natürlich gab Madame Sybilla die Melange zwar gratis, aber nicht umsonst aus. Gelegentlich bat sie mich um kleinere Dienste, etwa darum, irgendwelche Kisten aus dem Keller ins Erdgeschoß zu schleppen, oder ich hatte eine Glühlampe in eine Deckenleuchte unter einem hohen Plafond hineinzudrehen, weil Heza und ihr, so sagte sie jedenfalls, auf der langen Stehleiter immer schwindlig werde. In den letzten Wochen hatte ich derlei nicht einmal ungern erledigt, weil mir so vom Übermaß der Zeit ein wenig verging. Ich dachte zwar manchmal, dass mir diese verplemperten Stunden noch einmal fehlen könnten, spätestens beim Sterben, aber das hätte ich genauso gut über mein halbes bisheriges Leben sagen können. Die Madame wusste auch über meine Profession Bescheid und fragte mich hin und wieder, ob sie mich bei ihren Ukrainern rekommandieren solle. So weit wollen wir es aber dann doch wieder nicht treiben, hatte ich jedes Mal geantwortet. Manchmal erzählte sie auch einfach nur Geschichten und G’schichterln aus dem Bahnhofsrevier oder versuchte ganz im Gegenteil, mich über die Nachbarschaft auszuhorchen. Was sie mir nicht erzählte, war beispielsweise, dass ihre Ukrainer vor einigen Monaten versucht hatten, das Grätzel nördlich des Bahnhofes aufzukaufen, besser gesagt gleich die ganze Bank, der das Viertel praktisch zum Großteil gehörte. Die Landesregierung hatte aber ihr Veto eingelegt, offenbar reichten die Verbindungen von Madame Sybillas Arbeitgebern noch nicht bis nach ganz oben.
„In letzter Zeit streunt hier in der Gegend ein alter Mann herum, ein Auswärtiger mit einem komischen Dialekt, der übernachtet in leerstehenden Wohnungen“, meinte sie beiläufig.
Da ich nicht sofort dienstbeflissen darauf ansprang, gab sie noch eine kurze Personenbeschreibung wie aus einem Steckbrief. Die Mafia, dachte ich, hält ihr Umfeld in sorgfältiger Beobachtung, um möglichen Bedrohungen von vornherein begegnen zu können.
„Ein kleiner, kräftiger Kerl mit einem grauen Wuschelkopf, mehr breit als hoch, der immer in derselben alten, unmöglichen Strickjacke steckt. Kein Mensch weiß, woher der meschuggene Kerl kommt und was er hier in unserem Grätzel will. Außerdem fragt er den Leuten Löcher in den Bauch. Auch nach Ihnen hat er schon gefragt.“
In meinen großen Ohren klang das verdächtig nach einem neuen Kaffeedienst. Die Kisten waren ja wohl schon alle aus dem Keller. Es würde mich eigentlich schon interessieren, dachte ich, was ich da in den letzten Wochen alles in den kleinen Lagerraum hinter der Rezeption geschleppt hatte, aber besser ist vielleicht, ich frage nicht und erfahre es daher auch nicht.
„Tatsächlich?“, antwortete ich. „Vielleicht hat er ja Bedarf an einem Diskont-Detektiv und holt zunächst einmal Referenzen ein. Außerdem gibt es gerade in der Gegend mehr als genug fragwürdige Existenzen.“