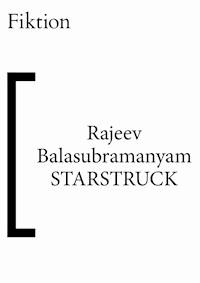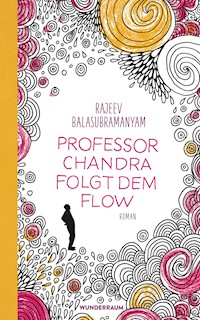
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wunderraum
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sein ganzes Leben hat Professor Chandra in Cambridge der Forschung geopfert. Und doch wird der berühmte Ökonom erneut beim Nobelpreis übergangen. Als Chandra infolge eines Fahrradunfalls auch privat Bilanz zieht, kommt er ins Grübeln. Von seiner Frau ist er geschieden, die drei Kinder sind in alle Welt verstreut, zu seiner jüngsten Tochter hat er keinen Kontakt. Was macht er nur falsch? Chandras Arzt empfiehlt, einfach mal kürzer zu treten und das Leben zu genießen. Aber wie um Himmels willen stellt man das an? Und was macht den Menschen eigentlich glücklich? In den Dingen des Herzens völlig ungeübt, begibt sich Professor Chandra auf eine abenteuerliche Reise.
Weitere berührende Wunderraum-Geschichten finden Sie in unserem kostenlosen aktuellen Leseproben-E-Book »Einkuscheln und loslesen – Bücher für kurze Tage und lange Nächte«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Sein ganzes Leben hat Professor Chandra in Cambridge der Forschung geopfert. Und doch wird der berühmte Ökonom auch dieses Jahr beim Nobelpreis übergangen. Als Chandra dann auch noch von einem Radfahrer über den Haufen gefahren wird, sieht er sich gezwungen, Bilanz zu ziehen, und kommt ins Grübeln. Von seiner Frau ist er geschieden, die drei Kinder sind in alle Welt verstreut, zu seiner jüngsten Tochter hat er keinen Kontakt. Was macht er nur falsch? Chandras Arzt empfiehlt, einfach mal kürzer zu treten und das Leben zu genießen. Aber wie um Himmels willen stellt man das an? Und was macht den Menschen eigentlich glücklich? In den Dingen des Herzens völlig ungeübt, begibt sich Professor Chandra auf eine abenteuerliche Reise.
Übersetzt von Sibylle Schmidt
Für meine Eltern
1
Es hätte der großartigste Tag seines Lebens werden sollen. Seine jüngste Tochter Jasmine war eigens aus Colorado angereist, um mit ihm seinen Triumph zu feiern. In der Financial Times und im Wall Street Journal las man Artikel, die schon nach Ruhmeshymne klangen: »Wie Usain Bolt beim Hundertmeterlauf und Mrs. Clinton im November kann dieser Kandidat das Rennen nicht verlieren.« Die Akademie war zwar berühmt für ihre Geheimhaltung, ihre raffinierten Methoden, nichts nach außen dringen zu lassen. Aber diesmal waren sich sogar die Buchmacher einig: Der Wirtschafts-Nobelpreis 2016 würde an Professor Chandra gehen.
In dieser Nacht hatte er kein Auge zugetan, nur im Bett gelegen und sich die Feierlichkeiten ausgemalt. Er würde natürlich Interviews auf BBC, CNN und Sky geben. Dann würde er mit Jasmine brunchen, bevor sie zurückflog, und ihr vielleicht sogar das eine oder andere Glas Champagner erlauben. Für den Abend würde die Uni einen Empfang in Cambridge organisiert haben, auf dem auch die Widersacher auftauchen würden, diese ganzen Nörgler, Langweiler, hinterhältigen Intriganten. Er jedoch würde sich großmütig zeigen und erklären, dass ihm der Scheck über eine Million Dollar und das Bankett beim König von Schweden eigentlich nicht so wichtig seien. Seine wahre Freude sei vielmehr, dass seine längst verstorbenen Eltern zu Recht an ihn geglaubt hatten, ebenso wie seine getreuen Kollegen und sein einstiger Mentor Milton Friedman, der ihm einmal im Schneegestöber beim Reifenwechsel geholfen hatte, als Chandra noch ein einfacher Lehrbeauftragter gewesen war.
Als der Tag anbrach, hatte Professor Chandra seine Dankesrede an die zehn Mal geprobt. Noch im Morgenmantel, machte er Kaffee, nahm sich eine Tasse mit ins Schlafzimmer und stellte sie neben das Telefon. Dann legte er sich wieder hin, die Hände hinterm Kopf verschränkt, und wartete auf den Anruf. Eine Stunde später kam seine Tochter ins Zimmer und fand ihren Vater schnarchend auf dem Bett vor.
»Dad, wach auf«, sagte Jasmine und rüttelte ihn am Fuß. »Du hast ihn nicht bekommen, Dad.«
Chandra rührte sich nicht. Er hatte so lange darauf gewartet, hatte so viel dafür durchgemacht: den Bachelor in Hyderabad, den Doktortitel in Cambridge, seinen ersten Unijob an der London School of Economics, dieses grausame Jahrzehnt in Chicago und nach der Rückkehr nach Cambridge der Börsencrash von 2008 mitsamt der daraus resultierenden Verunglimpfung von Ökonomen; Zweifel, Torten ins Gesicht und dann all die Jahre danach das Wissen, dass sein Name im April auf der Longlist und im Sommer auf der Shortlist des Komitees gestanden hatte und die Medaille aus achtzehnkarätigem Gold dennoch immer wieder in der Faust von jemand anderem gelandet war. In diesem Jahr hätte Chandras Leidenszeit endlich beendet sein sollen. Dieses Jahr hätte ihn für all die Qualen entschädigen sollen.
»Und wer, wenn ich fragen darf, ist dieses Jahr der glückliche Gewinner?«
»Es sind zwei«, antwortete Jasmine.
Chandra richtete sich auf, stopfte sich Kissen hinter den Rücken und setzte seine Brille auf.
»Wie heißen die?«
»Weiß ich nicht mehr.«
»Versuch es.«
»Heart und Stroganoff oder so.«
Chandra stöhnte. »Doch nicht etwa Hart und Holmström?«
»Ja, doch, ich glaub schon.«
»Und wer wird es dann wohl nächstes Jahr sein? Starsky und Hutch womöglich?«
»Weiß ich nicht, Dad. Kann schon sein.«
»Nun, das war’s dann wohl«, sagte Chandra. Er zog die Bettdecke über sich und ahnte, dass er vermutlich in dieser Position bis nächstes Jahr verblieben wäre, wäre da nicht seine Tochter gewesen.
Zehn Minuten später kam Jasmine wieder herein, um ihm mitzuteilen, dass ein paar Journalisten vor dem Haus standen. Chandra willigte ein, mit ihnen zu sprechen, und beantwortete – noch immer im Morgenmantel – höflich ihre Fragen. Es war Jasmines Idee gewesen, die Herrschaften zum Kaffee hereinzubitten, weshalb Chandra also mit vier Leuten von Regionalzeitungen an seinem Küchentisch saß, einer Reporterin von der Grantchester Gazette, einem Reporter von der Anglia Post und zweien von der Cambs Times.
»Es tut uns schrecklich leid, Sir«, sagte die junge Frau von der Gazette, offenbar den Tränen nah.
»Sie hätten ihn bekommen sollen«, sagte der Reporter von der Times, der nach Gin roch. »Wir hatten uns schon aufs Feiern heute Abend gefreut.«
»Ah, nun ja«, erwiderte Professor Chandra gerührt. »C’est la vie.«
»Es ist so ungerecht«, sagte die Frau. »Sie hätten den Preis so sehr verdient.«
»Oh, de rien, de rien«, erwiderte Chandra und wünschte sich, er könnte aufhören, Französisch zu reden, eine Sprache, die er gar nicht beherrschte. »Laissez-faire.«
Als die Journalisten aufbrachen, versicherte er allen, dass er sich für die Gewinner freue und froh sei, dass alles vorüber war, und dass man sich dann nächstes Jahr wiedersähe. Offenbar wirkte er auf alle überzeugend bis auf Jasmine, die mit der gnadenlosen Penetranz Siebzehnjähriger und völlig ungeachtet seiner Antworten so oft fragte: »Alles okay mit dir? Alles okay mit dir, Dad?«, bis er schließlich auf dem Weg zum Flughafen die Beherrschung verlor und »Das siehst du doch!« brüllte.
Früher hätte Chandra vermutet, Jasmine wollte nur lieb und fürsorglich sein, jetzt jedoch war er überzeugt, dass Niedertracht und Boshaftigkeit im Spiel waren. Bestimmt hatte Jasmine beschlossen – wie in der Familie üblich –, den Patriarchen zu quälen, denn sie war jetzt Teenager und lebte in Boulder, in den USA, bei ihrer Mutter, die Chandra nicht nur die Schuld an der Scheidung vor drei Jahren gab, sondern ihn auch für die Verbreitung von Ebola und die Entstehung der Terrorgruppe Boko Haram verantwortlich machte.
Sobald Chandra wieder zu Hause war, bekam er nonstop Beileidsanrufe, einige auch noch im Verlauf der Woche. Den gesamten nächsten Monat taten ihm auf der Straße nahezu wildfremde Leute ihr Bedauern kund, obwohl ebendiese Menschen vermutlich nicht mal drei Ökonomen hätten aufzählen können.
Im November hatte sich die Hysterie einigermaßen gelegt, weil man wegen der US-Wahlen unter Schock stand, und Professor Chandra wurde plötzlich bewusst, dass er die Hoffnung auf den Nobelpreis wohl endgültig aufgeben musste. Die Chancen standen schon schlecht, seit vor zehn Jahren der charmante Bengale ihn bekommen hatte. Doch selbst wenn genügend Zeit verstrichen war, um erneut einen Inder auszuzeichnen, hatte sich die gesamte Stimmung verändert. Seit Jahren hatten Ökonomen ihre Arbeit vorsätzlich verschleiert, indem sie mit unverständlichen Logarithmen alles so absurd technisch darstellten, dass sie eher wie mystische Seher denn wie Sozialwissenschaftler betrachtet wurden. Heutzutage waren die Wirtschaftswissenschaften kaum mehr als Basismathematik, aber Chandra rang noch immer mit der ganzen Rechnerei und erachtete sie als unter seiner Würde, als Job für einen mittellosen Rechercheassistenten.
In jedem Fall würden die Skandinavier seine neue Hinwendung zum Konservatismus ohnehin nicht belobigen; dieser kleingeistige Sub-Sub-Kontinent würde seine Haltung als Zeichen intellektueller und moralischer Abartigkeit erachten. Das verabscheute Chandra an Liberalen am meisten: ihre ungenierte Selbstgerechtigkeit. Als seien an den Verfehlungen der Menschheit grundsätzlich die anderen schuld, während alles, was diese Gestalten selbst veranstalteten – Mord und Brandstiftung eingeschlossen –, Heldentaten im Dienste von Freiheit und Gerechtigkeit waren. Dabei waren die Schweden nicht mal liberal, bestenfalls neutral; sie enthielten sich und taten so, als hätten sie sich zwecks Wahrung ihrer Objektivität absichtlich dagegen entschieden, eine Supermacht zu werden.
Chandra hätte jetzt nur allzu gerne einen Studenten aus Schweden gehabt, um ihn erbarmungslos zu quälen; doch es gab lediglich eine holländische Studentin mit amerikanischem Akzent, die bedauerlicherweise auch noch ziemlich klug war. Deshalb hielt Chandra also weiter seine Vorlesungen und versuchte zu wirken wie jemand, der so in seine Forschung vertieft ist, dass er von etwas derartig Banalem und Unwichtigem wie dem Nobelpreis nicht einmal Kenntnis hat.
An dem Mittwochmorgen nach Semesterende ging Chandra von seinem Haus in Grantchester zu Fuß über die Wiesen zur Uni, was er nur tat, wenn er mit dem Präsidenten – dem Master – zum Frühstück verabredet war. Chandra hatte am Gonville & Caius College den Status eines Clifford H. Doyle Professor emeritus, eine Ernennung auf Lebenszeit, die es ihm ermöglichte, so viel oder so wenig zu lehren, wie er eben wollte. Wie früher Professor Stephen Hawking gehörte Chandra ebenso zum Inventar des Colleges wie die steinernen Wasserspeier oben am Dach.
»Guten Morgen, Herr Professor«, sagte Maurice, der Portier, und tippte an seine Melone.
»Guten Morgen, Maurice«, erwiderte Chandra und nahm seine Post in Empfang, die aus der neuen Ausgabe des Economic Journal und diversen Einladungen zu Tees und Empfängen bestand, an denen er ganz bestimmt nicht teilnehmen würde.
»Der Master erwartet Sie, Sir«, sagte Maurice, der wie viele Portiers ehrerbietig und entschieden zugleich wirkte. »Seien Sie vorsichtig. Der Boden ist gefroren.«
»Bestens, danke«, sagte Chandra und wanderte zum Tree Court, der wegen der jetzt kahlen und dürren Schwedischen Mehlbeerbäume so benannt war.
Am Eingang zum Wohnhaus des Masters nahm ein livrierter Bediensteter mit Pokerface Chandra Mantel und Schal ab, und der Professor begab sich ins Esszimmer, wo der Master am offenen Kamin die Times las.
»Schön, Sie zu sehen, Chandra«, sagte der Master, der den Namen des Professors immer sehr eigentümlich aussprach.
»Ganz meinerseits. Eiskalt draußen.«
Wie viele englische Intellektuelle hielt sich der Master gerne in fast unbeheizten Räumen auf, weil dies angeblich – ebenso wie der Verzehr von nahezu rohem Rindfleisch – die Geisteskraft stärke.
»Es sind kalte Zeiten«, sagte der Master, vermutlich in Anspielung auf das amerikanische Wahlergebnis.
»Scheint so«, erwiderte Chandra.
Der Master wirkte jünger, als er war. Er hatte noch volles Haar, das er mit Pomade zurückkämmte, und seine Augen blickten in unterschiedliche Richtungen und waren leuchtend blau. Vor vielen Jahren hatte der Master als Hürdenläufer an der Olympiade teilgenommen, bis er bei einem Lauf Schotter ins Gesicht bekommen hatte und auf dem rechten Auge erblindet war. Gerüchten zufolge hatte er in den frühen Siebzigerjahren in Kenia Idi Amin Privatunterricht gegeben. Angesichts der tiefen Furchen im Gesicht des Masters fiel es nicht schwer, sich vorzustellen, dass er mehr als nur ein Leben gelebt hatte.
Er bat Chandra zum Esstisch, der groß genug für vierzig Gäste war. Wie immer genoss Professor Chandra das Ambiente: die Gemälde holländischer alter Meister, das schwere Silberbesteck, die Suppenterrine, alles zusammengenommen fast eine halbe Million Pfund wert. Für gewöhnlich drehte sich das Gespräch um Wirtschaft, wobei Chandra die Rolle des Therapeuten einnahm und dem Master beruhigend versicherte, dass Großbritannien nicht binnen fünf Jahren zum Drittweltland verkommen würde.
»Und wie geht es Ihnen, Professor?«, fragte der Master. »Haben Sie die kleine Enttäuschung schon verkraftet? Ich muss sagen, wir bedauern es alle ungemein, dass Sie nicht unser fünfzehnter geworden sind.«
Dieses College hatte bislang vierzehn Nobelpreisträger hervorgebracht. Tatsächlich waren gut informierte Kollegen vor einigen Monaten dazu übergegangen, Chandra »Fünfzehn« zu nennen. Womit sie nun schlagartig aufgehört hatten.
»Ach, recht gut«, antwortete Chandra, schob dem Diener seine Kaffeetasse hin und nahm mit einem Nicken das Angebot frischer Erdbeeren zum Croissant an.
»Aber die letzten Wochen waren sicher unerfreulich, oder? Und sehr anstrengend?«
»Ganz und gar nicht«, sagte Chandra, der es sich angewöhnt hatte, ganze Wochenenden im Bett zu verbringen. »Ich nehme derlei nicht schwer. Medaillen kommen und gehen.«
»Ja«, sagte der Master, legte sein Messer ab und strich sich durch die Haare. »Das stimmt wohl, aber … nun, das ist etwas heikel, aber einige Leute haben offenbar den Eindruck, dass Sie doch seit einiger Zeit etwas angegriffen sind.«
»Ach ja?«, fragte Chandra, der Unrat witterte.
»Ja, es hat Beschwerden gegeben.«
»Von wem?«
»Von Studierenden. Hauptsächlich aus dem Grundstudium.«
»Ach so«, sagte Chandra erleichtert.
»Sie haben wohl unlängst einige recht schroffe Bemerkungen gemacht. Die Studierenden können sicher nicht nachvollziehen, was Sie gerade durchmachen, aber einige waren sehr betroffen. Ich meine, an sich wäre das eine Angelegenheit für den Dekan, aber da es sich um Ihre Person handelt, wollte ich lieber selbst mit Ihnen sprechen.«
»Das tut mir sehr leid, Master«, sagte Chandra. »Aber ich kann mich gar nicht erinnern, schroffe Bemerkungen gemacht zu haben.«
»Tja«, sagte der Master und brachte sein Notizbuch zum Vorschein, was kein gutes Zeichen war. »Einige sind gewiss überempfindlich. Aber eine junge Frau haben Sie anscheinend vor ihren Kommilitonen mehrfach als ›Idiotin‹ bezeichnet, nach etwas, das sie selbst als vollkommen berechtigte Meinungsverschiedenheit beschreibt.«
»Ja«, erwiderte Chandra, der sich genau an den Vorfall erinnerte. »Wissen Sie, grundsätzlich bin ich sehr nachsichtig mit meinen Studierenden. Ich verlange nicht, dass sie bei meinen Seminaren nüchtern sind; ich habe es stillschweigend hingenommen, als einer seine Hausarbeit aus meinem eigenen Buch abgeschrieben hatte. Ich erwarte jedoch von ihnen, dass sie die Grundlagen der Ökonomie anerkennen. Diese junge Frau bezeichnete den keynesianischen Multiplikator als ›Trickle-down-Mythos‹. Aber da geht es nicht um Meinungen, Master. Es ist eine unumstrittene Tatsache, dass Unternehmen, die höhere Profite machen, mehr investieren und sich entsprechend die Arbeitslosenquote senkt. Man kann nicht während eines Gewitters behaupten, die Sonne schiene. Doch die besagte Studentin tat genau das, weshalb ich auf eine andere Tatsache verwies.«
»Dass die Studentin eine Idiotin sei.«
»Ganz genau.«
»Nun, ich kann das freilich nachvollziehen. Aber heutzutage gilt dieses Wort in so einem Zusammenhang – wie soll ich sagen – als politisch unkorrekt.«
»Auch wenn die besagte Person wirklich eine Idiotin ist?«
»Dann ganz besonders«, antwortete der Master mit einem Lächeln, das mehr nach Zahnschmerzen als nach Heiterkeit aussah. »Hören Sie, Chandra, es ist nur allzu verständlich, dass Sie in letzter Zeit gestresst waren. Derart im Licht der Öffentlichkeit zu stehen und mit hohen Erwartungen konfrontiert zu sein ist gewiss kräftezehrend. Deshalb denke ich mir – und nicht nur ich, sondern auch noch ein paar Kollegen –, dass ein Urlaub oder vielleicht ein Sabbatjahr Ihnen bestimmt guttun würde. Das ist natürlich Ihre freie Entscheidung, wir würden Ihnen so etwas nicht aufzwingen wollen. Aber Sie sollten sich das mal durch den Kopf gehen lassen.«
»Ich glaube nicht«, sagte Chandra.
»Aber der Vorschlag wäre doch eine Erwägung wert, nicht wahr?«
Chandra nickte, obwohl er durchaus nicht dieser Meinung war. »Ja, schon.«
»Damit wäre das Thema auch erledigt«, sagte der Master, als die Bediensteten Eier, Bacon und Toast servierten. »Reden wir über die Wirtschaft!«
In der nächsten halben Stunde erörterten sie den Brexit und die Kreditklemme. Der Master war äußerst beunruhigt über das stockende Wirtschaftswachstum in China und fragte, ob es die Welt ›übel in den Dreck reiten‹ werde, was in etwa der Frage »Werde ich in den nächsten fünf Jahren sterben?« oder der Frage »Werden wir das traditionelle Boat Race gewinnen?« entsprach. Mikroökonomisch betrachtet hätte die Antwort »Das ist ungewiss« lauten müssen, doch dann wäre nicht ausreichend Zeit zum Verzehr des zweiten Eies geblieben, das wie immer perfekt pochiert war. Deshalb entschied sich Chandra für einen positivistischen Ansatz, was bei derlei Fragen ohnehin angeraten war.
»Das ist sehr unwahrscheinlich«, sagte der Professor. »Wenn die USA niesen, bekommt der Rest der Welt eine Erkältung. Aber wenn China niest, sagen wir ›Gesundheit‹ und machen weiter wie gehabt. Das Entscheidende sind Kapitalkontrollen.«
»Na, das ist ja beruhigend, nicht wahr«, sagte der Master und wischte Krümel von seiner Hose. »Tut gut, das von jemandem zu hören, der weiß, wovon er redet.«
»Ist mir ein Vergnügen«, erwiderte Chandra.
»Die Armut verstehe ich einfach nicht«, fügte der Master hinzu, womit er sich auf eine potenziell endlose Tangente begab. »Wir könnten die gesamte Weltbevölkerung ernähren, aber wie sieht es in der Realität aus? Das ist doch absurd, Chandra. Ich meine, wird sich das jemals ändern? Werden wir jemals zur Vernunft kommen?«
Professor Chandra holte tief Luft. »Bestimmt«, sagte er.
»Da bin ich froh.«
Sie schüttelten sich die Hand, dann marschierte Chandra nach draußen, nahm Mantel und Schal in Empfang und trat hinaus in die eisige Novemberluft. Seine entschiedene Aussage hatte nichts mit seiner eigenen Meinung zu dem Thema zu tun – denn die war nichtexistent –, sondern war vielmehr der Tatsache geschuldet, dass er einen Termin mit einem Studenten hatte und bereits zweiundzwanzig Minuten zu spät dran war.
Chandra ging über den Rasen – ein Privileg, das nur den Profs vorbehalten war – und durchs Tor (allgemein bekannt als »Tor der Demut«). Der Campus vom Gonville & Caius College war durch eine Straße zweigeteilt, und wie üblich achtete Chandra nicht auf Touristen und Radfahrer, als er die Trinity Street überquerte. Dann sprintete er die Holztreppe zu seinen Räumen im dritten Stock hinauf.
Ram Singh, sein Doktorand, hockte auf dem Treppenabsatz und starrte auf sein iPhone, was heutzutage wohl alle Studierenden machten, wenn sie gerade nicht schliefen.
»Entschuldigung, Ram«, sagte Professor Chandra. »Tut mir wirklich leid.«
»Kein Problem, Herr Professor, ich war selbst spät dran.«
»Ah, gut … was zum Teufel ist das?«
Das Buch, das sich Ram Singh unter den Arm geklemmt hatte, trug den Titel: Statistik für Dummies.
»Nur ein bisschen unterhaltsame Lektüre.«
Professor Chandra seufzte, als er die Tür aufschloss. Weshalb ein Doktorand der führenden Eliteuniversität für Wirtschaftswissenschaften sich mit solchem Blödsinn abgab, entzog sich Chandras Verständnis. Aber da lag die Wurzel des Problems. Diese simplifizierenden Sachbücher versuchten die intellektuelle Schwelle zu senken, was ebenso gut gemeint wie absurd war. Denn man konnte eben nicht in drei Stunden lernen, wofür andere Jahre aufbrachten. Ob es der breiten Masse nun gefiel oder nicht: Die Ökonomie war noch immer eine Domäne von Experten und nicht – wie sein vierunddreißigjähriger Sohn Sunny zu sagen pflegte – »allgemein zugänglich«, so als könne jeder x-Beliebige oder Bengale eine Clifford H. Doyle Professur in Cambridge bekommen.
»Wie war’s denn in Delhi?«, fragte Chandra, während er herumlief, Bücher vom Sofa räumte, sich einen Becher Kaffee machte und seine Grünlilie wässerte, was die Reinigungskraft versäumt hatte.
»Wie immer«, antwortete Ram Singh. »Das Übliche. Bier ist teuer geworden.«
»Und die Feldforschung?«
»Die lief super. Hab die meisten Daten zusammen. Alles nur eine Frage von …« Ram klopfte auf das Dummies-Buch.
»Na, dann haben wir ja gar nicht viel zu bereden«, sagte Chandra. »Freut mich, dass Sie gut vorwärtskommen.«
»Wir müssten aber immer noch über Brasilien sprechen.«
Ram Singhs Dissertation hatte den Vergleich zwischen der Wirtschaftsleistung von Gujarat und der vom Rest zum Inhalt. Chandra war immer leicht irritiert, wenn Ram vom »Rest« sprach, womit der »Rest von Indien« gemeint war.
»Brasilien, ja«, sagte Chandra.
Das Thema war seit Monaten ein Streitpunkt zwischen ihnen. Sie wussten beide, dass Brasilien nur deshalb plötzlich so ungeheuer wichtig für die Dissertation geworden war, weil Ram Singhs Freundin, eine Miss Betina Moreira, vor einem Jahr nach São Paulo zurückgekehrt war.
Ram brauchte ein positives Gutachten, um weitere Forschungsgelder zu beantragen, und der Professor hatte sich bislang widersetzt. Jetzt kam ihm allerdings der Gedanke, dass Ram womöglich einer von denen war, die ihn angeschwärzt hatten. Denn erst im letzten Monat hatte Chandra dem Studenten mit einem Churchill-Zitat mitgeteilt, dass er mit nur wenigen Hirnzellen mehr ein Schwachkopf wäre.
»Tja«, sagte Chandra jetzt, »wenn Sie an die Gelder rankommen – warum nicht? Es würde natürlich die Thematik Ihrer Dissertation stark verändern, ganz zu schweigen von der zusätzlichen Arbeit, aber wenn Sie es für nötig halten …«
»Sie würden mir also eine Empfehlung schreiben, Sir?«, fragte Ram.
»Nun, Sie könnten Brasilien ja als Beispiel dafür anführen, was alles schieflaufen kann … Die Bonitätsbeurteilung des Landes fährt grade in den Keller, wie Sie wissen.«
Ram Singh machte sich Notizen und grinste breit, was Chandra nicht kommentierte.
»Und natürlich«, fuhr er fort, »muss man den Effekt der Fußballweltmeisterschaft und der Olympiade und so fort beurteilen. Das alles bleibt ja nicht ohne Wirkung.«
Ram leckte sich die Lippen beim Stichwort Weltmeisterschaft; mit der hatte sich seine letzte »Forschungsreise« nämlich »zufällig« überschnitten.
»Konzentrieren Sie sich in den ersten Kapiteln auf die Neunzigerjahre, dann untersuchen Sie die Auswirkungen von Modis Politik. Ich glaube, damit hätten wir’s für heute.«
»Danke, Herr Professor«, sagte Ram, der aussah, als werde er sich gleich verbeugen. »Ich soll auch schöne Grüße von meinen Eltern ausrichten.«
»Ach ja? Vielen Dank.«
»Ja, meine Eltern bestehen darauf, dass Sie sie besuchen, wenn Sie das nächste Mal in Delhi sind. Sie werden die Hunde bestimmt lieben. Die fehlen mir am meisten.«
»Hunde, ja«, sagte Chandra, der alles verabscheute, was einen Schwanz hatte. »Sehr schön.«
»Und, Sir …« Nur die Studierenden vom indischen Subkontinent sprachen den Professor mit »Sir« an, sogar jene, die mit ihren anderen Lehrkräften per Du waren. »Ich habe ganz vergessen zu sagen, wie leid es mir tut. Mit dem Preis, meine ich. Ich hoffe, es belastet Sie nicht zu sehr.«
»Ach, das habe ich schon vergessen. Wenn es mir nur um Auszeichnungen ginge …«
»Ja, natürlich«, sagte Ram Singh, dem es bei seinem Studium ums Geld ging. »Das sehe ich auch so.«
»War prima, dass Sie vorbeigeschaut haben.«
Das war an sich kaum die richtige Art, einen Studenten zu verabschieden, der wegen seiner Dissertation das Gespräch gesucht hatte. Hörte sich an, als wolle Ram nur das geborgte Kabel vom Rasenmäher wieder abgeben. Manch einer hätte dieses Benehmen vielleicht sogar als unprofessionell bezeichnet, aber derartige Bürohengste wussten schließlich auch nicht, dass Chandra vor zwei Jahren den Liebesbesuch seines Studenten in Brasilien quasi finanziert hatte.
»Ich mach mich sofort ans Werk, Sir«, sagte Ram.
Er verabschiedete sich, und Chandra schaltete seinen PC ein und starrte auf den Bücherstapel auf seinem Schreibtisch. Dann fiel sein Blick auf den Becher mit der Aufschrift »Ruhe bewahren und Ökonomie studieren« – ein Geschenk von seiner ältesten Tochter Radha, die ihn inzwischen aus ihrem Leben verbannt hatte. Er goss Milch in den Kaffee und dachte dabei, dass es höflich gewesen wäre, Ram auch einen anzubieten. Aber als der anfing, vom Nobelpreis zu reden, war klar gewesen, dass der Doktorand nichts mehr von Bedeutung von sich geben würde.
Der verfluchte Nobelpreis. Alle, die Chandra darauf ansprachen, machten das gleiche blöde Gesicht, etwa als müssten sie einen Zweijährigen überreden, eine Knarre fallen zu lassen.
Chandra verlagerte sich aufs Sofa und legte die Füße auf den niedrigen Tisch. Als damals die Krise mit Jean eskaliert war, hatte er sich mitsamt den Fotos von den Kindern und dem Stehpult, an dem er nie stand, in seine Uniräume verkrochen. Hatte etliche Nächte auf dem roten Chesterfield-Sofa zugebracht und Besprechungen von Doktorarbeiten in Morgenmantel und Pantoffeln abgehalten. Aber seit Jean nach Colorado gezogen war, verbrachte Chandra seine Abende meist in seinem Haus. Er lehnte Essenseinladungen ab und schaute stattdessen fern oder las Romane, mit denen er in der Mensa nicht gesehen werden wollte. Und allmählich dämmerte ihm, dass er nicht nur geschieden, sondern auch einsam war. Das Cottage in Grantchester, mit seinem schwarzen Reetdach und den Balken aus dem siebzehnten Jahrhundert, früher voller Trubel und Kinderlachen, kam Chandra jetzt vor wie die düstere Klause eines tragischen Einsiedlers, einer indischen Miss Havisham, mit einem Lehrstuhl und Takeaway-Essen.
Manchmal sann er darüber nach, ob nicht alles ein großer Schwindel war: dieser Buchstabenschwarm vor seinem Namen, die Dinner mit Angela Merkel und Narendra Modi, die Lobesworte von Gordon Brown und Larry Summers. Das erschien ihm zunehmend wie diese falschen Oscar-Statuen, die man in Billigläden kaufen und für seine Angestellten mit Inschriften wie »Beste Kopiererin der Welt« oder »Bester Glühbirnenwechsler der Galaxie« versehen lassen konnte. Nach seinem Ableben würden von Chandra nur seine Bücher bleiben, endgültig obsolet, wenn Erdöl und Kohle ausgingen und die Spezies ihre erste Siedlung auf dem Mars bezog.
Professor Chandra war der international prominenteste Handelsökonom. Er konnte jederzeit jeden Finanzminister der Welt anrufen und auch sofort sprechen. Aber wenn er sich nun nur einredete, dass die Welt ihn bewunderte? Wenn man ihn, mit seinem aufgeblasenen Ego, seinen Maßanzügen und dem gedrechselten Akzent in Wirklichkeit bedauerte?
Seine Frau war schon seit Jahren aus seinem Leben verschwunden, seine Kinder auch. Hätte er den Nobelpreis bekommen, dann hätte Chandras Leben ganz genauso wie vorher ausgesehen; es hätte lediglich etwas gefehlt, worauf er sich freuen konnte. In seinem Fachgebiet hatte er wohl jedes relevante Buch gelesen, weshalb sein Berufsleben nur noch daraus bestand, Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen und die ihm zustehende Anerkennung zu erringen, die er – und nun kam der blöde Witz – längst in rauen Mengen bekommen hatte.
Chandra stellte den Kaffeebecher ab und stapfte hinaus. Er hatte keine Ahnung, wo er hinwollte, wusste nur, dass er nicht bis zum Mittagessen auf dem Sofa hocken bleiben und sein Leben verabscheuen wollte.
Auf der Trinity Street ging er nach links und steuerte den Copper Kettle an. Mit einem Glas Wein ließ sich der Vormittag vielleicht schneller rumkriegen. Erstsemester radelten mit Zigarette im Mund und Unischal um den Hals zu ihren Vorlesungen. Vor der King’s College Chapel zückten Touristen aus Boston, Tokio oder Hongkong gigantische Nikons, um das berühmte fünfhundert Jahre alte Bauwerk abzulichten.
Das King’s College lag mitten in der Stadt, als beanspruche es alles Sonnenlicht für sich, und Chandra mochte es am wenigsten von allen Colleges in Cambridge. Ihm erschien es wie die akademische Entsprechung einer Disney-Prinzessin, die mit kokettem Blick Touristen anlockte, und zwar solche, die fragten: »Wo ist die Universität?«, und dann mit etlichen Fotos vom King’s College wieder abreisten, in der Überzeugung, sie hätten Cambridge gesehen. In puncto Ökonomie hatte es natürlich imposante Namen zuhauf zu bieten – Kaldor, Joan Robinson, J. K. Galbraith und Keynes selbst –, inzwischen aber nur noch schwachsinnige Studierende, die ihr Soziales Jahr der Armut in Afrika widmeten und der Meinung waren, Männer wie Chandra seien für diese Armut verantwortlich. Aber so war das eben heutzutage: Wer eine anständige Ausbildung genossen hatte, nutzte sie für kriminelle Machenschaften, und wer keine hatte, hielt sie nicht für wichtig.
Als Chandra an Mr. Simms Süßwarengeschäft vorbeikam, ging er spontan hinein, obwohl er den Wocheneinkauf eigentlich schon getätigt hatte. Eine Verkäuferin mit Schürze und Plastikschildpattbrille begrüßte Chandra, dem die junge Frau nicht bekannt vorkam, bis sie sagte: »Guten Morgen, Professor Chandra.«
»Guten Morgen.«
»Wie geht es uns heute?«
»Kann nicht klagen«, antwortete Chandra, was eine monumentale Lüge war.
»Was kann ich für Sie tun?«
Normalerweise kaufte er hier zweihundert Gramm Gummibärchen, die für eine Woche reichen mussten. Aber heute war ein Notfall.
»Fünfzig Gramm mit Schokolade überzogene Gummibärchen«, sagte er.
»Sehr gerne«, erwiderte die Verkäuferin und schaufelte Gummibärchen aus einem Bonbonglas in eine Papiertüte. »Kalt heute, oder?«, sagte die junge Frau, als sie die Tüte auf die Theke legte.
»Ganz furchtbar«, bestätigte Chandra und reichte der Verkäuferin einen Fünf-Pfund-Schein. Im selben Moment klingelte sein Handy, und er begann hektisch alle Taschen abzutasten, um das Ding zu orten, der übliche Zirkus. Dabei murmelte er: »Je mehr Technologie, desto mehr Probleme«, bekam das Handy schließlich zu fassen und sagte: »Ja, wer ist da, bitte?«
»Sir«, sagte ein Mann mit indischem Akzent, »Sie interessieren sich für ein Samsung Galaxy J5 Smartphone mit sechzehn Gigabyte internem Speicher. Ich rufe Sie an, um den Kauf dieses Geräts abzuschließen.«
»Ich habe nicht das geringste Interesse an einem solchen Gerät«, erwiderte Chandra, während er das Wechselgeld in Empfang nahm.
»Sir …«
Wie üblich gelang es Chandra nicht, das Gespräch zu beenden, so sehr er auch auf dem Display herumdrückte, und schließlich steckte er das Handy einfach wieder in die Tasche, aus der dann das anklagende »Sir« zu vernehmen war, als säße ein Kobold in seinem Mantel.
»Danke«, rief er der Verkäuferin noch zu, als er ins Wintersonnenlicht hinaustrat.
Der Copper Kettle mit seinem guten Rioja war jetzt nur noch wenige Meter entfernt, aber Chandra hatte eine Studentin entdeckt, die ihn von der anderen Straßenseite aus beobachtete. Und zwar die Idiotin. Damals hatte sie gekränkt gewirkt, jetzt aber lächelte sie auf diese postironische Weise, die ihn immer sprachlos machte. Nach dem Treffen mit dem Master war er dieser jungen Frau wohl eine Erklärung schuldig, sagte sich Chandra.
Er trat auf die Straße, als er hinter sich jemanden »Herr Professor!« rufen hörte und sich umdrehte. Die Verkäuferin hielt seine Tüte mit Gummibärchen hoch.
»Ach!«, rief er aus, aber jetzt rief die Idiotin: »Professor Chandra!« und dann: »Vorsicht!«
Er drehte sich wieder um, aber zu spät.
Das Fahrrad hatte bereits versucht auszuweichen und zu bremsen, doch jetzt konnte der Fahrer nur noch die Hände in die Luft werfen, während der Lenker Chandras Taille einklemmte wie ein gehörntes Ungeheuer, der Helm des Fahrers mit Wucht auf Chandras Rücken prallte und beide Männer auf den Asphalt stürzten, zuerst der Professor, dann der junge Radler, und zuletzt landete das Fahrrad auf ihnen beiden.
Chandra wurde schwarz vor Augen, minutenlang, wie ihm schien, und er dachte, er sei vielleicht tot, obwohl ihm das zugleich unwahrscheinlich vorkam. Er schmeckte nämlich Blut und hörte Stimmen. Jemand zerrte das Fahrrad von ihm herunter. Als Chandra die Augen aufschlug, sah er mehrere Gesichter über sich.
Er hatte nie angenommen, dass er in Cambridge zu Tode kommen würde, sondern sich immer vorgestellt, er werde an einem Flussufer in Indien sterben, umgeben von weinenden Enkelkindern – nicht von triumphierenden Kollegen, schwachsinnigen Studierenden und fotografierenden Touristen.
»Professor Chandra?«, rief eine junge Stimme, offenbar gerade der Pubertät entwachsen. »Hatten Sie einen Unfall?«
»Natürlich hatte ich einen verfluchten Unfall«, hätte Chandra gerne ausgerufen – nur ein Erstsemester konnte eine derart dümmliche Frage stellen –, aber sein Mund war voller Blut.
Während er dalag und auf den Krankenwagen wartete, schien sich die halbe Studentenschaft zu versammeln, um diesem unwürdigen Ende von Professor P. R. Chandrasekhars Leben beizuwohnen. Einige weinten, andere hatte er im Verdacht, dass sie sich ihre Häme mühsam verkneifen mussten. Noch jetzt fiel es ihm schwer zu glauben, dass diese Menschen nichts Besseres zu tun hatten, als sich über sein Scheitern, in die Ränge der Nobelpreisträger für Wirtschaft aufgenommen zu werden – deren Namen er auswendig kannte und in Momenten extremer Frustration vor sich hin murmelte wie ein Mantra –, lustig zu machen. Aber das stimmte natürlich gar nicht: Die Leute sahen lediglich einen blutenden alten Mann, der auf der Straße lag. Sie konnten nicht wissen, wie schlimm er sein Leben verpfuscht hatte.
»C’est la vie«, sagte sich Chandra und wehrte sich gegen die Sauerstoffmaske, die ihm über Mund und Nase gestülpt wurde. »La scheiß vie.«
2
Am nächsten Morgen erwachte Professor Chandra in einem Einzelzimmer, mit Schmerzen am ganzen Körper, von dumpf bis stechend. Seine Rippen waren geprellt, das linke Handgelenk verstaucht, weil er versucht hatte, sich im Fall abzustützen, und seine Wirbelsäule hatte ein Trauma abbekommen, was er nicht verstand, was aber bedeutete, dass er umgehend operiert wurde, damit seine Wirbel wieder an Ort und Stelle kamen. Ferner hatte er einen »stummen Herzinfarkt« gehabt, was ihm seine miese Stimmung in den letzten Wochen verständlicher machte. Gute-Besserung-Karten trafen ein, von seiner Sekretärin, einigen Kollegen und den meisten Mitgliedern von International Economics. Jasmine schickte eine E-Mail aus Colorado, sein Bruder eine aus Delhi (was äußerst selten vorkam), aber weder Chandras Sohn Sunny noch seine älteste Tochter Radha meldeten sich. Letztere hatte seit zwei qualvollen Jahren nichts von sich hören lassen, deshalb wunderte er sich nicht.
Jasmine hatte ein Gedicht angehängt, das Chandra zum Lächeln brachte.
Lieber Dad, wir denken an dich
du hast uns erschreckt ganz fürchterlich
schau erst links, dann rechts, sonst wirst du nicht alt
ruh dich schön aus, gib gut auf dich acht
viel schlafen und lächeln, komm nicht auf den Hund
sondern werd schnell wieder ganz gesund.
Jean hatte auch ein paar Zeilen geschrieben, in denen sie – mit diesem typisch nordenglischen Mix aus Unverblümtheit und Verbrämung – durchblicken ließ, dass es ja irgendwann dazu hatte kommen müssen, und würde er nicht nur dauernd an seine Arbeit denken, hätte sich der Unfall nicht ereignet und das Leben seiner Familie wäre auch wesentlich weniger mühselig. Immerhin schien sie zumindest erleichtert, dass er nicht tot war, und irgendwie lag er ihr wohl am Herzen, wenn auch auf eine Art, die bar jeder Einfühlung und spürbarer Zuneigung war.
Als die Krankenschwester hereinkam, wandte sie den Blick ab, als bedaure sie Chandra wegen seiner Einsamkeit. In den anderen Krankenzimmern wimmelte es vermutlich von Blumen und Menschen, und man schrammelte Lieder auf handbemalten Gitarren.
Erst einen ganzen Tag später bekam Chandra einen Anruf von seinem Sohn, der sich aus der Lobby des Oberoi in Mumbai meldete. Wie Jean war auch Sunny der Ansicht, dass Chandra sein aktuelles Schicksal selbst zu verantworten hatte, vertrat jedoch die Ansicht, der Unfall sei eine »synchronistische Notwendigkeit«.
»Es geht dabei immer um die Seele, Dad«, sagte Sunny. »Wir schaffen unsere eigene Wirklichkeit.«
Sunny betrieb in Hongkong ein ungeheuer erfolgreiches Unternehmen namens Institut für achtsames Management, das sich positives Denken und Finanzkarma auf die Fahnen geschrieben hatte – Resultat einer Ideologie, die Chandra als kapitalistischen Mystizismus bezeichnete.
Man traf Sunny immer nur in schwarzem Anzug mit Nehru-Kragen, weißem T-Shirt, Sneakers und Brille an, obwohl Chandra sicher war, dass sein Sohn exzellente Augen hatte. Manchmal sprach Sunny mit hörbar indischem Tonfall, der dem seines Vaters ähnelte. Chandra gestand sich das selbst äußerst ungern ein, aber Sunny und er waren zu Konkurrenten geworden. Und er hatte den Nobelpreis unter anderem deshalb unbedingt bekommen wollen, damit er seinem Sohn endlich beweisen konnte, wer recht hatte.
»Sunny«, sagte Chandra, »wenn du mir jetzt sagst, ich soll positiv denken, lege ich auf, ich schwör’s dir.«
»Freut mich, dass du so lebhaft klingst, Dad.«
»Hast du was von Radha gehört?«
»In letzter Zeit nicht.«
»Dann weiß sie gar nichts?«
»Doch.«
»Also hast du von ihr gehört?«
»Ich hab ihr eine Nachricht geschrieben.«
»Schreib ihr, sie soll mich anrufen, Sunny.«
Das hatte die Familie hinter seinem Rücken ausgeheckt. Alle wussten, wo Radha sich aufhielt, hatten ihr aber Geheimhaltung gelobt. Zuerst hatte er darauf mit einem Tobsuchtsanfall reagiert, aber alle blieben unerbittlich, sogar Jasmine. Chandra besaß keine Telefonnummer von Radha, und sie beantwortete seine E-Mails nicht. Und sogar jetzt, wo er im Krankenhaus lag, ließ sich offenbar niemand erweichen.
»Ich könnte tot sein«, sagte Chandra. »Ich könnte tot sein, und es wäre meiner ältesten Tochter egal.«
»Du bist nicht tot, Dad.«
»Was Radha aber nicht weiß.«
»Doch«, erwiderte Sunny. »Ich habe ihr geschrieben, dass so weit alles okay ist mit dir.«
Chandra stellte sich gerade vor, dass er als Erstes die Wachleute rufen und seine Tochter dann eiskalt ignorieren würde, wenn sie jetzt zur Tür hereinkäme. Aber das glaubte er nicht mal selbst, denn sie fehlte ihm.
»Ich hatte einen Herzinfarkt, Sunny. Ich könnte jederzeit sterben. Sag ihr das.«
»Dein Körper teilt dir auf diese Weise mit, dass du dein Leben ändern musst, Dad. Mach, was die Ärzte dir sagen, dann wird es nicht wieder vorkommen. Glaub mir. Du bist gesund.«
»Ich bin neunundsechzig, Sunny. Jeden Tag sterben Menschen, die jünger sind als ich.«
»Nicht, wenn sie sich anständige Kliniken leisten können.«
»Ich könnte mit dem Auto tödlich verunglücken.«
»Du fährst einen Volvo. Der ist so sicher wie ein Panzer.«
»Ich könnte erschossen werden.«
»In Cambridge?«
»Ich möchte darüber nicht diskutieren, Sunny. Du willst mir doch wohl nicht erzählen, dass ich nicht sterben werde, oder?«
»Nein, das wäre Unsinn. Aber es ist durchaus denkbar, dass du mindestens neunzig wirst. Die Menschen meiner Generation können alle hundert werden, es sei denn, sie wachsen in Slums oder sozialen Brennpunkten auf. Die Medizin macht so rasante Fortschritte, dass du vielleicht selbst noch dreistellig wirst, du hast also keinen Anlass, dir Sorgen zu machen. Ich tu’s nicht und Radha auch nicht. Sich sorgen heißt nur, dass man versucht, die Zukunft zu leben, bevor sie da ist.«
»Das soll also heißen, solange wir am Leben sind, ist alles okay, oder wie? Wir brauchen uns nicht zu sehen? Es reicht, wenn ich euch einmal im Jahr per Mail schreibe, dass ich noch da bin? Und ansonsten leben wir alle wie gehabt?«
»Komm schon, Dad, nun sei nicht so. Ich kann’s kaum erwarten, dass du mich mal in Hongkong besuchst.«
»Mach ich noch. Ich hatte sehr viel zu tun.«
»Schon klar, Dad. Du hast deine Arbeit, ich weiß.«
Es war unfassbar, wie es Sunny gelang, ihm Schuldgefühle einzuflößen, ein Akt ungeheurer emotionaler Manipulation. Dabei war sein Sohn im Grunde ein schüchterner, unsicherer, hochsensibler Mensch, der vorgab, genau das Gegenteil zu sein, und zwar mit solcher Geschicklichkeit, dass er fast alle täuschen konnte.
»Ist gut, Sunny. Danke. War nett, dass du angerufen hast.«
»Gerne, Dad. Gib auf dich acht.«
Professor Chandra hackte auf seinem Handy herum, aus dem er jetzt Sunny in gebrochenem Hindi sprechen hörte, und widerstand der Versuchung, das Ding in die Vase mit den Tulpen zu werfen, die »der Fachbereich« geschickt hatte, also lediglich seine Sekretärin. Dann starrte er auf den Gipsverband an seinem Handgelenk, den keinerlei Unterschriften zierten, und erwog Jasmine anzurufen, aber sie ging nie ran, sondern schrieb nur ein paar Minuten später eine Nachricht – Alles okay, Dad? –, worauf er dann antwortete: ja, und bei dir?, was wiederum mit: alles gut, xx beantwortet wurde.
Jasmine hatte unlängst die Ergebnisse ihrer Tests fürs Studium bekommen und weigerte sich, sie ihm mitzuteilen, sosehr er auch bat, herumbrüllte oder sie zu erpressen versuchte. Sie sagte lediglich, sie hätte den Test »komplett verkackt«, und leider war Chandra geneigt, ihr zu glauben. Im Gegensatz zu ihren älteren Geschwistern, die überall exzellent abgeschnitten hatten, war Jasmine eine schwierige Schülerin gewesen, immer auf Nachhilfe angewiesen. Chandra hatte sich allerdings bislang keine großen Sorgen gemacht, weil sie immer so fröhlich und lieb gewesen war. Doch auch das begann sich gerade zu ändern.
Bevor Professor Chandra aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wurde er noch einmal genau untersucht und besprach die Ergebnisse dann mit seinem Arzt, Dr. Chris Chaney, einem zweiunddreißigjährigen Amerikaner mit Converse-Sneakern, schimmernden Zähnen und sorgfältig gepflegtem Dreitagebart.
»Sie sollten das sehr ernst nehmen«, sagte Dr. Chaney. »Stumme Herzinfarkte können genauso tödlich enden wie andere. Sie müssen sich mindestens zwei Monate freinehmen.«
Professor Chandra lächelte. Dr. Chaney hatte ganz offensichtlich keine Ahnung, wen er vor sich hatte.
»Mayonnaise ist ab jetzt vom Speiseplan gestrichen«, fuhr der Arzt fort. »Besser noch: alle Milchprodukte. Und natürlich rotes Fleisch.«
»Natürlich«, sagte Chandra.
»Ferner Rotwein, Weißbrot, Kartoffelchips, Pommes frites, Zucker im Kaffee, Koffein …«
»Wieso sagen Sie mir, ich darf keinen Zucker in den Kaffee nehmen, wenn ich gar keinen Kaffee mehr trinken darf?«
»Koffeinfreien dürfen Sie trinken.«
»Ach so.«
»Auch zu vermeiden sind gehärtete Pflanzenfette, alles, was Fruktosesirup enthält, Weizenmehl und weißer Reis, wenn Sie es irgendwie hinkriegen, obwohl da etwas mehr Spielraum ist. Brot und Kartoffeln sind allgemein eher nicht hilfreich, und auf Zigarren müssen Sie natürlich komplett verzichten.«
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Professor Chandra Follows His Bliss« bei Chatto & Windus, an imprint of Vintage, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Wunderraum-Bücher erscheinen im
Wilhelm Goldmann Verlag, München,
einem Unternehmen der Random House GmbH.
1. Auflage
Copyright © der Originalausgabe
2019 by Rajeev Balasubramanyam
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Susann Rehlein
Umschlaggestaltung und Konzeption: Buxdesign | München
Umschlagmotiv: © Carla Nagels, shutterstock/majivecka
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-24309-8V001
www.wunderraum-verlag.de