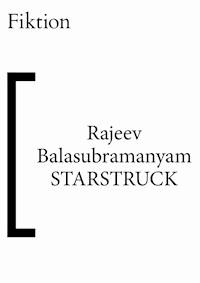
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fiktion
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Starstruck wurde aus dem Englischen von Thomas Melle übersetzt. Über das Buch: Starstruck ist eine Sammlung von zehn miteinander verknüpften Geschichten, die sich auf surreale, dunkle, oft auch komische Weise um jeweils eine prominente Persönlichkeit drehen. Fanatische Apple-Jünger versuchen eine Frau digital zu lynchen, weil sie es gewagt hat, Steve Jobs zu kritisieren, David Beckham begegnet uns als hochpolitisierter Wüterich, und sowohl Freddie Mercury als auch Michael Jackson suchen uns aus dem Jenseits heim. Rajeev Balasubramanyam seziert die moderne Gesellschaft mit scharfem Skalpell und legt die Schönheit, die Zerbrechlichkeit und das schier Bizarre der menschlichen Spezies frei.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Erstveröffentlichung Fiktion, Berlin, 2014www.fiktion.ccISBN: 978-3-9816970-1-8
Projektleitung Programm Mathias Gatza, Ingo Niermann
Projektleitung Kommunikation Henriette Gallus
Übersetzung Thomas Melle
Lektorat Mathias Gatza
Korrektorat Rainer Wieland
Lektorat englischsprachig Alexander Scrimgeour
Graphikdesign Vela Arbutina
Programmierung Maxwell Simmer, Version House
Das Copyright für den Text liegt beim Autor.
Fiktion wird getragen von Fiktion e.V., entwickelt in Kooperation mit dem Haus der Kulturen der Welt und gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes.
Fiktion e.V., c/o Mathias Gatza, Sredzkistrasse 57, D-10405 Berlin
Vorstand
Rajeev Balasubramanyam STARSTRUCK
Aus dem Englischen von Thomas Melle
Ein Roman in zehn Teilen
Mitwirkende (in alphabetischer Reihenfolge): David Beckham, Björk, Tony Blair, George Bush Senior, Sarah Ferguson, Prinz Harry, Michael Jackson, Steve Jobs, Freddie Mercury und Mike Tyson
In Erinnerung an Shyam
Alle Personen in diesem Buch sind erfunden. Jede Ähnlichkeit mit realen Personen ist rein zufällig.
Und:
All haters are just confused admirers.
– Justin Bieber
Wenn du dieses Buch liest, bist du wahrscheinlich wie ich. Warum sonst sollte dich interessieren, ob Rihanna Chris verlassen, ob Miley Robin angetwerkt oder wie viel die Hochzeit von Kim und Kanye gekostet hat? Prominente sind Idioten, die von Idioten an andere Idioten verkauft werden. Warum sollten wir ihren Narzissmus finanzieren? Warum unsere Zeit verschwenden? Wir sind schließlich keine Idioten.
Doch so einfach ist es nicht. Manchmal wird uns Atheisten erst auf dem Sterbebett klar, dass wir unser ganzes Leben nur von Gott geredet haben.
O ja, am Ende kriegen sie uns.
Früher oder später werden wir alle starstruck, promigeil, ob wir wollen oder nicht.
Das weißt du, denn auch du hast es gesehen. Versuche nicht, es zu leugnen. Ich weiß es, du weißt es, die anderen wissen es. Wir alle haben es gesehen, Herrgott nochmal.
Was gesehen? Komm mir nicht damit. Du weißt, was.
Das Video. Ja, genau, das Video.
Über zwei Milliarden Klicks auf YouTube. Google war für zwei Stunden offline. Das Thema wurde, und zwar sehr ernsthaft, bei einer Fragestunde des Premierministers behandelt. Und was ihn etwas angeht, das geht dich auf jeden Fall auch etwas an. Warum, spielt keine Rolle. Es ist einfach so. Als dieses Video online ging, hielt die Welt den Atem an, und ein kollektiver Seufzer war zu vernehmen.
Er lebt, sagten wir alle im selben Moment. Er lebt.
Und alle lächelten wir, selbst die Abgestumpften und die Zyniker, die Intellektuellen und die Eremiten, ja, sogar die verschwitzten, milchgesichtigen, herumhurenden Pressefritzen.
Wir alle.
Außer mir vielleicht.
Als ich das Video sah, wusste ich sicher, dass mein Bruder tot war.
Los, öffne den Browser. Tipp die Wörter ein, du weißt schon, welche. Scrolle hinunter und klicke auf Play.
Und dann schau.
Mein Bruder hat das für dich gemacht, also erzähl mir nicht, dass du nicht lächelst. Erzähl mir nicht, es sei dir egal. So habe ich auch geredet, früher.
1.
Der ganze Streit ging von meinem Vater aus, und ich hasste ihn dafür. Als ich ihm sagte, dass ich heiraten würde, leuchteten seine Augen auf wie Kathodenstrahlen:
„Ameena …“, murmelte er, während es ihm langsam dämmerte. „Aber wir sind doch gegen Muslime“, sagte er. „Genau, wie wir gegen Schwarze sind. Beschäm uns bitte nicht.“
Es war dieses Verb, das mich verletzte; ‘verärgere uns nicht’ wäre besser gewesen, sogar ‘blamier uns nicht’. Alles wäre besser gewesen.
Ich musste es mir eingestehen: Mein Vater war weder rückwärtsgewandt noch ignorant; er war schlichtweg ein gemeiner Egoist. Sechs Jahre lang redete ich nicht mehr mit ihm.
Er bat am Ende darum, aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, um zuhause in seinem Schlafzimmer zu sterben. Ameena und ich lebten in den Staaten, aber wir flogen sofort hin und quartierten uns in einem Hotel ein. Ich ging nach Hause und sie einkaufen, weil uns nichts Besseres einfiel. Das erste, was mein Vater zu mir sagte, war: „Ashish, entweder diese Tapete verschwindet, oder ich.“
Mein Vater war ein Oscar-Wilde-Fan, obwohl er sich immer weigerte, mir zu glauben, dass sein Idol schwul war.
Ich setzte mich auf sein Bett und hielt seine Hand, und er sagte: „Wo ist Ameena? Wo ist meine Tochter?“
Ich war so verblüfft, dass ich nur noch weinen konnte.
Wir waren bei meinem Vater, als er seinen letzten Atemzug tat, und ich vergab ihm alles - es war so einfach. Sein Tod brachte meine Mutter, Ameena und mich wieder zusammen. Wir wurden zu einer Familie. Vergebung ist der reinste Ausdruck der Liebe.
Doch dann begann meine Ehe auseinanderzubröckeln.
Nicht die Familie war schuld an diesem Zerwürfnis, sondern die Politik - ein Wort, das ich inzwischen hasse. Es fing mit dem 11. September an und fand sein Ende an dem Tag, als George Bush Senior vorbeikam, um unsere Toilette zu benutzen. Aber dazu kommen wir später.
Ameena und ich waren nie sehr politisch. Als Jugendlicher war ich in der Labour Party, und sie hatte was mit Greenpeace zu tun, in New York leitete sie dann, außer ihrer Zahnarztpraxis, noch eine Frauengruppe, aber das war mehr eine Therapie für einsame Herzen als irgendetwas Feministisches. Und ich, ich bin in meiner Arbeit schier ertrunken.
Ich bin Professor für Linguistik und habe alles gelesen, was Noam Chomsky je geschrieben hat, jedenfalls alles außer seinen politischen Aufsätzen. Die standen zwar in meinem Bücherregal, aber ich hatte nie das Bedürfnis, sie zur Hand zu nehmen. Ich habe den Mann sogar bei drei verschiedenen Anlässen getroffen, doch wir redeten ausschließlich über Grammatik und Genetik. Ich könnte wohl die Namen des amerikanischen Präsidenten, des britischen Premiers und vielleicht noch zwei anderer Staatsoberhäupter aufzählen, für einen Akademiker ist das schon ganz gut. In meiner Universität gibt es einen Professor, der denkt, dass China noch immer von Mao regiert wird. Als ich ihn berichtigen wollte, sagte er: „Ach ja, klar, der neue Typ; wie hieß der noch, Hong Kong?“
Ich schätze, es ist ein ziemlicher Luxus, so sein zu können, und es fällt daher in Amerika leichter als in jedem anderen Land, obwohl sich das nach dem 11. September zu ändern begann. Er rüttelte alle irgendwie auf, und als die Apathiker dann über Nacht politisch geworden waren, gaben sie die dümmsten Sachen von sich. Das ist unvermeidlich. Stell dir vor, alle würden sich plötzlich am Esstisch über generative Grammatik unterhalten wollen.
Diese Veränderung fiel mir erstmals auf, als Ameena eines Tages verheult nach Hause kam, und sie zitterte geradezu vor Wut. Es stellte sich heraus, dass jemand ihr beim Warten an der Supermarktkasse vier Speckstreifen in die Bluse gesteckt hatte. Dass ihr niemand helfen wollte, machte es nur noch schlimmer. Einige lachten sogar. Sie bewarf den Übeltäter mit dem Speck, fluchte laut, schmiss eine Flasche aus dem Regal auf den Boden und verschwand, doch auf dem Heimweg fing eine Streife sie ab und nahm sie fest, um sie zu verhören. Sie ließen sie zwar frei, sie aber ging daraufhin für drei Tage nicht mehr aus dem Haus. Am vierten Tag war Ameena verändert.
Sie trank mehr, fing aber auch an zu beten, und bisweilen ging sie mit einem Kopftuch nach draußen. All das verlieh ihr eine neue Stärke, was mich erfreute, doch außerdem begann sie, über Politik zu reden. Ständig. Anfangs war mir das egal. Nun ja, ich hörte halt zu. Aber mit der Zeit wurde es extremer. Ameena ging auf Demonstrationen, und wenn sie von dort nach Hause kam, war sie so überdreht, dass sie stundenlang herumfluchte. Als ich sie anflehte, damit aufzuhören, schrie sie mich an:
„Dir ist alles egal außer dir selbst“, sagte sie.
„Wach auf, du Idiot. Siehst du denn nicht, was los ist?“ Und, am schlimmsten: „Du bist kein Muslim. Warum solltest du uns verstehen? Dir macht das wohl auch noch Spaß.“
Aber das war einfach nur unfair, von welcher Seite man es auch betrachtete. Ja, ich war kein Muslim, aber meine Frau war eine Muslimin, und ich identifizierte mich mit ihr, also identifizierte ich mich auch mit ihnen. Ich versuchte, ihr das klarzumachen, aber sie sagte, ich solle den Mund halten und nicht linguistisch daherreden.
„Das ist die Realität, Ashish.“
„Das ist Logik, Ameena. So denke ich einfach.“
„Scheiß auf Logik. Wie wär’s mit ein wenig Solidarität? Du weißt, dass Michael Jackson Muslim geworden ist?“
„Was?“
„Es ist wahr.“
Es stimmte. Es stand im MJ-Schrein. Aber was hieß das schon?
„Willst du mir sagen, dass ich konvertieren soll?“
„Ich will sagen, dass der Islam ein Zufluchtsort für die Unterdrückten ist. Nicht, dass Sie irgendwas davon verstünden, Herr Professor.“
„Wir werden nicht unterdrückt. Der Krieg ist Tausende von Kilometern weit weg. Wir haben zwei Autos und ein Haus.“
„Der Krieg ist hier, vor der Tür. Siehst du das nicht?“
Ich blickte aus dem Fenster.
„Nein.“
„Selbst wenn der Krieg Tausende von Kilometern entfernt ist: Die töten Babys im Irak, Ashish. Willst du mir sagen, dass dir das egal ist?“
„Ich dachte, das war in Afghanistan.“
„Die Sanktionen, du Idiot!“
„Gegen Babys?“
Sie wurde so wütend, dass sie in mein Arbeitszimmer ging und mit den Chomsky-Bänden nach mir warf. Danach versuchte ich tatsächlich, auch die politischen Bücher zu lesen. Jedoch konnte ich mich dann nie an das erinnern, was ich gelesen hatte. Das machte sie nur noch wütender, bis wir im Herbst kaum mehr miteinander sprachen. Es war so schlimm, dass ich sogar versuchte, Chomsky anzurufen, doch er rief nie zurück.
Im Oktober sah ich sie vielleicht zwei Abende die Woche, aber entweder telefonierte sie oder surfte im Internet, kommunizierte mit „Gleichgesinnten“. Ich hatte damals keine Ahnung, was „Gleichgesinnte“ eigentlich bedeuten sollte. Meine Frau wurde mir fremd.
Der November kam, und meine kleine Schwester stand kurz vor ihrem Studienabschluss. Sie hatte zuhause gewohnt, um die Kosten gering zu halten, denn - das wusste ich immerhin - die Regierung hatte Studiengebühren eingeführt. Ameena und ich beschlossen, zur Abschlusszeremonie nach England zu fliegen. Ich befürchtete, dass sie sich noch umentscheiden würde, was meine Mutter verärgert hätte, aber als der Tag da war, hatte sie gepackt und war reisebereit.
Natürlich wurde unser Gepäck gleich zweimal durchsucht, doch Ameena sagte nichts, nicht einmal während des Fluges. Auch ich schwieg, um sie nicht zu provozieren, und las Deterring Democracy von Chomsky. Als wir landeten, schien Ameena entspannter zu sein und gestand, dass sie froh über unseren Aufenthalt in England sei.
„Es ist zum Kotzen faschistisch“, sagte sie, „aber schlimmer als Amerika kann es nicht sein.“
Ich nickte zustimmend.
Als wir zuhause ankamen, drehte sich das Gespräch ausschließlich um Mala und ihre Erfolge, die Atmosphäre war liebevoll und fröhlich. Mala teilte uns ihren Entschluss mit, ihren Doktor in Politik zu machen. Ameena applaudierte ihr, während ich ein langes Gesicht machte, worauf mir nahegelegt wurde, doch endlich mal erwachsen zu werden; von wem, weiß ich nicht mehr genau.
Ameena und ich überreichten Mala das Geschenk, das wir ihr aus New York mitgebracht hatten, ein brandneues Apple Powerbook G4 mit 17-Zoll-Bildschirm.
„Darauf kannst du deine Dissertation schreiben“, sagte ich zu ihr.
„Gibt kein schnelleres, Süße“, sagte Ameena. „Schau dir den Bildschirm an. Ist super für DVDs.“
Mala murmelte „danke“, ließ den Computer jedoch in der Verpackung. Ameena sah mich an. Ich sah Mutter an.
„Sie ist eine Anarcho-Primitivistin“, sagte Mutter.
„Was ist das denn?“, fragte ich.
„Weiß ich nicht.“
„Sie ist gegen Technologie-Fetischismus“, erklärte Ameena. „Sie will zurück zur Natur.“
Ich presste mein Gesicht in ein Kissen und schrie hinein, was die anderen für einen Witz hielten.
Während des Essens machten wir eine eine Flasche Champagner auf, dann eine zweite. Ameena trank am meisten, aber sie schien guter Dinge zu sein. Sie zog Mala wegen ihrer Freunde auf, ereiferte sich mit meiner Mutter über die Aggression im Straßenverkehr (und das von einer Frau, die regelmäßig bei Männern, die sie für Republikaner hielt, zu dicht auffuhr), und sie grinste sogar über meine Witze.
Während meine Mutter nach dem Essen Kaffee machte, beging ich den Fehler, den Fernseher einzuschalten. Die Nachrichten liefen. Plötzlich wurden Ameenas Augen ganz glasig: ihr Nachrichtenblick. Dann kam meine Mutter wieder ins Zimmer, ein Tablett mit Kaffeetassen in den Händen. Sieben Minuten später war ein Streit zwischen den beiden entflammt, und Ameena war wieder stocknüchtern. Statistiken, Analysen und „harte Fakten“ schossen ihr aus dem wortgewandten Mund, worauf meine Mutter von oben herab mit halbverrückten, unlogischen Folgerungen konterte.
Dazu muss man wissen, dass meine Mutter für diesen Krieg war. Meine Frau nicht.
„Ich habe das Dossier gelesen“, sagte Ameena. „Es besteht nur aus Lügen.“
„Das denkst du nur, weil du keine Kinder hast“, sagte Mutter.
„Zehn Millionen Menschen weltweit haben an einem einzigen Tag protestiert“, sagte Ameena.
„Wie wär’s, wenn du dir ein Hobby suchst?“, sagte Mutter. „Vielleicht Vogelbeobachtung.“
„Wenn es überhaupt keine Waffen gäbe, gäbe es auch keinen Krieg“, sagte Mala.
„Warum beruhigen wir alle uns nicht ein wenig“, sagte ich und starrte meine Schwester sauer an.
„Halt den Mund, Ashish“, sagte Ameena.
„Ja“, sagte Mala. „Halt den Mund, Ash.“
Mala verstand nicht, dass mein ganzes Leben inzwischen aus diesen Ausbrüchen bestand, Tag für Tag von früh bis spät. Ich polterte nach oben, um zu rauchen, aber meine Mutter kam mir hinterher und befahl, ich solle dafür nach draußen gehen. Also stand ich, ein ordentlicher Professor von 38 Jahren, wie ein Teenager in der Kälte. Von der Straße aus konnte ich sie noch immer hören.
Als ich wieder ins Wohnzimmer kam, war ihre Meinungsverschiedenheit vergessen, und beide richteten sich gegen mich. Meine Mutter war plötzlich außer sich, dass ich eine Muslimin geheiratet hatte. Mal wieder. Und meine Frau war wütend darüber, dass ich mich weigerte, meine Mutter zu verdammen. Mala verschwand in ihr Zimmer und redete am Telefon mit ihren Freunden, was mich nur noch mehr verärgerte. Wie kommt sie dazu, ein Telefon zu benutzen, aber keinen Computer?
Wütend erhob ich meine Stimme:
„Haltet jetzt den Mund. Beide.“
Es funktionierte. Sie starrten mich mit Spielplatzgesichtern an.
„Ich muss euch was zeigen“, sagte ich und zog den Brief hervor (ich hatte ihn für den richtigen Moment aufgespart, der nun offensichtlich gekommen war).
„Lieber Professor Iyer“, hieß es da. „Im Rahmen der Abschlussfestivitäten möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, Sie zu einem Abendessen mit dem Vizekanzler am Abend des 9. Juli einzuladen. Es wäre uns eine Ehre, Sie in Ihrer Heimatstadt auszeichnen zu dürfen, und wir hoffen, dass Sie die Einladung annehmen. Wir haben nicht viele Wunderkinder vorzuweisen, zumal nicht solche Ihres unerreichten Formats.“
Ein paar akademische Stars würden anwesend sein, und natürlich war Ameena ebenfalls eingeladen. Es unterstrich die akademischen Meriten, die ich dank meiner Aufsätze in den letzten Jahren erreicht hatte, und meine Festanstellung in so jungem Alter. Meine Mutter war sehr stolz und wendete den Brief mehrmals um, so als würde sie einen beigefügten Scheck suchen. Auch Ameena schien glücklich zu sein.
„Es tut mir leid, dass ich mich so aufgeregt habe“, sagte sie. „Eine Abendgesellschaft scheint mir eine gute Idee zu sein.“
Ich öffnete einen Whiskey aus dem Duty-Free-Shop, und sogar meine Mutter liess sich einen winzigen Schluck einschenken. Doch dann kam Mala zurück und enthüllte die Identität des Tischredners.
Es war George Bush - Senior.
Ameenas Kopf schien um die eigene Achse zu rotieren.
„Ich verbiete dir, dich diesem Mann auch nur zu nähern“, sagte sie und versuchte zudem plötzlich, meiner Schwester die Abschlussfeier auszureden, was wiederum meine Mutter auf den Plan rief.
„Ameena, was hat dieser Mann dir denn getan? Er hat nur seinen Job gemacht, und das gar nicht mal schlecht. Jetzt können wir ruhig schlafen, ohne Angst vor einem Atomkrieg haben zu müssen.“
Ameenas Antwort war nicht zu verstehen. Ich konnte nicht einmal erkennen, in welcher Sprache sie da redete.
„Sag mal, Ameena“, fuhr meine Mutter fort, „wen magst du eigentlich? Du magst weder Bush noch Clinton, du magst Reagan nicht, du magst nicht einmal Thatcher oder Major oder Blair. Du magst niemanden.“
„Ich mag Menschen“, sagte Ameena. „Das ist der springende Punkt.“
„Welche Menschen denn?“, sagte meine Mutter. „Saddam Hussein. Oder Osama Bin … „
Ameena stürmte nach oben, und ich saß alleine mit meiner Mutter da, die mich anblickte, als wollte sie sagen: „Das ist alles nur deine Schuld.“
Wir stritten uns die ganze Nacht, meine Frau und ich. Sie beschimpfte meine Mutter auf die schlimmste Weise, mit Wörtern, die ich nicht zu wiederholen wage. Ich verlor schließlich die Fassung.
„Sie ist meine Mutter“, sagte ich. „So kannst du nicht über sie reden.“
„Schau dich nur an, Ash“, sagte sie. „Du verteidigst sie - sie, die Mörder und Vergewaltiger verteidigt, und völkermörderische … „
„Was redest du denn da? Das ist meine Mutter. Wir müssen nicht einer Meinung mit ihr sein. So sind Eltern.“
„Aber du bist mit ihr einer Meinung, oder, Ash? Auch du denkst, dass Bush ‘ein guter Mann ist, der viel um die Ohren hat’.“
„Ameena, ich sagte doch schon, dass ich von Politik keine Ahnung habe.“
„Es geht nicht um das, was du weißt, Ashish, es geht darum, wer du bist. Und wenn du zu diesem Essen gehst und neben diesem Mann sitzt, sagt es einiges darüber aus, zu was für einem Menschen du inzwischen geworden bist.“
„Ich bin Akademiker, Ameena, und das hier ist nur irgendeine Universität. Wir müssen sowas machen. Es ist eigentlich sogar ein Privileg.“
„Privileg. Das bist du also, ein Verteidiger von Privilegien, genau wie General Scheißfranco.“
„Das ist der Spanier, nicht wahr?“
„Fahr zur Hölle, Ashish.“
„Meena, es tut mir leid. Ich will nur nicht, dass du dich mit Mama streitest.“
„Sie hat mich verdammtnochmal eine Terroristin genannt.“
„Sie war nur wütend. Ihr beide wart es. Überleg doch mal, wie du sie genannt hast.“
„Hier ist Schluss, Ash. Hier ist die Weggabelung. Du kannst zur Zeremonie gehen, aber wage es, diesem Abendessen auch nur nahezukommen, und mit unserer Ehe ist es aus. Mir ist egal, was du sonst machst.“
Ich schlief schlecht, doch am nächsten Morgen entschied ich mich, die Sache mit Ameena zu vergessen und an meine Schwester zu denken. Schließlich war das ihr Tag.
Die Zeremonie war goldig.
Meine Mutter weinte, und man umarmte und küsste sich und machte Fotos. Mala sah hübsch aus, und ich vermisste Ameena sogar und wünschte, sie wäre auch da. Und dann sah ich Bush.
Er kaute auf etwas herum, Tabak, kombinierte ich, und er hatte einen gelangweilten, aber, wie ich zugeben musste, machtvollen Gesichtsausdruck, als ob nichts seinen Willen beugen könnte, nicht einmal Pistolenkugeln. Ich fühlte, wie eine Epiphanie mir das Rückgrat hochkitzelte.
Ameena hatte allen Respekt vor mir verloren, weil ich unentschieden und zaudernd in meinen Meinungen war, oder keine Meinungen hatte, zu denen ich überhaupt hätte stehen können. Aber was zählte es am Ende, wo ich stand, solange ich nur wie ein Mann stand? Und wie stand eigentlich ein Mann? Genau wie der Expräsident hier vor mir, mit durchgedrückten Beinen, angespannten Muskeln und einem Kiefer wie ein Schraubstock. Er hatte den Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen, und ich würde das auch noch lernen.
Als die Zeremonie vorbei war, verschwand Mala mit ihren Freunden, und Mutter ging heim. Ich blieb. Da war ein Essen, an dem ich teilnehmen musste.
Mir wurde ein Büro zugewiesen, in dem ich mich umziehen konnte, und nachdem ich mich in meinen Smoking gezwängt hatte, mischte ich mich beim Prä-Empfangs-Empfang unter die Professoren. Es gab Champagner und Häppchen, die mir schmeckten, ich machte Steven Pinker am anderen Ende des Raumes aus und ging zu ihm. Er schätzt meine Analyse der Zeichensprache von Primaten sehr und schlug vor, ein Buch daraus zu machen, worauf ich lächelte und erklärte, dass „das Populäre nicht so mein Ding ist“. Danach redeten wir nicht mehr viel, was mich aber nicht störte. Der Ehrengast war eingetroffen, im Glanz seines silbernen Kummerbunds und präsidialer Manschettenknöpfe.
Ich wurde ihm, in einer Reihe stehend, vorgestellt, und wir plauderten kurz über mein Sachgebiet und die Stadtgeschichte. „Ja, ich kannte mal einen Linguisten“, sagte er. „Er war Cunnilinguist.“ Wir lachten beide, obwohl ich den Witz seltsam fand.
„Schätze, Ihre Frau mag das?“, setzte er einen drauf.
„Ja, jedenfalls liegt sie mir oft auf der Zunge.“
Bush schlug mir so hart auf den Rücken, dass ich meinen Drink verschüttete.
„Freut mich, dich kennenzulernen, Partner“, sagte Bush. „Wir hängen später noch ab, okay?“
„Alles klar, George“, antwortete ich und schüttelte ihm so viril wie möglich die Hand.
Wahrscheinlich war ich für ihn, der sonst von Schleimern umgeben war, so etwas wie eine frische Meeresbrise. Das erste Mal seit langem fühlte ich mich wichtig.
Ich saß mit einigen Physikern am Tisch und schlug mich ganz gut, machte ein paar fulminante Bemerkungen über die Wirkung von Mantras auf neuronale Zellenmuster, spielte die ethnische Karte, aber nicht zu stark (was immer am besten ist). Am meisten schmeichelte mir, als eine blonde Biologin mich darum bat, einen meiner Aufsätze zu signieren. Sie habe ihn extra mitgebracht, sagte sie.
Ich zwinkerte und schrieb: „In Liebe, Dein Cunnilinguist.“
Nun, ich hatte wirklich zu viel getrunken, aber sie wurde rot und gab mir ihre Nummer, die ich mir in den Kummerbund steckte.
Nach dem Essen hielt der Expräsident unter großem Applaus und ein paar Buhrufen seine Rede. Die Buhrufe steckte er locker weg. Jemand schrie, gerade als Bushs Fliege sich gelöst hatte und in seinen Teller fiel, dass Clinton der einzige echte Amerikaner in Washington gewesen sei.
„Jedenfalls wurde ich nie mit heruntergelassenen Hosen erwischt“, stichelte er, und die Menge röhrte ihre Zustimmung durch den Raum.
Als die Rede zu Ende war und Kaffee serviert wurde, schlängelte ich mich zu ihm durch. „Bescheuerter Zwischenrufer“, sagte ich. „Ein Mann in Ihrer Position muss sicherlich ständig auf der Hut sein.“
„Eigentlich kaum“, antwortete er. „Nachdem auf Reagan geschossen wurde, haben sie die Sicherheitsvorkehrungen derart verschärft, man glaubt es kaum. Die Hälfte der Leute hier sind Agenten.“
„Echt?“, sagte ich und überflog den Raum.
„Man sieht es nicht. Aber das sind Profis. Mach nur eine falsche Bewegung, und sie schießen dir zwischen die Augen, bevor du es überhaupt mitbekommst.“
Ich machte einen Witz, indem ich so tat, als würde ich ihn mit dem Teelöffel schlagen, und wir lachten beide schallend.
„Wo bist du her?“, fragte er.
Auf die Frage hatte ich gewartet.
„Nun, geboren bin ich hier, aber jetzt lebe ich in Ihrem Land.“
„Guter Mann“, sagte er. „Guter Mann. Solche wie dich brauchen wir.“
„Ja, ich mag es sehr dort“, begeisterte ich mich. „Ich lerne sogar Baseball.“
„Ich dachte, ihr Jungs mögt Cricket“, sagte Bush.
„Nee“, sagte ich (obwohl ich Cricket liebe). „Ich bin jetzt Amerikaner.“
„Schon mal in Texas gewesen?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Solltest du. Texas ist einzigartig. Schau dir mal diese Stiefel an.“ Ich sah sie an. Er war gekleidet wie Clint Eastwood. „Die sind gegen Schlangen. Deshalb sind sie so hochgeschnitten. Ich geh nie ohne sie raus.“
Und dann lud mich George Bush nach Texas ein. Er würde mir ein Flugzeug vorbeischicken, sagte er. Ich war so überrascht, dass mir keine Antwort einfiel.
„Bah, der Kaffee ist Mist“, sagte Bush. „Lass uns Bourbon trinken, oder etwas von dem Scotch, für den ihr Jungs so berühmt seid.“
Ich ging los, um eine Flasche zu suchen, aber als ich zurückkam, war George Bush gerade im Begriff aufzubrechen.
„Ich muss heute Abend in Edinburgh sein“, sagte er. „Wollte selbst hinfahren, aber die Security lässt mich nicht. Also werde ich mich jetzt hier verpissen und es trotzdem machen. Scheiß auf sie. Alt werden wir früh genug.“
„Sie sagen es“, sagte ich.
„Alle halten mich für so langweilig, weißt du. Alter Mann, der Bush. Humorloser Grantler. Aber das ist nur PR. Das bin ich gar nicht.“
„Glaub ich sofort.“
„Scheiß auf all das“, sagte Bush. „Willst du mitkommen? Ich fahre dich nach Hause, und wir nehmen einen Absacker im Wagen.“
„Das wäre toll“, antwortete ich und konnte meinen Ohren kaum trauen. Zusammen verdrückten wir uns in eine Ecke.
Für einen alten Mann war Bush erstaunlich flink. Und auch sehr stark, sein Arm schloss sich um meinen Bizeps wie ein Schraubstock, und ich stellte mir vor, wie er zuhause auf seiner Farm mit Büffeln rang. Im nächsten Augenblick waren wir durch die Tür und rannten über den Korridor, lachten wie Schuljungen. Wir hörten schreiende Männer hinter uns herrennen, aber wir liefen weiter die Treppen hinab, den Notausgang hinaus in die Nacht.
Bush führte mich in eine Tiefgarage, die mir noch nie aufgefallen war.
„Für VIPs“, sagte er, schloss seinen Mercedes auf und warf den Whiskey auf den Vordersitz.
Als wir losfuhren, sahen wir, wie zwei Agenten auf den Wagen zuliefen. Ich warf ihnen eine Kusshand zu.
Wir wählten die lange Route zum Haus meiner Mutter, so dass wir mehr Zeit für den Whiskey hatten. Auf der Autobahn schmissen wir die Gläser aus dem Fenster und ließen die Flasche hin- und herwandern. Bush riss ein paar Zoten, und wir sangen zu Bruce Springsteen, der im Radio lief.
„Born in the USA!“, sang Bush.
„Born in the USA!“, echote ich.
„Hey“, sagte ich betrunken, „ist das Lied nicht eigentlich irgendwie gegen euch?“
„Und wenn schon“, sagte Bush. „Das hat mein Sohn mal wieder nicht kapiert. Wenn man nämlich gegen uns ist, ist man trotzdem für uns, weil man schlicht keine andere Wahl hat, und das, mein Freund, ist Politik.“
„Politik, ja sicher“, sagte ich. „Erzähl das mal meiner Frau.“
„Frauen. Deren Vorstellung von Politik ist das hier.“
Mit diesen Worten holte Bush seinen Penis heraus und ließ ihn vor mir herumbaumeln.
„Alles klar“, sagte ich und tat es ihm nach.
„Schöner Pimmel, Alter“, sagte Bush.
„Deiner auch, George.“
Wir tranken und sangen, bis die Flasche leer war und in einem Feld landete. Dann hielt er den Wagen vor dem Haus meiner Mutter an.
„Also“, sagte ich, „das war großartig. Wir sehen uns in Texas wieder, Kumpel. Du hast meine Nummer.“
„Ja, klar“, sagte Bush. „Ich ruf dich an. Jetzt geh da rein und zeig deiner Frau, was Politik ist.“
„Mach ich, und danke fürs Fahren.“
„Kein Ding“, sagte Bush. „Aber hey, könnte ich vielleicht kurz eure Toilette benutzen? Muss ‘ne Menge Scotch loswerden.“
„O je, weiß nicht“, sagte ich. „Meine Frau ist nicht gerade dein größter Fan.“
„Ja, und?“, sagte Bush. „Wir sind Cowboys, Alter. Rodeostyle. Gib ihr die Sporen, reite die Kuh.“
„Okay“, sagte ich. „Hast recht. Komm mit.“
Wir gingen rein. Ameena war sicher eh im Bett, dachte ich.
Meine Mutter wartete in der Küche auf mich.
„Du hast doch nicht getrunken, oder, Ashish? Oh …“
„Mama“, sagte ich. „Das ist George Bush, aus Amerika.“
„Sehr angenehm, Mister Bush“, sagte Mutter.
„Nennen Sie mich einfach George“, sagte Bush.
„Darf ich Ihnen einen Tee anbieten?“
„Das wäre schön, Lady. Einfach nur schön wäre das.“
„Ich setz welchen auf.“
„Das Badezimmer ist oben“, sagte ich.
„Ashish!“, sagte Mutter, nachdem er weg war. „Bist du jetzt völlig bekloppt?“
„Ich dachte, du freust dich, Mama. Ich habe ihn mitgebracht, damit du ihn kennenlernen kannst.“
Mutter sah kurz froh aus, wurde aber sofort wieder ernst.
„Und was ist mit Ameena, Ashish. Mit mir hat sie heute Nachmittag Frieden geschlossen, mit dir aber ist sie noch längst nicht im Reinen. Ich habe ihr gesagt, sie solle vergeben und vergessen, aber ich weiß nicht, wie sie das hier je vergessen soll.“
„Wo ist sie?“
„Im Schlafzimmer. Schau nach ihr, und dann werd ihn schnell los, sonst verzeiht sie dir nie.“
„Okay“, sagte ich und ging nach oben.
Bush hatte Stiefel und Gürtel im Schlafzimmer abgelegt und lag auf meiner Frau. Er presste ihr ein Taschentuch auf den Mund.
„Scheiße, was machst du denn da“, schrie ich.
„Immer mit der Ruhe, Partner.“
Zwei Hanteln lagen auf dem Boden. Ich hob eine auf und schmetterte sie gegen den Kopf des Expräsidenten. Sie schien einfach abzuprallen, also schlug ich nochmals zu. Sie brach entzwei, aber immerhin hielt er jetzt inne und blickte zu mir herauf.
„Runter von meiner Frau“, sagte ich.
„Moses und Jesus auf der Arche, ey. Jetzt bleib mal geschmeidig, Freundchen.“
„Runter da!“
„Okay, okay. Halt die Bälle flach.“
Bush zog seine Hose hoch und ging nach unten. Ameena war bewusstlos. Ich streichelte ihre Hand und wählte den Notruf. Ich sagte ihnen nicht, wer der Eindringling war, nur dass er gefährlich und ein Vergewaltiger sei.
Danach fiel mir ein, dass ich meine Mutter alleine gelassen hatte, und stürmte nach unten. In der Küche war niemand. Ich wurde panisch und stürzte ins Wohnzimmer.
George Bush saß auf dem Sofa, trank Tee und weinte. Meine Mutter hielt ihn in den Armen.
„Armes Ding“, sagte sie. „Muss dringend in Therapie.“
„Ein Tier ist das!“, schrie ich. „Ins Gefängnis muss er, das ist alles, wo er hin muss, verdammte Scheiße!“
„Ashish, nicht in diesem Ton“, sagte Mutter.
„Ameena hat recht gehabt. Du bist nichts als ein Verbrecher und Mörder, George. Ein Verbrecher gegen alle Menschlichkeit.“
„Ein Verbrecher?“, sagte Bush. „Nenn mir ein Verbrechen, das ich begangen habe. Nur eines.“
„Granada“, sagte ich, Chomsky im Hinterkopf. „Tausende hast du ermordet.“
„Das war Reagan“, sagte Bush.
„Was wir nicht wissen, sollten wir nicht verurteilen“, sagte Mutter.
„Weißt du, was euer Problem ist?“, sagte Bush. „Ihr Typen lasst die Vergangenheit nie ruhen. Was wollt ihr denn? Wollt ihr, dass ich die Schwarzen wieder zum Leben erwecke? Sie sind tot, Mann. Lass einfach los.“




























