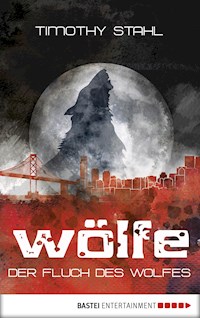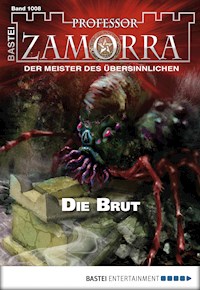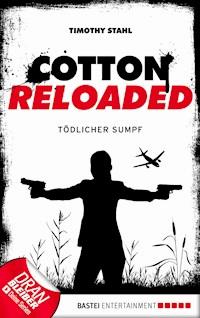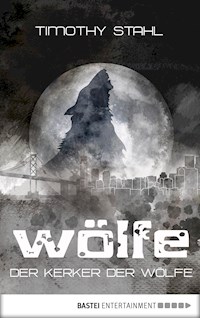1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Professor Zamorra
- Sprache: Deutsch
Halloween - die Nacht, in der die Kinder von Haus zu Haus ziehen, Süßigkeiten erbetteln oder üble Streiche spielen.
Halloween ist aber auch die Nacht der Geister und Dämonen.
Als Zamorra in einer solchen Nacht aus dem Fenster seines Schlosses schaut, glaubt er draußen etwas zu spüren, eine Gefahr. Aber er entdeckt nichts, und das Amulett, das sich kurz erwärmt zu haben schien, beruhigt sich wieder.
Da sieht er eine Gestalt unten am Tor. Draußen steht, gruselig verkleidet, ein einzelnes Kind und bittet um etwas Süßes - oder Saures.
Was er nicht ahnt: dass der Schrecken dieser Nacht ihn viele Jahre später wieder einholen wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Impressum
Geboren an Halloween
Leserseite
Vorschau
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige eBook-Ausgabe der beim Bastei Verlag erschienenen Romanheftausgabe
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
© 2018 by Bastei Lübbe AG, Köln
Programmleiterin Romanhefte: Ute Müller
Verantwortlich für den Inhalt
Titelbild: Timo Kümmel
Datenkonvertierung eBook: Blickpunkt Werbe- und Verlagsgesellschaft mbH, Satzstudio Potsdam
ISBN 978-3-7325-7109-3
www.bastei-entertainment.de
Geboren an Halloween
von Timothy Stahl
»Still, Kind! Sei doch still, bitte, sonst kriegen sie uns …«, wisperte die Frau. Der Atem wehte ihr im Laufen von den Lippen und wurde eins mit dem Herbstnebel, der in dieser Halloween-Nacht über allem hing – über dem Pfad und den Bäumen des Waldes zu beiden Seiten, bis hoch zum Schloss, das auf dem Hügel thronte.
»Nicht weinen«, flehte die Frau erneut, und ihr Blick flog voll Furcht nach hinten. »Bitte nicht weinen!«
Und tatsächlich verstummte das Kind, das die keuchende Frau im Arm und an ihre Brust gedrückt trug. Das kleine Gesicht war längst nicht mehr runzlig wie bei der Geburt vor nun einem Jahr, sondern zart und hübsch. Die Augen blickten auf, groß und rund, und der winzige Mund verzog sich …
Der Mund verzog sich nun zu einem Lächeln und dann zum Lachen … als lache das Kind über die fliehende Frau, die da glaubte, die anderen würden sie letzten Endes nicht doch kriegen. Oder die das wenigstens hoffte – mit all der Kraft einer verzweifelten Mutter.
Die Frau sah zum Schloss hinauf. Mal verschwand es, dann tauchte es wieder auf zwischen den Wipfeln der Bäume, um die der Nebel hing und wogte wie die Gespinste einer Unzahl von Spinnen. Das Schloss, es schien nicht größer zu werden, nicht näher zu rücken. Der Weg schlängelte sich in Kehren durch den Wald und den Hügel empor, anstatt in halbwegs gerader Linie seinem Ziel entgegenzuführen. Die Steigung wäre zu steil gewesen, der Aufstieg zu mühsam, die Anfahrt kaum möglich.
Aber vielleicht galten in dieser besonderen Nacht heute auch andere Gesetze, nicht einfach nur die anerkannten der Natur. Es mochten Mächte wirken, die die von Wissenschaftlern festgeschriebenen Regeln heute Nacht außer Kraft zu setzen verstanden.
Ein Blick zum Schloss hoch konnte den Verdacht durchaus bestärken. Hinter dem Bauwerk mit seinen zwei Türmen strahlte der volle Mond beinah hell wie eine Sonne, die das Firmament zu entflammen schien. Als setzten die fast vergessenen Götzen, denen in dieser Nacht des Jahres einst gehuldigt wurde, alles daran, um die Grenze zwischen dieser und der jenseitigen Welt niederzubrennen und herüberzukommen. Wie früher …
Ein Lachen im Dunkeln ließ die Frau mit dem Kind in den Armen zusammenzucken. Als würden ihre Gedanken gelesen und für Amüsement sorgen.
Sie schaute nach hinten, gehetzt wie ein Reh, dem der Wolf auf den Fersen war.
Sie machte ihre Verfolger nicht aus. Weil sie sich am Rand des Gesichtsfelds zu bewegen wussten, auf der feinen Grenze zwischen hell und dunkel, zwischen dem, was man gerade noch sah, und dem, wo der Blick nicht mehr hinreichte.
Aber da waren sie. Und hinter ihr her waren sie. Hinter ihr – und vor allem dem Kind, das nicht mehr ihres sein sollte, das sie ihr wegnehmen wollten, weil sie …
Die Frau schluchzte erstickt auf.
Weil sie Ja gesagt hatte!
Wieder ein Blick zurück. War es nur Nebel, was sie da sah – oder der Atem ihrer Verfolger, der aus dem Dunkeln drang, hinter dem sie sich verbargen?
Die Frau schlug einen Haken, wich vom Weg ab und tauchte ein in den Wald.
Aber im Wald, da waren sie auch. Im Wald waren sie erst recht! Der Wald war ihr Tempel. Ihr Heiligtum. Ihre Welt. Ihr Reich. Hier wohnten sie, hier waren sie, überall, in jedem Schatten, hinter jedem Baum, unter jeder Wurzel. Das hatten sie ihr gepredigt, aber sie hatte … was? Hatte sie es nicht geglaubt? Weil sie nicht dazugehörte? Keine von ihnen war?
Es war egal. Zu spät.
Zweige und trockenes Herbstlaub flüsterten unter den Füßen der Frau. Sie hörte, wie ihre Schritte langsamer wurden, ohne dass sie es wirklich wollte oder die Kraft sie verlassen hätte. Ihre Kraft hätte noch gereicht, um bis zum Schloss hinaufzukommen …
Aber es kam nur ihr Blick noch bis dort hinauf.
Als sie eine Lichtung erreichte, hatte sie ein letztes Mal freie Sicht zum Schloss auf dem Hügel. Jetzt kam es ihr größer vor, war sie ihm endlich näher gekommen, auch wenn es noch nicht zum Greifen nahe lag …
Ihr Augenmerk wurde abgelenkt.
Etwas rollte vom gegenüberliegenden dunklen Waldrand her auf die im Mondlicht liegende Lichtung.
Ein Kinderwagen, wie von Geisterhand geschoben, auf großen, dünnen Rädern leise quietschend, sachte schaukelnd. Das Innere leer und schwarz wie ein Maul, das aufklaffte und hungrig war …
Die Frau presste das immer noch stumme Kind, das schwarzhaarig war wie sein Vater, fest an sich. Als könnte sie es wieder eins werden lassen mit ihrem schützenden Mutterleib.
Eine Bewegung. Droben auf dem Hügel, hinter einem der erleuchten Schlossfenster. Eine Gestalt, ein Mann zeichnete sich im Licht ab wie ein Scherenschnitt. Er schien von dort oben herabzuschauen. Als suche er nach irgendetwas, vielleicht ohne zu wissen, wonach er eigentlich Ausschau hielt.
Die Frau glaubte seinen Blick auf sich zuwandern zu spüren. Als käme der Mann selbst näher. Sie sah zu ihm hinauf. Gleich mussten ihre Blicke sich kreuzen, wie die Lichtkegel von Lampen in den Händen zweier Menschen, die sich suchten und gleich gefunden haben würden …
Und dann war es vorbei.
Dunkelheit spannte sich wie ein plötzlich geöffneter Schirm über die Lichtung und sperrte alles aus – sämtliches Licht, jeden Blick und alle Magie …
***
Der Vampir stand am Fenster seines Schlosses, sah bohrenden Blickes hinaus, den Hügel hinab, fasste sich an die Brust seines blütenweißen Rüschenhemds und machte: »Hm.«
»Monsieur?«, fragte hinter ihm sein alter Diener, der in der Halle zugange war, wie stets korrekt livriert. Nur ungewöhnlich blass war er heute Abend. Totenbleich. Oder vielmehr: kreideweiß.
»Alles in Ordnung?«, hakte der Diener nach, als sein Herr nicht reagierte.
»Wie? Ja, ja, es … scheint so.« Der Mann am Fenster, das Haar glatt nach hinten gestriegelt, nahm die Finger von der Brust und winkte ab. »Ich dachte nur, ich hätte etwas gespürt, aber …«
»Aber?« Der Diener blickte bezeichnend auf die weiße Hemdbrust seines Herrn.
»Nichts, mein Lieber.«
»Es ist eine besondere Nacht«, gab der Diener zu bedenken und warf selbst einen Blick zum Fenster hinaus. Der Mond stand ungewöhnlich hell am Himmel, und sein Licht schien heute nicht silbern, sondern fast rötlich, als brannte das Firmament – oder etwas dahinter.
»Ich glaubte, da unten etwas gesehen zu haben«, sagte der Schlossherr. »Auf der Lichtung dort.«
Der Diener wusste, von welcher Lichtung sein Herr sprach. Er kannte die Aussicht aus jedem Fenster des Schlosses seit langer, langer Zeit. Aber jetzt konnte er die Lichtung nicht sehen. Seltsam, wo die Nacht doch so hell war. Es schien, als spannte sich ein schwarzer Schirm über die baumlose Stelle mitten im Wald.
Aber wenn sein Herr nichts spürte, dann war da gewiss auch nichts. Kein Grund zur Sorge jedenfalls. Und dies war nun einmal eine Nacht, jene Nacht des Jahres, in der ungewöhnliche Dinge geschahen und Geister umgingen. Aber nicht alles Ungewöhnliche und nicht jeder Geist bedeutete gleich etwas Schlimmes.
Schlimm fand der Diener etwas anderes …
Er seufzte. »Mit Verlaub, Monsieur, ich komme mir etwas albern vor. Und wenn Sie gestatten – Sie sehen auch recht lächerlich aus.«
Der Vampir musterte seine Erscheinung im Glas der Fensterscheibe. Dann fuhr er herum, so heftig, dass sein blutrot gefütterter Umhang wehte.
»Also, ich finde, ich sehe echt aus«, sagte er und setzte eine Miene auf, als wäre ihm jetzt auch das Blut des alten Dieners gut genug.
»In den Augen derer, in denen auch Monsieur Lee als Dracula aussieht wie ein echter Vampir, mögen Sie ja echt wirken«, erwiderte der Diener. »Aber wir wissen es doch besser, Monsieur.« Wieder seufzte er. »Leider …«
»Sie wollen mir partout den Spaß verderben, nicht wahr?«
»Ich finde, gerade wir sollten mit derlei Dingen keinen Schabernack treiben, Monsieur.«
»Gerade wir müssen mit derlei Dingen auch einmal Schabernack treiben, um nicht am Ernst dieser Dinge zu zerbrechen.«
»Wie Sie meinen, Monsieur.« Der Diener sah zu der monströsen Standuhr in der Ecke hin. »Aber ich glaube nicht, dass heute noch jemand kommt. Wenn Sie erlauben, würde ich mich gern …«
»Ein Stündchen noch«, bat ihn sein Herr und wies mit einer Geste und einem Blick die Treppe hoch. »Mein lieber Schatz ist noch gar nicht fertig und wäre doch sehr enttäuscht, wenn wir alles abblasen würden, bevor sie auch nur ihren Auftritt hatte …«
Es klopfte, kräftig und laut. Dreimal. Wie Donner rollte es durch die heute Nacht nur von Kerzen erhellte Eingangshalle. Zugleich begann die Standuhr zu schlagen.
Der Diener sah seinen Herrn fragend an.
»Nun öffnen Sie schon.« Der Vampir scheuchte den bleichen Butler zur Tür und folgte ihm.
Von oben tönte es: »Ich komme schon!«, und eine Frau in fluoreszierendem Weiß schwebte gleichsam die Treppe herab.
Der Diener öffnete einen der schweren Türflügel. Das alte Holz knarrte, die trockenen Scharniere verlangten jammernd nach Öl. Ein kalter Wind säuselte herein. Nebel wallte draußen um die Mauern und über den Hof.
Vor der Tür stand ein Werwolf.
»Farce ou friandise«, knurrte er, ein kleiner Vertreter seiner Art. Da hatte man hier schon größere gesehen …
»Und?«, sagte der Diener, als weiter nichts kam und das Wölfchen ihm mit der haarigen kleinen Pfote einen Jutesack hinhielt.
»Was denn noch?« Er schüttelte den Sack und wiederholte mit Nachdruck: »Farce ou friandise! Trick or treat! Süßes oder Saures!«
»Na«, meinte der Vampir, der an allen anderen Tagen des Jahres ein Professor namens Zamorra war, »international beschlagen ist er jedenfalls, unser kleiner Freund.«
»Aber Manieren hat er keine«, sagte Raffael Bois, der auch an allen anderen Tagen des Jahres der Schlossdiener, aber nicht angehalten war, sich mit Kreide weiß wie ein Toter zu schminken und einfach nur im übertragenen Sinn der gute Geist von Château Montagne sein durfte.
»S’il-vous-plaît«, begriff der kleine Wolf endlich, worauf der alte Diener hinauswollte. »Süßes oder Saures, bitte.«
»Na also, geht doch.« Raffael bleckte grinsend seine teils schwarz gefärbten Zähne und langte in den großen, mit Süßigkeiten gefüllten Korb, der neben der Tür stand, und packte dem fantasievoll kostümierten Jungen aus dem Dorf drunten den Jutebeutel voll. Die Augen hinter der haarigen Maske mit dem zähnestarrenden Maul leuchteten.
»Merci«, sagte er. »Der Weg hier hoch hat sich gelohnt.«
»Schick noch ein paar von deinen Freunden herauf«, bat Zamorra. »Es soll ihr Schaden nicht sein.«
Der Junge winkte im Davongehen. »Die trauen sich nicht.«
»Wir beißen doch nicht!«, rief die Weiße Frau, die nun ebenfalls mit an der Tür stand.
»Sie vielleicht nicht«, erwiderte der Junge, ohne sich umzudrehen, »aber liegt hinter dem Château nicht eine Vampirin begraben?«
»Aber die ist doch tot!«
Der Junge lachte. »Das sagen sie alle.«
Dann verschluckte ihn der Nebel, und Raffael schloss die Tür.
Jetzt seufzten sie alle drei, der Diener, der Schlossherr und die Weiße Frau, die an allen anderen Tagen des Jahres Zamorras Partnerin und Assistentin Nicole Duval war. Und alle drei blickten sie auf den Korb mit Süßigkeiten. Außer dem kleinen Werwolf war niemand gekommen, um sich etwas davon zu holen.
»Was machen wir jetzt damit?«, fragte Zamorra.
»Wir fahren morgen ins Dorf hinunter und verteilen es nach der Schule an die Kinder«, erklärte Nicole und zog sich die Perücke aus künstlichen Spinnweben vom Kopf.
»Wie jedes Jahr«, unkte Raffael. »Amerikanischer Humbug!«
»Halloween ist keine amerikanische Erfindung«, entgegnete Nicole belehrend. »Schon die alten Kelten …«
»… feierten Samhain«, musste Zamorra seiner Gefährtin in die Parade fahren. »Und Samhain ist möglicherweise ein Vorläufer dessen, was heute Halloween genannt wird. Vielleicht aber auch nicht. Darüber streiten sich nicht nur die Gelehrten.«
»Na, egal«, meinte Nicole. »Für mich ist Halloween jedenfalls eine gute Gelegenheit, um mir einen Vampir ins Bett zu holen. Komm mit. Du musst mir aus der aufwendigen Maskerade heraushelfen.« Mit raschelndem Kostüm rauschte sie die Treppe hinauf, Zamorra stapfte hinterher. »Gute Nacht, Raffael!«
»Gute Nacht, Mademoiselle, Monsieur«, wünschte der alte Diener und machte sich daran, die in ausgehöhlten Kürbissen brennenden Kerzen auszublasen.
»Dieser alberne sogenannte Feiertag wird sich hierzulande nicht durchsetzen«, murmelte er und musste niesen, als sich Kreidestaub von seinem Gesicht löste und ihm in die Nase stieg.
»Gesundheit, Raffael!«, rief es von oben.
Er blies die letzten Kerzen aus.
»Halloween in Frankreich«, brummelte Raffael Bois und zog sich auf sein Zimmer zurück. »Pah! Nicht zu meinen Lebzeiten.«
Womit er recht behalten sollte, der alte Diener.
Denn all das war nun schon fünfzehn Jahre her …
***
Heute.
Barbaren waren sie, allesamt!
Herve Plouyann wieselte auf seinen kurzen Beinen durch Creux d’Urban. Hindurch zwischen blutverschmierten Zombies, bleichen Vampiren, haarigen Monstern. Und auf den Armen trug er, behutsam an sich gedrückt, die sterbende Katze.
»Seht euch den an!«, rief jemand.
Und ein anderer: »Wow, sieht ganz schön echt aus, das Viech!«
»Soll das lustig sein?«, fragte ein Mädchen und klang verstört.
»Na ja, ›lustig‹ ist für mich was anderes«, wurde ihr geantwortet.
»Und wie das stinkt!« Eine Frau mit klaffender Halswunde hielt sich die Nase zu. »Hast du das gerochen?«, fragte sie den Henker, der neben ihr ging, ein blutiges Beil geschultert.
Herve Plouyann rempelte sie beide zur Seite, unwirsch und wütend. Aber recht hatten sie ja. Er hielt den Gestank von verbranntem Fell und Fleisch selbst kaum noch aus. Der beißende Geruch steckte ihm in der Nase, und seine Jacke, die er über das brennende Tier geworfen hatte, um das Feuer zu ersticken, und in die er es nun eingewickelt vor sich hertrug, würde er wegschmeißen müssen. Der Gestank würde jedem Reinigungsversuch widerstehen.
Aber, bei den Göttern, seine blöde Jacke scherte ihn nun wirklich am allerwenigsten!
Das arme Tier …
Barbaren!
»Ich beeil mich, ich beeil mich«, flüsterte Herve der Katze zu, die mit trüben, vielleicht blinden Augen ins Nichts schaute, aber irgendetwas zu suchen schien. Aus irgendeinem Grund vergeudete das schrecklich verwundete Tier seine letzten Kräfte damit, mühsam den Kopf zu drehen und kläglich zu maunzen.
»Sei doch still«, keuchte Herve. »Ganz ruhig, wir sind bald da.«
Das schnelle Laufen strengte ihn an. Zwar ging er viel zu Fuß und fuhr oft mit dem Rad, aber nie hatte er es dabei so eilig. Jeder im Ort kannte ihn nur, wie er gemütlich durchs Städtchen spazierte, Augen und Ohren immer aufgesperrt, stets nach etwas Neuem Alten, das ihm bislang entgangen war, Ausschau haltend und horchend – ein Symbol etwa, das in eine der alten Mauern von Creux d’Urban geritzt war, ein Stein, der aus einer bestimmten Perspektive ein Wegweiser sein mochte, der Wind, der um Ecken heulte und ein Lied sang, dessen Worte man verstehen konnte, wenn man genau hinhörte … und die Sprache kannte.
Heute jedoch, an diesem Abend, hatte Herve Plouyann für all das nichts übrig. Zeit war jetzt das A und O. Es kam auf jede Minute an, vielleicht sogar auf jede Sekunde.
Und vielleicht war es schon zu spät …
»Barbaren!«, schnaufte Herve.
Sie hatten die Katze angezündet! Sie, irgendjemand … weiß der Teufel, wer und warum! Ja, der Teufel, der mochte es wissen. Der hatte sie dazu getrieben. Das würden sie jedenfalls behaupten. Oder irgendetwas ähnlich Unsinniges!
Halloween …
Herve spuckte aus.
Er hasste das Fest. Und er hasste, was Halloween aus Creux d’Urban in den vergangenen Jahren gemacht hatte. Mit jedem Mal war es schlimmer geworden. Und längst beschränkte es sich nicht mehr auf den einen Tag, die eine Nacht. Der verfluchte Zirkus begann am 1. Oktober und dauerte den ganzen Monat! Inzwischen hatte das Treiben Ausmaße angenommen, das Tausende von Besuchern nicht nur aus ganz Frankreich in das sonst so beschauliche Städtchen Creux d’Urban lockte. Und viele der zweieinhalbtausend Einwohner waren auf diesen Zug aufgesprungen, den der neue Bürgermeister vor nunmehr zehn Jahren in Gang gesetzt hatte. Der neue Bürgermeister – ein Amerikaner. Natürlich! Ein Unding schon an sich, ein Ami, der in Frankreich Bürgermeister wurde. Aber, genau genommen, war Richard Demorand auch nicht wirklich Bürgermeister von Creux d’Urban geworden – eigentlich hatte er die kleine Stadt gekauft.
Demorand, der Sohn französischer Auswanderer in x-ter Generation und Sprössling einer inzwischen wohlhabenden amerikanischen Familie, musste sich gelangweilt haben, weil sein Vermögen sich unterdessen von selbst vermehrte. So war er auf den Geschmack gekommen, ins Land seiner Vorväter zurückzukehren und, das wollte Herve ihm gar nicht absprechen, dort etwas Gutes tun mit dem Geld, das er zu viel hatte. Dieser Schuss jedoch war nach hinten losgegangen!
Richard Demorand hatte in Creux d’Urban in alles Mögliche investiert und die eigentlich schon nicht mehr nur verträumt schlummernde, sondern komatös vor sich hinvegetierende kleine Stadt mit Geldspritzen neu vitalisiert. Er hatte den alten Ort aufgemöbelt und die Leute für sich gewonnen. Sie liebten den Heimkehrer Demorand, die meisten jedenfalls – oder wenigstens genug von ihnen, dass es reichte, um ihn zum Bürgermeister zu wählen, nachdem er sich vorher in Windeseile praktisch zum politischen Ziehsohn seines Vorgängers gemacht hatte.