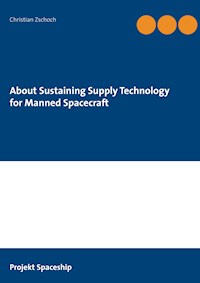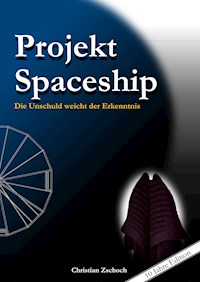
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lilli liebt ihre Unabhängigkeit und sehnt sich dennoch nach Zweisamkeit. Auch Franz Hansen tut dies, jedoch auf eine sehr viel tragischere Weise! Erfahren Sie von einer emotionalen Begegnung, einer Flucht von der Erde und dem Willen zur Unsterblichkeit. Doch Sie erwartet noch mehr. Lesen Sie mit diesem Werk auch gleichzeitig die wissenschaftliche Betrachtung einer nachhaltigen Raumschiffkonstruktion mit zahlreichen konzeptionellen Designideen, die auch Sie Teil dieser Geschichte werden lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Die Reise zu Gliese 581
Flucht in die Einsamkeit
Leben und leben lassen
Die Unschuld weicht der Erkenntnis
Momente der nahenden Freigabe
Eine Ankunft unter vielen
Zur nachhaltigen Versorgungstechnologie bemannter Raumflugkörper
Vorwort
Anspruch der vorgestellten Arbeit
Die Mikrobiologie als entscheidender Faktor für eine organisch integrierte Raumschiffkonzeption
Äußere und innere Struktur eines autarken Raumfahrzeuges
Systeme zur Lebenserhaltung
Systeme zur Energieversorgung und der organischen Stoffverarbeitung
Vereinfachte Apparaturen zur Elektromechanik, Raumnavigation sowie zum Raumschiffantrieb
On Board Software
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Über dieses Buch
Dieses Buch soll helfen, Unbekanntes zu verstehen und die vergangenen und die noch kommenden Ereignisse festzuhalten. Das Universum in seiner Unendlichkeit ist angefüllt mit Geheimnissen und Wundern, von deren Existenz niemand etwas weiß. Sie zu entdecken und zu studieren, wird jeden von uns in der Geschichte verewigen.
Das Ziel des hier vorgestellten Werkes ist es, alternative Technologien für ein neuartiges Raumschiff in einem Konzept zusammenzufassen. Diese Inhalte sollen künftigen Raumfahrtkonstrukteuren dienen, welche diese technischen Lösungen verwenden mögen. Deshalb wird sein Inhalt auch regelmäßig ergänzt, um auch Neuerungen darin einfließen zu lassen. Das Feedback von Lesern der ersten Auflage dieses Buches ließ erkennen, dass das Interesse an fachlichen Themen und der erzählten Geschichte eines beispielhaft realisierten Raumschiffes dieser Art unterschiedlich gewichtet ist. Ich möchte diesem Umstand Rechnung tragen und habe deshalb in dieser Fassung die wissenschaftliche Abhandlung von der Abenteuergeschichte getrennt und letztere lediglich mit Verweisen zur technischen Grundlage versehen.
All diese Inhalte konnte ich mir während der vergangenen Jahre selbst erarbeiten, ein Geschenk jedoch waren die vielen guten Gespräche zu diesen Themen mit meiner Frau Julia, der ich sehr dankbar bin für ihre Geduld und ihre Inspiration. Dieses Kapitel meines Lebens widme ich daher ihr.
Es folgt nun im Anschluss die überarbeitete und fortgeführte Geschichte des Franz Hansen. Auch dieses Mal wird unser fiktiver Held auf seiner Reise zu einem benachbarten Sonnensystem mit Herausforderungen zu tun haben, die für ihn ebenso unerwartet sein werden, wie für den Leser.
Haben Sie eigene Ideen zur Umsetzung und können einen inhaltlichen Beitrag leisten? Dann nutzen Sie die Möglichkeit sich über den aktuellen Entwicklungsstand zu informieren oder eine E-Mail zu senden! Werden Sie Teil dieses Projektes, und helfen Sie, das Know-How für ein privates Raumschiff zu sammeln:
www.Projekt-Spaceship.de E-Mail: [email protected]
Christian Zschoch
Geschichtlicher Teil
Die Reise zu Gliese 581
1-8 Raumschiffsegmente
Navigationsraum
Wohnraum
Zentraltunnel
Längstunnel
Bioreaktoren
Gastanks
Pflanzregale
Material-Collection-Bay
Antennen
Nährlösungspumpe
Antriebe
Flucht in die Einsamkeit
Der Gedanke etwas Bleibendes auszuschicken, das über alle Zeit hinaus besteht, ist in unserem Fall nicht nur ein Ziel, sondern selbst Teil der Botschaft an das Universum. Zusammen mit aller Information, die das Wesen des Menschen ausmacht, kann nicht nur jeder diese Nachricht senden, sondern auch selbst Teil ihrer Botschaft werden.
Wenn man sich fragt, was denn der Unterschied ist, zwischen all der leblosen Materie und uns, den Lebewesen, dann ist es die Seele, die uns zu dem erhebt was wir sind. Sie ist Gast in unserem Körper, und Sie ist es, was übrig bleibt, wenn wir das Leben, wie wir es kennen, beenden. Was sich dabei von unserem Körper trennt, wird oftmals als Geist bezeichnet, entspricht aber eher einem Seelenwesen.
Es ist eine neue Welt, in die man sich begibt. Alles, was wir mitnehmen können von der Erde, sind unser Wissen und unsere Erfahrung, die untrennbar in unserer Seele verankert sind. Der Tod ist somit der Einstieg in ein Paradies, welches das ganze Universum umfasst. In einem Zustand, der am besten mit einem „denkenden Energiegemisch“ umschrieben werden kann, gibt es keine räumlichen Grenzen mehr. Geschwindigkeiten im Bereich der Lichtgeschwindigkeit ermöglichen es, sich von der Zeit befreit an jeden beliebigen Ort des Universums zu begeben.
Man wird alte Freunde, die man vor langer Zeit verloren glaubte, wiedersehen, sich mit ihnen verständigen und gemeinsam neue Wege beschreiten. Zwischen den Seelenwesen gibt es äußerlich keine Unterschiede, so dass jeder als das zählt, was er ist. Auch in anderen Welten entstehen solche Seelenwesen, und so entsteht eine große allübergreifende Gemeinschaft.
Sich in dieser Gemeinschaft zurechtzufinden, sich in ihr zu integrieren und daraus ein harmonisches und interessantes Dasein zu erlangen, das ist das Ziel unseres Handelns hier auf der Erde.
Leben bewahren, Neues entdecken, Freunde gewinnen und Liebe verehren!
1
Navigationsraum der Merania, 25. Oktober 2016
Es ist 20:32 Uhr und geradezu verblüffend, wie schnell es um diese Jahreszeit dunkel wird. Die Abende waren noch vor einigen Wochen bis 22 Uhr so hell, dass man ohne Licht im Garten sitzen konnte. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, zuvor noch einmal den blauen Himmel und den schönen roten Lichtschimmer zu betrachten, der abends im Herbst bei Sonnenuntergang auftritt. Doch Kapitän Franz Hansen vergaß dies letztendlich aus lauter Aufregung, als er vor weniger als zwei Stunden die drei Stufen bis zur Luke des Schiffes erstieg und damit für immer verschwand.
Der Höhenmesser zeigte bereits über 1.000 Meter, das rauschende Geräusch der vier Antriebe lag überall in der Luft, und wenn das jetzt nicht so ein verdammt wichtiger Moment wäre, wäre er wohl eingeschlafen. Aber warum auch nicht? Die kommenden 30 Jahre würde er sowieso nicht viel erleben, und da könnten ein paar Minuten Schlaf eigentlich nichts mehr ausmachen. Letzte Nacht konnte er lange Zeit nicht einschlafen, dafür war er innerlich zu aufgewühlt. Und das, obwohl es bei seinem Abflug niemanden zu verabschieden gab, denn seine Mutter – seine einzige verbliebene Verwandtschaft – war kurz nach seinem 43. Geburtstag verstorben.
Und auch so hielten ihn all die Fragen darüber, ob er an alles gedacht hatte, in dieser Nacht wach. Das Schiff hatte seine Lebenserhaltung bereits vor über drei Monaten in Betrieb genommen, und alles schien perfekt zu funktionieren. Die Triebwerke hatte er ebenfalls für einige Stunden getestet, ohne dass Fehler aufgetreten waren. Es sollte, ja, es musste alles gut gehen!
Genug abgeschweift! Hansen warf einen Blick auf den Anzeigeschirm, um den Luftraum über und unter sich zu prüfen. Alles frei. In dieser Höhe müsste der Luftdruck bereits merklich gesunken sein, aber der manuelle Höhenmesser an den „Central Installations for Navigation and automated Processes“ – kurz CINA (vgl. Seite →) – zeigte noch keine Abweichung. Auch CLEO, die als zentrales Computergedächtnis sonst so gesprächig war, und die seit ihrer erstmaligen Aktivierung vor einigen Wochen meistens unverständliche Sätze von sich gab, schwieg in diesem wahrlich erhebenden Moment.
Er schaltete die Ansicht der rechten Bildschirmseite auf die vordere Projektionslinse. Und dann sah er ihn zufällig doch noch: Den schönsten Sonnenuntergang dieses Jahres. Und das nicht nur, weil die Sonnenscheibe noch warm über der Erdoberfläche flimmerte, sondern auch, weil das Land in der Tiefe mit einem dunklen Grünton eines Sommerwaldes dalag, den er in dieser Schönheit für seine Erinnerungen behalten wollte.
Drei Stunden später säuselte immer noch das einschläfernde Geräusch der Antriebe in seinen Ohren. Aber zu dieser gemütlichen Geräuschkulisse hatte sich ein leises Knacksen hinzugesellt, das nach einigen Minuten wiederkehrend auftrat.
Die Schiffshülle dürfte nicht viele dieser Druckwechsel aushalten, dachte sich Hansen und beschloss, dass es jetzt Zeit für einen kleinen Rundgang wäre, um auf andere Gedanken zu kommen. Die Höhe betrug nun schon 25.000 Meter, und mit zivilem Luftverkehr war fortan nicht mehr zu rechnen. Also erst mal abschnallen und raus aus dem Pilotensitz! Ein letzter Blick auf CLEOs Bildschirm verriet ihm, dass es draußen mittlerweile auch eisig kalt wurde. Auf minus 82 Grad Celsius abgekühlt war es für die Maschine nicht einfach, dem fallenden Außendruck stand zu halten. Und trotz der planmäßigen Druckreduzierung auf 0,7 Bar, blieb noch genug Spannung auf den Außenwänden, um eine Katastrophe zu verursachen.
Als er gerade den Navigationsraum in Richtung achtern verlassen wollte, fiel ihm ein, dass er gar nicht weiter auf die Innentemperatur der Antriebe und der Reaktoren geachtet hatte. Doch wozu hatte er CLEO, die ihm bei anormalen Werten hoffentlich rechtzeitig Bescheid geben würde. Eigentlich waren für heutigen Tag keine weiteren Aktivitäten mehr geplant, nur das Risiko eines unvorhergesehenen Sauerstoffmangels machte Hansen in seinem Gedankenchaos zunehmend nervös. Und so nahm er sich vor, zur Sicherheit eines der Pflanzenbeete im Schiffssegment 3 neu einzusäen. Vom Navigationsraum kommend zwängte er sich zunächst an einer Brennstoffzellen-Bioreaktorkombination vorbei und erreichte durch den kurzen bogenförmigen Gang die Luke in den Längstunnel des Schiffes. Er stieg hindurch und gelangte so nach hinten in die äußere Ringebene. Den fünf Meter langen Tunnel hatte er bereits mit wenigen Schritten passiert und verließ ihn durch eine weitere Luke auf der linken Seite direkt in den Pflanzenbereich des äußeren Segments 4. Hier waren bereits junge Sprösslinge in den Pflanzrinnen der Anbauregale gekeimt, deren Zustand er bei dieser Gelegenheit ebenfalls anhand einiger Einzelgewächse überprüfte. Anschließend kam er – nur wenige Schritte weiter entlang der gebogenen Schiffswand – zu seiner heutigen Pflanzaufgabe: Es waren zwei etwa eineinhalb Quadratmeter große aufrechte Pflanzflächen, die sich beidseitig hinter einer reflektierenden Abdeckung befanden, und die zusammen mit acht weiteren solcher Flächen in einem der sechs Pflanzregale des Raumschiffes befestigt waren. An der Seite des Regales stand zudem bereits ein Töpfchen vorgekeimten Saatgutes (vgl. Seite →)…
2
Navigationsraum der Merania, 14. Januar 2017
Hansen überprüfte die Entfernung zur Erde. Mit dem Navigationslineal in der Hand war er an den blassen Anzeigeschirm angelehnt und maß den Durchmesser der kleinen blauen Scheibe darauf. »Jetzt sollte es funktionieren! «, brummelte er in sich hinein.
Der enge Navigationsraum des Raumschiffes klang nicht gerade nach surrendem High-Tech-Equipment, so wie man sich eine Schiffszentrale üblicherweise vorstellte. Und jede Bewegung in dem engen Raum wollte genau koordiniert werden, um nicht ungewollt an einem Instrument oder einem Schalter hängen zu bleiben. Hansen griff rechts zu den Flugkontrollen und zog die vier Schubhebel der Antriebe auf null. Augenblicklich entfiel auf den Schiffskörper der gleichmäßige Druck von unten. Und was dies für ihn bedeutete: Entfällt dieser Druck, so entfällt auch die so erzeugte Schwerkraft, die ihn und alles um ihn herum bislang am Boden beziehungsweise im Sitz hielt. Und so erlebte er nun zum ersten Mal die wunderbare Wirkung der Schwerelosigkeit, oder besser gesagt das unmittelbare Gefühl von Übelkeit und Schwindel…
Mittlerweile hatte sich Hansens Schiff gut 38.000 Kilometer von der Erde entfernt, und die nun stark reduzierte Erdschwerkraft erlaubte ihm einen kurzen antriebslosen Weiterflug. Er brannte darauf das erste Rotationsmanöver seiner Mission auszuführen und die Flugkontrollen dafür zu testen. Aber noch waren einige Vorbereitungen zu treffen. Sein erstes Ziel, das er in der Schwerelosigkeit anschweben wollte, sollte die quadratische Öffnung zum Wohnraum sein, welche sich vor ihm in nur zwei Metern Entfernung oben in der Wand befand. Mit den Armen drückte er sich zunächst hoch, zog die Beine seitlich am Anzeigeschirm vorbei und flog dann ohne weiteres Zutun schnurgerade auf die gegenüber liegende Ecke zu. Dort angelangt ergriff er die an der Seite der Öffnung befestigte Leiter und schob sich daran weiter nach vorne durch den Durchstieg in den Wohnraum. Erst jetzt konnte er diese Luke wirklich verwenden, da sie ausschließlich für die Nutzung während eines Rotationsfluges geplant war.
Im Wohnraum war es dunkel, und nur durch die Tür auf der linken Seite schimmerte etwas Licht durch die Fugen. Er hatte vor seinem Start die Beleuchtung routinemäßig ausgeschaltet, um das projizierte Außenbild auf dem Anzeigeschirm besser erkennen zu können. Er suchte sich Halt an seinem seitlich befestigten Bett, das entlang der Außenwand umgeklappt werden konnte, weshalb es dort mit flexiblen Scharnieren befestigt war. Nachdem er durch einem weiteren Schubs hinüber zur Tür gelangt war, die hinaus zu den Pflanzensegmenten führte, und nachdem der diese geöffnet hatte, empfing ihn ein markant feuchter Geruchscocktail aus vermoderter Waldluft mit deftigem Toilettenodeur. Ein schöner Geruch, der in der kalten, technischen Umgebung so etwas wie das Gefühl einer Naturpräsenz entstehen ließ. An der linken Seite des gebogenen Ganges hingen die Pflanzregale und füllten den diesen Raum durch ihr herausquellendes Grün mit Leben. Reflektiertes Licht trat aus den oberen und unteren Öffnungen der Regale, sodass Hansen seine Augen zunächst noch an die erhöhte Helligkeit gewöhnen musste.
Befand sich das Raumschiff im normalen Lebenserhaltungsbetrieb, so bildete die herabfließende Nährlösung in diesen Bereichen eine wahrhaft beruhigende Symphonie aus tropfendem Wasser. Doch weil er vor wenigen Minuten die Schraubenpumpe des Wohnraums für den bevorstehenden Wechsel der Schwerkraftrichtung vorübergehend abgeschaltet hatte, und die vorherrschende Schwerelosigkeit auch allen weiteren Flüssigkeitsfluss unterbrach, war es nun gespenstig still um ihn herum.
Hansen hielt sich am Holm des ersten Regals fest. Er griff zwischen den Pflanzwänden hindurch zu einem unteren Verschluss, der die Beetregalkonstruktion an der Wand festhielt. Mit einem Klack war das untere Ende des Regals frei. Er ließ los und zog sich weiter zu den nächsten zwei Regalen, bei denen er ebenfalls die Verschlüsse öffnete. So gelangte er in der äußeren Ringebene bis zum Einstieg des Längstunnels in Segment 5. Elegant flog er hinein und schubste sich zur Luke auf der gegenüberliegenden Seite, die er ebenfalls passierte, um dort die drei weiteren Pflanzenregale aus ihrer Wandhalterung zu befreien.
Am Ende des Ganges, und nachdem dort im vorderen Segment 2 die letzte der grün wuchernden Pflanzeinheiten losgemacht war, drehte er um und hangelte sich wieder zurück zum Längstunnel. Über den Tunnel schwebte er zurück in das Schiffszentrum und zog sich an einer seitlich angebrachten Leiter durch die rechte Luke in die inneren Bereiche der Segmente 4, 3 und 2. Darin befand sich eine der beiden brennstoffzellenbeheizten Bioreaktoreinheiten, die einem großen tonnenförmigen Behälter glich, der seitlich an der inneren Ebenentrennwand befestigt war. Es war dunkel in diesem inneren Bereich, weshalb man die Anschlüsse und die Füllöffnung des Bioreaktors nicht direkt erkennen konnte. Hansen tastete seitlich daran entlang, um den Sperrhebel zu lösen, der den seitlich aufgehängten Körper vor einer ungewollten Drehung parallel zur Ebenentrennwand schützte. Direkt darüber befand sich – ebenfalls an einer drehbaren Aufhängung – der angeschlossene quaderförmige Gastank. Hier wurde das zwischenzeitlich nicht benötigte Faulgas des Bioreaktors gelagert, indem der mit Federn in den Tank eingefügte Kolbenboden herausgedrückt wurde (vgl. Seite →). Da die Abdichtung dieses Bodens zur Behälterwand nur durch die ständig zugeführte Nährlösung gebildet wurde, die das Verteilungssystem nun nicht mehr nachförderte, hatte ein Federwippenventil den Behälter am Nährlösungsablauf automatisch verschlossen und damit ein Austreten der Gase verhindert. Hansen entriegelte die Drehachse des Behälters und führte den inneren Kolbenboden mit einem Hebel an der Unterseite zurück in die unterste Stellung. Der Boden rastete wie vorgesehen unten an der Ventilwippe ein, so dass diese ihn bei Einsetzen des Nährflüssigkeitszulaufs wieder freigeben würde, wodurch der Gaslagerdruck ohne weiteres Zutun wieder aufgebaut werden konnte. Hansen schwebte zurück und durchquerte abermals den Längstunnel der inneren Ebene, um wieder in den Navigationsraum zu gelangen. Direkt nach dem Längstunnel war noch die zweite Bioreaktoreinheit nebst Gastank angebracht, bei denen er ebenfalls die Drehsperren löste und die erforderlichen Wartungsarbeiten durchführte.
Erst jetzt, nachdem all diese Aufgaben nun abgeschlossen waren, bemerkte Hansen, dass ihm etwas weniger schwindelig zumute war. Dennoch beeilte er sich, um wieder in den Navigationsraum zu gelangen, denn nur in der Nähe seiner Kontrollsysteme hatte er die scheinbare Sicherheit, auf jede unvorhersehbare Situation schnell reagieren zu können. Da jetzt alle Vorbereitungen abgeschlossen waren, wandte er sich wieder um den Anzeigeschirm herum und erreichte so einen zweiten Pilotensitz, der waagerecht an der senkrechten Ebenentrennwand befestigt war. Hansen legte sich darin sorgsam die Haltegurte an, denn er wollte kein Risiko eingehen diesen ungewollt zu verlassen. Aber welches Risiko wäre es schon gewesen, ungesichert mit dem Rotationsschub zu arbeiten, wenn auch alle anderen Auswirkungen der Raumschiffrotation unbekannt waren?
Die rechte Bildschirmhälfte zeigte noch die zentrale Ansicht der oberen Schiffsachse. Die Anzeige lag aus seiner jetzigen Position wie ein flächiger Tisch vor ihm, und er musste sich etwas vorbeugen, um darauf blicken zu können. Für den nächsten Schritt brauchte er zusätzlich auch die Hilfe von CLEO…
Sie hatte während des bisherigen Aufstiegs alle Systeme fortlaufend überwacht und die räumliche Ausrichtung des Raumschiffes mit dem vorbestimmten Zielobjekt des optischen Projektionssystems verglichen. Im Zentrum des Projektionsschirmes war der Stern Gliese 581 im Sternbild Waage zentriert, und das Navigationssystem hatte den Kurs in den letzten Tagen immer wieder danach angepasst. Gliese 581 war ein kleiner, schwach leuchtender Stern und befand sich in etwa 20 Lichtjahren Entfernung zur Sonne. Er sollte das erste Ziel ihrer langen Reise sein, und CLEO hatte bereits einen Plan eingespeichert, der die Merania automatisch zu einer Reihe von weiteren Sternen führen sollte. Jeweils nach der Hälfte der Flugstrecke in Richtung eines angeflogenen Sternes würde sie in einen Bremsflug übergehen und nach dem Erreichen eines relativen Stillstandes zu ihrem Ziel, den nächsten Stern auf ihrer Liste anfliegen. Am Ende dieser gigantischen Mission schloss sich der Kreis der Destinationen wieder, und sie würde – nach einem Vorbeiflug an der Sonne – diesen Rundkurs von neuem beginnen.
Da CLEO die letzten Tage durchgängig geschwiegen hatte, griff er direkt – ohne weitere Worte zu verschwenden – zur Tatstatur. Mit einem Textkommando deaktivierte er die unrotierte Lageregelung und informierte CLEO über den anstehenden Flugphasenwechsel, sodass sie ihre Prüfparameter entsprechend korrigieren konnte. Damit war auch das Computersystem bereit für den Beginn des Rotationsfluges. Hansen stellte die Antriebsgondeln in eine quer zur zentralen Schiffsachse liegende Rotationsposition, wodurch er die künstliche Schwerkraft mit einem umlaufend ausgerichteten, gegensätzlichen Schub der Triebwerke einleiten konnte.
Seine Hand bewegte die Regler für die Antriebe, und das Schiff begann sich langsam um seinen Zentraltunnel zu drehen. Überraschenderweise warf es ihn nicht einmal heftig zur Seite. In seinem Sitz drückte nur eine leichte Kraft seinen Oberkörper nach links. Und wenige Minuten später – der Schwerkraftmesser zeigte bereits einen Wert von etwa 800 Gramm je Kilogramm – deaktivierte Hansen die Triebwerke wieder und drehte sie zurück in die Antriebsstellung. Mit der Aktivierung des „Light Controlled Rotation Flight System“ (vgl. Seite →), das den im Anzeigeschirm noch immer zentrierten Stern mit der Schubsteuerung in der Flugrichtung hielt und die gleichmäßige Rotation des Schiffes überwachte, konnte er die erste wichtige Stufe der Raumschiffumwandlung erfolgreich abschließen.
Die nächste wichtige Aufgabe war die Inbetriebnahme des Motors der Nährlösungspumpe und der Luftumwälzung. Nachdem hier der Speisestrom eingeschaltet war, dauerte es noch einige Sekunden, bis sich die Einheit im unter ihm liegenden Wohnraum wieder in Gang setzte. Zu seiner Erleichterung arbeitete sie anschließend in ihrem gewohnten plätschernden Rhythmus. Hansen wollte als letzten Schritt nun auch noch die Materiesammlung aktivieren, um die endgültige Raumflugkonfiguration zu erreichen. Er betätigte den großen Schieber für das Öffnen der Material Collection Bay. Ein Zischen war wahrzunehmen, das durch die Strömung der Druckluft in den Druckzylinder der Öffnungsmechanik entstand. Keine fünf Sekunden später war es auch wieder verschwunden. Mit einem Schalter startete er nun den statischen Generator zur Aufladung der Staubfangeinrichtung und überließ die Anlage dann erst einmal sich selbst (vgl. Seite →).
Beim Aufstehen aus seinem Pilotensitz überkam Hansen ein verwirrendes Gefühl. Alles im Navigationsraum hatte sich durch das Rotationsmanöver um 90 Grad gedreht, und die Türen zu den Bioreaktoren in den Segmenten 3 und 7 lagen plötzlich quer unter der Decke. Aus dem Anzeigeschirm war ein kleiner Tisch geworden, auf dem sich die Sterne wie in einer Salatschleuder drehten.
Bevor er den Navigationsraum verließ, startete er CLEOs Rotationsflugprogramm, um alle Schiffssysteme wieder vollständig in ihre Überwachung zu geben. Irgendetwas musste ihre Gedanken beschäftigen, sonst hätte sie längst ein Wort gesagt. Stattdessen folgte sein Bordhirn nur schweigend seinen Kontrollpflichten und kümmerte sich wohl nicht weiter um Hansen. Auch wenn CLEO eine programmierte Maschine war, so hätte er sich durchaus gerne mit ihr über das Manöver ausgetauscht (vgl. Seite →).
Er stieg über die Leiter durch die nun am Boden liegende Öffnung zum Wohnraum hinab und schaute kurz die Tür zu den Pflanzregalen hinaus. Sie hatten sich während des Rotationsmanövers wie vorgesehen geschwenkt und bildeten seitlich wieder die gewohnte grüne Wand, die in drei Metern Entfernung dem äußeren Schiffsradius folgend in weiter nach oben verlief (vgl. Seite →). Nach einigen Schritten entlang der leise tropfenden Regale beendete er seinen kurzen Kontrollgang und ging zurück in den Wohnraum. Er aß erst einmal einige Getreidesprösslinge und -halme aus seinem Tagesvorrat, füllte sich einen großen Becher mit Wasser und machte sich daran sein Bett zu richten. Bereits beim Öffnen der oberen Bettbefestigungen musste er lange gähnen und merkte, wie schnell ihn jetzt auch die Müdigkeit überkam. Dann lag er endlich im Bett und lauschte dem gluckern der Schraubenpumpe und dem leisen Rauschen der Lüftung, die ohne Unterlass für die Pflanzennährlösungs- und Luftbewegung im Schiff sorgten (vgl. Seite →).
Hansen war nun schon mehr als 80 Tage im All. Bislang vergingen diese recht schnell, denn er hatte immer etwas zu tun. Er pflegte die Beete, erntete, reinigte die Bioreaktoren und prüfte die Umwelt- und Flugkontrollen. Wie wird es nun aber weitergehen? Sein Flugkurs war ja vorherbestimmt, und aller Voraussicht nach würde es die nächsten 100 Jahre keine größeren Aufgaben mehr für ihn geben. Während der letzten Tage kam ihm immer wieder die Geschichte des Robinson Crusoe auf seiner kleinen Insel in den Sinn. Er war nun Robinson und CLEO der freundliche Freitag.
3
Kiel, Deutschland, 10. Januar 2012
Es war vier Jahre zuvor, als er Post nach Hause bekam. Er wohnte in einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Kiel und hatte einen Job in einer Gärtnerei. Sein Leben war nichts Besonderes, und als mit seiner Mutter die letzte Familienangehörige starb, zog er sich mehr und mehr zurück. Alles und jeder schienen Druck auf ihn auszuüben, und am liebsten wäre er mit seinem Kummer nie mehr aus dem Haus gegangen.
Der Brief in seiner Hand sah förmlich aus, und er überlegte, ob noch irgendwelche Rechnungen unbezahlt wären. Doch nachdem er ihn geöffnet hatte, stand etwas völlig anderes darin. Etwas, das sein Leben für immer verändern würde:
„Sehr geehrter Herr Hansen,
in der Nachlasssache Tobias Hansen, zuletzt wohnhaft in Kandel/Pfalz, setzen wir Sie hiermit in Kenntnis, dass Sie testamentarisch berücksichtigt worden sind. Zur Verkündung des Testaments möchten wir Sie gerne am 30.01.2013 um 10 Uhr in unsere Geschäftsstelle in Karlsruhe einladen.
Bitte geben Sie uns bis Bescheid, ob Sie zum genannten Termin anwesend sein werden.
Mit freundlichen Grüßen Notare T. & F. Brügge“
Wer war Tobias Hansen? Diesen Namen hatte er noch nie zuvor gehört. Seine eigene Familie war nicht mehr existent, und von fernen Verwandten wusste er nichts. Vielleicht war er ein Onkel seines Vaters? Sein Vater hatte ja keine eigenen Brüder, aber vielleicht sein Großvater. Alles in allem fand er es verblüffend, wie er von jemandem etwas erben konnte, den er noch nicht einmal kannte.
Da ihn der Inhalt des Testaments interessierte, nahm er sich an besagtem Tag frei und fuhr mit dem Zug die lange Strecke nach Karlsruhe. Ausgestattet mit seinem Musikspieler konnte er während der Fahrt die anderen Fahrgäste nahezu perfekt ignorieren. Nur seinen Sitznachbarn hielt dies nicht von einem zwanghaften Gespräch mit ihm ab. Erst als er sich schlafend stellte, hatte er wieder Zeit für sich und seine Gedanken.
Die Reise dauerte etwas mehr als sieben Stunden, dann stand er endlich vor dem Notargebäude in Karlsruhe. An der Information fragte er zunächst nach dem Weg zum angegebenen Zimmer. Dort angekommen waren im Büro nur der Notar selbst und sein Gehilfe anwesend.
»Guten Tag Herr Hansen, mein herzliches Beileid«, begrüßte ihn der Mann und gab ihm ruhig die Hand. »Dann sind wir vollzählig.«, fügte er seinen Worten hinzu, um die Sitzung auch direkt zu eröffnen.
Für Hansen war es das erste Mal, dass er etwas erbte. Mit Geld oder Wertsachen könnte er gut etwas anfangen. Was aber, wenn er nur Plunder erbte? Er hatte naturgemäß etwas gegen Sachen, die bereits Gebrauchsspuren von Fremden aufwiesen. In diesem Fall würde er wohl auf das Erbe verzichten.
Nach einigen einführenden Worten und dem Feststellen seiner Identität kam der Notar endlich auf den Punkt: »Sie wurden mit einem Schiff beerbt.«
Hansen horchte verdutzt auf. Wo könnte denn in dieser Ecke Deutschlands wohl ein Schiff vor Anker liegen? Hatte er vielleicht einen Kahn auf dem Rhein geerbt?
Und bereits die Adresse hätte ihn stutzig machen müssen, denn sie lag weitab vom Wasser, in der Nähe der pfälzischen Stadt Kandel.
4
An der angegebenen Hausnummer stand eine große Scheune. Hansen lief langsam darauf zu und schaute sich um. Es roch nach altem Holz, und irgendwo in der Nähe zirpte eine Grille in kurzen Abständen. Die Bretter des oberen Drittels der gut sechs Meter hohen Scheune waren ringsum mit Zwischenräumen angebracht, wohl um Licht und Luft ins Innere zu lassen. Alles war in einem erbärmlichen Zustand. Das Dach konnte nicht mehr wirklich dicht sein, und wenn hier tatsächlich ein Schiff eingelagert war, so hätte es bestimmt einen massiven Rostschaden.
Hansen hatte es gereizt, ein Schiff zu besitzen. Schließlich wohnte er in Meeresnähe, und so könnte er nach dessen Instandsetzung ab und zu der realen Welt des Festlandes entkommen. Sobald es möglich wäre, würde er mit einem Auto kommen und den Schiffsanhänger nach Hause schleppen.
Das Schloss an der Kette war trotz des Schlüssels sehr schwer zu öffnen. Tobias Hansen, der tatsächlich ein Onkel seines Vaters gewesen war, hätte leicht ein hier verarmter Bauer sein können. Wie Hansen erfahren hatte, gehörte die Scheune nämlich einem anderen Bauern im selben Ort, bei dem er zuvor den Schlüssel abholen musste. Es hatte den Anschein, dass der Landwirt seine Maschinen und Traktoren hier nur vorübergehend unterstellte. Der Bauer war gleich sehr freundlich und bot ihm auch an, die Scheune weiter nutzen zu dürfen.
Dann endlich rasselte die Kette der Scheunentür zu Boden, und Hansen konnte den Zugang mit mäßigem Kraftaufwand ein wenig öffnen. Und nachdem er seinen Kopf durch den schmalen Türspalt gedrückt hatte, erblickten seine Augen keinen Schiffsanhänger, sondern etwas sehr Großes aus gewölbten Flächen und silbernem Metall. Es war sein „Schiff“.
Lange Zeit hatte er benötigt, um sich in die archivierten Studien des Tobias Hansen einzuarbeiten. Er war ein Forschergeist gewesen, das stand fest. Jedoch keiner der herkömmlichen Sorte mit einem Labor oder einem einfachen Fernrohr. Vielmehr hatte er versucht, seine Ideen gleich praktisch zu verwirklichen, und es muss ein Lebenswerk gewesen sein, dieses Schiff zu entwerfen und zu bauen. Hansen ließ sich enthusiastisch auf die Ideen seines Verwandten ein. Zwar war der Traum seines Schiffes hier ein gänzlich anderer, jedoch faszinierte ihn dieser hier um vieles mehr. Die Philosophie hinter diesem Projekt war nichts Geringeres für ihn, als die endgültige Antwort auf all seine Fragen, die er sich in der Vergangenheit über sein Leben gestellt hatte.
Gegenüber anderen Menschen hatte Hansen nur noch wenig zu geben, aber im Rahmen seiner Forschungen könnte er nun der gesamten Menschheit beweisen, was in ihm steckte. Und so sollte für ihn die Fertigstellung einer universellen Botschaft an alle Wesen mehr zur Erfüllung werden, als nur eine Aufgabe. Da er immer mehr Zeit für seine Forschungen benötigte und deshalb immer öfter und länger in Kandel blieb, wurde bald deutlich, dass sein altes Leben im Norden nicht so weitergehen konnte. Längst hatte er die Scheune des Bauers übernommen und wohnte während seiner Arbeit an Bord des Schiffes. Er finanzierte all dies nur mit seinen Ersparnissen, und so musste er auf Dauer alle seine weiteren Ausgaben so weit wie möglich reduzieren.
Um seine eigene Versorgung sicherzustellen, ging er recht früh die Symbiose mit dem Lebenserhaltungssystem des Schiffes ein. Denn bereits nach der Herstellung einer externen Stromversorgung konnte er die Pflanzenbeleuchtung der Pflanzregale für seinen eigenen Bedarf aktivieren. Er wollte damit auch testen, ob die angedachten Nutzpflanzen in der vorgesehenen Weise gediehen. Dazu erstellte er Bewirtschaftungspläne für die Anbauregale und begrünte nach und nach die äußere Ringebene des Schiffes. Er befüllte die Bioreaktoren mit den Pflanzenabfällen und konnte so auch bald die interne Energieversorgung herstellen. Während der folgenden Monate nahm Hansen alle weiteren Schiffsysteme in Betrieb, bevor er letztendlich seinen Job im Norden kündigte und seine Wohnung aufgab. Sämtliche Nahrung und Trinkwasser (vgl. Seite →) erhielt er fortan aus der Lebenserhaltung des Schiffes. Und zuletzt erzeugte das Schiff auch eigenständig Licht und Wärme mit einem Minimum eingebrachter Energie.
Leben und leben lassen
1
Kandel, Deutschland, 9. März 2017
MERANIA KOMMUNIKATIONSÜBERWACHUNG
AKTIVITÄTENPROTOKOLL DER ROUTINEÜBERPRÜFUNG
ZEITSTEMPEL 04:50:00 UHR
PRÜFUNG I:
Kommunikationszeitfenster abwarten:
ERFOLGT
PRÜFUNG II:
Position MERANIA bereits bekannt?
NEGATIV
PRÜFUNG III:
Antennenausrichtung auf Nullstellung:
ERFOLGT
PRÜFUNG IV:
Start der Antennensuchfahrt:
ERFOLGT
SCHLEIFENBEGINN
PRÜFUNG V, SCHRITT a:
Antennenausrichtung plus ein Grad:
ERFOLGT
PRÜFUNG V, SCHRITT b:
Eigenkennung senden:
ERFOLGT
PRÜFUNG V, SCHRITT c:
Rückantwort empfangen?
NEGATIV
PRÜFUNG V, SCHRITT d:
Fortführung bei NEGATIV mit SCHRITT:
PRÜFUNG V, SCHRITT a
ZEITSTEMPEL 05:08:24 UHR
PRÜFUNG VI:
Optimieren des Antennensignals:
73 %
PRÜFUNG VII:
Prüfung der Anfrageart:
INTERNETZUGRIFF
PRÜFUNG VIII:
Weiterleitung an das Internet:
'Franz, ist dort?'
2
Pflanzensegment 2 der Merania, einen Tag zuvor…
CLEO meldete sich über die Lautsprecher: »Alarm – Hüllendruck ist über Grenzwert. Biogasdruck ist unter Grenzwert.«
Hansen, der gerade seinen täglichen Pflichten für die Pflanzenzucht nachging, nahm es erst einmal gelassen: Was hatte sie gesagt? Wie kann der gefallen sein? Er lief in den Wohnraum und kletterte dann die Leiter zum Navigationsraum hinauf. »Was ist los?«, fragte er die Technik. Es kam keine Antwort. Doch gerade als er sich auf dem Pilotensitz niederlassen wollte, roch er selbst den Grund für CLEOs Meldung. Gas!? Dem fauligen Geruch nach war es ausgetretenes Methangas oder eines der Nebengase aus dem Bioreaktor. Schnell fiel sein Verdacht auf die Reaktoreinheit Nummer zwei, denn durch den linken Durchgang des Navigationsraums war der Geruch stärker wahrzunehmen. Und auch ein Blick auf die Druckanzeige bestätigte ihm den um 2,8 Prozent leicht angestiegenen Hülleninnendruck, sodass aktuell 0,82 Bar vorherrschten.
Wie das? Hansen versuchte sofort zu handeln – zu gefährlich wäre ein weiterer Anstieg der Methangaskonzentration in der Atemluft. Hastig wandte er sich um und lief in das angrenzende Segment. Mit jedem Schritt wurde der Gasgeruch stärker. So stark, dass ihm bereits schwindelig wurde. Krampfhaft hielt er sich am Türrahmen hinter sich fest, den er in Panik mit der rechten Hand wie ein Schraubstock umschloss. Er ließ sich hinab und blieb zunächst am Boden sitzen, um hier die scheinbar weniger belastete Luft zu atmen. Links neben ihm thronte bereits der längliche Behälter des Bioreaktors.
Nach einer raschen Überprüfung stand fest, dass das Gas nicht direkt aus dem Reaktor stammen konnte, denn nachdem er die Isolierungen der Einheit abgenommen hatte, wäre ihm eine Schadstelle an der Gasabführung oder den Zuleitungen zu den Brennstoffzellen schnell aufgefallen.
Er hielt einen Moment inne, um seine Gedanken schnell zu sammeln. Es konnte eigentlich nur noch am Gasbehälter liegen, dachte er. Behindert von den umherliegenden Isolationsteilen des Reaktors drehte er seinen Körper um 180 Grad zum Gastank hinter sich. Er hielt die Luft an, legte sich über den Behälter und horchte. Ein leises Hauchen verriet ihm, dass er der Ursache jetzt näher kam. Nach einigen Sekunden des Suchens richtete er sich auf und holte kurz Luft. Ihm war schwindelig, und er konnte nicht einmal aufrecht auf seinen Knien bleiben. Doch er musste dieses Leck sofort schließen, um nicht binnen weniger Minuten sein Leben zu verlieren.
Los, denk‘ nach! Befüllt und entleert wurde der Gasspeicher über ein Einlass- und ein Auslassventil an der hinteren Behälterkante. Auch gab es eine zweite Verbindungsleitung zur Gasspeichereinheit auf der gegenüber liegenden Schiffsseite. Dieser Leitung würde er zuletzt nachgehen. Die wichtigste Leitung kam vom Bioreaktor und füllte den Vorrat durch den leichten Druck, den die Gasproduktion in seinem Inneren erzeugte. Also verfolgte Hansen nun diese Leitung, die hinter dem Gasbehälter mit einer Biegung verschwand. Das kommt von da hinten! Mist!
Seine Hand ergriff das rückseitig liegende Gasventil, und so schnell er konnte drehte er dieses zu, um den Gasfluss zu stoppen. Mit einiger Anstrengung gelang ihm dies endlich, was aber nicht ohne Folgen blieb...
Die Gaswolke nahm Hansen mehr und mehr das Bewusstsein. Das Fauchen des austretenden Gases hatte aufgehört, und er hoffte nun, dass sich die Gasmengen etwas im Schiff verteilten. Mit dem Rücken zum Gasbehälter war er erschöpft auf den Boden gesunken, um für einen Moment Luft zu holen. Kaum, dass er wieder etwas zu sich kam, wurde auch die fatale Tragweite dieses Unfalls klar. Die allzeit rauschende und plätschernde Technik verstummte mehr und mehr, denn der anhaltende Gasverlust auch einer kompletten Bioreaktor- und Brennstoffzelleneinheit überbeanspruchte die Kapazität der verbliebenen zweiten Einheit um 100 Prozent. Nur einen Moment später fiel das Licht aus, und es wurde dunkel. So dunkel, dass nur noch Lichtschatten vor seinen Augen schwebten, die wie erloschene Blitze im Raum flimmerten. Die Stille, die ihn umgab, wirkte mehr als erdrückend. Es war eine Stille des Todes, die ihn eingefangen hatte. Bliebe er nun hier sitzen, würde er ihr in wenigen Augenblicken niemals mehr entkommen können.
Hansen brauchte sein Werkzeug. Er griff hinter sich, um im Dunkeln wenigstens einen Anhaltspunkt für eine Reparatur zu ertasten. Als er die knapp fünf Millimeter dicke Leitung erfasste, spürte er gleich, dass diese ungewöhnlich leicht zu bewegen war. An der Wand schien sie fest noch verschraubt zu sein, aber in Richtung des Gastankventils bewegte sie sich anscheinend frei. Immer weiter tastete er die Metallleitung ab, bis er an ihr Ende kam. Es war ein sauberer Schnitt. Knapp dahinter ertastete er die Anschlussmuffe des Ventils. Sie war ebenfalls ohne Anzeichen einer gebrochenen Leitung.
Vielleicht genügte es, sie einfach neu zu verschrauben? Was, wenn sie nur aus der Muffe gesprungen war?, dachte er. Aber dafür würde er erst einmal sein Werkzeug holen müssen, welches sich im Lager des Wohnraumes befand.
Die Zeit drängte, denn solange die Pflanzenbeleuchtungen ausgeschaltet waren, nahm der Sauerstoffgehalt der Luft mehr und mehr ab. Nicht nur, dass die Pflanzen bei Dunkelheit kein Kohlendioxid mehr in Sauerstoff umwandelten, nein, sie wurden darin sogar selbst zu Luftverbrauchern, und das wusste Hansen. So würde zum ausgetretenen Biogas nun auch noch der Kohlendioxidgehalt ansteigen.
Tastend kroch er den stockdusteren Meter zum Längstunnel. Den üblen Geruch des Biogases konnte er mittlerweile nicht mehr wahrnehmen, aber er spürte bereits, wie seine Kräfte nachgelassen hatten. Im Tunnel kam er nur sehr mühsam die Leiter zur äußeren Ebene hinunter. Eine schier endlose Anzahl von Sprossen lag unter ihm, und es erschien ihm wie eine Ewigkeit, bis er mit dem linken Fuß endlich die Deckfläche der Außenwand berührte. Er ließ sich fallen und krabbelte durch die Luke in Richtung des Wohnraumes. Um ihn war es totenstill, nur sein stumpfes Keuchen hallte in der Dunkelheit. Er passierte kriechend ein Pflanzregal nach dem anderen und kam dem Wohnraum langsam näher. Hinter der Zugangstür öffnete er die seitlich liegende Klappe zum Lagerschrank. Die Werkzeugkiste stand dort gewöhnlich auf einem der mittleren Regalböden, weshalb er hier versuchte den Griff der Kiste zu erreichen. Hansen hatte Glück und erfasste direkt den Kunststoffgriff an der Oberseite. Mit einem Schwung holte er das Werkzeug nach unten und begann darin nach der Multizange zu suchen. Es dauerte eine Weile bis er sie gefunden hatte, aber dafür fielen ihm auch noch die handbetriebene Taschenlampe und ein Gabelschlüsselsatz in die Hände, den er gleich in seiner Hosentasche verstaute. Mit der Lampe in der rechten Hand, die ihm wenigstens etwas Licht verschaffte, machte er sich sogleich auf den Weg zurück zum Gasvorratsbehälter. Immer schwerer erscheinen ihm seine Arme und Beine, wobei sich seine Lungen mit jedem Atemzug pfeifend füllten und leerten. Das Atmen der feuchten und mittlerweile auch kühlen Luft glich dem Inhalieren einer zähen Flüssigkeit.
Er wählte als Rückweg wieder die äußeren Segmente und den Längstunnel, da ihm die Luft hier etwas atembarer erschien. Die Leiter zur inneren Ebene wurde abermals die größte Herausforderung auf dem Weg zum Gasbehälter, und mit letzter Kraft zog er sich durch die obere Luke. Hastig fand er die defekte Leitung wieder. Mit der Taschenlampe in der einen und der Multizange in der anderen Hand schraubte er zunächst die Anschlussmuffe des Gasventiles ab. Diese steckte er lose über das freiliegende Leitungsende und drückte die Röhre fest in die Öffnung des Gasventils. Da er die Muffe mit seiner zweiten Hand anziehen und die Taschenlampe hierfür loslassen musste, wurde es erneut ruhig und dunkel um ihn. Das Surren und die Helligkeit der handbetriebenen Dynamolampe hatten ihm etwas trügerische Sicherheit gegeben. Nun würde er den Rest der Reparatur blind bewältigen müssen, und er begann die Muffe mit der Zange festzuziehen. Wenig später hatte er mit schwankendem Oberkörper die letzte Drehung der Muffe durchgeführt, und die Reparatur war beendet. Seine Hand drehte nun wieder am Ventil, das ihm zuvor alles Lebensnotwendige genommen hatte. Ein leises Rauschen ging durch die Leitung, nur um eine Sekunde später wieder zu erlöschen. Diesmal war es die Stille, die Hansen wieder neue Hoffnung gab. Die Leitung schien dicht zu sein!
3
Für das Wiederanlaufen der ausgefallenen Brennstoffzellen war jetzt das Wiederanlaufen der Reformierung des zugeführten Biogases zu oxidierbarem Wasserstoffgas entscheidend. Es war Hansens akribischer Planung zu verdanken, dass der noch verbleibende Reststrom im aktuellen Notbetrieb ausreichte, um den Glühdraht des benötigten Methangasreformers auf über 1.000 Grad zu erhitzen, womit die Wasserstofferzeugung und dessen nachfolgende Oxidation in den Brennstoffzellen schnell wieder anlaufen konnten (vgl. Seite →). Es dauerte eine Weile, doch dann glimmten langsam die Pflanzenleuchten auf. Sitzend und keuchend sah er zu, wie sich ihr Lichtschein an der Wand des Längstunnels spiegelte. Einen Augenblick später begann im Wohnraum auch die Lüfter- und Pumpeneinheit wieder leise zu plätschern. Hansen fuhr es dabei eiskalt über den Rücken. Er hatte es geschafft! Ein leises Piepen aus dem Navigationsraum verriet ihm, dass nun auch CLEO wieder zu ihm zurückkehrte. Nach der erfolgten Startprozedur des Computers prüfte sie nun eigenständig alle Systeme. Ihr Ergebnis war nach einigen Minuten aber erneut ernüchternd: »Alarm – Hüllendruck ist über Grenzwert.«
Hansen fand diese Meldung merkwürdig: Warum stieg denn der Hüllendruck an? Die Gasspeicher hatten zwar fast ihr gesamtes Gas verloren, aber dafür nahmen diese das gleiche Ausgleichsvolumen an Luft wieder auf. In Summe ersetzten sich die beiden Gase also nur, weshalb der Innendruck hierdurch nicht beeinflusst werden konnte.
Warum war so viel Gas in die Luft entwichen, dass er davon nun nahezu bewusstlos wurde? Eine Vermutung stieg in ihm auf, und im Kopf rechnete er einmal nach: Das Schiff hatte ein Luftvolumen von insgesamt 203 Kubikmetern. Beide Gasbehälter könnten mit ihrem Inhalt von etwa einem Kubikmeter den Biogasanteil der Luft um lediglich 0,5 Prozent erhöhen, was bestimmt noch keine Wirkung auf ihn gehabt hätte. Wenn allerdings die defekte Gasverbindung schon länger undicht gewesen wäre, hätte der Methangasanteil aber auch allmählich zunehmen können. Und da das gebildete und so entwichene Methangas nicht in den Brennstoffzellen oxidiert wurde, vergrößerte es kontinuierlich das Gasvolumen im Schiff. Dies würde einen leichten Druckanstieg bewirken. So musste es sein!
Mit dieser Annahme rechnete er sodann weiter: Bei 20 Prozent laufendem Gasverlust würde eine Flugdauer von nunmehr 136 Tagen logischerweise einen langsamen, aber beträchtlichen Anstieg des Methangasanteils bewirken. Und nun war die Leitungsverbindung auch noch vollständig gebrochen, sodass sprungartig ein sehr gefährliches Gasniveau in der Luft erreicht wurde. Je nach Verfassung seiner Pflanzen könnte jetzt noch der Kohlendioxidgehalt zusätzlich angestiegen sein, sodass sich beide Gase auf zusammen vier Prozent Luftanteil addierten.
Hansen hatte keine Ahnung, was genau das Faulgas in seiner Atemluft bewirkte. Sein Kopf fühlte sich schwindelig und benommen an. Wahrscheinlich musste er einige weitere Schritte einleiten, um seine Situation zu verbessern. Das Gasgemisch könnte in dieser Konzentration beispielsweise explosiv sein, und ob eingeatmetes Biogas giftig war, wusste Hansen in diesem Moment noch nicht. Er wollte das Gas jedenfalls schnellstens aus der Atemluft bekommen und damit auch den Überdruck auf die Schiffshülle reduzieren. Nur, dazu hatte er weder Filter noch Messgeräte, um den Gasgehalt zu messen und zu beeinflussen. Obwohl er eigentlich nicht zurück zur Erde blicken wollte, beschloss er, sich jetzt von dort Rat und Hilfe zu holen...
Seit Stunden ging ihm merklich schlechter. Die Gasanteile schienen seine Sauerstoffzufuhr zu reduzieren. So hatte er sich in den Wohnraum zurückgezogen und erst durch die hier einkehrende Ruhe seine Übelkeit bemerkt. Augenblicklich überkam ihn diese ohne jede weitere Vorwarnung. Er übergab sich in eine Schüssel, die neben dem Waschbecken auf der Ablage stand. Einige Minuten später wusch er sich das Gesicht und kletterte wieder die Leiter zum Navigationsraum hinauf.
Im seinem Pilotensitz prüfte er zunächst routinemäßig den Projektionsschirm. Während der vergangenen Flugzeit ohne jede Steuerung, hatte die Merania ihre Ausrichtung beibehalten. Im Zentrum der hinteren Projektionsanzeige lag immer noch der blaue Planet. Er schaltete den Datenfunk ein und wählte einen Kanal, den er auch auf der Kommunikationseinheit zuhause eingestellt hatte. Dort überwachte ein Computer seine Frequenz, und beim Zustandekommen einer Verbindung würde dieser den Austausch von Nachrichten vornehmen und seine Anfragen an das Internet weiterleiten. Aufgelehnt auf den Anzeigetisch verfolgte er die Signalanzeige des Funkgerätes. Wenn alles funktionierte, müsste er demnächst das Sendesignal des Heimatsenders empfangen.
Die beiden Parabolantennen in der Bugspitze des Schiffes befanden sich dazu hinter einem für Radiosignale durchlässigen Aramidgewebe. Sie waren einander entgegengesetzt angeordnet, eine Antenne zeigte in die Flugrichtung, während darunter die zweite Antenne dieser entgegen angebracht war (vgl. Seite →). Für einen stabilen Funkkontakt waren die Antennen auf einem beweglichen Fuß montiert, sodass kleinere Schiffsbewegungen ausgeglichen werden konnten, wodurch eine dauerhafte Ausrichtung auf einen festen Kommunikationspunkt ermöglicht wurde.
Mit der hinteren Antenne sollte nun also aus der aktuellen Ausrichtung ein Kontakt mit der Erde möglich sein. Da sich die Empfangsstation seines Heimatstützpunktes fortwährend im Tages- und Nachtzyklus um die Erde bewegte, gab es für eine Verbindung immer einen festgelegten Zeitraum, in dem sich beide Antennen anpeilen konnten. Hansens Zugang zum irdischen Datennetz war dadurch zwar eingeschränkt, sollte aber laut dem Schiffschronometer jetzt bereits möglich sein.
Doch nichts dergleichen geschah. Der Anzeiger für die Signalstärke schlug zwar aus, verharrte jedoch fest auf einer Position von zehn Prozent. Hansen seufzte. Konnte alles wirklich so schief gehen? Dabei gab es kaum Chancen für eine bessere Verbindung. Denn dazu müssten die Antennen noch genauer aufeinander ausgerichtet werden, und da seine eigene Antenne die Erde bereits recht gut anvisierte, war ein Problem bei seiner Empfangsstation sehr viel wahrscheinlicher.
Ihm wurde erneut schlecht. Bevor er ging, beschloss er das Funkgerät noch nicht auszuschalten und stattdessen CLEO die Überwachung der Signalstärke zu überlassen. Er gab ihr an der Tastatur den zu überwachenden Signaleingang sowie die Benachrichtigungsgrenze von 50 Prozent ein. Sie würde ihm Bescheid geben, falls dieser Wert erreicht wurde.
Hansen hatte keine weiteren Ideen mehr. Ihn beschäftigte der Gedanke, dass schon ein einzelner Funke die Gasmischung um ihn herum zum Explodieren bringen könnte. Nachdem er sich wieder in einen der Bioreaktoren übergeben hatte, wählte er noch CLEOs Seite mit den Umgebungsparametern. Der Luftdruck lag noch unverändert bei 0,82 Bar und hatte sich auch nicht verändert, seit er den Gasaustritt gestoppt hatte. Er musste bald handeln, da er nicht wusste, wie lange er in dieser Situation noch überleben konnte. Daran, etwas zu Essen oder seine Beete zu bepflanzen, konnte er im Traum nicht denken. Er wusste ja nicht einmal, wie lange seine Pflanzen in dieser Umgebung überleben würden.
4
Wohnraum der Merania, 9. März 2017
Hansen hatte alle Lampen im Wohnraum ausgeschaltet und sich auf das Bett gelegt.
Nur aus dem Navigationsraum drang ein wenig blasses Licht von den Anzeigen herein. Das braune Holzimitat der Wände wirkte dunkler als sonst und war fast schwarz. Die goldenen Armaturen und Griffe an der Wand des Wohnbereiches glänzten dagegen in diesem Lichtschein um die Wette. Hansen trieb im Halbschlaf durch den hoffnungslosen Moment, den ihm sein Schicksal gerade erleben lies. Vor wenigen Minuten hatte er noch einmal sich mit leerem Magen übergeben und war schwindelnd hingefallen. Seine Müdigkeit hatte ihn so sehr eingenommen, dass er alle Pflichten vergaß und sich nur noch nach Schlaf sehnte. Ob er wieder aufwachen würde, vermochte er nicht zu sagen. Und sollte er irgendwann einmal gefunden werden, so würde wohl wenigstens sein Ordnungssinn in Memoriam gewürdigt werden. Er hatte immer alles gut aufgeräumt und sauber gehalten, und so war der Wohnraum auch jetzt noch das Schmuckstück des ganzen Schiffes.
Gerne würde er jetzt die Luken öffnen und frische Luft hereinlassen. Ein paar Kubikmeter neue Atemluft hätten ihn bestimmt wieder schnell auf die Beine gebracht. Und dann wäre er bereit gewesen für neue Forschungen, wie die Fortführung der Sternenkarten, die CLEO für ihre Navigation benötigte, oder die Dokumentation seiner Nutzpflanzenmerkmale, die sich über die Jahre mit Sicherheit genetisch an ihr spezielles Umfeld anpassen würden. Und letztlich war auch noch CLEO ein Forschungsgebiet, das die Weiterentwicklung ihres elektronischen Verstandes beinhaltete, welcher vielleicht einmal eine Historie aller Ereignisse wiedergeben könnte. Aber was sollte sie jetzt schon berichten? Würde man nicht sagen, dieses Projekt war der Fehler eines Dummkopfes, der nicht wusste, worauf er sich eingelassen hatte?
Hansen spürte, wie er schwächer wurde. Seit einem Tag atmete er nun schon die gasbelastete Luft ein. Alles was er zu tun vermochte, war hier im Bett zu liegen und zu warten. Warten darauf, dass sich irgendwann ein Signal von der Erde fände, und er vielleicht gerettet würde. Mit diesen letzten Gedanken war er eingenickt und versank in einen tiefen Schlaf.
5
Wie lange er geschlafen hatte, konnte er nicht sagen. Immerhin wachte er wieder auf. Alles war noch immer dunkel, so wie Hansen es vor seinem Schlaf in Erinnerung hatte. Er fühlte sich benommen, und seine Glieder waren schwer. Im Liegen lauschte er einem leisen Fauchen in der Luft. Es entsprach nicht dem üblichen Säuseln der Lüftungsanlage, die ständig seine Luft entlang der äußeren Ebene bewegte (vgl. Seite →). Er vernahm ein helleres Geräusch, das durch die Öffnung des Navigationsraums drang. Eine Weile genoss er benommen das warme Rauschen, das ihn an einen Sturm in weiter Ferne erinnerte.
Was war es? War es tatsächlich ein Geräusch des Windes?
Weshalb kam es aus der inneren Schiffsebene?
Und: Warum war er noch am Leben?
Er stand langsam auf. Wider Erwarten ging es ihm besser, aber sein Körper verlangte nach Flüssigkeit. Er war sehr schwach, seine Lungen schmerzten beim Atmen, und seine Muskeln hatten einen Muskelkater. Was ist passiert? Vorsichtig, um nicht hinzufallen, ging er auf seinen wackeligen Beinen zur Tür der Pflanzensegmente. Als er sie öffnete, empfing ihn ein kühler Schwall aus feuchter Luft. Neben den Pflanzregalen stand eine Wolke dichten Nebels, die durch die Pflanzenbeleuchtung so hell angestrahlt wurde, dass sie den Flur dahinter nur schemenhaft erkennen ließ. Die Lufttemperatur musste gesunken sein, sonst wäre all die Feuchtigkeit nicht als Nebel darin kondensiert. Das Grün, das über die Beete herauswucherte, schien auch viel intensiver zu sein, als er es in Erinnerung hatte. Ja, eindeutig, die Pflanzen waren gewachsen! So weit, dass diese sogar aus den Beeten heraushingen. Wie lange konnte er wohl geschlafen haben? In den Regalen tropfte es unaufhörlich herab, und Hansen bemerkte, dass seine Atmung durch die Feuchtigkeit erleichtert wurde.
Er hustete, und aus den Lautsprechern ertönte darauf eine bekannte Stimme: »Hallo, Franz ist gesucht?«
Es war CLEO, die Hansens Wiederauferstehung anscheinend wahrgenommen hatte und ihn deshalb begrüßte. Hansen erschrak innerlich zutiefst. Erst nach einigen Sekunden fragte er mit belegter Stimme nach den Umgebungsparametern: »Status der inneren Systeme?«