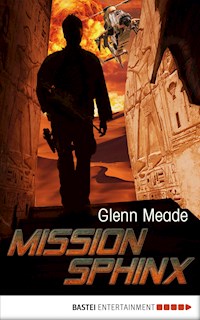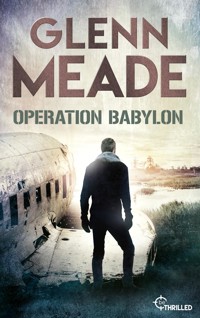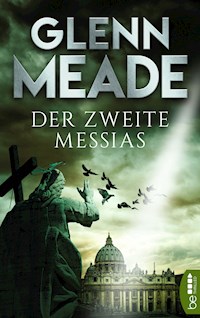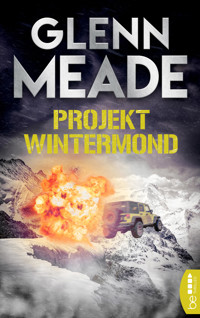
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Polit-Thriller von Bestseller-Autor Glenn Mead - packende Spannung vor dem Hintergrun
- Sprache: Deutsch
Auf der Jagd nach dem Geheimnis ihres Vaters ...
Jennifer March wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Vor Jahren drang ein Unbekannter in das elterliche Haus ein, ermordete Jennifers Mutter und verletzte ihren Bruder schwer. Zugleich verschwand ihr Vater spurlos.
Jetzt wird in den Schweizer Alpen die Leiche eines Mannes entdeckt, der die Papiere ihres Vaters bei sich trägt. Jennifer begibt sich in die Schweiz, um den rätselhaften Ereignissen auf den Grund zu gehen. Doch sie ist nicht die Einzige, die sich für den Toten interessiert - die CIA und Mitglieder der russischen Mafia heften sich an ihre Fersen, und Jennifer gerät unversehens in tödliche Gefahr .....
Projekt Wintermond: Glenn Meades spannender Agententhriller um ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Cover
Weitere Titel des Autors
Über dieses Buch
Über den Autor
Titel
Impressum
Widmung
ERSTER TEIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ZWEITER TEIL
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
DRITTER TEIL
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
VIERTER TEIL
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
FÜNFTER TEIL
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
Weitere Titel des Autors
Mission Sphinx
Operation Schneewolf
Der Jünger des Teufels
Die letzte Zeugin
Operation Babylon
Operation Romanow
Der letzte Messias
Die Achse des Bösen
Unternehmen Brandenburg
Über dieses Buch
Auf der Jagd nach dem Geheimnis ihres Vaters …
Jennifer March wird von ihrer Vergangenheit eingeholt: Vor Jahren drang ein Unbekannter in das elterliche Haus ein, ermordete Jennifers Mutter und verletzte ihren Bruder schwer. Zugleich verschwand ihr Vater spurlos.
Jetzt wird in den Schweizer Alpen die Leiche eines Mannes entdeckt, der die Papiere ihres Vaters bei sich trägt. Jennifer begibt sich in die Schweiz, um den rätselhaften Ereignissen auf den Grund zu gehen. Doch sie ist nicht die Einzige, die sich für den Toten interessiert – die CIA und Mitglieder der russischen Mafia heften sich an ihre Fersen, und Jennifer gerät unversehens in tödliche Gefahr …
Über den Autor
Glenn Meade (*1957 in Dublin) arbeitete als Journalist und als hochspezialisierter Ausbilder am Flugsimulator für Aer Lingus, bevor er zu internationalem Bestsellerruhm gelangte. Seine Bücher wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Glenn Meade lebt in Irland und widmet sich ganz der Schriftstellerei.
GLENN MEADE
PROJEKT
WINTERMOND
THRILLER
Aus dem Englischen vonKarin Meddekis
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2004 by Glenn Meade
All rights reserved.
Titel der englischen Originalausgabe: »Web of Deceit«
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2004/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven © Evannovostro/shutterstock; © Fedor Selivanov/shutterstock; © Landscape Nature Photo/shutterstock; © Michal Zduniak/shutterstock; © Nathan Pang/shutterstock; © railway fx/shutterstock
ISBN 978-3-7517-0625-4
be-ebooks.de
lesejury.de
Gewidmet in LiebeDiane,die diese Geschichtegern hören wollte, sowieElaine und Tom
ERSTER TEIL
1
Jennifer March erwachte mitten in der Nacht und erstarrte. Sie spürte sofort, dass jemand in ihrem Schlafzimmer war.
Draußen tobte ein Unwetter über New York. Blitze zuckten, Donner grollte. Es regnete in Strömen.
Jennifer setzte sich im Bett auf, horchte im Krachen der Blitze und dem Prasseln des Regens nach verräterischen Geräuschen. Das entsetzliche Gefühl, dass jemand im Schlafzimmer war, trieb ihr den Schweiß auf die Stirn. Ihr Puls raste, ihr Atem ging keuchend. Als sie die Bettdecke zurückwarf, um aufzustehen, sah sie die schwarze Gestalt eines Mannes, der sich über sie beugte.
»Beweg dich nicht!«
Jennifer wollte sich nach vorn werfen, wollte an dem Schatten vorbei. Der Mann packte sie und verpasste ihr eine schallende Ohrfeige, die sie zurück aufs Bett warf. »Ich habe gesagt, du sollst dich nicht bewegen!« Ein Blitz erhellte das Schlafzimmer mit flackerndem Licht. Jennifer erhaschte einen Blick auf das Gesicht des Eindringlings.
Er hatte kein Gesicht.
Es war unter einer schwarzen Maske verborgen. Durch die schmalen Schlitze konnte sie die dunklen Augen des Mannes sehen. Er trug Lederhandschuhe, und in der Rechten hielt er ein Metzgermesser. Als Jennifer zu schreien anfing, presste ihr der Mann die linke Hand auf den Mund. Jennifer wand sich in Panik, versuchte sich dem Griff zu entziehen. Dabei rutschte ihr Morgenmantel die Beine hoch. Der Mann legte das Messer auf den Nachttisch. Augenblicke später spürte Jennifer eine Hand auf ihrem Körper, die zwischen ihre Beine glitt. »Ganz ruhig, oder ich schneid dir die Kehle durch.«
Jennifer March erstarrte zu Eis. Der Mann schnallte seinen Hosengürtel auf, packte ihre Handgelenke, schob sich auf sie und drang in sie ein. Vor Schmerz und Schock war Jennifer wie gelähmt. Nie zuvor hatte sie solchen Ekel empfunden, solche Angst. Starr vor Entsetzen lag sie da. Wie aus weiter Ferne hörte sie die Geräusche des Unwetters, begleitet vom lauten Stöhnen des Mannes, der mit wilden Stößen in sie eindrang.
Irgendwann war es vorbei. Der Mann löste sich von ihr, setzte sich auf und nahm die Hand von ihrem Mund. Jennifer war benommen vor Schmerz und Schock. Ein Schrei erstarb in ihrer Kehle. Dann sah sie, wie ihr Peiniger das Messer vom Nachttisch nahm. Die blutige Stahlklinge funkelte.
»Was … was haben Sie vor …?«, fragte Jennifer flüsternd.
»Ich werde dich töten.«
Jennifers namenloses Entsetzen löste sich in einem schrillen Schrei …
2
Sie erwachte mit einem Schrei auf den Lippen und presste das Kissen auf ihre Brust. Ein fürchterlicher Albtraum hatte sie aus dem Schlaf gerissen. Sie schnappte nach Luft.
Jennifer ließ das Kissen los und warf die Decke zurück. Sie knipste die Nachttischlampe an, schwang sich aus dem Bett und ging mit zitternden Beinen zum Fenster. Um sich zu beruhigen, atmete sie tief durch und lauschte dem Prasseln des strömenden Regens in dieser stürmischen, düsteren Gewitternacht.
Draußen war nichts als Dunkelheit. Der Himmel war schwarz und sternenlos. Heftige Böen peitschten den Regen gegen die Scheibe. Wieder zuckte ein Blitz über den Himmel, gefolgt von krachendem Donner, der durch die Straßenschluchten New Yorks rollte. An der gesamten Ostküste wütete der Sturm. Jennifer war jetzt hellwach. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen; die Angst nahm ihr den Atem.
Schon wieder hatte sie bei einem Unwetter ein Albtraum gequält. Und schon wieder war dieser Albtraum so realistisch gewesen, so echt, dass ihr jetzt noch die Knie zitterten.
Mit unsicheren Schritten ging Jennifer über den Flur ins Bad, zog das Handtuch aus der runden Halterung und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Anschließend ging sie in die Küche, schaltete das Licht an der Abzugshaube ein, nahm eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank, goss ein großes Glas voll und warf ein paar Eiswürfel hinein. Nachdem sie einen kräftigen Schluck getrunken hatte, ging sie zurück ins Schlafzimmer, setzte sich aufs Bett, lehnte sich gegen die Wand, drückte sich das Wasserglas gegen die erhitzte Stirn und blickte auf die blassgrüne Digitalanzeige der Uhr auf dem Nachttisch: 3:05.
Sie nahm die Schlaftabletten vom Nachttisch, öffnete das Plastikröhrchen und spülte zwei Tabletten mit einem Schluck Wasser hinunter. Gern nahm sie die Tabletten nicht, doch sie wollte schlafen, ohne von Albträumen gepeinigt zu werden, und vielleicht half das Medikament.
Ihre Wohnung in Long Beach war klein: Schlafzimmer, Wohnraum, kleine Küche, winziges Bad. Bei klarem Wetter konnte sie über die Bucht bis Cove End blicken, wo ihr Elternhaus stand, ein grauweiß gestrichenes Kolonialhaus, das einsam und verlassen dalag. Jennifer war von dort weg und in die kleine Wohnung gezogen, weil sie neu anfangen wollte. In dem großen alten Haus, das sie mit schrecklichen Erinnerungen quälte, konnte sie nicht mehr leben.
Doch ein Neubeginn war ihr nicht gelungen. Die Fesseln der Vergangenheit hielten sie gefangen, und der Albtraum kehrte immer wieder. Was sie auch tat, um die Erinnerungen vergessen zu machen – die Vergangenheit meldete sich hartnäckig zurück. Erinnerungen an das Leben, das sie mit ihrem Vater und ihrer Mutter geteilt hatte.
Und das für immer verloren war.
Von Zeit zu Zeit waren die Albträume besonders schlimm, voller Entsetzen und Schmerz, und wollten einfach nicht loslassen – so wie heute Nacht. Und wie zuvor in solchen Nächten hatte Jennifer auch diesmal den brennenden Wunsch, die Stimme eines anderen Menschen zu hören, der ihr Halt gab und sie spüren ließ, dass sie nicht ganz allein war.
Wieder blickte Jennifer auf die Anzeige der Uhr: 3:06.
Es gab nur einen Menschen, mit dem sie mitten in der Nacht über ihre Verzweiflung sprechen konnte. Jennifer nahm das Telefon, stellte es neben sich aufs Bett und drückte auf die beleuchteten Ziffern. Zehn Kilometer entfernt – in Elmont, Long Island – klingelte es mehrere Male, bevor der Hörer abgenommen wurde. Eine schläfrige Männerstimme meldete sich.
»Hallo …?«
»Ich bin’s.«
»Jennifer? Alles in Ordnung?«
Mark Ryan war sofort hellwach, als er ihre Stimme erkannte. Jennifer spürte seine Besorgnis. »Tut mir Leid, Mark. Ich weiß, es ist schon eine Weile her, aber ich wusste nicht, wen ich um diese Zeit sonst anrufen kann …«
»Schon gut, Jennifer. Ich bin immer für dich da.«
»Tut mir Leid, dass ich dich geweckt habe …«
»Macht nichts. Ich bin gerade erst zu Bett gegangen und hatte noch nicht richtig geschlafen.« Er lachte leise. »Dein Glück. Normalerweise weckt mich nicht einmal ein Erdbeben.« Ein lauter Donnerschlag ließ die Fensterscheiben klirren.
»Ein verdammtes Unwetter, nicht wahr?«, sagte Mark.
»Ja.«
»Hattest du wieder einen Albtraum? Hast du deshalb angerufen, Jennifer?«
»Ja. Es war wieder derselbe Traum. Ich … ich konnte ihn sehen. Er war bei mir im Schlafzimmer. Mark, ich hatte das Gefühl, es wäre Wirklichkeit … und meine Fantasie hat alles noch viel schlimmer gemacht.« Sie verstummte kurz. »Manchmal glaube ich, den Verstand zu verlieren. Ich vermisse sie schrecklich, Mark. Ohne sie fühle ich mich einsam und verloren. Ich dachte immer, mit der Zeit wird es besser, aber so ist es nicht. Es ist jetzt zwei Jahre her, aber manchmal kommt es mir vor, als wäre es erst gestern geschehen.«
Mark hörte ihr zu. »Es ist nicht einfach, Jennifer«, sagte er dann. »Und an Geburtstagen ist es besonders schlimm, vor allem, wenn solch tragische Erinnerungen damit verbunden sind. Du musst dir immer wieder deutlich machen, dass der Mann nie wieder kommt. Niemals. Du musst es dir klar machen, Jennifer, sonst wirst du nie damit fertig.«
Jennifer starrte in die Dunkelheit, lauschte dem Rauschen des strömenden Regens. Auf der anderen Seite der sturmgepeitschten Bucht lag Cove End, eingehüllt von der kalten, schwarzen Nacht. Einst war es ein warmes, freundliches Zuhause gewesen, voller angenehmer Erinnerungen …
»Bist du noch dran, Jennifer?«, fragte Mark.
»Ja.«
»Deine Mutter hätte nicht gewollt, dass du dich an ihrem Geburtstag mit Erinnerungen quälst. Denk nicht mehr an den verdammten Traum. Es ist bloß ein Traum. Leg dich wieder hin. Mach einfach die Augen zu, und versuch zu schlafen. Tust du mir den Gefallen, Jennifer?«
»Ich habe Schlaftabletten genommen, Mark.«
»Wie viele?«
»Zwei.«
»Okay«, sagte Mark. »Meinst du, du kannst schlafen?«
»Ich glaub schon.«
»Was hältst du davon, wenn wir morgen telefonieren und in aller Ruhe reden?«
»Ja … ist ’ne gute Idee.«
»Dann schlaf jetzt, Jennifer. Versuch es.« Sie hörte ein leises Lachen, als wollte Mark sie auf andere Gedanken bringen. »Wenn ich bei dir wäre, würde ich dich in den Schlaf wiegen.«
»Ich weiß. Danke, Mark. Danke, dass du mir zugehört hast.«
»Wozu hat man Freunde? Wir kennen uns schon eine halbe Ewigkeit, vergiss das nicht. Schlaf jetzt. Ich ruf dich an.« Er hielt kurz inne und fügte hinzu: »Pass auf dich auf, Jennifer.«
Er legte auf.
Nur noch der Regen und der ferne Donner unterbrachen die Stille der Nacht. Schließlich legte auch Jennifer den Hörer auf, schlug die Decke über sich und zog die Beine an den Leib. Wie ein Kind bettete sie den Kopf auf die Hände und starrte auf die regengepeitschte Fensterscheibe, bis allmählich die Wirkung des Schlafmittels einsetzte. Gefangen im Niemandsland zwischen Wachen und Schlafen, arbeiteten ihre Gedanken noch eine Zeit lang weiter. Sie wusste, dass niemand ihr helfen konnte. Das konnte nur sie selbst. Sie musste lernen, mit den Dämonen, die ihre Seele quälten, in Frieden zu leben. Irgendwie. Doch tief im Innern wusste sie, dass es unmöglich war …
Zumindest war der maskierte Mann nicht mehr da. In dieser Nacht kehrte der Albtraum nicht wieder. Wenigstens das.
Endlich fielen Jennifer die Augen zu, und sie ergab sich für den Rest der Nacht dem erlösenden Schlaf.
3
John F. Kennedy International AirportNew York
Nadia betete, es möge bald vorbei sein.
Wenn sie die nächsten fünf Minuten überlebte, hatte sie es geschafft. Wenn nicht, war sie so gut wie tot.
Sie drückte Alexi, das Baby, ängstlich an ihre Brust und umfasste die kleine Hand ihrer zweijährigen Tochter Tamara. Auf dem Flughafen herrschte reges Treiben. Nadia war zum ersten Mal auf dem John F. Kennedy Airport. Der Lärm und die Menschenmengen machten ihr Angst, obwohl die Männer ihr gesagt hatten, welcher Trubel sie am Flughafen erwartete. Auf Nadias Stirn bildeten sich Schweißperlen. Das Wollkleid klebte auf ihrem Rücken.
Die dreiundzwanzigjährige Frau hatte blaue Augen und ein unschuldiges Gesicht. Das war auch der Grund dafür, dass die Wahl der Männer auf sie gefallen war. Und Nadias Tochter Tamara ähnelte ihr sehr: ein hübsches, kleines, rundes Gesicht mit großen, unschuldigen Augen. Nadia liebte das Mädchen über alles.
Sie dachte an Moskau zurück, an das harte Leben dort. Es war schwer, sich in der Acht-Millionen-Stadt durchzuschlagen. Nadia hatte in einem winzigen Zimmer im vierten Stock einer Mietskaserne gewohnt – für fünftausend Rubel im Monat. Heißes Wasser gab es nicht, und in dem Zimmer tummelten sich Ratten und Ungeziefer.
Nadia Fedow wollte Tamara ein besseres Leben ermöglichen. Das Mädchen sollte nicht so enden wie seine Mutter, die in einem Nachtclub arbeitete, der nichts anderes war als ein Bordell. Sie sollte nicht eines Tages für eine Hand voll Rubel von betrunkenen Männern brutal missbraucht werden. Sie sollte eine schöne Wohnung haben, ein sauberes Bett, heißes Wasser. Sie sollte in einer guten Wohngegend aufwachsen und nette Spielgefährten haben. Das war Nadias sehnlichster Wunsch.
Sie betrachtete Tamara, die nach dem achtstündigen Flug von Moskau nach New York müde und quengelig war. Ihr Haar war zerzaust, und sie rieb sich die Augen.
»Schlafen, Mama.«
»Gleich kannst du schlafen, Tamara. Gleich«, sagte Nadia, wiegte das in eine blaue Decke gewickelte Baby sanft in den Armen und blickte zum Schalter der Einwanderungsbehörde. Nur eine Person war vor ihr an der Reihe. Ungeduldig stand Nadia vor dem gelben Strich auf dem Boden, der die Wartezone markierte.
»Hab keine Angst«, flüsterte sie, um sich selbst zu beruhigen.
Nadias Reisepass war eine hervorragende Fälschung. Die Namen ihrer Kinder standen in dem Dokument, und auf einer Seite war der Stempel mit dem amerikanischen Visum. Jetzt war sie an der Reihe. Der Beamte der Einwanderungsbehörde in der blauen Uniform bat sie an den Schalter. Nadia trat vor und reichte ihm den Reisepass mit dem Einreiseformular, das sie im Flugzeug ausgefüllt hatte.
Der Mann blätterte den Pass durch, schaute auf das Foto, warf einen musternden Blick in Nadias Gesicht und legte den Pass auf ein elektronisches Prüfgerät. »Ihr Ticket bitte«, sagte er dann und streckte den Arm aus.
Nadia reichte ihm das Flugticket. Der Beamte überprüfte es und musterte die junge Frau erneut. »Sie wollen zwei Wochen in New York bleiben?«
»Ja.«
»Unter dieser Adresse?«
»Ja.«
»Mit den beiden Kindern?«
»Ja.«
Der Beamte beugte sich über den Schalter, um einen Blick auf Tamara werfen zu können. Das kleine Mädchen lächelte den Mann an und klammerte sich schüchtern an das Kleid ihrer Mutter.
»Ein hübsches Kind«, sagte der Mann.
»Ja.« Nadia lächelte nervös. Der Mann war nett, ganz anders, als sie erwartet hatte. Er warf einen kurzen Blick auf das Baby, das in die Decke gewickelt auf Nadias Arm lag. Anschließend heftete er das Einreiseformular an eine Seite des Passes, stempelte ihn und reichte ihn mitsamt dem Ticket an Nadia zurück.
»Danke, Ma’am. Angenehmen Aufenthalt in New York.«
Doch damit war die Prozedur noch nicht überstanden. Nadia holte ihren Koffer vom Band, besorgte sich einen Gepäckwagen und näherte sich dem Zoll. Sie schob den Wagen mit einer Hand und drückte das Baby mit der anderen an ihre Brust. Die kleine Tamara hielt sich am Gepäckwagen fest.
Wieder stieg schreckliche Angst in Nadia auf. Ihr Herz pochte wild. Sie wiegte den Säugling in den Armen und flüsterte: »Schlaf, Alexi, schlaf.« Langsam schritt sie auf den zehn Meter entfernten Zollschalter zu, an dem mehrere uniformierte Beamte standen. Eine automatische Tür führte in den Ankunftsbereich.
Die Freiheit ist zum Greifen nahe, dachte Nadia. Alles, was ich mir für Tamara wünsche, ist jetzt in Reichweite.
Sie sagte sich wieder und wieder, dass alles gut ginge, doch ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Die Männer hatten ihr erklärt, dass die Zollbeamten die Passagiere oft gar nicht anhielten. Vor allem darfst du sie nicht ansehen, darfst keinen Blickkontakt herstellen und auf gar keinen Fall Angst oder Misstrauen zeigen. Diese Männer können Angst riechen wie Spürhunde. Verhalte dich wie ein ganz normaler Passagier, der nichts zu verbergen hat.
Nadia rief sich diese Tipps in Erinnerung. Trotzdem kostete es sie unendliche Mühe, Ruhe zu bewahren, als sie sich mit dem Gepäckwagen und dem Baby auf dem Arm dem Abfertigungsbereich näherte. Die meisten Fluggäste passierten ungehindert den Zoll; die Beamten schienen kein Interesse zu haben, jemanden anzuhalten – auch Nadia nicht. Nur einer der Zollbeamten schaute sie an, als sie ihr Baby in den Armen wiegte und leise, aber vernehmlich sagte: »Schlaf, Alexi.«
Der Mann hielt sie nicht auf. Nadia fiel ein Stein vom Herzen. Doch als sie sich dem Ankunftsbereich näherte, legte ein anderer Zollbeamter eine Hand auf ihren Gepäckwagen.
»Ist das Ihr Gepäck, Ma’am?«
Das Herz schlug Nadia bis zum Hals. »Da, mein … Gepäck.« Lass dir deine Nervosität nicht anmerken. »Folgen Sie mir bitte.« Wenn du angehalten wirst, tust du, was man dir sagt. Ganz ruhig bleiben, keine Angst zeigen.
Nadia hatte schreckliche Angst, als sie den Wagen an den Schalter schob. Schwindel überkam sie, und sie hatte das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Der Mann hob den Koffer vom Gepäckwagen und legte ihn auf den Metalltisch.
»Würden Sie Ihren Koffer bitte öffnen?«, bat er sie.
Nadia hatte Mühe, ihre Tasche aufzubekommen, als sie nach dem Schlüssel suchte. Sie schwitzte vor Angst. Spürte der Mann ihr Unbehagen? Endlich fand sie den Schlüssel. Mit dem Baby auf dem Arm schickte sie sich an, den Koffer zu öffnen. Ihre Hand zitterte leicht, und es gelang ihr nicht, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Der Mann sagte freundlich: »Lassen Sie mich das machen.«
Er schloss den Koffer auf und durchsuchte ihre Habseligkeiten. Billige Kleidungsstücke und Unterwäsche von Nadia und den Kindern. Eine kleine, in Geschenkpapier eingewickelte Schachtel mit einer rosafarbenen Schleife lag zwischen den Sachen. Sofort zog sie die Aufmerksamkeit des Zollbeamten auf sich. Er legte sie zur Seite und durchsuchte die restlichen Sachen rasch und gründlich. Als er fertig war, nahm er die Schachtel auf. »Was ist darin, Ma’am?«
»Ein Geschenk. Für meinen Cousin.«
»Was für ein Geschenk?«
»Eine Krawatte.«
Der Mann schüttelte die Schachtel, hörte aber kein verräterisches Geräusch im Innern. Er musterte Nadia, schaute auf das Baby auf ihrem Arm und blickte hinunter auf Tamara. Dann wandte er sich wieder Nadia zu.
»Mit welcher Maschine sind Sie geflogen, Ma’am?«
Nadia antwortete langsam: »Flug 3572. Aus Moskau. Ich bin gerade erst gelandet.«
Sie wiegte Alexi in den Armen, um ihre Nervosität zu bezwingen.
Der Mann runzelte die Stirn. »Ist mit dem Baby alles in Ordnung?«
»Es ist sehr erschöpft«, erwiderte Nadia. »Es war ein langer Flug.«
Der Mann schaute nachdenklich auf die Schachtel in seiner Hand, als wüsste er nicht, wie er weiter vorgehen sollte. »Würden Sie bitte mit ins Büro kommen?«
»Aber mein Baby! Ich muss mich um den Kleinen kümmern …«
»Es dauert nicht lange.«
Der Mann schob den Gepäckwagen zur Tür. Eine Kollegin öffnete ihm. Sie war klein, hübsch und dunkelhaarig und hatte mexikanisches Blut in den Adern. Auf dem Namensschild über ihrem linken Busen stand »Reta Hondalez«. Nadia wurde übel vor Angst, als sie ein kleines, überhitztes Büro betrat. Ganz fest hielt sie Tamaras Hand. Die Kleine blickte verwundert und schien sich zu fragen, warum die fremden Leute mit ihrer Mutter sprechen wollten.
Der Mann legte die Schachtel auf den Tisch. Seine Kollegin stellte sich neben ihn. »Tut mir Leid, aber ich muss die Schachtel öffnen. Haben Sie etwas dagegen?«
»Wie bitte?«
»Habe ich Ihr Einverständnis, das Geschenk zu öffnen?«
Nadia nickte und versuchte, das Zittern ihrer Stimme zu unterdrücken. »Ja … sicher.«
Der Zollbeamte zog vorsichtig die Schleife auf, entfernte das Geschenkpapier und hob den Deckel ab. Eine billige, gemusterte Nylonkrawatte war alles, was er in der Schachtel fand. Der Mann sah ein wenig verärgert aus. Röte stieg ihm in die Wangen – sei es aus Verlegenheit oder weil er nichts gefunden hatte. »Würden Sie mir bitte Ihren Reisepass zeigen?«
Nadia wühlte in ihrer Handtasche und zog den Pass heraus, wobei er ihr fast aus der Hand gefallen wäre. Der Zollbeamte fing ihn auf und blätterte ihn durch. »Sind das Ihre Kinder?«
»Ja. Sie stehen im Reisepass.«
»Ich weiß. Aber sind es Ihre eigenen Kinder?«
»Ja.«
»Wie alt ist das Baby?«
»Drei Wochen.«
Der Zollbeamte schaute auf das Bündel in Nadias Armen. Nadia sagte leise: »Es geht ihm nicht gut. Der lange Flug …«
»Das sagten Sie bereits. Ich werde Sie auch nicht länger aufhalten.« Der Zollbeamte reichte Nadia den Reisepass zurück, wobei er noch einmal auf das Baby schaute, das behaglich in die hellblaue Decke gewickelt war, die Augen geschlossen. Es sah friedlich aus.
Der Beamte zögerte; dann strich er, einem Instinkt folgend, über die Wange des Babys. Im gleichen Moment wurde er blass und blickte Nadia entsetzt an. In seinen Augen spiegelte sich die Wahrheit, die Nadia bereits kannte.
»Ma’am, Ihr Baby ist tot!«
Die 113. Polizeiwache in New York befand sich in einem tristen Gebäude am Baisley Boulevard. Diese Wache war für den Stadtteil Queens sowie für einen der größten Flughäfen der Welt zuständig, den John F. Kennedy International.
Jennifer March parkte ihren blauen Ford und betrat das Gebäude durch den Haupteingang. Der Sergeant am Schalter und ein paar uniformierte Kollegen kümmerten sich um die Wartenden. Der Polizist hob den Blick, als er die junge, attraktive Frau mit der Aktentasche erkannte. Sie war Ende zwanzig, hübsch und dunkelhaarig. Das modische blaue Kostüm betonte ihre schlanke Figur. Der Sergeant lächelte sie freundlich an. »Hi, Jennifer!«
»Ist Mark da?«
»Er müsste in seinem Büro sein.«
»Danke, Eddy.«
»Kein Problem.«
Jennifer ging den Flur hinunter und klopfte an die Tür.
»Immer hereinspaziert.«
Sie betrat das kleine, beengte Büro mit den gelbgrauen Wänden. Der Schreibtisch war mit Papierkram übersät. Hinter dem Computer saß ein Kriminalbeamter in Zivil, der auf die Tastatur tippte. Er lächelte jungenhaft und nahm einen Schluck Kaffee aus einem Plastikbecher.
»Heute ist wohl mein Glückstag. Hallo, Jenny«, sagte Mark Ryan.
Der dunkelhaarige Detective war Mitte dreißig. Er hatte freundliche grüne Augen und eine gewinnende Art. Er stand auf, kam um den Schreibtisch herum und drückte Jennifer die Hand. »Was führt dich zu mir?«
»Der Bezirksstaatsanwalt hat mich gebeten, die Voruntersuchung im Fall Fedow zu übernehmen, da niemand anders zur Verfügung stand. Aber er wurde mitten im Telefonat unterbrochen, deshalb fehlen mir ein paar Angaben. Ich hoffe, du kannst mir helfen.«
»Klar, kein Problem.« Ryan warf ihr einen besorgten Blick zu. »Und? Wie hast du den Rest der Nacht überstanden?«
Jennifer strich ihm über den Arm. »Gut, Mark. Nett von dir, dass du mir zugehört hast. Du bist der Einzige, den ich anrufen konnte. Einer der wenigen Menschen, der mich versteht.«
»Wozu sind gute Freunde da? Möchtest du einen Kaffee, bevor wir anfangen?«
»Nein, danke. Keine Zeit. Ich habe heute Nachmittag noch einen anderen Termin. Deshalb würde ich gern sofort anfangen.«
»Müssen die armen Anwälte samstags immer so schuften?«
Jennifer zog einen Notizblock und einen Stift aus ihrer Aktentasche und schaute grinsend auf Ryans voll gepackten Schreibtisch. »Wie es aussieht, steckst du ebenfalls bis zum Hals in Arbeit.«
Ryan verzog das Gesicht. »Was will man machen.« Er setzte sich auf die Schreibtischkante und bot ihr einen Platz an.
Jennifer setzte sich. Ryan stellte seinen Kaffeebecher auf den Schreibtisch. »Ihr Name ist Nadia Fedow. Die Zollbeamten haben sie heute Morgen am Flughafen geschnappt. Sie kam mit einem drei Wochen alten Baby im Arm mit einer Aeroflot-Maschine aus Moskau.«
»Und?«
»Der Leib des Säuglings war von oben bis unten aufgeschnitten und wieder zusammengenäht. Die Gerichtsmediziner haben fünf Pfund Heroin in dem Leichnam gefunden.«
Jennifer wurde erschreckend blass.
»Alles in Ordnung?«, fragte Mark besorgt.
»Ja … geht schon.«
»Soll ich dir ein Glas Wasser holen?«
»Nein. Wie lange war das Kind schon tot?«
»Etwa sechzehn Stunden. Der Flug dauerte acht Stunden. Wenn wir für die Zeit nach der Landung eine Stunde einkalkulieren und drei Stunden bis zur Autopsie, müsste das Kind ungefähr vier Stunden, bevor die Frau Moskau verließ, gestorben sein.«
»Wurde das Kind getötet?«
»Die Gerichtsmedizin geht von einem natürlichen Tod aus, aber der endgültige Bericht liegt bisher nicht vor. Da alle inneren Organe entfernt wurden, könnte es schwierig werden, die genaue Todesursache zu bestimmen.«
Jennifer schüttelte den Kopf. Noch immer war die Farbe nicht in ihre Wangen zurückgekehrt. »So etwas Grauenhaftes habe ich noch nie gehört. Und ich dachte, mich könnte so schnell nichts mehr erschüttern.«
»Ja, es ist unglaublich. Aber mit solch abscheulichen Verbrechen haben wir ständig zu tun. Rauschgiftschmuggel. Diese Art des Schmuggelns soll im Fernen Osten häufig praktiziert werden. Mir persönlich ist ein solcher Fall bis heute nicht begegnet. Die Schmuggler stehlen ein totes Kind aus dem Leichenschauhaus und entfernen ein paar Stunden, ehe die Drogen auf Reisen gehen, die inneren Organe. Der Leichnam wird mit Formaldehyd konserviert und das Rauschgift im Bauchraum festgenäht. Die junge Frau hat den Leichnam des Säuglings die ganze Nacht sorgfältig zugedeckt und ihn kaum aus den Armen gelegt.« Ryan atmete tief ein. »Die Menschen, die dahinter stecken – wenn man sie überhaupt als menschliche Wesen bezeichnen kann – kennen keine Skrupel. Das sind Bestien, Jenny.« Ryan schaute sie an. »Aber … du kennst das ja.«
Jennifer wurde übel. »Und was ist mit der jungen Frau?«
»Sie ist dreiundzwanzig. Russin. Ihr Reisepass ist gefälscht. Die Arbeit eines Profis. Der Pass wurde gestohlen und mit den entsprechenden Änderungen sowie einem US-Visum versehen. Eine verdammt gute Fälschung. Den Schalter der Einwanderungsbehörde hat die Frau damit mühelos passiert.«
Jennifer machte sich ein paar Notizen. »Sonst noch was?«
»Sie hatte noch ein anderes Kind bei sich. Ein kleines Mädchen von zwei Jahren. Das Jugendamt kümmert sich um die Kleine.«
»Und das tote Baby? War es ihres?«
»Nein. Sie behauptet, ein Paar, das sie nie zuvor gesehen hatte, hätte es ihr am Moskauer Flughafen übergeben.«
»Und das kleine Mädchen?«
»Angeblich ihre Tochter. Sie heißt Tamara.«
»Was hast du für einen Eindruck?«
»Von der Tochter?«
»Von der Mutter und der Tochter.«
Ryan zuckte mit den Schultern. »Das Kind ist völlig verstört und fragt ständig nach seiner Mama. Und die Mutter ist total verängstigt. Sie weiß, dass sie für Jahre in den Knast wandert. Bei solchen Fällen wünsche ich mir manchmal, ich wäre nie zur Polizei gegangen.«
»Wie viel hat man der Frau gezahlt?«
»Zehntausend Dollar, behauptet sie.«
»Was hat sie sonst noch gesagt?«
»Nichts. Sie verweigert jede weitere Aussage und bittet um einen Anwalt. Irgendetwas scheint ihr eine Heidenangst einzujagen.«
»Glaubst du, sie steckt in der Sache mit drin?«
»Das kann ich nicht beurteilen.« Ryan seufzte. »Könnte sein, dass sie bedroht und dazu gezwungen wurde, aber wer weiß? Sie hat sich nicht dazu geäußert.«
»Wurde sie über ihre Rechte aufgeklärt?«
»Für wen hältst du mich, Jenny? Du kennst mich doch.«
Jennifer ließ ihren Notizblock sinken und hob den Blick. »Und was geschieht jetzt mit ihr, Mark?«
»Das müsstest du eigentlich wissen. Egal, wie tief sie mit drinsteckt – auf jeden Fall kam sie mit gefälschten Papieren in die USA und hat fünf Pfund reines Heroin im Leichnam eines Babys geschmuggelt. Das Zeug hat einen Verkaufswert von mehr als einer Million Dollar. Sie könnte zwanzig Jahre in Bedford kriegen … fünfzehn, wenn sie Glück hat. Auf jeden Fall wandert sie in den Knast. Es sei denn, sie macht den Mund auf. Vielleicht spricht sie ja mit dir.«
»Und ihre Tochter?«
»Wird zurück nach Moskau geschickt. Zu Verwandten, wenn es welche gibt. Sonst kommt sie in ein Waisenhaus.«
»Spricht sie Englisch?«
»Die Mutter? Ja, ganz gut, und sie ist nicht dumm. Du brauchst keinen Dolmetscher. Aber wenn du einen haben möchtest, besorge ich dir jemand.«
Jennifer schüttelte den Kopf und packte ihre Sachen zusammen.
Die Tür zum Verhörzimmer fiel ins Schloss. Jennifer betrachtete die junge Frau, die sich zögernd hinter dem Holztisch erhob. Sie sah jünger aus, als Jennifer erwartet hatte. Mit den blassen Wangen und den großen, unschuldigen Augen hätte sie als Achtzehnjährige durchgehen können. Ihr billiges blaues Wollkleid war abgetragen und an einigen Stellen geflickt. In ihren vom Weinen geröteten Augen spiegelte sich tiefste Verzweiflung.
Jennifer reichte ihr die Hand. »Hallo, Nadia. Mein Name ist Jennifer March. Ich wurde als Ihre Anwältin bestimmt. Verstehen Sie, was ich sage?«
Die junge Frau begrüßte sie mit zitternder Hand. »Da … ich verstehe Sie gut.«
»Ist alles in Ordnung?«
In den Augen der jungen Russin schimmerten Tränen. »Ich möchte meine Tochter sehen.«
»Vielleicht kann ich es später einrichten, aber jetzt müssen wir zuerst miteinander reden. Setzen Sie sich, Nadia.«
Jennifer zog sich einen Stuhl heran und nahm der jungen Frau gegenüber Platz.
»Ich kann Sie nicht bezahlen«, sagte Nadia. »Ich habe kein Geld.«
»Keine Sorge. Die Stadt New York übernimmt die Gerichtskosten. So verlangt es das Gesetz. Sie haben das Recht auf einen Anwalt, der Ihre Verteidigung übernimmt, auch wenn Sie Ausländerin sind, die illegal in die USA eingereist ist und die keine erkennbaren finanziellen Mittel hat. Haben Sie mich verstanden, Nadia?«
Die junge Frau nickte.
»Sie wurden mit einer großen Menge Heroin geschnappt. Außerdem trugen sie ein totes Baby bei sich, das möglicherweise zum Zweck des Heroinschmuggels getötet wurde. Das sind sehr schwer wiegende Beschuldigungen. Deshalb wäre es das Beste, wenn Sie mir die Wahrheit sagen. Erzählen Sie mir alles von Anfang an.«
Nadia Fedow rieb sich die Augen. »Ich arbeite in Moskau in einem Nachtclub. Vorher habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, aber keinen Job bekommen. Deshalb habe ich in dem Nachtclub angefangen. Manchmal kommen zwei Männer in den Club, die mit dem Geld nur so um sich werfen. Sie beobachten mich immer. Eines Tages sagt einer zu mir: ›Würde es dir gefallen, zehntausend Dollar zu verdienen?‹ Ich habe ihn gefragt, was ich dafür tun muss. Die Männer sagten mir, dass ich irgendetwas nach New York bringen soll und dass sie mir und meiner Tochter einen russischen Reisepass mit einem amerikanischen Visum geben würden. Ich habe sie gefragt, was ich hierher bringen soll. Etwas Wichtiges, sagten sie.« Nadia hielt kurz inne. »Zehntausend Dollar sind sehr viel Geld … und ich dachte, mit dem amerikanischen Visum könnte ich vielleicht in den USA bleiben und müsste nie mehr nach Moskau zurück. Darum habe ich den Männern gesagt, dass ich es mir überlege.«
Jennifer ermunterte sie fortzufahren.
»Ein paar Tage später kommen die beiden wieder in den Nachtclub und sagen mir, dass ich … dass ich ein totes Baby mitnehmen muss. Es würde als mein eigenes Kind in meinen Reisepass eingetragen. In dem Leichnam wären Drogen versteckt. Ich war fassungslos und bekam schreckliche Angst. Ich fragte die Männer, woher sie das tote Kind hätten. Sie sagten, das ginge mich nichts an. Aber allein die Vorstellung, im Körper eines toten Babys Drogen zu schmuggeln … es war grauenhaft, unvorstellbar. Ich sagte, dass ich so etwas niemals tun würde. Daraufhin haben die Männer mich geschlagen … haben gesagt, sie würden meiner Tochter etwas antun und sie töten, wenn ich nicht tun würde, was sie verlangen. Wenn ich das Baby … das Rauschgift … nach Amerika schmuggle, würde ich das Geld bekommen, und mir und meiner Tochter geschähe nichts. Also habe ich getan, was sie von mir verlangten …«
»Was sollten Sie nach Ihrer Ankunft in New York mit dem toten Baby machen?«
»Die Männer sagten, dass in einem Hotel in der Nähe des Flughafens Leute auf mich warten. Ich selbst kenne die Leute nicht, aber sie wissen, wer ich bin. Sie sollten mir das Baby abnehmen und mich bezahlen. Danach, sagten die Männer mir, könne ich den Reisepass behalten und gehen, wohin ich will …«
Jennifer beugte sich vor und sah der Russin ins Gesicht. »Ist das die Wahrheit, Nadia?«
Nadia Fedow bekreuzigte sich. »Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist.«
»Warum haben Sie dem Zoll am Flughafen nicht einfach gesagt, dass Sie gezwungen wurden, Drogen zu schmuggeln?«
»Weil die Männer gedroht haben, mich und meine Tochter zu ermorden, wenn ich der Polizei etwas sage.«
»Wie heißen die Männer?«
Nadia Fedow zuckte mit den Schultern. »Das weiß ich nicht. Und wenn ich es wüsste, könnte ich es Ihnen nicht sagen.«
»Warum nicht? Haben Sie Angst?«
»Ja, furchtbare Angst. Die Männer haben gesagt, sie würden mich auch dann finden und töten, wenn ich im Gefängnis sitze. Mich und meine kleine Tochter.« Nadia Fedow biss sich auf die Unterlippe. »Diese Männer sind brutal … grausame Bestien, die keine Gnade kennen. Sie sagten mir, dass alles ganz einfach sei und dass niemand mich schnappen würde. Mit zwei Kindern würde man mich nicht für eine Drogenschmugglerin halten. Aber falls ich doch geschnappt und der Polizei etwas sagen würde … wie die Männer aussehen, woran man sie erkennen kann … drohten sie mir, mich zu töten.«
»Warum haben Sie zuerst eingewilligt? Warum haben Sie getan, was diese Männer Ihnen vorgeschlagen haben, Nadia? Sie wussten doch, dass es gegen das Gesetz verstößt.«
Wieder biss Nadia sich auf die Lippe. »Ich habe es für meine Tochter getan.«
»Ich verstehe nicht …«
»Sie sind Amerikanerin. Sie leben in einem reichen Land. Sie wissen nicht, was es heißt, arm zu sein. Kein Geld zu haben, keine Hoffnung. Kein Leben zu haben, nur Armut und Leid. Ich wollte nicht, dass meine Tochter arm ist und leidet. Ich wollte ihr ein schönes Leben hier in Amerika ermöglichen. Und nun werde ich sie niemals wieder sehen.«
Nadia Fedow schlug schluchzend die Hände vors Gesicht. Jennifer legte eine Hand auf ihre Schulter und versuchte sie zu trösten. Doch es war vergebens.
Mark Ryan wartete auf dem Gang auf Jennifer. »Und? Wie ist es gelaufen?«
»Sie wurde hereingelegt, Mark. Man hat sie benutzt.«
»Ich hab mir gleich gedacht, dass sie nur den Kurier gespielt hat. Menschen wie sie werden eingespannt, den gefährlichsten Teil des Jobs zu übernehmen. Arme Schlucker, die es wegen des Geldes tun, oder weil sie bedroht wurden, oder beides. Die Haie kassieren ab und kommen meist ungeschoren davon. Glaubst du, sie wird reden?«
»Das bezweifle ich. Sie hat wahnsinnige Angst.«
»Kein Wunder. Wahrscheinlich haben die Typen ihr gedroht, sie im Gefängnis umzulegen, falls sie den Mund aufmacht.« Ryan sah die Tränen in Jennifers Augen. »Alles in Ordnung? Du siehst ziemlich fertig aus.«
»Es geht schon. Ich muss nur immer an das tote Baby denken … und an Nadia und ihre Tochter, deren Leben verpfuscht ist.«
Ryan strich Jennifer über den Arm. »Nimm es nicht so schwer. Denk an das oberste Gebot: stets professionellen Abstand wahren. Sonst stehst du diesen Job nicht durch.«
»Was ist mit Nadias Tochter? Darf sie das Mädchen sehen?«
»Ich schau mal, was ich tun kann.«
»Versprochen?«
»Klar.«
»Danke, Mark.«
»Und wie geht es dir sonst?«
»Kann nicht klagen.«
»Und Bobby?«
»Bobby geht’s gut.«
»Ich war ein paar Mal im Cauldwell draußen und hab ihn besucht. Aber das ist schon einige Monate her. Ich sollte mal wieder hinfahren.«
»Er würde sich freuen.«
Ryan zögerte. »Vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für diese Frage, aber hättest du Zeit, diese Woche mit mir essen zu gehen?«
»Tut mir Leid, Mark. Im Augenblick sieht es schlecht aus. Ich stecke bis zum Hals in Arbeit. Nächste Woche?«
Ryan errötete und lächelte Jennifer gequält an. »Sicher. Wann du möchtest. Soll ich dir einen guten Rat geben? Geh nach Hause und denk nicht mehr an diese Sache. Die Frau da drinnen in dem blauen Kleid zerbricht sich den Kopf für drei.«
Jennifer betrat die Toilette im Erdgeschoss und versuchte sich zu beruhigen. Seit einem Jahr arbeitete sie in der Kanzlei des Bezirksstaatsanwalts. Sie liebte ihre Arbeit, auch wenn sie sich manchmal schreckliche Dinge anhören musste.
Die Geschichte, die sie soeben gehört hatte, berührte sie ganz besonders. In gewisser Weise identifizierte sie sich mit der jungen Russin. Jennifer wusste, was es hieß, verletzt zu werden und ein Trauma zu erleiden. Sie wusste nur zu gut, was es bedeutete, wenn das eigene Leben durch brutale Bestien zerstört wurde. Ihre Narben waren bis heute nicht verheilt, der Schmerz nicht abgeklungen. Deshalb konnte sie nachfühlen, was Nadia jetzt durchmachte.
Die junge Anwältin betrachtete sich im Spiegel. Sie hatte ein lebhaftes, interessantes Gesicht mit vollen Lippen, dunkelbraunes Haar und glatte, helle Haut. Ihre blauen Augen sprühten vor Intelligenz. Mit ihrem hübschen Gesicht, der schlanken Figur, den langen Beinen und dem festen Busen war Jennifer eine attraktive Frau, die auf Männer wirkte, auch wenn ihre ein wenig abweisende Art den meisten Männern den Mut nahm, sich ihr zu nähern. Es war keine Arroganz, sondern ein Schutzpanzer, den sie sich nach dem Tod ihrer Mutter zugelegt hatte.
Über mangelnde Kontakte konnte sie sich dennoch nicht beklagen. Sie trainierte im Fitnessstudio und ging ab und zu mit ehemaligen Studienkollegen in ein Café, eine Bar oder ein Restaurant. Richtige Freunde hatte sie wenige. Sie wohnte in einer kleinen Mietwohnung und fuhr einen fünf Jahre alten Ford. Mit fast dreißig Jahren war sie noch immer unverheiratet. Und es gab niemanden, den sie liebte.
Vielleicht, weil ich den Richtigen noch nicht getroffen habe.
Aber das war nicht der Grund, und das wusste Jennifer. Der Beweis war Mark Ryan – falls es überhaupt eines Beweises bedurfte. Jennifer und Mark kannten sich seit ihrer frühen Jugend, als sie Nachbarskinder gewesen waren. Mark war fünf Jahre älter als sie. Jennifer hatte ihn immer sehr gemocht, auch wenn sie seine Einladung zum Essen gerade abgelehnt hatte. Mark war ein charmanter Bursche und ein guter Cop. Ein sympathischer Mann mit Sinn für Humor, den ihm auch seine Scheidung nicht hatte rauben können.
Vor drei Jahren hatten sie sich durch Zufall wieder gesehen. Jennifer studierte Jura, als Mark mit einigen Kollegen zur Columbia Law School gekommen war, um vor den Studenten über polizeiliche Ermittlungsarbeit zu referieren.
Anschließend hatten sie in der Kantine Kaffee getrunken, und Mark erzählte ihr von seiner Scheidung. Damals wirkte er verletzt, einsam und verbittert. Obwohl beide an jenem Tag kein tiefer gehendes Interesse füreinander gezeigt hatten, entstand eine anfangs flüchtige Freundschaft, die sich im Laufe der nächsten Monate festigte. Sie gingen mindestens einmal im Monat essen, und es verging kaum eine Woche, in der sie nicht telefonierten. Sex und Intimitäten gab es zwischen ihnen nicht. Mark war ein guter Freund – vielleicht der beste Freund, den Jennifer je hatte –, aber mehr nicht. Sie mochte ihn und fand ihn anziehend. Doch ihre Furcht, eine zu große Nähe zu einem Mann zuzulassen, saß noch immer zu tief.
Jennifer erinnerte sich an einen Abend vor zwei Monaten. Nach einem Essen bei Spaglio’s hatte Mark sie in ihre Wohnung begleitet. Sie hatten sich unterhalten – und irgendwann hatte Mark sie geküsst. Jennifer hatte seine Berührung, seine intime Nähe sehr genossen, doch als der Kuss inniger wurde und Mark langsam ihre Bluse aufknöpfte, hatte die alte Angst sie überfallen, und sie hatte sich von ihm freigemacht.
Nun warf sie einen weiteren Blick in den Spiegel. Vielleicht bin ich frigide.
Ihre letzte ernst zu nehmende Verabredung lag zwei Jahre zurück. Abgesehen von Mark waren die beiden anderen zwanglosen Treffen mit Männern in den letzten sechs Monaten nach dem gleichen Muster verlaufen. Sobald die Burschen zu intim wurden, beendete Jennifer die Beziehung, ehe sie richtig begann. Die geringste sexuelle Annäherung löste eine Sperre in ihr aus.
Im Grunde hatte sie den Gedanken an Sex bereits aufgegeben. Ein Leben ohne Sex und Zärtlichkeiten war für sie zur Normalität geworden. Jennifer wusste, dass Gespräche und Therapien ihr nicht helfen würden. Die meisten Therapeuten schienen mehr Komplexe und Probleme zu haben als ihre Patienten. Außerdem kannte Jennifer ihr Problem. Es hatte mit dem Trauma zu tun, das sie in der Nacht erlebt hatte, als ihre Mutter gestorben war. Niemals würde sie diesen entsetzlichen Albtraum vergessen.
Heute war der Geburtstag ihrer Mutter. Und Jennifer wollte an diesem Tag nicht alleine sein.
Der Calverton-Friedhof auf Long Island lag an diesem sonnigen Nachmittag einsam und verlassen da. Jennifer parkte ihren Ford und ging mit einem Rosenstrauß zum Grab ihrer Mutter. Die Inschrift auf dem weißen Marmor jagte ihr wie immer kalte Schauer über den Rücken.
In liebendem Gedenken an Anna MarchEhefrau von Paul March1951–2001Ruhe in Frieden
Es war zwei Jahre her, und doch verging kein Tag, an dem Jennifer nicht an das albraumhafte Drama dachte, an den Tod ihrer Mutter und das Verschwinden ihres Vaters. Jennifer wünschte sich ihre Eltern sehnsüchtig zurück. Sie hatten ihr alles bedeutet. Ihr Vater war ein großzügiger, freundlicher Mann gewesen, ihre Mutter eine hübsche, intelligente und liebevolle Frau. Sie hätte sich keine bessere Mutter wünschen können.
Das Grab war gepflegt. Mindestens einmal die Woche brachte Jennifer frische Blumen. Nun stand sie in der Frühlingssonne am Grab und schaute auf den Marmorstein. Die spärlichen Worte sagten im Grunde nichts aus, denn über die Vergangenheit ihrer Eltern gab es sehr viel mehr zu sagen, als alle Grabsteine oder Inschriften der Welt hätten ausdrücken können.
Jennifer legte die Rosen aufs Grab, stand auf und ließ die Gedanken in die Vergangenheit schweifen …
4
In den ersten fünf Lebensjahren bekam Jennifer ihren Vater kaum zu Gesicht. Ständig war er geschäftlich unterwegs: in Paris, London, Zürich, Rom, in exotischen Städten und fremden Ländern, von denen die kleine Jennifer nie zuvor gehört hatte. Sie vermisste ihren Vater sehr.
Paul March war als Investmentbanker tätig. Jennifer war überglücklich, wenn der große, schlanke, gut aussehende Mann mit den dunklen, freundlichen Augen sie mit seinen starken Armen durch die Luft wirbelte. Sie liebte das Gefühl von Sicherheit, das sie spürte, wenn er ihre Hand hielt oder sie anlächelte. Sie liebte seinen Geruch – eine Mischung von frischem Aftershave, blumiger Seife und männlichem Duft.
Als Jennifer zwölf war, stieg ihr Vater bei einer kleinen Investmentbank in New York ein, der Prime International. Er war sehr ehrgeizig – ein Mann, der Karriere machen wollte. Da er häufig Überstunden einlegte und lange Geschäftsreisen unternahm, schrieb er seiner einzigen Tochter aus all den fremden, wundervollen Orten, die er besuchte, Ansichtskarten.
Das ist Paris, Jennifer. Eine traumhafte Stadt …
Gestern Abend habe ich in einem Restaurant in der Nähe vom Trevi-Brunnen gegessen. Rom ist wundervoll …
Ich habe dir in London ein Geschenk gekauft. Es wird dir gefallen, mein Liebling …
Sobald ihre Mutter die Ansichtskarten gelesen hatte, verstaute Jennifer sie in einem alten Schuhkarton und hütete sie wie einen Schatz. Obwohl die Ansichtskarten sie nicht für die Tage und Wochen entschädigen konnten, die ihr Dad nicht zu Hause war, machte die Gewissheit, dass er an sie dachte, seine Abwesenheit ein wenig erträglicher.
Manchmal schlich die kleine Jennifer sich in sein Arbeitszimmer und kletterte auf seinen Stuhl, nur um ihm nahe zu sein. Sie nahm einen Pullover, ein Hemd oder einen Hausschuh von ihm und blieb stundenlang dort sitzen. Während sie die bunten Ansichtskarten betrachtete, wartete sie sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Vaters. Endlich sah sie ihn eines Tages über den schmalen Weg zum Haus kommen, und mit einem Freudenschrei stürmte Jenny ins Freie und fiel ihm überglücklich in die Arme. Stets brachte er ihr Geschenke mit: Schokolade aus der Schweiz, eine Stoffpuppe aus Frankreich, eine bunte Holzmarionette aus Italien. Doch das Gefühl der Sicherheit in den Armen ihres Vaters bedeutete Jennifer mehr als alle Geschenke der Welt.
Als Paul March erfolgreicher wurde, zog die Familie in eine wunderschöne alte Villa in Long Beach. Das Grundstück lag am Wasser und verfügte über einen eigenen Steg. Obwohl Jennifers Vater sehr gut verdiente und Jenny eine schöne Kindheit verbrachte, hatten ihre Eltern einen eher bescheidenen Lebensstil. Ihre Mutter gab ihren Job als Sekretärin nach Jennifers Geburt auf, um sich ganz der Erziehung ihrer Tochter zu widmen. Jennifer liebte ihre Mutter. Sie hatte ein hübsches Gesicht mit hohen Wangenknochen und blondes Haar. Und für die warmherzige Frau war die Rolle der Mutter die perfekte Erfüllung. Sie liebte Jenny über alles, genauso wie ihr Mann.
Als Jennifer später, in der Pubertät, mit den üblichen Problemen zu kämpfen hatte, gab die Liebe ihrer Eltern ihr Selbstvertrauen. Jennifer hing sehr an ihrer Mutter, fühlte sich aber noch stärker zum Vater hingezogen. Vielleicht liebte sie ihn umso mehr, weil seine vielen Reisen in die Ferne ihn mit einer geheimnisvollen Aura umgaben.
Trotz seiner zahlreichen Geschäftsreisen war Paul March stets bemüht, sich Zeit für seine Frau und seine Tochter zu nehmen. Manchmal reiste Jennifers Mutter mit ihrem Mann ins Ausland. In dieser Zeit kümmerte sich eine Kinderfrau um Jennifer, die dann durch lange Reisen in den Sommerferien für das Alleinsein entschädigt wurde, die sie durch Amerika, nach Mexiko und sogar nach Europa führten. Jennifer sah die wundervollen Orte von den Ansichtskarten ihres Vaters nun mit eigenen Augen: Rom, London, Zürich, Paris.
Sie erinnerte sich an den Spaziergang mit ihren Eltern durch die Straßen von Paris an einem Sommermorgen; sie erinnerte sich an die Sehenswürdigkeiten, den Lärm und die Gerüche dieser wunderschönen Stadt. Nachdem sie am Nachmittag eine Fahrt auf der Seine gemacht und die Gärten eines prachtvollen Schlosses besichtigt hatten, kehrten sie alle erschöpft ins Hotel zurück. Jennifer schlief in den Armen ihrer Eltern ein. Es gehörte zu den größten Freuden ihrer Kindheit, bei ihren Eltern im warmen Bett zu liegen und ihre Liebe zu spüren.
Als Jennifer dreizehn war, wurde ihr Bruder Robert geboren. Sie musste sich damit abfinden, nun nicht mehr im Mittelpunkt zu stehen. Allzu schmerzhaft war es für sie nicht, denn Bobby war ein netter kleiner Knirps mit blonden Locken, der immerzu lächelte und sich freute, wenn seine große Schwester ihn auf den Arm nahm und mit ihm spielte. Manchmal aber versetzte es Jennifer einen Stich, wenn ihr Vater Bobby in den Armen hielt wie einst seine kleine Tochter. Er schien Bobby zu vergöttern, und das weckte Jennifers Eifersucht.
Eines Tages erklärte Jennys Mutter ihr, warum Bobby tatsächlich so etwas wie ein Wunder war, nachdem sie und ihr Mann sich viele Jahre ein zweites Kind gewünscht hatten. Alle Männer wünschten sich einen Sohn, sagte sie, aber das bedeute nicht, dass er sie, Jenny, nun weniger lieb habe. Doch Jennifer musste sich damit abfinden, die Liebe ihres Vaters zu teilen.
Als sie älter wurde, fiel Jennifer etwas Merkwürdiges auf: Es gab keine Fotos ihres Vaters aus früheren Zeiten. Die Eltern und Tanten, Onkel und Cousinen ihrer Mutter kamen manchmal zu Besuch, ihr Vater aber schien keine Verwandten zu haben und sprach auch nie darüber. Im Familienalbum war kein einziges Bild seiner Eltern, Brüder oder Schwestern zu finden, nur Fotos von Jenny, Bobby und ihrer Mutter. Es war so, als hätte ihr Vater keine Vergangenheit.
Doch eines Tages erfuhr Jennifer jäh, dass auch ihr Vater eine Vergangenheit hatte.
Eine Vergangenheit, mit der ein schreckliches Geheimnis verbunden war.
Während einer Geschäftsreise ihres Vaters nach Europa entdeckte sie die Truhe auf dem Speicher. Jennifer war vierzehn und hatte sich in ein hübsches junges Mädchen verwandelt. Ihre Hüften waren ausgeprägter geworden, ihre Beine lang und schlank, und seit kurzem trug sie einen BH. Doch wegen ihrer Zahnspange und der ständigen Veränderungen ihres Körpers fand sie sich hässlich. Was sie im Spiegel sah, gefiel ihr nicht.
An jenem Tag musste ihre Mutter Besorgungen machen. Jennifer blieb allein zu Hause und langweilte sich. So stieg sie die Treppe zum Speicher hinauf, den sie bisher kaum betreten hatte. In einer Ecke stand eine große alte, stabile Holztruhe. Jennifer erinnerte sich an die Schlüssel, die im Arbeitszimmer ihres Vaters hingen. Neugierig auf das, was in der Truhe war, rannte sie los, holte die Schlüssel und probierte sie durch, bis sie den passenden gefunden hatte.
In der Truhe lagen stapelweise Papiere.
Zuerst glaubte Jenny, es wären alte Geschäftsunterlagen. Doch als sie die Papiere durchblätterte, sah sie, dass es etwas anderes war: Kopien von Aussagen, die die Opfer eines Verbrechers der Polizei gegenüber gemacht hatten.
Joseph Delgado hat mein Leben zerstört … Er hat meinen Sohn brutal ermordet …
Joseph Delgado hat mein Unternehmen bestohlen … Er ist ein Dieb, dem man nicht vertrauen kann …
Joseph Delgado ist ein Mörder, der es verdient hat, für seine Verbrechen zu sterben …
Joseph Delgado ist ein gefährlicher junger Mann, der für den Rest seines Lebens hinter Gitter muss …
Wer war dieser Joseph Delgado?
Zwischen den Papieren lag ein Schwarzweißfoto, das wie ein Bild von einem Tatort aussah. Es war das grässliche Foto eines Mordopfers, das mit einem Messer in der Brust in einer schmutzigen Gasse lag. Das Gesicht des Toten war schrecklich verzerrt. Jennifer konnte den entsetzlichen Anblick nicht lange ertragen.
Bevor sie die Truhe wieder verschloss, entdeckte sie ein zweites Foto zwischen den Papieren. Sie nahm es und starrte fassungslos darauf: Es war das Foto eines jungen, dunkelhaarigen Mannes in Sträflingskleidung. Jemand hatte mit schwarzer Tinte einen Namen unter das Bild geschrieben:
Joseph Delgado.
Das Gesicht kam Jennifer bekannt vor.
Es war das Gesicht ihres Vaters.
Diese Entdeckung jagte Jennifer einen fürchterlichen Schreck ein. Joseph Delgado war offenbar ein böser Mann. Aber ihr Vater war nicht böse, also konnte er nicht dieser Delgado sei, auch wenn der ihm sehr ähnlich sah. Jennifer war völlig verwirrt.
Als ihr Vater von der Geschäftsreise zurückkehrte, fragte sie ihn: »Dad, wer ist Joseph Delgado?«
Paul March wurde kreidebleich. »Woher kennst du diesen Namen?«
Jennifer gestand, die Truhe geöffnet zu haben. »Der Mann auf dem Foto sah aus wie du, Daddy.«
Zum ersten Mal erlebte Jennifer, wie ihr Vater wütend wurde, während sich in seinen Augen nackte Angst spiegelte. Er verpasste seiner Tochter eine schallende Ohrfeige und stürmte aus dem Zimmer. Die schluchzende Jenny wurde von ihrer Mutter getröstet.
»Warum war Daddy so wütend?«, fragte das Mädchen unter Tränen. »Warum hat er mich geschlagen?«
»Du darfst nicht in Vaters Sachen wühlen, Jennifer«, sagte ihre Mutter, die blass geworden war. »Das darfst du nie wieder tun.«
»Aber ich hab doch nur …«
»Nie wieder, Jennifer.«
Jahre vergingen. Inzwischen war Jennifer eine junge Frau geworden. Nachdem sie ihr Kunststudium abgeschlossen und zwei langweilige Jahre in einer Galerie in Manhattan gearbeitet hatte, entschloss sie sich mit vierundzwanzig, Jura zu studieren. Sie erhielt ein Stipendium für die New York University, was ihren Vater mächtig stolz machte.
Er arbeitete noch immer bei Prime International und stieg weiter die Karriereleiter hinauf. Ein Jahr zuvor war das Unternehmen von einem privaten Investor aus dem Ausland übernommen worden, und Jennys Vater wurde zum stellvertretenden Direktor befördert. Er übernahm die Betreuung der größten Kunden und verdiente mehr Geld als je zuvor. Doch dieser Karrieresprung veränderte seinen Charakter. Er wurde kühl und launisch und schien unglücklich zu sein. Jennifer verstand nicht, warum.
Eines Tages ging sie zufällig an seinem Arbeitszimmer vorbei. Eine Terrassentür führte in den Garten, von dem man auf den See und den kleinen Steg blicken konnte. Ihr Vater ging hier oft mit Bobby spazieren. Im Sommer saßen sie stundenlang auf dem Steg, angelten und plauderten, bis die Sonne unterging. An jenem Tag war die Terrassentür geöffnet. Jennys Vater saß allein auf der Terrasse, das Gesicht in den Händen vergraben. Langsam hob er den Blick und starrte hinaus auf den See. Jennifer hatte ihn noch nie so verzweifelt gesehen.
Als sie durchs Arbeitszimmer ging, um ihm Gesellschaft zu leisten, sah sie auf dem Schreibtisch aus Apfelholz eine graue, geöffnete Metallkassette liegen. Sie war leer. Neben der Kassette lagen ein gelber Notizblock und eine Diskette. Jennifer blieb stehen. Sie sah das Wort »Wintermond« auf dem Notizblock, darunter ein paar unleserliche Notizen in der Handschrift ihres Vaters. Plötzlich bemerkte ihr Vater sie. Er sprang abrupt aus dem Gartenstuhl auf und stürmte ins Arbeitszimmer. »Schnüffelst du in meinen Sachen, Jennifer?«
»Nein … nein. Ich wollte dir gerade Gesellschaft leisten, Dad.«
Ihr Vater legte Diskette und Notizblock in die Kassette und sagte ungewöhnlich schroff: »Das ist privat! Lass die Finger davon!«
»Ich wollte doch nur …«
»Steck deine Nase nicht in Angelegenheiten, die dich nichts angehen.«
Er zog einen silbernen Schlüssel aus der Brieftasche und verschloss die Kassette. Sein Gesicht war vor Wut verzerrt. Er war so außer sich wie damals, als Jennifer als Vierzehnjährige von dem Foto auf dem Speicher erzählt hatte.
»Was ist denn los, Dad? Warum bist du so aufgebracht?«
Er legte den Schlüssel in seine Brieftasche zurück und führte Jennifer zur Tür. »Bitte lass mich allein. Ich habe viel zu tun.«
»Dad, ich wollte nur …«
»Wir sprechen ein andermal darüber. Geh jetzt, Jennifer.« Ehe ihr Vater sie aus dem Zimmer drängte und die Tür von innen verschloss, fügte er noch hinzu: »Und schnüffle nie wieder in meinen Sachen herum.«
»Ich wollte doch nur …«
»Nie wieder, Jennifer.«
Einen Monat später wurde ihre Mutter brutal ermordet, und ihr Vater verschwand spurlos.
Sie würde die Nacht, in der es geschah, niemals vergessen. Ihre Mutter hatte sie eingeladen, das Wochenende zu Hause zu verbringen. Jennifer nahm die Einladung dankend an. An jenem Abend flog ihr Vater in die Schweiz. Das Apartment in Manhattan, das Jennifer die Woche über mit einer Kommilitonin teilte, war klein und beengt; deshalb freute Jennifer sich jedes Mal, wenn sie in ihrem eigenen Zimmer schlafen und die gute Küche ihrer Mutter genießen konnte.
Als sie an jenem Abend zu Bett ging, tobte ein Unwetter. Blitze zuckten über den dunklen Himmel, und es goss wie aus Eimern. Der Lärm musste Jennifer geweckt haben. Als sie die Augen aufschlug, drangen im Bruchteil einer Sekunde zwei Dinge in ihr Bewusstsein: der tosende Sturm und das erschreckende Gefühl, dass irgendjemand sich im Haus aufhielt.
Mit bebender Hand betätigte Jennifer den Schalter der Nachttischlampe. Nichts geschah. Vermutlich hatte der Sturm einen Kurzschluss verursacht. Sie stieg aus dem Bett, zog den Bademantel über und öffnete die Tür. Das Schlafzimmer ihrer Eltern lag neben Bobbys Zimmer am Ende des Korridors. Als Jennifer auf den Flur trat, strich ein eisiger Windhauch über ihren Körper und ließ sie frösteln. Sie drückte auf den Lichtschalter im Treppenhaus. Wieder vergebens. Ein Fenster auf dem Flur war geöffnet; der heftige Wind blähte die Vorhänge. Jennifer stutzte. Normalerweise war das Fenster geschlossen.
Der Wind muss es aufgestoßen haben.
Als Jennifer ans Fenster trat, fuhr ein Windstoß ins Haus und warf sie beinahe um. Schließlich aber gelang es ihr, das Fenster zu schließen. Das Licht im Treppenhaus flackerte kurz.
»Mutter?«, rief Jennifer ängstlich.
Keine Antwort. Sie öffnete die Tür zum Schlafzimmer ihrer Eltern und ging langsam hinein. Es herrschte Totenstille. Plötzliche Angst schnürte Jennifer die Kehle zu. Warum antwortete ihre Mutter nicht? Wie schon das Licht im Treppenhaus, flackerte auch die Lampe im Schlafzimmer kurz auf. Dann zuckte hinter den regennassen Scheiben ein greller Blitz, in dessen flackerndem Licht Jennifer für einen Moment das Chaos im Schlafzimmer sehen konnte: Schubladen waren durchwühlt, der Boden mit Kleidungsstücken übersät. Auf dem weißen Teppichboden und den Wänden klebten Blutspritzer …
Jennifer stockte der Atem. Ein weiterer Blitz erhellte das Zimmer. Der Donnerschlag erschütterte sie bis ins Mark. Dann sah sie die beiden. Ihre Mutter lag mit einer klaffenden Wunde im Rücken auf dem Bett. Das Betttuch war mit großen, dunkelroten Blutflecken übersät. Bobby lag neben dem Bett zusammengekrümmt auf dem Boden. Aus einer Wunde im Nacken sickerte Blut.
Einen kurzen Augenblick glaubte Jennifer, dass alles nur ein Albtraum sei. Sie kniff die Augen zusammen, blickte erneut auf das Bild des Grauens.
Es war kein Albtraum.
Als Jennifer ihr Entsetzen hinausschrie, presste jemand ihr eine Hand auf den Mund …
Es war ein Mann, und er war kräftig. Jennifer versuchte vergeblich, sich aus der Umklammerung zu befreien. Der Mann zerrte sie über den Korridor in ihr Zimmer. Als sie sich wehrte, versetzte er ihr einen Faustschlag ins Gesicht und stopfte ihr ein Tuch in den Mund. Das Licht auf dem Nachttisch flackerte, und sie starrte in sein Gesicht.
Er hatte kein Gesicht.
Der Mann war maskiert. Er hatte dunkle Augen und hielt ein blutverschmiertes Metzgermesser in der Hand. »Ganz ruhig, Schlampe, dann passiert dir nichts«, sagte er mit rauer, krächzender Stimme.
Der Mann legte das Messer auf den Nachttisch. Jennifer sah die Pistole, die unter seinem Hosenbund steckte. Trotz des Knebels schrie sie dumpf. Der Bademantel rutschte ihre Beine hoch. Eine Hand strich über ihren Körper.
»Beweg dich nicht, sonst schneide ich dir die Kehle durch.«
Jennifer erstarrte zu Eis. Sie schluchzte, als der Mann sie zwang, die Beine zu spreizen. Nie zuvor hatte sie eine solch wahnsinnige Angst verspürt. Sie wagte es nicht, sich zu bewegen. Während draußen das Unwetter tobte, flackerte die Lampe erneut. Jennifers Blick fiel auf das blutverschmierte Messer auf dem Nachttisch. Verzweifelt griff sie danach und stieß die Klinge in den Hals des Mannes.
Er sank brüllend zu Boden. Mit weit aufgerissenen Augen hob er die Hand, um das Messer herauszuziehen. Jennifer schwang sich aus dem Bett, rannte zur Tür und eilte die Treppe hinunter. Sie stürmte hinaus ins Unwetter und riss sich den Knebel aus dem Mund. Regen peitschte ihr ins Gesicht. Blitze zuckten über den Himmel. Donner krachte. Jennifer rannte um ihr Leben.
»Hilfe!«, schrie sie gellend.
Das nächste Haus stand hundert Meter weiter auf der anderen Straßenseite. Jennifer sah durch den Schleier des Regens die weiße Tür. Die Veranda war in Dunkelheit gehüllt. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen. Sie warf einen Blick über die Schulter und sah den maskierten Mann. Er folgte ihr, eine Hand auf die Wunde gepresst, in der anderen das blutverschmierte Messer.
»Nein!«
Noch vierzig Meter bis zur Tür.
Das Nachthemd rutschte Jennifer zwischen die Beine und behinderte ihren Lauf.
Zwanzig Meter.
Der Regen nahm ihr die Sicht. Sie hörte schnelle Schritte hinter sich, wagte es aber nicht, einen Blick über die Schulter zu werfen.
Er wird mich töten!
Zehn Meter.
Jennifer rannte die Treppe zur Veranda hinauf.
Sie schlug mit den Fäusten wild gegen die Tür und schrie. »HILFE! O GOTT! HELFTMIR! ERWIRDMICHTÖTEN. BITTE!«
Dann schwanden ihr die Sinne.
Sie erwachte im Einbettzimmer eines Krankenhauses. Jemand hatte das Fenster geöffnet. Die Vorhänge wogten im Wind. Ein Mann betrat den Raum. Er war Ende fünfzig, attraktiv, gepflegt, mit silbergrauem Haar. Der einzige Makel war ein leichtes Hinken. Jennifer sah den uniformierten Polizisten vor ihrem Zimmer, bevor der Mann die Tür schloss. »Wie geht es Ihnen, Jennifer?«, fragte er.
Sie stand noch immer unter Schock. »Ich … ich weiß es nicht«, erwiderte sie mit bebender Stimme.
Der Mann betrachtete sie mitfühlend. Er war sichtlich bestürzt. In seinen Augen schimmerten Tränen, als er sich ans Bett setzte. »Mein Name ist Jack Kelso. Ich bin ein Freund Ihres Vaters. Vielleicht hat er meinen Namen mal erwähnt …?«
»Nein, das … das hat er nicht. Sind Sie ein Kollege von ihm?«
»Nein. Wir sind gute Freunde. Tut mir Leid, dass wir uns unter so schrecklichen Umständen kennen lernen, Jennifer. Als ich erfuhr, was geschehen ist, bin ich sofort hergekommen. Ihre Mutter … sie war eine wundervolle Frau.«
»Sie ist tot, nicht wahr?«
Kelso nickte. »Ja. Sie ist tot.«
»Und Bobby?«
Kelso seufzte. »Bobby lebt. Er liegt auf der Intensivstation.«
»Was ist mit ihm?«
Kelso suchte nach den richtigen Worten. »Er wird durchkommen. Eine Kugel hat die Wirbelsäule getroffen und ist am Kopf wieder ausgetreten. Ich will ehrlich sein: Er wird bleibende Schäden zurückbehalten … Schwierigkeiten beim Laufen und wahrscheinlich auch beim Sprechen. Aber er wird überleben, Jennifer.«
»Mein Gott …«
»Er lebt, Jennifer. Nur das ist erst einmal wichtig.«
Jennifer war wie benommen. »Warum?«, fragte sie schließlich. »Warum hat jemand meine Mutter getötet und auf meinen Bruder geschossen?«
Kelso schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht, Jennifer. Aber Sie müssen der Polizei helfen. Bobby kann nicht sprechen. Die Verletzungen, der Schock … Vielleicht wird er sich nie mehr an den Vorfall erinnern können. Das ist häufig so, wenn junge Opfer bei einem Verbrechen ein Trauma erleiden. Die Polizei meint, der Einbrecher könnte Schmuck Ihrer Mutter gestohlen haben. Vielleicht ist sie aufgewacht und hat den Einbrecher gesehen. Oder Bobby wurde wach und ist auf den Mann losgegangen, und daraufhin schoss er auf die beiden.«
»Der … der Mann. Er wollte mich auch töten.«