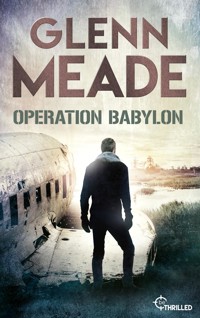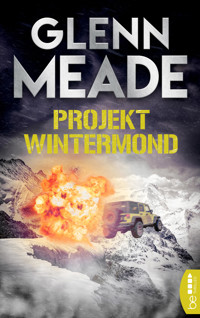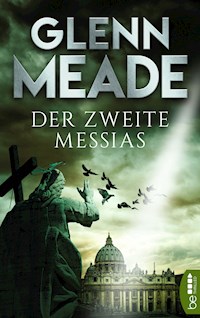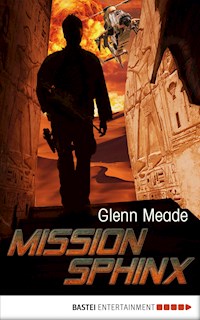
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
November 1943. Die deutsche Abwehr plant das wohl spektakulärste Unternehmen des Zweiten Weltkrieges: US-Präsident Roosevelt und der britische Premier-Minister Churchill sollen während ihrer Geheimkonferenz in Kairo ermordet werden. Auf diese Weise könnte die geplante Invasion der Alliierten in der Normandie - eines der wichtigsten Konferenzthemen - verhindert werden. Als der amerikanische Geheimdienst von dieser Mission erfährt, beginnt die fieberhafte Suche nach den Attentätern. Harry Weaver, Mitarbeiter des amerikanischen Nachrichtendienstes, bleiben nur wenige Tage, das feindliche Team unschädlich zu machen. Doch diesem gehören zwei Menschen an, mit denen er vor dem Krieg einen Freundschaftspakt geschlossen hat. Vom Autor der Weltbestseller OPERATION SCHNEEWOLF und UNTERNEHMEN BRANDENBURG!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 948
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über den Autor
Glenn Meade, geboren und aufgewachsen in Dublin, ist der Autor mehrerer internationaler Bestseller. Seine Thriller OPERATION SCHNEEWOLF, UNTERNEHMEN BRANDENBURG und MISSION SPHINX wurden in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Neben dem Schreiben arbeitete Glenn Meade als Experte im Bereich der Flugsimulation, will sich aber nun ganz der Schriftstellerei widmen.
GLENN MEADE
MISSIONSPHINX
THRILLER
Aus dem Englischenvon Susanne Zilla
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Vollständige Taschenbuchausgabe
Deutsche Erstveröffentlichung
Titel der englischen Originalausgabe: THE SANDS OF SAKKARA
© 1999 by Glenn Meade
© für die deutschsprachige Ausgabe 2000 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank / Marco Schneiders
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von iStock/ninjaMonkeyStudio; iStock/Antonis Liokouras; thinkstock/Romolo Tavani; thinkstock/RyanFletcher
E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-1617-9
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
»Wir hatten diesen unglaublichen Plan. Er sollte die Alliierten in ein totales Chaos stürzen und die bevorstehende Invasion verhindern. Sie können sich nicht vorstellen, wie nahe Deutschland daran war, den Krieg zu gewinnen.«
Walter Schellenberg, Generalmajor der Waffen-SS, in einem Gespräch mit den alliierten Anklägern während des Nürnberger Prozesses, Februar 1946
»Unter Freunden bedarf es der Gerechtigkeit nicht.«
Aristoteles
Inhalt
Gegenwart
1
Kairo
Es war April, und der Kamsin blies, ein heulender Wüstenwind, der den Sand durch die Straßen trieb, bis man vor Schmerz die Augen schließen musste.
Als das Taxi vor der Leichenhalle anhielt und ich ausstieg, fragte ich mich erneut, warum ich in einer so scheußlichen Nacht hierhergekommen war, wo es doch nicht mehr zu sehen gab als die Leiche eines alten Mannes, die am Ufer des Nils angeschwemmt worden war.
»Möchten Sie, dass ich warte, Sir?« Der Taxifahrer war ein bärtiger junger Mann mit schlechten Zähnen.
»Warum nicht?« In einer solchen Nacht war man froh, wenn man kein neues Taxi suchen musste.
Die Leichenhalle war eines dieser ehrwürdigen, massiven Steingebäude, die man in Ägypten häufig antrifft, ein Überrest aus der kolonialen Vergangenheit, aber jetzt machte das Haus einen düsteren und ungepflegten Eindruck. Im Laufe der Zeit war der Granit von den Abgasen ganz schwarz geworden. Neben der Halle konnte ich eine schmutzige, enge Gasse erkennen, in der der Abfall vom Wind durcheinandergewirbelt wurde. Über einer blau gestrichenen Tür mit einem Metallgitter in der Mitte brannte ein Licht. Ich ging in die Gasse hinein und klingelte. Irgendwo im Gebäude summte es, und kurze Zeit später öffnete sich das Metallgitter. Das unrasierte Gesicht eines Mannes erschien.
»Ismail?«
Der Mann nickte.
»Ich möchte mir die Leiche des alten Mannes ansehen«, sagte ich in arabischer Sprache. »Den sie aus dem Nil gefischt haben. Captain Halim von der Polizei in Kairo hat mir gesagt, ich soll mich an Sie wenden.«
Er schien überrascht, dass ich seine Sprache sprach, aber dann zog er rasselnd den Riegel beiseite, öffnete die Tür und ließ mich hinein. Erleichtert, dem grässlichen Wind zu entkommen, klopfte ich mir den Sand vom Mantel und trat ein. Ich spürte eine merkwürdige Erregung. Hier stand ich nun, ein Mann Mitte fünfzig, und kam mir vor wie ein aufgeregtes Schulkind – ich hoffte, nun endlich eine Antwort auf die vielen Fragen zu finden, hoffte, dass das bizarre Rätsel, das mich seit vielen Jahren beschäftigt hatte, sich doch noch lösen würde.
Es war überraschend kühl im Inneren des Gebäudes, und ein penetranter Geruch umgab mich. Eine Mischung aus den Düften des Orients und der Verwesung. Ich konnte den hölzernen Bogen erkennen, der in die eigentliche Leichenhalle führte, aber dahinter versank alles im Dunkel. Nur eine einzelne Glühbirne und ein paar flackernde Duftkerzen brannten dort. In dem Raum standen mehrere Metalltische, auf denen unter schmuddeligen weißen Tüchern die Leichen lagen. Außerdem gab es in den Granitwänden der Leichenhalle noch mindestens ein Dutzend Fächer hinter verkratzten, verbeulten Stahltüren.
Ismail sah mich an. Seine traurige Miene wirkte gekünstelt. Er war klein, dick und trug eine verschlissene Dschellaba aus Baumwolle. »Sind Sie ein Verwandter des Toten?«
»Ich bin Journalist.«
Der Ausdruck der Trauer verschwand augenblicklich aus seinem Gesicht. »Das verstehe ich nicht.« Ismail runzelte die Stirn. »Was wollen Sie denn hier?«
Ich nahm meine Brieftasche heraus, zählte großzügig ein paar Scheine ab und gab sie ihm. »Für Ihre Bemühungen.«
»Wie bitte?«
»Ihre Zeit, aber ich werde nicht viel davon in Anspruch nehmen. Ich möchte nur die Leiche des alten Mannes sehen. Wäre das möglich? Es ist vielleicht eine Story für mich drin, verstehen Sie?«
Ismail verstand offensichtlich. Das Geld verhinderte jeden Widerspruch, und er lächelte, als er sich die Scheine in die Tasche stopfte. »Natürlich, wie Sie wünschen, einem Mann von der Presse bin ich immer gern behilflich. Sie sind Amerikaner?«
»Ja, das stimmt.«
»Das dachte ich mir schon. Bitte kommen Sie hier entlang.«
Er führte mich in die Leichenhalle. Es war sehr kühl dort, und von den Wänden blätterte die blaue Farbe ab. Die filigrane arabische Holzschnitzerei der Bögen und Türen war außerordentlich kunstvoll, aber der Raum sah trotzdem schäbig aus. Eine Renovierung war längst überfällig.
Ismail zeigte in eine Ecke, die mit einem schweren Perlenvorhang abgetrennt war. »Er liegt dort. Ich habe gerade an ihm gearbeitet, als Sie geklingelt haben. Nicht sehr angenehm, wenn so eine Leiche mehrere Tage im Wasser gelegen hat. Möchten Sie sie immer noch sehen?«
»Deshalb bin ich ja hier.«
Ich folgte ihm, und er zog den Vorhang beiseite. Ein paar flackernde Duftkerzen standen neben einem Marmorblock, auf dem eine nackte, männliche Leiche lag. Daneben stand ein kleiner Metalltisch, auf dem sich die einfachen Instrumente eines Bestattungsunternehmers befanden. Gewachste Fäden, Watte, ein paar Schüsseln mit Wasser. Neben dem Tisch lagen ordentlich gefaltete, saubere Kleidungsstücke: ein alter Leinenanzug, Hemd und Krawatte, Socken und Schuhe. Wahrscheinlich waren sie für die Leiche gedacht.
Der alte Mann, der dort aufgebahrt lag, war sicher schon über siebzig und ziemlich groß, mindestens einen Meter achtzig. Seine Augen waren offen und starrten glasig ins Leere. Das dünne graue Haar war straff nach hinten gekämmt, die Haut weiß und vom Wasser ganz runzlig. Seine Gesichtszüge waren schrecklich verzerrt, aber es fehlte die lange Narbe auf der Brust, die auf eine Autopsie hingedeutet hätte. In moslemischen Ländern werden die Toten rasch begraben, meistens noch vor Sonnenuntergang, wenn der Tod am Morgen eingetreten war, sonst am nächsten Tag. Die Toten gelten als heilig und werden selten angerührt. Selbst die Opfer eines Mordes werden gewöhnlich nur einer Nekropsie unterzogen: Einer oberflächlichen Untersuchung der Leiche, um die Ursache des Todes festzustellen, bloße Vermutung also.
Ich schauderte, denn der Duft der Kerzen konnte den Gestank der Verwesung nicht überdecken. »Was können Sie mir über ihn sagen?«
Der Leichenbestatter zuckte die Achseln. Als ob ein Toter mehr in einer chaotischen Stadt, in der fünfzehn Millionen Menschen lebten, wichtig wäre. »Er ist gestern gebracht worden. Die Polizei hat ihn im Wasser in der Nähe der Eisenbahnbrücke gefunden. Er trug einen deutschen Ausweis auf den Namen Johann Haider bei sich, und er besaß eine Wohnung im Imbaba-Viertel.«
So viel wusste ich bereits. »Hat sich irgendjemand gemeldet?«
»Noch nicht. Die Leiche wird noch eine Weile aufbewahrt werden, während man nach Verwandten sucht. Aber bis jetzt haben sie niemanden gefunden. Es sieht aus, als hätte er allein gelebt.«
»Ich nehme an, er ist kein Moslem?«
»Die Polizei hält ihn für einen Christen.«
»Ist er ertrunken?«
Ismail nickte. »Das sagt jedenfalls der Pathologe. Wie Sie selbst sehen können, weist der Körper keinerlei Wunden auf. Der Pathologe glaubt, dass der alte Mann aus Versehen in den Fluss gefallen ist, was manchmal passiert. Oder er hat Selbstmord begangen und ist von einer der Brücken gesprungen.« Ismail rieb sich das unrasierte Kinn. »Genau werden wir das nie wissen.«
»Gibt es noch irgendetwas, was Sie mir über ihn sagen können?«
»Ich fürchte, nein. Da müssen Sie schon die Polizei fragen.«
»Soweit ich weiß, hat die Polizei inzwischen herausgefunden, dass unser toter Freund hier einen zweiten Ausweis in seiner Wohnung versteckt hatte. Und zwar einen ziemlich alten auf den Namen Hans Meyer.«
Ismail zuckte die Achseln. »Ich bin nur ein einfacher Leichenbestatter. Ich habe nichts davon gehört. Aber ich weiß, dass eine ganze Menge Ausländer in Kairo leben, auch Deutsche. Arbeiten Sie für eine amerikanische Zeitung?«
»Ja, ich bin Auslandskorrespondent für den Nahen Osten.«
»Interessant.«
Ich deutete auf die Leiche. »Aber wahrscheinlich nicht annähernd so interessant wie dieser alte Mann hier.«
»Kannten Sie ihn denn?«, fragte Ismail überrascht.
»Lassen Sie es mich so sagen: Wenn er wirklich der ist, für den ich ihn halte, dann haben Sie hier die sterblichen Überreste eines wirklich bemerkenswerten Mannes vor sich, vor allem, wenn man bedenkt, dass er schon seit fünfzig Jahren tot sein soll.«
»Wie bitte?«
»Das ist eine lange Geschichte, zu lang, um sie zu erzählen. Aber wenn er es ist, dann verbringen Sie die heutige Nacht in der Gesellschaft einer wirklich interessanten Leiche.«
Ismail pfiff leise. »Dann ist es ja kein Wunder, dass sich der andere Gentleman so für ihn interessiert hat.«
»Was für ein Gentleman?«
»Er war vor einer halben Stunde hier. Er wollte sich die Leiche ansehen. Ein älterer Amerikaner. Jemand, der es gewohnt ist, alles zu bekommen, was er will. Ein typischer Amerikaner eben. Er ist hier hereingeplatzt und wollte die Leiche sehen.« Ismail grinste und klopfte sich auf die Tasche seiner Dschellaba. »Er war nicht so großzügig wie einige seiner Landsleute. Als ich ihn um ein bisschen Bakschisch bat, wollte er mir glatt die Hand abhacken.«
»Wer war er denn?«
Ismail kratzte sich am Kopf. »Harry Weaver hieß er, glaube ich.«
Der Name ließ mein Herz schneller schlagen. »Harry Weaver? Sind Sie sicher?«
»Ich glaube schon.«
»Beschreiben Sie ihn mir.«
»Ziemlich groß. Ende siebzig, vielleicht sogar älter, aber topfit. Er scheint hart an sich zu arbeiten. Eine ziemlich beeindruckende Erscheinung.« Ismail hielt überrascht inne, als er mein Gesicht sah. »Kennen Sie diesen Mr Weaver?«
»Nicht persönlich, aber ich habe von ihm gehört.«
»Er scheint ein wichtiger Mann zu sein. Jemand, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen. Ein hoher Offizier vielleicht.«
»Ja, allerdings«, meinte ich. »Und Sie können Allah danken, dass Sie noch leben und beide Hände besitzen. Harry Weaver ist nun wirklich nicht der Mann, mit dem man Schmiergelder aushandeln kann. Er ist die Integrität in Person. Fast vierzig Jahre lang war er Sicherheitsberater des amerikanischen Präsidenten.«
Ismail hob hilflos die Hände. »Aber Bakschisch ist hier nun mal üblich.«
»Als ob ich das nicht wüsste.« Ich schlug den Mantelkragen hoch und drehte mich um, um zu gehen.
Ismail sagte: »Glauben Sie, bei der Leiche handelt es sich um den Deutschen, von dem Sie gesprochen haben?«
Ich warf noch einen Blick auf die Leiche. »Das weiß der Himmel. Er ist ja in einem so erbärmlichen Zustand, dass man kaum noch weiß, wo vorne und hinten ist. Wissen Sie, wo Mr Weaver hingegangen ist?«
»Zu dem Haus, wo der Deutsche gelebt hat. Ich habe ihn mit dem Taxifahrer sprechen hören, der draußen auf ihn gewartet hat.«
»Das wird ja immer interessanter. Kennen Sie die Adresse?«
»Natürlich. Ich bin gestern dort gewesen, um ein paar Kleidungsstücke für die Beerdigung zu holen, auf Anweisung der Polizei.« Ismail schrieb die Adresse auf ein Stück Papier, das ich ihm gab. »Die Wohnung ist im obersten Stockwerk.«
»Hat die Polizei die Wohnung versiegelt?«
»Nein, das war wohl nicht nötig. Der alte Mann hat nicht sehr viel besessen. Aber wenn die Wohnungstür verschlossen sein sollte, der Vermieter hat den Schlüssel.«
Als ich das Stück Papier einsteckte, fragte Ismail: »Gibt es sonst noch etwas?«
Ich warf einen letzten Blick auf die Leiche des alten Mannes, bevor ich mich umdrehte, um zu gehen. »Nein, vielen Dank, Sie haben mir sehr geholfen.«
Imbaba ist ein Arbeiterviertel am Ufer des Nils, das zum Teil aus verfallenen Holzhütten, zum Teil aus trostlosen Mietskasernen aus Beton besteht. Auf der Straße sammelt sich das Abwasser in Pfützen, und die Häuser drängen sich eng aneinander, als ob sie sich gegenseitig vor dem allgegenwärtigen Dreck und der Armut beschützen wollten. Der Taxifahrer fand die Adresse ohne Probleme.
Das Haus war im arabischen Stil erbaut, ein großes, altes Gebäude aus uraltem, braunem Holz. Es machte einen heruntergekommenen Eindruck. In den Fenstern hingen schäbige, verschlissene Netzgardinen, und im ersten Stock befand sich ein Balkon aus verwittertem, geschnitztem Holz. Es stand kein weiteres Taxi vor dem Gebäude, aber die Haustür war offen und schlug im Wind. Dahinter lag ein dunkler Flur.
»Warten Sie hier«, sagte ich dem Fahrer und stieg aus.
Im Treppenhaus stank es nach Urin und ranzigem Essen. Die hölzernen Stufen knarrten, als ich die Treppe hinaufstieg. Ich hörte ein Kind weinen, und irgendwo stritt sich ein Paar in den finsteren Tiefen des Hauses. Im ersten Stock stand eine Tür offen, und ich trat ein.
Es war ein typisch ägyptisches Zimmer, aber schäbig und völlig durcheinander. Schubladen standen offen, und der Inhalt quoll heraus. Alte Papiere, Briefe, Kleider und persönliche Gegenstände, mittendrin eine kaputte Brille, lagen überall verstreut auf dem Boden. Es sah aus, als ob jemand die Wohnung durchsucht hätte. Es gab noch ein paar weitere Türen zu den anderen Räumen und ein Fenster, durch das man den Nil sehen konnte, der jetzt in Dunkelheit gehüllt war. Ich sah die Papiere und Briefe durch, aber sie waren uninteressant. Als ich eine der Schubladen schloss, stieß ich versehentlich eine Tischlampe um, die mit lautem Geklapper zu Boden fiel. Plötzlich öffnete sich eine der Türen.
Als ich mich umdrehte, sah ich einen großen älteren Mann, der förmlich in den Raum hineinstürzte. Das Schlafzimmer, aus dem er kam, war ebenfalls in völliger Unordnung. Überall lag Papier herum, und er hielt eine Lesebrille in der Hand. Er trug einen hellen Trenchcoat, sein silbernes Haar war voller Sand, und auf seinem sonnengebräunten Gesicht lag ein gehetzter Ausdruck. Ich wusste, dass er mindestens Anfang achtzig war, aber er hatte sich erstaunlich gut gehalten. Er strahlte eine Frische aus, die ihn zehn Jahre jünger erscheinen ließ. Und den hohen Offizier sah man ihm noch immer an. Er war fast einen Meter neunzig groß und hatte ein scharf geschnittenes Gesicht. Lediglich seine gebeugten Schultern und die etwas wässrigen, aber durchdringenden grauen Augen verrieten sein Alter.
Sie verengten sich, als er mich ansah. »Wer, zum Teufel, sind Sie?«, wollte er wissen. Sein Akzent war unverkennbar amerikanisch.
»Das Gleiche könnte ich Sie auch fragen, wenn ich die Antwort nicht schon wüsste, Colonel Weaver.«
Er stutzte. »Sie kennen mich?«
»Nicht persönlich, aber welcher Amerikaner hat wohl noch nicht von Harry Weaver gehört? Eine Legende zu Lebzeiten. Fast vierzig Jahre lang Sicherheitsberater der amerikanischen Präsidenten.«
»Und wer sind Sie?«, schnaubte Weaver verächtlich.
»Ich heiße Frank Carney.«
Er schien nicht beeindruckt, aber dann sah ich ein leichtes Flackern in seinen Augen, und er runzelte die Stirn. »Doch nicht etwa Carney, der Reporter der New York Times?«
»Ich fürchte, ja.«
Weaver entspannte sich. »Ich habe alle Ihre Artikel gelesen. Nicht, dass ich Ihre Meinung immer geteilt hätte.«
»Manchmal aber schon«, entgegnete ich. »Ich war noch grün hinter den Ohren, als man mich nach Dallas geschickt hat, um einen Kollegen zu vertreten. Ich war dabei, als Kennedy ermordet wurde. Sie waren einer seiner Sicherheitsberater. Sie haben ihm geraten, nicht zu fahren, erinnern Sie sich?«
»Zu viele Schwachpunkte. Zu viele verdammte Lücken bei der Sicherheitsüberwachung vor Ort. Und in dem offenen Wagen war er die perfekte Zielscheibe, auch wenn die Leute vom Geheimdienst ihm unentwegt versichert haben, dass sie ihn beschützen könnten.«
»Wenn John F. Kennedy auf Sie gehört hätte, wäre er wahrscheinlich heute noch am Leben. Das habe ich in meinem Artikel auch geschrieben.«
Weaver schüttelte traurig den Kopf. »Zu spät. Aber wenn ich es mir richtig überlege, ich glaube, ich kann mich sogar noch an Ihren Artikel erinnern. Es war eine faire und exakte Beschreibung der Tatsachen.«
»Das lag daran, dass ich meine Hausaufgaben gemacht hatte. Ich habe damals alles an Hintergrundinformation gelesen, was ich in die Finger bekommen konnte. Traue niemandem und sei skeptisch, was auch immer sich dir an Tatsachen präsentiert. Das war Ihr persönliches Motto. Wenn man Ihre Karriere betrachtet, sollte man wohl auf Sie hören. Das habe ich jedenfalls damals getan.«
»Alles Erfahrung. Man wird härter mit den Jahren.« Weaver sah mich an und wurde plötzlich wieder misstrauisch. »Aber das alles erklärt nicht, warum Sie hier sind. Das hier ist schließlich Privateigentum.«
»Wieder könnte ich Sie das Gleiche fragen. Hat der Vermieter Sie hereingelassen?«
»Was, zum Teufel, geht Sie das an? Antworten Sie gefälligst auf meine Frage, verdammt noch mal.«
»Oh, ich nehme an, Sie können es sich schon denken. Wir waren beide aus dem gleichen Grund im Leichenschauhaus. Johann Haider. Eines der größten Rätsel des Zweiten Weltkriegs.«
Weaver erstarrte. »Sie waren im Leichenschauhaus?«
»Anscheinend habe ich Sie knapp verpasst. Und übrigens, der Mann dort war nicht sehr erfreut darüber, dass Sie ihm kein Trinkgeld gegeben haben.«
»Er hat verdammtes Glück gehabt, dass ich ihm nicht die Ohren abgerissen habe.« Weavers Augen verengten sich. »Was wissen Sie über Johann Haider?«
»Ägyptologie hat mich immer schon interessiert, daher habe ich auch die letzten fünf Jahre als Auslandskorrespondent in Kairo gearbeitet. Vor mehreren Jahren habe ich Recherchen über einen gewissen Franz Haider angestellt, einen reichen Deutschen, der ägyptische Kunstgegenstände sammelte. Ich wollte damals ein Buch über einige der wertvollen Kunstschätze Ägyptens schreiben, die während des letzten Krieges aus privaten Sammlungen und Museen in ganz Europa verschwunden sind. Viele davon hat man bis heute nicht wiedergefunden.«
Weaver schien interessiert. »Und?«
»Vor dem Krieg besaß Haider eine der wertvollsten privaten Sammlungen in Deutschland, die meisten Stücke waren unersetzbar. Außerdem war er Mäzen des Ägyptischen Museums. Er starb, als die Alliierten 1943 Hamburg massiv bombardierten. Kurz darauf war seine gesamte Sammlung verschwunden. Ich habe noch ein bisschen tiefer gegraben und herauszufinden versucht, ob es noch irgendwelche lebenden Verwandten gibt, die vielleicht wissen könnten, was aus der Sammlung geworden ist. Also bat ich einen befreundeten Journalisten in Berlin, für mich ein paar Nachforschungen anzustellen. Es gab keine lebenden Angehörigen mehr, jedenfalls niemand, der mir hätte weiterhelfen können, aber es stellte sich heraus, dass Haider einen Sohn hatte, Johann, der im Krieg gedient hatte. In den Listen der Deutschen steht, dass er 1943 bei irgendeiner Mission gefallen sei. Wie und wo ist allerdings nicht verzeichnet. Aber mein Freund fand heraus, dass die Abwehr Haider 1940 rekrutiert hatte. Das war der Geheimdienst der Deutschen im Krieg.«
»Danke, ich weiß sehr wohl, was die Abwehr war, Carney. Aber fahren Sie fort.«
»Johann Haider ist in Amerika aufgewachsen, bis seine Mutter tragischerweise bei der Geburt des zweiten Kindes starb. Danach ist sein Vater mit ihm nach Berlin zurückgekehrt, obwohl sie noch mehrere Jahre lang den Sommer in Amerika verbracht haben. Die Familie seiner Mutter hatte große Besitztümer im Staate New York. Ich bin vor ein paar Jahren dort gewesen, aber der Besitz ist vor vielen Jahren verkauft und das Haus abgerissen worden. Niemand in der Gegend konnte sich noch an die Haiders erinnern.«
»Das wundert mich nicht. Das alles liegt schließlich schon sehr lange zurück.«
»Johann Haider hat außerdem mehrere Sprachen fließend gesprochen, unter anderem Arabisch, und er stieg im Krieg bis zum Rang eines Majors auf, obwohl er nie Mitglied der Nationalsozialistischen Partei wurde. Der Rest seiner Zeit beim Militär liegt im Dunkeln, außer dass er wohl einige Zeit in Nordafrika verbracht hat. Über die Mission, bei der er gestorben sein soll, ist nichts bekannt.«
»Und was haben Sie sonst noch herausgefunden?«, fragte Weaver ruhig.
»Jetzt wird es eigentlich erst richtig interessant. Ich habe mich nicht mehr mit der Sache beschäftigt, bis ich neulich mit einem ehemaligen Leiter des Ägyptischen Museums, Kemal Assan, ein Interview geführt habe, kurz bevor er starb. Ich habe Franz Haider beiläufig erwähnt, und Assan sagte, dass er seinen Sohn Johann 1939 getroffen habe, bei einer archäologischen Ausgrabung in Sakkara, an der er teilgenommen hat. Er hat sogar behauptet, ihn nach dem Krieg in Kairo gesehen zu haben. Wenn man bedenkt, dass Haider damals schon tot gewesen sein soll, ist das eigentlich ziemlich merkwürdig.«
Weaver zeigte plötzlich großes Interesse. »Und was genau hat Assan Ihnen erzählt?«
»Vor zehn Jahren saß er in einem Café in Kairo und dachte an nichts Böses, als ihm plötzlich der Mann am Nebentisch auffiel. Sein Gesicht kam ihm merkwürdig vertraut vor. Als er ihn fragte, ob sie sich kannten, lächelte der Mann und sagte auf Deutsch: Vor langer Zeit in einem anderen Leben haben wir uns schon einmal getroffen. Dann stand er auf und ging. Assan sprach ein bisschen Deutsch, und er war sich absolut sicher, dass es Haider gewesen ist.«
Weavers Augen funkelten. »Ist er ihm denn nicht nachgegangen?«
»Doch, aber er hat ihn auf dem Basar verloren.«
Weaver schien enttäuscht. »Ich verstehe. Das heißt, Sie haben geglaubt, dass Haider noch leben könnte?«
»Seit damals lässt mich der Gedanke jedenfalls nicht mehr los. Ich wusste wirklich nicht, was ich davon halten sollte. Die ganze Geschichte war so überaus rätselhaft. Aber ich habe damals eine großartige Story gewittert. Wenn Haider noch lebte, dann wusste er vielleicht, was aus der Sammlung seines Vaters geworden war. Dann habe ich in der Egyptian Gazette von gestern gelesen, dass man die Leiche eines älteren Deutschen aus dem Nil geborgen hat. Offenbar lautete sein Ausweis auf den Namen Johann Haider, und die Polizei hat jeden, der etwas über ihn wissen könnte, gebeten, sich mit ihr in Verbindung zu setzen. Als ich den Namen gehört habe, habe ich einfach zwei und zwei zusammengezählt und gehofft, dass es vier ergibt.«
Ich sah Weaver an, der sich alles in Ruhe anhörte, ohne etwas zu entgegnen.
»Die Frage ist, was tun Sie hier, Colonel? Soweit ich weiß, leben Sie in Washington, also frage ich mich ehrlich gesagt, was Sie hier in Kairo tun? Andererseits haben Sie sich ja ein Leben lang für Ägypten interessiert, wenn ich mich richtig erinnere. Sie haben an mehreren Ausgrabungen teilgenommen und waren während des Krieges für den militärischen Nachrichtendienst der Amerikaner in Ägypten tätig. Über die wahren Gründe kann ich zwar nur Vermutungen anstellen, aber ich nehme an, Sie wissen über Haider Bescheid.«
Weaver schien plötzlich nach Worten zu ringen. Er steckte in seiner eigenen Falle. Er seufzte und ließ sich in einen der Sessel fallen, aber er sagte immer noch nichts.
Ich blickte ihn an. »War das Johann Haider im Leichenschauhaus?«
Weaver antwortete nicht.
»Dann sagen Sie mir doch wenigstens, warum Sie hier sind. Und warum Sie über Haider Bescheid wissen. Schließlich stoße ich nicht jeden Tag auf so eine großartige Story über einen Mann, der angeblich tot ist und mehr als fünfzig Jahre später noch gelebt haben soll.«
Weaver schwieg.
Ich starrte ihn an. »Ich habe langsam das Gefühl, gegen eine Wand zu reden, Colonel.«
Er saß noch immer da, ohne sich zu rühren.
»Sagen Sie mir doch wenigstens, warum Sie hier sind. Eine einfache Frage. Ist das denn wirklich zu viel verlangt?«
Jetzt schien Weaver die Geduld zu verlieren. »Himmelherrgott, Carney, Sie führen sich auf wie ein Hund, der hinter einem Knochen her ist. Jetzt habe ich aber genug von der verdammten Fragerei.« Er stand auf, als ob er gehen oder zumindest das Gespräch beenden wollte, und sagte mit entschiedener Stimme: »Sie sind ein Fremder für mich. Und mit Fremden spreche ich gewöhnlich nicht über persönliche Angelegenheiten.«
»Gut, Colonel, wenn Sie es so wünschen. Aber ich möchte Ihnen gern noch etwas erzählen. Vielleicht können Sie das Ganze ja unter einem anderen Blickwinkel betrachten.«
Weaver sah fast verzweifelt aus. »Halten Sie die Klappe, Carney. Ich bin nicht in Stimmung.«
»Ich könnte mir aber vorstellen, dass Sie das, was ich zu sagen habe, interessieren würde.«
»Tatsächlich? Das glaube ich kaum.«
»Hören Sie mir nur noch eine Minute zu. In dem Moment, als ich Ihren Namen in der Leichenhalle gehört habe, ist mir ein regelrechter Schauer den Rücken hinuntergelaufen. Die Ägypter würden es als Kismet bezeichnen. Vielleicht hat das Schicksal uns beide zusammengeführt.«
Weavers Augen verengten sich. »Wovon, zum Teufel, reden Sie da eigentlich?«
»Der Artikel, den ich über Sie geschrieben habe, nach der Tragödie von Dallas. Sie haben mich nicht gefragt, wie ich an die Informationen über Ihr Privatleben gekommen bin. Informationen, die der Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich waren.«
Weaver runzelte die Stirn und nickte dann. »Ja, ich erinnere mich noch, dass Sie alles sehr genau beschrieben haben. Aber ich verstehe den Zusammenhang nicht.«
»Sagt Ihnen der Name Tom Carney etwas?«
Weaver zuckte zusammen, als ob ich ihn geschlagen hätte, und starrte mich fassungslos an. »Captain Tom Carney?«
»Ja, genau der. Das war mein Vater. Sie waren gemeinsam in Nordafrika damals: Operation Torch, 1943. Sie sind verwundet worden, als Ihre Aufklärungseinheit vor Algier von einem Minenwerfer getroffen wurde. Er hat Sie unter heftigem Beschuss hinter die amerikanischen Linien zurückgetragen. Dafür hat er einen Orden bekommen, auf Ihre Empfehlung hin. Er ist dann auch zweimal verwundet und nach Hause geschickt worden.«
Der harte Ausdruck wich aus Weavers Gesicht, sein Ärger war verflogen, und er betrachtete mich jetzt eingehend. »Ich werd’ verrückt. Sie sind Tom Carneys Sohn?«
»Mein Vater hat viel von Ihnen erzählt. Mir schien, als ob Sie einmal ziemlich enge Freunde gewesen wären.«
Weaver nickte, und seine Augen füllten sich mit Tränen. »Er war ein guter Mann. Mutig. Ehrlich. Einer der besten, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Es tut mir so leid, dass wir später den Kontakt verloren haben. Aber wenn ich richtig gehört habe, ist er vor etwa zehn Jahren gestorben?«
»Vor zwölf Jahren. Und es vergeht noch immer kein Tag, an dem er mir nicht fehlt.« Ich blickte Weaver fest in die Augen. »Ich denke oft, dass sich das Leben zweier Menschen nicht ohne Grund überschneidet, auch wenn dieser Moment noch so kurz ist. Nicht, dass wir den Grund dafür auch nur ansatzweise verstehen könnten. Vielleicht steht es in unseren Sternen geschrieben. Aber Sie und mein Vater – es klingt vielleicht merkwürdig, aber wissen Sie, dass er oft über Vorsehung gesprochen hat? Möglich, dass sich für Sie beide alles ganz anders entwickelt hätte, wenn er nicht dabei gewesen wäre, als Sie verwundet wurden. Das Schicksal geht seltsame Wege, Colonel. Und als ich Ihren Namen in der Leichenhalle gehört habe, kam mir das wie ein Wink des Schicksals vor. Kismet hat uns nicht ohne Grund zusammengebracht. Diese Geschichte über Haider hat mich all die Jahre nicht losgelassen, ein Rätsel, das einfach nicht zu lösen war, und ich will der Sache endlich auf den Grund gehen. Wenn Sie mir also irgendwie dabei helfen können, dann wäre ich Ihnen mehr als dankbar. Ihre Freundschaft zu meinem Vater möchte ich dabei nicht ausnutzen, Colonel, glauben Sie mir. Aber ich nehme an, Sie haben meinem Vater vertraut. Ich bitte Sie lediglich, auch mir zu vertrauen.«
Weaver schwieg wie ein Grab.
»Vielleicht finden Sie, dass ich mir zu viel herausnehme, aber ich habe nur zwei einfache Fragen an Sie. Warum sind Sie hier, und wieso kannten Sie Haider?«
Weaver seufzte. Es klang, als ob er sich von einem Schmerz, der tief in ihm steckte, befreien wollte. »Ja, ich habe Johann Haider gekannt«, gab er schließlich zu. »Vor sehr langer Zeit.«
»Jetzt überraschen Sie mich allerdings. Ich weiß, warum ich hier bin, aber Sie? Warum sind Sie hier?«
Weaver beugte sich in seinem Sessel vor. Die gebeugte Haltung ließ ihn plötzlich sehr alt erscheinen, als ob meine Hartnäckigkeit ihn erschöpft hätte. Auf seinem Gesicht lag ein müder, trauriger Ausdruck. »Oh, da gibt es eine Menge Gründe, Carney. Eine ganze Menge, das kann ich Ihnen sagen.« Er wollte noch mehr sagen, aber dann schien er es sich anders überlegt zu haben. »Das heißt, Sie haben geglaubt, dass sich dahinter eine gute Story verbirgt?«
»Das habe ich jedenfalls gehofft. Und selbst wenn es nicht so ist, dann kann ich wenigstens meine Neugier befriedigen.«
Weaver zögerte, als ob er innerlich mit sich kämpfte, dann sagte er: »Ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, dass sich dahinter eine Story verbirgt, aber ich bezweifle, dass sie Ihnen bei der Suche nach Franz Haiders Kunstsammlung weiterhelfen könnte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Sammlung nach dem Sturm auf Berlin in russische Hände gelangt ist. Immerhin ist fast alles von Wert dort gelandet.«
»Das habe ich mir auch schon gedacht. Aber was ist mit Johann Haider? Er scheint mir der einzige Schlüssel zu diesem Rätsel zu sein. Was können Sie mir über ihn sagen?«
Weaver schien sich plötzlich unwohl zu fühlen, als ob der Schmerz, den er versucht hatte zu vertreiben, zurückgekommen wäre. Er sah sich im Zimmer um. »Gibt es hier denn nichts zu trinken?«
»Ich fürchte, nein.«
»Verdammt!« Weaver stand auf und ging zum Fenster. Der Sturm hatte sich noch immer nicht gelegt, und die hohen Palmen am Ufer des Nils bogen sich im Wind. Er starrte gedankenverloren hinaus, und als er endlich sprach, klang er irgendwie abwesend. »Kairo war ein verdammt interessanter Ort im Krieg, wussten Sie das? Man kann sogar behaupten, dass das Schicksal der gesamten Welt hier entschieden wurde.«
»Tatsächlich? Wollen Sie mir nicht mehr darüber erzählen?«
Weaver antwortete nicht sofort. Er starrte immer noch auf das Ufer des Nils. »Ich könnte Ihnen eine Story liefern, Carney. Vielleicht die verrückteste, die Sie je gehört haben. Aber die Frage ist, ob Sie sie glauben würden?«
»Stellen Sie mich ruhig auf die Probe.«
Er drehte sich um. Sein Gesicht war plötzlich todernst. »Unter einer Bedingung. Sie werden nichts von dem, was ich Ihnen erzähle, zu meinen Lebzeiten veröffentlichen.«
Ich war überrascht. »Sie machen einen erstaunlich gesunden Eindruck, Colonel. Da müsste ich wohl sehr lange warten.«
»Vielleicht nicht. Ich bin ein alter Mann, Carney, viel Zeit wird mir nicht mehr bleiben. Und ich nehme an, dass ich zu diesem Zeitpunkt niemanden mehr mit der Wahrheit verletzen kann, nicht nach so vielen Jahren. Aber wissen Sie, was das Merkwürdigste ist? Ich habe meine Geschichte bis heute niemandem erzählt. Ich hätte es tun können, wenn ich gewollt hätte, schon oft, denn sie verfolgt mich, aber fünfzig Jahre lang habe ich sie für mich behalten. Und vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen, Sie mit jemandem zu teilen, bevor es zu spät ist.« Weaver starrte mich an. »Vielleicht haben Sie recht mit Ihrer Theorie über das Schicksal, Carney. Dass die Vorsehung hier ihre Hand im Spiel hat. Außerdem habe ich einiges von Ihnen gelesen, und wenn Sie nur halbwegs nach Ihrem Vater kommen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Sie ein ehrlicher Mann sind, der auf meine Wünsche Rücksicht nehmen wird.«
Ich erwiderte seinen Blick und nickte. »Sie haben mein Wort.«
Weaver sah sich in dem schmutzigen, unordentlichen Zimmer um, als ob ihn diese Umgebung plötzlich bedrückte. »Macht es Ihnen etwas aus, wenn wir woanders hingehen?«
»Mein Taxi wartet unten. Ich kann Sie mitnehmen.«
»An einem solchen Abend sage ich nicht Nein. Übrigens, ich wohne im neuen Shepheards. An das alte kommt es zwar nicht annähernd heran, aber wenigstens servieren sie dort einen ganz ordentlichen Scotch.«
»Das klingt nicht schlecht.«
Weaver klappte den Kragen seines Trenchcoats hoch, trat ins Treppenhaus und ging rasch die Stufen hinunter. Ich sah mich noch ein letztes Mal in der armseligen Wohnung um, schloss die Tür und folgte ihm.
Die Fahrt zum Shepheards stellte mich auf eine harte Probe. Aus irgendeinem Grund sprach Weaver kaum. Er starrte die ganze Zeit aus dem Fenster und schien sich ganz in seine eigene Welt zurückgezogen zu haben. Ich wurde das ungute Gefühl nicht los, dass er sich vielleicht doch noch anders entschieden hatte, was seine Geschichte betraf, aber als wir das Foyer des Hotels betraten, schüttelte er sich den Sand vom Mantelkragen und sagte: »In zehn Minuten in der Bar. Bestellen Sie mir einen sehr großen Dewars. Ohne Eis.«
Er stieg in den Aufzug, und ich ging in die Bar des Restaurants. Das alte Shepheards-Hotel hatte über etwas verfügt, was die Reiseführer Atmosphäre zu nennen pflegen. Über allem hatte der verblasste Glanz der belle époque gelegen: dunkles Holz und hohe Marmorsäulen, dicke Teppiche und Antiquitäten. Es gehörte zu den weltberühmten Grandhotels, die für die reichen Europäer gebaut worden waren. Das moderne Shepheards war im Vergleich dazu eine traurige Imitation, obwohl es noch immer als Touristenattraktion galt. Aber in der Bar saßen an diesem Abend keine Touristen, nur ein paar ausländische Geschäftsmänner, die sich unterhielten. Ich setzte mich an einen Tisch am Fenster und bestellte zwei große Dewars, entschied mich dann aber anders und sagte dem Kellner, er solle gleich die ganze Flasche bringen.
Weaver kam zehn Minuten später. Er hatte sich umgezogen und trug jetzt einen Pullover und Baumwollhosen, und er machte einen etwas entspannteren Eindruck, als er sich in der Bar umsah. »Es ist zum Heulen. Nichts erinnert mehr an den Glanz vergangener Tage.«
»Löst das Shepheards bei Ihnen alte Erinnerungen aus, Colonel?«
»Viel zu viele, fürchte ich«, antwortete Weaver mit einem Anflug von Wehmut. »Aber jetzt ist Schluss mit diesem Colonelgetue. Ich bin schließlich seit über zwanzig Jahren im Ruhestand.« Er sah sich weiter im Raum um. »Wussten Sie, dass Greta Garbo im alten Hotel abgestiegen ist? Ganz zu schweigen von Lawrence von Arabien, Winston Churchill und der Hälfte der Gestapo-Spione während des Krieges.«
Ich füllte unsere Gläser und stellte die Flasche zwischen uns. »Irgendwo habe ich einmal gelesen, dass Rommel nach dem Fall von Tobruk angerufen haben soll, um zu reservieren, weil er geglaubt hat, dass er eine Woche später wieder in Kairo sein würde. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das alte Shepheards bei den Unabhängigkeitsaufständen 1952 abgebrannt. Offenbar haben viele Ägypter darin ein Symbol des britischen Imperialismus gesehen.«
»Sie kennen sich in der Geschichte ja gut aus, Carney.«
»Und deswegen stört mich auch etwas. Wenn alles, was ich über Johann Haider herausbekommen habe, wahr ist, und wenn er wirklich all die Jahre gelebt hat, warum hat er sich dann versteckt, warum diese Geheimnistuerei?«
»Nun, dafür könnte es mehrere Gründe geben. Zum einen hatten die Vereinigten Staaten Grund genug, ihn als Verräter zu verhaften. Vielleicht hätten sie ihn sogar gehängt.«
Ich runzelte die Stirn. »Wofür denn? Sicher, Haider war deutscher Staatsbürger, aber wieso soll er ein Verräter gewesen sein?«
»Er war zwar Deutscher, kam jedoch in Amerika zur Welt. Sein richtiger Name war Johann, aber eigentlich nannte man ihn seit seiner Kindheit Jack. Nur die Deutschen nannten ihn Johann. Jack klang ihnen zu ausländisch. Und sein Verschwinden hatte mit dem Einsatz zu tun, von dem Sie gesprochen haben. Der Einsatz, bei dem er gestorben sein soll. Das war vielleicht das Gewagteste, was sich die Nazis je haben einfallen lassen. Und es hat hier in Ägypten stattgefunden.«
»Ich verstehe gar nichts.«
»Haider war der Leiter eines Teams, das Präsident Roosevelt und Premierminister Winston Churchill in Kairo ermorden sollte. Der Befehl kam direkt von Adolf Hitler.«
Fassungslos starrte ich ihn an. »Jetzt erstaunen Sie mich wirklich. Ein in Amerika geborener Attentäter wird von Hitler beauftragt, den Präsidenten der USA zu ermorden? Das klingt mehr als gewagt.«
Weaver stellte sein Glas auf den Tisch. »Und dazu noch den wahrscheinlich bedeutendsten amerikanischen Präsidenten, der je gelebt hat. Haiders Einsatz sollte das Kriegsgeschehen zugunsten der Nazis beeinflussen. Und es stand eine Menge mehr auf dem Spiel als bei Kennedy in Dallas. Die Zukunft der gesamten freien Welt, nicht weniger als das. Das Ganze sollte im November 1943 stattfinden, als Roosevelt und Churchill an der Konferenz in Kairo teilnahmen, einer der entscheidendsten Konferenzen der Alliierten während des Krieges. Unter anderem waren der Präsident und der Premierminister auch deshalb in Kairo, um hinsichtlich der Operation Overlord, der geplanten Invasion in Europa, zu einer Einigung zu gelangen. Wäre Hitler mit seinem Attentat erfolgreich gewesen, dann hätte das die Alliierten in ein totales Chaos gestürzt, die Invasion hätte nicht stattgefunden, und Deutschland hätte den Krieg gewonnen.« Weaver hob die Hand. Daumen und Zeigefinger berührten sich fast. »Glauben Sie mir, Carney, sie waren so nah dran. Fast hätten sie es geschafft. Der Gedanke macht mir immer noch Angst.«
Ich war sprachlos. »Meinen Sie das ernst? Das soll wirklich passiert sein?«
»Allerdings. Da gibt es nichts zu zweifeln. Und es war meine Aufgabe, Haider aufzuhalten und zu töten. Aber darüber steht nichts in den Geschichtsbüchern, denn es war eine viel zu delikate Angelegenheit.«
Ich sah ihn gespannt an. »Aber ich verstehe das nicht. Selbst wenn ich davon ausgehe, dass Haider überlebt hat, warum sollten Sie ihn dann nach so langer Zeit immer noch suchen? Um ihn doch noch als Verräter zu entlarven? Dafür war es doch wohl etwas zu spät, oder nicht?«
Auf Weavers Gesicht lag nun ein Ausdruck der Trauer. Er sah eine Weile auf den Nil hinaus, bevor er sich wieder mir zuwandte. »Nein, es waren viel persönlichere Gründe«, sagte er leise.
Ich hörte die plötzliche Gefühlsaufwallung in Weavers Stimme. »Nur dass Sie richtig verstehen, Carney. Haider hat tatsächlich den Verlauf der Weltgeschichte beeinflusst.«
»Macht es Ihnen etwas aus, mir zu erzählen, wie Sie das meinen?«
Weaver konnte die Verwirrung in meinem Gesicht nicht entgangen sein, aber er schwieg. Stattdessen sah er aus dem Fenster hinaus, und seine Augen verschleierten sich, als ob er versuchte, sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen. Der heulende Sandsturm hatte sich beinahe gelegt, und wie aus dem Nebel tauchte die Stadt auf. Plötzlich konnte man den Nil in all seiner erhabenen Pracht sehen und die Hausboote auf dem Fluss; die engen, dunklen Gassen, in denen es nach Abfall und Gewürzen roch, und die schlanken Minarette; in einiger Entfernung die geisterhaften Umrisse der Pyramiden. Ich konnte mir gut vorstellen, wie die Stadt vor über fünfzig Jahren gewesen sein musste: eine Stadt voller Geheimnisse, Verlockungen und Intrigen.
Als Weaver sich wieder umdrehte, trug sein Gesicht einen schwer zu deutenden Ausdruck. Trauer vielleicht oder Schmerz, ich konnte es mir nicht erklären.
»Ich erzähle die Geschichte wohl am besten von Anfang an. Sie müssen nämlich wissen, Jack Haider und ich waren schon lange vor dem Krieg Freunde. Wir kannten uns schon als Kinder. Man könnte sogar sagen, wir waren wie Brüder.«
Vergangenheit
2
Sakkara
Es hatte eine Zeit gegeben, in der sie alle zusammen gewesen waren.
Sie waren jung, und der Ort hieß Sakkara. Ein Team von Archäologen hatte den Eingang zu einer geheimen Grabkammer neben der Stufenpyramide des Pharaos Djoser entdeckt, die in der Nähe der historischen Stadt Memphis etwa dreißig Kilometer südlich von Kairo lag. Eine internationale Gruppe war im Frühjahr 1939 gekommen, um bei den Ausgrabungen zu helfen. Sie bestand aus lauter jungen Leuten, alle unter dreißig, die aus Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Amerika kamen. Es waren fast einhundert, darunter einige Archäologen und Ägyptologen, aber auch Ingenieure oder einfach nur junge Menschen auf der Suche nach einem Abenteuer. Sie alle arbeiteten hart in der erbarmungslos heißen Wüstensonne. Voller Eifer waren sie und entschlossen, dieses einmalige Erlebnis zu genießen, auch wenn sich die Gerüchte über einen bevorstehenden Krieg immer mehr verdichteten.
Wie immer, wenn junge, abenteuerlustige Menschen an einem exotischen Ort zusammenkommen, bildeten sich schon bald enge Freundschaften. Für zwei der jungen Männer allerdings, Harry Weaver und Jack Haider, war die Ausgrabung in Sakkara ein geplantes Wiedersehen. Jack Haider, der Sohn einer schönen Dame aus der feinsten New Yorker Gesellschaft und eines reichen preußischen Geschäftsmannes mit einem Faible für Ägypten, war von Natur aus Abenteurer. Er war vierundzwanzig, ein Jahr älter als Weaver, der die erste Gelegenheit, ins Ausland zu reisen, mit Begeisterung angenommen hatte. Sein Vater hatte als Verwalter auf einem großen Besitz der Familie von Jack Haiders Mutter gearbeitet, und trotz ihrer so unterschiedlichen sozialen Herkunft hatten sich die beiden Jungen schon als Kinder miteinander angefreundet, und diese Freundschaft hatte noch immer Bestand. Selbst nach dem Tod von Haiders Mutter verbrachten sie ihre Sommer gemeinsam, wenn Franz Haider einmal im Jahr nach New York kam. Aber in Sakkara gab es ein Problem. Beide hatten sich in dieselbe Frau verliebt.
Rachel Stern war eine junge Archäologin von dreiundzwanzig Jahren und kam frisch von der Universität. Sie war die Tochter eines katholischen Deutschen und einer Jüdin. Mit ihrem blonden Haar und den blauen Augen schien sie nicht nur die Intelligenz ihrer Eltern geerbt zu haben, sondern auch ihr gutes Aussehen. Beide waren bekannte Archäologen, und Rachels Vater, ein Professor, war der Leiter der Ausgrabung. Rachel mochte die beiden jungen Männer sehr, aber sie schien sich nicht entscheiden zu können, wen von den beiden sie liebte, also war es ihr nur recht, dass sie alles zu dritt unternahmen.
Im Sommer fuhren sie nach Kairo und Luxor, besichtigten die Basare und Märkte, die Täler der Könige und Königinnen und den Tempel von Karnak. Am Wochenende gingen sie oft ins Shepheards zum Tanz, besuchten Partys im Mena-Hotel, das im Schatten der Pyramiden lag, aßen in einem der zahllosen kleinen, gemütlichen Restaurants am Ufer des Nils und gingen anschließend in einen der vielen so erfolgreichen Hausboot-Nachtclubs auf dem Fluss.
Harry Weaver hatte einmal ein Foto von allen dreien gemacht. Sie standen zwischen den Gräbern in der glutheißen Wüste in Sakkara, und die Stufenpyramide bildete den Hintergrund. Alle drei waren braun gebrannt und lächelten in die Kamera. Rachel stand in der Mitte und hatte die Arme um die Taillen der Männer geschlungen. Und obwohl es niemand von ihnen je aussprach, wussten sie alle, dass dies für sie eine glückliche Zeit war, vielleicht die glücklichste in ihrem jungen Leben.
Aber der Sommer ging zu Ende. Keiner von ihnen konnte sich noch an das genaue Datum erinnern, an dem sie sich kennengelernt hatten, aber auf dem Abschied lag ein düsterer Schatten: September 1939. Es war der Monat, in dem in Europa der Krieg begann. Hitler war in Polen einmarschiert, und ihr Leben, wie das von so vielen anderen, sollte sich grundlegend ändern.
Es war Nachmittag, und in der Ferne flimmerten die Umrisse der Pyramiden in der Hitze der Wüste. Der Jeep mit zugezogenem Verdeck hielt an, und Harry Weaver stieg aus. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und nahm einen alten Lederbeutel vom Rücksitz. Dann ging er auf die Zelte zu, die um die Ausgrabungsstätte von Sakkara herum errichtet worden waren.
Einige Kollegen waren dabei, Ausrüstungsgegenstände der Ausgrabung auf Bedford-Lastwagen zu verladen, und als Weaver zu ihnen hinging, trat ein grauhaariger Mann aus einem der Zelte. Er trug einen Hut, und sein Kakihemd war voller Schweißflecken.
Professor Stern machte ein ernstes Gesicht, nicht ohne einen Anflug von Humor, und als er Weaver sah, nahm er die Brille ab, reinigte sie mit einem Taschentuch und lächelte. »Harry, Sie sind zurück. Das wurde aber auch Zeit, Ich habe schon befürchtet, dass wir Ihnen ein Suchkommando hinterherschicken müssen.«
»Bitte entschuldigen Sie, Professor, aber ich bin noch beim Shepheards vorbeigefahren, um zu sehen, ob es etwas Neues gibt.«
»Und, was hat Kairos wichtigstes Wasserloch zu vermelden?«
»Warschau steht noch immer in Flammen. Die deutschen Stukabomber legen die Stadt in Schutt und Asche. Niemand glaubt, dass die Polen noch lange durchhalten.«
»Dieser schwachsinnige Hitler«, stieß Stern durch die zusammengebissenen Zähne hervor. »Nicht lange, dann liegt ganz Europa in Trümmern. Aber was kann man von so einem Verrückten auch schon erwarten?« Er wechselte rasch das Thema, als wäre es ihm irgendwie unangenehm, und wandte sich in die Richtung des summenden Dieselgenerators, der nicht weit weg von ihnen in der flirrenden Hitze stand. Wie Schlangen wanden sich die elektrischen Kabel durch den Sand und verschwanden in einer großen Grube, die zur Sicherheit rundherum mit einem stabilen hölzernen Gerüst abgestützt war. Eine Leiter führte in den Schacht hinein. »Wir kommen gut voran. Wir müssen nur noch die letzten Geräte aus dem Tunnel nach oben schaffen, dann können wir uns darauf konzentrieren, hier oben aufzuräumen. Haben Sie die Post abgeholt?«
Weaver hob den Lederbeutel hoch. »Hier ist sie. Zum letzten Mal. Und ich habe auch Ihre Liste mit den Nachsende-Adressen der Mannschaft im Ministerium abgeliefert, falls nach unserer Abreise noch Post für uns ankommen sollte.«
»Ausgezeichnet!« Stern stemmte die Hände in die Hüften, blinzelte im gleißenden Sonnenlicht und sah sich um. »Tja, unsere Zeit in Sakkara ist nun also bald abgelaufen, nicht wahr, Harry?«
Weaver machte ein trauriges Gesicht. »Um ehrlich zu sein, ich bin nicht froh darüber. Jemandem wie mir bietet sich nicht oft die Gelegenheit, Ägypten zu besuchen und an einer Ausgrabung teilzunehmen. Ich habe das Gefühl, dass dieses Abenteuer der Höhepunkt meines Lebens sein könnte.«
Stern lächelte und klopfte Weaver auf die Schulter. »Unsinn. Sie sind noch so jung. Wie alt sind Sie eigentlich, Harry? Wahrscheinlich so wie die meisten hier – dreiundzwanzig, vierundzwanzig?«
»Dreiundzwanzig, Sir.«
»Dann haben Sie alles noch vor sich. Da wird es noch eine ganze Menge hochinteressanter Abenteuer geben, da bin ich sicher.«
»Was ist mit Ihnen, Professor? Haben Sie immer noch vor, von hier nach Istanbul zu fahren?«
Stern nickte. »In vier Tagen. Ich habe mich entschlossen, die befristete Dozentenstelle anzunehmen, auch wenn das alles sehr überstürzt war. Aber Istanbul ist eine herrliche Stadt, und ich bin sicher, dass es meiner Frau und Rachel dort gefallen wird. Wie auch immer, ich werde jedenfalls für eine Weile etwas zu tun haben.« Er nahm sein Taschentuch und wischte sich den Schweiß von der Stirn, dann streckte er die Hand nach dem Postsack aus und nickte in Richtung des Schachts. »Rachel und Jack und ein paar von den anderen sind noch da unten. Die Hitze ist ja nicht auszuhalten, warum gehen Sie nicht auch hinunter und helfen ihnen beim Aufräumen? Ich werde die Briefe verteilen.«
Weaver stieg die Leiter in den Schacht hinunter, dessen Wände zum Teil aus massivem Fels bestanden. Er war gute fünfzehn Meter tief, und unten teilte er sich in mehrere schmale Gänge, die in verschiedene Richtungen führten.
Die gelben Lehmwände waren hier mit Holzpfählen abgestützt und mithilfe einer Kette von Glühlampen, die oben am Generator angeschlossen waren, beleuchtet. Die Tunnel führten zu den drei einzelnen Gräbern, die man hier gefunden hatte, und die Decke war dort zum Teil so niedrig, dass man nicht aufrecht gehen konnte. Aber verglichen mit der kochenden Hitze oben war die Luft hier unten angenehm kühl, ja fast kalt, und es war ein wenig unheimlich. Aber Weaver war daran gewöhnt, und er spazierte munter einen der Gänge entlang, bis er ans Ende kam und Stimmen hörte.
Ein großer Sarkophag, das Grab einer wenig bekannten Prinzessin der Djoser-Dynastie, stand am hinteren Ende des Tunnels in einer Wandnische. Die mumifizierten Überreste waren nach der Entdeckung des Grabes entfernt worden, und der steinerne Sargdeckel war gegen die Wand gelehnt. Seine Oberfläche war mit prachtvollen Hieroglyphen verziert. Mehrere junge Leute waren damit beschäftigt, Werkzeug und elektrische Kabel aus dem Bereich zu entfernen. Weaver sah Jack Haider und Rachel Stern hart arbeiten. Ihre Kleidung war von einer feinen Staubschicht bedeckt. Dann drehte sich Rachel um und sah ihn.
Ihr blondes Haar war zurückgebunden und betonte so ihre hohen Backenknochen. Winzige Schweißperlen bedeckten das sonnengebräunte Gesicht und den Hals, und obwohl sie ein weites Kakihemd und Hosen trug, zeichnete sich ihre Figur deutlich darunter ab. Sie sah hinreißend aus wie immer. Sie lächelte Weaver an, und sein Herz begann sogleich schneller zu klopfen. »Harry, wir haben gerade über dich geredet.«
»Nichts Schlechtes, will ich hoffen?«
»Natürlich nicht. Wir haben uns bloß gefragt, wo du so lange bleibst.« Sie kam näher und gab ihm einen Kuss auf die Wange. Ein verschmierter Staubfleck blieb zurück. »Sieh nur, was ich da angerichtet habe.«
Lachend wischte sie den Fleck weg, und als ihre Hand seine Haut berührte, lief es Weaver heiß den Rücken herunter. Es war wie ein elektrischer Stromschlag. Jedes Mal, wenn er Rachel Stern ansah oder sie ihn berührte, spürte er eine enorm starke Anziehung. Das war vom ersten Tag an so gewesen, und er kämpfte schwer damit, seine Gefühle unter Kontrolle zu halten. »Ich bin noch beim Shepheards vorbeigefahren. Die Neuigkeiten sind nicht gut. Warschau wird noch immer bombardiert, und man sagt, dass die Polen nicht mehr lange durchhalten werden.«
»Das ist wirklich schrecklich«, sagte Rachel besorgt. »Nicht wahr, Jack?«
Jack Haiders Gesicht strahlte eine eigenartige Rastlosigkeit aus. Immer umspielte ein leichtes Lächeln seinen Mund, als wäre das Leben für ihn ungleich interessanter, als er es sich je vorgestellt hatte. Aber jetzt war das Lächeln verschwunden. »Es ist allerdings furchtbar. In diesem Augenblick schäme ich mich fast, Deutscher zu sein.«
Weaver legte dem Freund die Hand auf die Schulter. »Wir alle finden die Ereignisse schrecklich, Jack. Aber weder du noch irgendeiner der Deutschen bei dieser Ausgrabung ist schuld an diesem Konflikt. Verantwortlich ist einzig und allein Adolf Hitler.«
»Wahrscheinlich hast du recht.« Haider starrte einen Moment lang in den offenen Sarkophag, dann strich er mit der Hand über die glatte Oberfläche des Deckels. »Ich bin sehr traurig, dass ich dieser letzten Ruhestätte unserer Prinzessin Lebewohl sagen muss. Ist es nicht unglaublich, wenn man es sich genau überlegt?«
»Wie meinst du das?«
»Tausende von Jahren hat sie hier gelegen, bis wir sie gefunden haben. Zu Lebzeiten wurde sie gewiss von nicht wenigen Männern begehrt. Und jetzt liegen ihre mumifizierten Überreste im Ägyptischen Museum, um zerschnitten und untersucht zu werden, wie die anderen, die wir gefunden haben. Und auf all die wichtigen Fragen, die wir so gerne stellen würden, werden wir wahrscheinlich nie eine Antwort finden. Wie hat sie ausgesehen? Wie hat sie gelebt? Wen hat sie geliebt? Ich glaube kaum, dass jemand über uns einmal solche Fragen stellen wird. Sie hat wenigstens eine gewisse Unsterblichkeit erlangt.«
Rachel lächelte. »Jack, was für ein romantischer Träumer du doch bist.«
»Wir wollen nur hoffen, dass unserer Prinzessin kein Fluch anhängt, sonst stecken wir alle in Schwierigkeiten«, meinte Weaver trocken.
»Du glaubst doch wohl nicht an Flüche, Harry, oder?«, fragte Rachel ungläubig.
»Frag mich das in ein paar Jahren noch einmal, wenn wir alle mit diesen scheußlichen roten Flecken übersät sind und an irgendeiner unbekannten, unheilbaren Krankheit sterben.«
Sie lachten, dann hörten sie ein Geräusch hinter sich. Jemand kam die knarrende Holzleiter hinunter. Es war Professor Stern, der jetzt im Tunnel erschien. »Sie scheinen sich ja gut zu amüsieren, und ich verderbe Ihnen nur ungern die Stimmung, aber ich habe gerade die Post verteilt, die Harry in Kairo abgeholt hat. Größtenteils schlechte Neuigkeiten, soweit ich das sagen kann. Mindestens ein Dutzend der Leute sind einberufen worden, und sie sind alles andere als begeistert darüber.«
»Harry hat uns erzählt, wie es in Warschau aussieht«, meinte Haider.
»Ich will gar nicht darüber nachdenken«, sagte Professor Stern niedergeschlagen. »Ich bin auch so schon deprimiert genug.« Er sah sich um. »Du hast hart gearbeitet, Rachel. Und Sie auch, Jack.«
»Und all das, ohne uns ein Bein zu brechen, Professor«, antwortete Haider. »Wenn Harry uns hilft, sollten wir eigentlich in ein paar Stunden mit allem hier fertig sein.«
»Bevor ich es vergesse, Jack, da war auch etwas für Sie in der Post.« Der Professor gab ihm den Brief. »Ich glaube, er kommt aus Deutschland.«
Haider trat unter eine der Glühlampen, riss den Umschlag auf und las den Brief. Sein Gesicht verfinsterte sich merklich, dann faltete er das Papier langsam zusammen und steckte es in die Brusttasche seines Hemds.
»Was ist denn? Schlechte Neuigkeiten?«, fragte Rachel.
Haider zwang sich zu einem Lächeln. »In gewisser Weise. Er ist von meinem Vater.«
Mehr sagte er nicht, als ob es sich um ein heikles Thema handelte. Stern reagierte als Erster. Munter klopfte er Weaver auf die Schulter und sagte: »Also, wir machen uns besser wieder an die Arbeit. Ich möchte alles erledigt haben, bevor es dunkel wird, damit wir die große Party morgen Abend so richtig genießen können.«
»Welche Party?«, fragte Weaver, und alle sahen den Professor an.
Stern lächelte. »Das habe ich bis jetzt für mich behalten, aber nun ist es an der Zeit, dass Sie es alle wissen. Erinnern Sie sich noch an meine Worte von vergangener Woche, dass ich das Budget ein bisschen strecken konnte, um der gesamten Mannschaft zum Abschluss ein billiges Hotelzimmer in Kairo und ein Abendessen bezahlen zu können? Nun, es wird sogar noch besser. Was hier noch an Arbeit zu tun ist, wird natürlich vom Ministerium übernommen werden, aber man hat unsere Grabung als großen Erfolg eingestuft, und so wird es nun eine Party beim amerikanischen Botschafter geben. Es ist ja bekannt, dass er sich sehr für Archäologie interessiert, und er hat darauf bestanden, uns zu Ehren einen Galaabend zu veranstalten. Es wird ein großartiges Büfett geben, viele wichtige Leute sind eingeladen, und wie ich höre, hat der Botschafter sogar eine Tanzband organisiert. Das ist doch alles überaus freundlich von ihm, finden Sie nicht?«
»Nun, das klingt ja großartig«, sagte Haider.
»Wundervolle Neuigkeiten, Papa«, stimmte Rachel zu. »Nicht wahr, Harry?«
»Die besten, die ich seit Langem gehört habe.«
»Habe ich mir doch gedacht, dass euch das aufmuntern wird.« Der Professor krempelte sich die Ärmel hoch. »Also, lasst uns die Ausrüstung nach oben bringen und verladen, dann können wir uns alle ausruhen.«
Die Sonne ging unter und tauchte die Wüste in ein oranges Licht. Die Beduinen, die für die Dauer der Grabung als Köche verpflichtet worden waren, hatten das Abendessen serviert: Köfte, Safranreis und frisches Brot. Und da es die letzte Nacht im Zeltlager war, hatte Professor Stern große Mengen von ägyptischem Bier und Wein spendiert.
Sie saßen um das große Lagerfeuer herum, aber man sprach kaum über den Krieg, denn niemand im Lager wollte, dass die Politik sie entzweite. Einer der Franzosen spielte auf seinem Akkordeon und wurde von zwei Engländern auf der Gitarre begleitet. Alle stimmten mit einem Enthusiasmus ein, zu dem nur junge Menschen fähig sind, und als sie genug geredet und gesungen hatten, war es beinahe Mitternacht. Die Asche des Feuers glühte nur noch schwach, und man zog sich allmählich in die Zelte zurück.
Haider war nicht mehr ganz nüchtern, und irgendwie hatte er noch drei Flaschen Bier organisiert. Grinsend reichte er jeweils eine an Rachel und Weaver. »Noch eines vor dem Schlafengehen, hab’ ich mir gedacht. Wie wär’s, wenn wir Djoser ein letztes Mal gute Nacht sagen?«
»Warum nicht«, meinte Rachel, und alle drei spazierten zur Stufenpyramide hinüber. Sie waren nach dem Alkoholgenuss ausgesprochen fröhlich, und Weaver trug eine Kerosinlampe, die ihnen den Weg leuchtete. Sie setzten sich auf eine der mächtigen Steinstufen am Fuß der Pyramide, wie sie es fast jeden Abend während des Sommers getan hatten. Und noch immer waren sie voller Ehrfurcht angesichts der Schönheit und Größe des fast fünftausend Jahre alten Grabmals. »Das war’s also«, sagte Haider traurig. »Unser letzter Abend in Sakkara.«
Rachel war ebenfalls niedergeschlagen. »Ich will gar nicht daran denken, dass wir diesen Ort verlassen. Es war so herrlich hier, und wir haben so viel Spaß gehabt.« Sie blickte die beiden Männer an. »Und das liegt vor allem daran, dass du hier warst, Jack, und du, Harry. Ihr habt mir die schönste Zeit meines Lebens beschert. Dafür möchte ich euch danken.«
Plötzlich sagte Haider: »Erinnerst du dich noch an das Foto, das Harry von uns dreien gemacht hat?«
»Natürlich. Warum?«
Haider nahm einen Schluck aus der Flasche und grinste spitzbübisch. »Ich habe darüber nachgedacht. Ich finde, wir brauchen mehr als ein Foto, um uns an den gemeinsamen Sommer zu erinnern. Etwas, das die Jahrhunderte überdauert.«
»Was genau meinst du denn damit, Jack?«, fragte Weaver.
Haider stand auf und schwankte leicht. »Wartet hier.«
Er nahm die Kerosinlampe und schlenderte zum Zelt der ägyptischen Arbeiter hinüber. Schon bald kam er mit einer alten Baumwolltasche zurück.
»Was, zum Teufel, hast du vor, Jack?«, entfuhr es Weaver.
»Habt Geduld. Sagt jetzt bitte nichts. Kein Wort, sonst lenkt ihr mich nur ab. Und ihr dürft nicht hinsehen, bis ich es euch sage.«
Er ging ein Stück weiter weg am Fuß der Pyramide entlang, setzte die Lampe ab und zog einen Hammer und einen Meißel aus der Tasche. Er saß da und arbeitete konzentriert im Licht der Lampe. Als er fertig war, wischte er sich den Schweiß von der Stirn und lächelte. »In Ordnung. Jetzt könnt ihr euch umdrehen.«
Er hielt die Lampe hoch, und sie kamen herbei.
Das ganze Fundament der Djoser-Pyramide war mit Inschriften übersät, und sie hatten oft staunend davor gestanden; viele Hundert Namen und Initialen waren da von zahllosen Besuchern über die Jahrhunderte hinweg in den Stein gemeißelt worden. Und obwohl es illegal war, hatten die Behörden bisher keinen Weg gefunden, es zu verhindern. Einige der Inschriften stammten noch aus römischer Zeit.
Und mitten unter ihnen stand jetzt von Jack Haider in den Stein gemeißelt: RS, HW, JH. 1939.
»Jack«, rief Rachel lachend. »Du bist nicht nur betrunken, du bist verrückt. Papa wäre entsetzt, wenn er wüsste, dass du ein so ehrwürdiges Monument entstellt hast.«
»Vielleicht, aber jetzt sind wir unsterblich«, sagte er und lächelte. »Genau wie unsere Prinzessin. In vielen Jahren noch werden die Menschen hierherkommen und sich vielleicht, nur vielleicht, fragen, wer wir wohl waren. Wir sind jetzt Teil des Geheimnisses der Pyramide.«
Rachel strich ihm freundschaftlich über den Arm. »Weißt du was? Ich bin froh, dass du es getan hast. Es war immerhin eine ganz besondere Zeit für uns hier, und es erscheint mir irgendwie angemessen. Findest du nicht, Harry?«
»Wenigstens gibt es jetzt etwas, das an uns erinnert, wenn wir schon lange tot sind.« Weaver hob die Bierflasche hoch. »Auf uns! Und auf Sakkara!«
Auf uns! Und auf Sakkara!
Sie wiederholten es alle gemeinsam und lachten. Dann unterhielten sie sich noch eine Weile und betrachteten den hellen Schein der Lichter von Kairo, der den Horizont erhellte. Schließlich stand Rachel auf und klopfte sich den Staub von den Hosen. »Und jetzt gehe ich besser ins Bett. Ich freue mich schon auf die morgige Party. Ihr müsst mir beide versprechen, dass ihr mit mir tanzen werdet.« Sie küsste beide zärtlich auf die Wange. »Gute Nacht, Jack! Gute Nacht, Harry! Schlaft gut, meine Lieben.«
»Sollen wir dich nicht mit der Lampe begleiten?«
»Nein, bleibt nur und trinkt euer Bier aus. Das Mondlicht ist hell genug.« Sie machte sich auf den Weg zu den Zelten, und Weaver sah ihr lange nach im schwachen Silberlicht des Mondes. Wie ein Geist verschwand sie schließlich, und er warf Haider, der ihr ebenfalls nachsah, einen Blick zu. Er schien in eine Art Trance versunken.
»Denkst du, was ich denke?«
»Ich weiß es nicht, Jack. Sag’s mir.«
»Dass sie die hübscheste, wunderbarste Frau ist, die wir je getroffen haben.«
»Du hast meine Gedanken gelesen, wie immer.«
»Lass uns ehrlich sein, Harry. Die Wahrheit ist, dass sie uns beiden total den Kopf verdreht hat. Warum lassen wir dann nicht diesen ganzen männlichen Blödsinn sein, dass man beispielsweise seine Gefühle nicht zeigt, und reden darüber, was wir wirklich empfinden? Wir haben bis jetzt immer vermieden, darüber zu reden, weil man das unter Männern eben nicht tut. Stets haben wir unsere wahren Gefühle verborgen, manchmal sogar vor uns selbst.«
»Du möchtest, dass ich ganz ehrlich über meine Gefühle spreche?«
»Ja. Karten auf den Tisch. Ich verspreche dir, dass ich es auch tun werde.«
Weaver wandte sich ab und starrte auf den schwächer werdenden Lichtschein der Stadt. »Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, weil ich an sie gedacht habe. Vor allem, da uns nur noch wenige Tage bleiben. Und es hat nicht einen Tag gegeben, seit ich sie getroffen habe, an dem ich nicht an sie gedacht habe, nicht mit ihr zusammen sein wollte. Nur um ihr Gesicht zu sehen, ihre Stimme zu hören. Sie ist die erste Frau, in die ich mich wirklich verliebt habe.«
Jack machte ein ernstes Gesicht. »So schlimm hat es dich erwischt?«
»Ich fürchte, ja. Und es will einfach nicht besser werden.«
»Aber du hast ihr nie auch nur im Ansatz erzählt, wie es um dich steht, oder?«