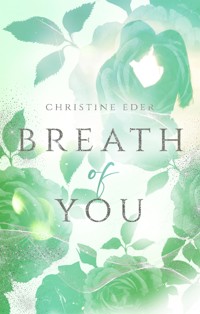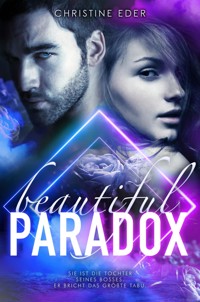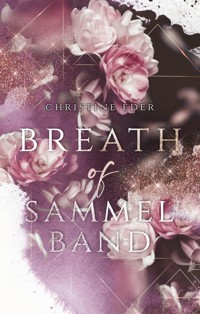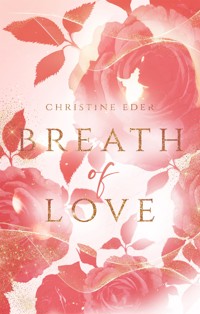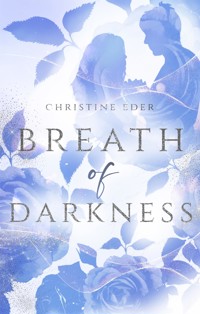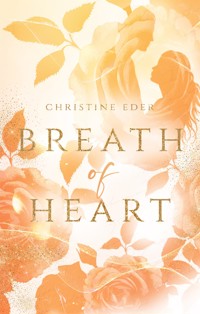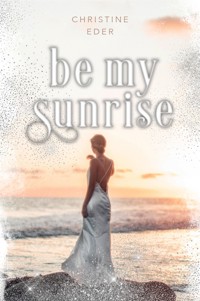3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was hat Luna dazu veranlasst, aus dem Fenster zu springen? War das ein gewöhnlicher Suizid, die Handlung eines unausgeglichenen Teenagers oder war Luna Opfer eines Verbrechens?
Thomas kann den Tod seiner Schwester nicht akzeptieren und fühlt sich als älterer Bruder verpflichtet herauszufinden, was ihr gefehlt und was sie zu ihrer Tat bewogen hat. Nach und nach entdeckt er in ihrem Profil bei einem sozialen Netzwerk merkwürdige Beiträge und geht dem nach. Schon bald muss er feststellen, dass er, wenn er alles über Lunas letzte Tage erfahren will, diese auch genauso durchleben muss, wie sie es getan hat, und steigt somit in ein tödliches Spiel ein. Um die Wahrheit herauszufinden, ist er sogar bereit, sein Leben zu opfern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Promised Heaven
Das Leben ist gerechter als der Tod (Thriller)
Elaria81371 München.
Verlag:
Elaria
Sonnenstraße 23
80331 München
Deutschland
© Christine Eder 2019
Coverdesign: © Licht Design – Kristina Licht
Bildquelle: https://de.123rf.com/profile_tohey
Korrektorat/Lektorat: Dr. Andreas Fischer
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Lieber Leser, liebe Leserin,
an erster Stelle möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Geschichte kommen Suizid und Beschreibungen von Suizidmethoden vor sowie von damit verbundenen psychischen Belastungen. Ich möchte mit meiner Arbeit niemanden zum Selbstmord auffordern, beeinflussen, beeinträchtigen oder Suizidpropaganda starten. Was ich lediglich möchte, ist, dass meine Geschichte so manchem Menschen die Augen öffnet und die Zeilen jemanden erreichen.
Allerdings ist diese Story nicht ganz aus der Luft gegriffen. Nicht alle Aspekte der Handlung sind frei erfunden, sondern basieren zum größten Teil auf wahren Begebenheiten. Alle handelnden Personen dieses Buches sind frei erfunden, jedoch ähneln sie den Betroffenen, die etwas Derartiges bereits durchlebt haben. Deswegen fiel mir die Recherche zu diesem Thema äußerst schwer sowie das Ganze in eine Geschichte zu verpacken. Das hat mich so manches Mal ziemlich mitgenommen und ich musste meine Arbeit abbrechen. Nach zwei Jahren bin ich trotzdem zu dem Entschluss gekommen, dass solche Thematiken nicht totgeschwiegen werden dürfen.
Suizid ist ein sensibles und schweres Thema, daher weiß ich nicht, welche Schlussfolgerung ihr aus dieser Geschichte zieht, ob meine Sorgen und die Absicht, mit der ich das Buch zu schreiben versucht habe, euch erreichen … Ich hoffe es sehr.
Falls ihr über meine Story in den sozialen Netzwerken sprechen wollt, dann benutzt bitte in euren Beiträgennicht die im Buch erwähnten Hashtags!
Den Lesern, die das Thema Suizid nicht abschreckt, wünsche ich viel Vergnügen beim Lesen.
Eure Christine Eder
Prolog
Aus ganzer Kraft presche ich die Treppe hinunter, laufe um mein Leben. Warum eigentlich? Warum will ich plötzlich, sechsundzwanzig Tage nachdem ich beschlossen habe, mein Leben zu verlassen, dem jetzt so schnell wie möglich entgehen? Es gibt doch kein Zurück mehr. Ich würde aus diesem Teufelskreis nicht mehr entkommen können.
Mein Herz donnert wie bekloppt gegen meine Rippen und mein Atem ist außer Kontrolle, als ich die Wohnungstür erreiche und diese hinter mir rasch zumache. Abschließen! Eins. Zwei. Warum haben wir keinen zweiten Riegel?!
Ich weiß, dass ich beobachtet werde, dass ich verfolgt werde. Ich habe Angst. Nicht zum ersten Mal. Die Angst ist bereits mein Problem. Natürlich hat jeder Mensch Ängste: Vor Mikroben, Spinnen, Flugzeugen, vor verschiedenen Erkrankungen wie Aids oder Krebs, vor Liebe oder Heirat, Zahnärzten, Schwiegermüttern, Falschheit und Neid, Höhe, Terroristen, einem Haar in der Suppe, Clowns, Hexerei und bösen Geistern … Aber vor allem hat jeder Angst vor dem Sterben. So wie ich …
Meine Nerven liegen blank. Seit Wochen spüre ich, dass ich nicht mehr normal bin – normal war ich auch schon davor nicht –, aber dass meine Psyche jetzt stark nachgibt, das bezweifle ich nicht mehr. Ich bin nicht mehr ich selbst … das merken auch bereits die anderen. Doch will ich sie auch alle um mich rum haben? Eigentlich nicht wirklich, zumindest bis heute nicht. Irgendwie habe ich mich in den letzten Wochen mit meinem stillen Ich sehr gut angefreundet, fühlte mich wohl. Doch jetzt will ich anders sein, kann es aber nicht mehr. Irgendetwas in mir hält mich fest, zieht mich runter, taucht mich in die schwarze Tiefe … will, dass ich untergehe! Das war doch das Ziel des Ganzen …
Mein Handy klingelt in der Sweetjacke. Mein Atem hat einen Aussetzer und ich hole es mit zitternden Händen heraus, fürchte mich, darauf zu schauen. Es macht keinen Sinn, wegzulaufen …
Als ich sehe, dass es Thomas ist, atme ich etwas erleichtert aus. Er will bestimmt wissen, wo ich abgeblieben bin. – Ich bin beim Aufgeben!
Thomas. Wenn er wüsste, wie sehr mir die frühere Zeit fehlt. Mir kullern die Tränen. Ich vermisse ihn. Ich hätte von Anfang an zu ihm kommen sollen, er war immer meine Stütze gewesen, bis ich in diesen Abgrund fiel. Warum konnte ich ihm das nicht anvertrauen? Warum kann ich ihm das jetzt nicht erzählen? … Weil ich damit auch sein Leben riskieren würde … auch das von Elise. Mein Herz blutet beim Gedanken an meine kleine Schwester. Die Entscheidung, die mir anfangs so leicht erschien, fällt mir nun sehr schwer. Weil es jetzt nicht von mir selbst ausgeht, sondern weil ich Bockmist gebaut und mich auf einen Deal mit dem Teufel eingelassen habe. Und damit meine Familie nun in Sicherheit bleibt, muss ich das zu Ende bringen.
Erneut simst mein Handy, diesmal weiß ich, wer das ist – der Teufel selbst. Ich reagiere nicht und schaue nicht mal mein Telefon an, sitze inzwischen auf meinem Bett und denke an die Tage zurück, versuche selbst herauszufinden, wann das alles begann: Seit dem Tod meiner Mutter, die nach der Geburt meiner Schwester verstorben ist? Gott, ich bin fast wahnsinnig geworden, wie sehr ich sie vermisst habe und es immer noch tue. Sie fehlt mir nach wie vor sehr und ich kann sie nicht mehr umarmen. Mit meinem Ärmel wische ich über meine Augen. Ich will zu ihr, ich will sie sehen … Das ist einer der Gründe, warum ich sterben möchte.
Doch ich weiß ganz genau, dass es nicht der wahre Grund ist, der mich endgültig dazu gebracht hat, mich auf den Teufel einzulassen. Es war David, der mir diesen Stoß gegeben hat. Ich lehne meinen Kopf an die Wand und denke an den Tag zurück, als mich irgendetwas geritten hat, ihm meine Liebe in einem Brief zu beichten.
»Guckt mal, ich habe einen Liebesbrief bekommen!«, ruft er so laut, dass es die halbe Schule hören kann.
Neben ihm lachen seine Kumpels gehässig auf.
Ich habe so viel Mut in den Brief gesteckt, mich ihm darin ganz in meiner Liebe offenbart und er … er tritt mich gerade mit Füßen, stellt mich vor allen bloß. Ich bin nicht nur verliebt in ihn, ich liebe ihn bis zum Verrücktwerden, bin süchtig nach seinem Äußeren, nach seinem Parfüm, das ich am liebsten immer riechen will, und bin wie versteinert in seiner Gegenwart.
Ich will ihm meinen Brief wieder aus seiner Hand entreißen, er soll jetzt nicht mehr wissen, wie sehr ich ihm mein Herz ausschütte. Doch er streckt seine Hand mit dem Papierstück so hoch, dass ich nicht drankomme und er deshalb schallend lacht.
Die Kränkung brennt in mir, bringt mich zum Glühen und ein dicker Kloß lässt kein Wort mehr heraus. Vor Schmerz und Demütigung will ich mich nur noch kleinmachen, in eine Ecke verkriechen und heulen. Das Bedürfnis dringt immer mehr an die Oberfläche und ich kann ein paar Tränen nicht mehr halten.
»Ahaha, du hast sie zum Heulen gebracht!«, meldet sich einer seiner Kumpels und sie brüllen vor Lachen. Das gibt mir den Rest. Ich laufe weinend davon.
Niemals hätte ich geglaubt, dass ich seine grauen Augen, die mich damals so anblickten, derart hassen würde. Nicht nur wegen seiner Nummer mit dem Brief, sondern weil er noch weiterging und die Liebe in mir zum Einsturz gebracht hat, er hat sie gnadenlos ermordet.
Ein paar Tage nach meinem Bekenntnis traf David mich in der Bibliothek, in der ich auf meinen Bruder wartete. Er sprach mich an, als wären wir beste Freunde, was mich nach der Aktion mit meinem Liebesbrief sehr verwunderte. Er entschuldigte sich sogar für sein Verhalten!
Ich war so naiv und habe ihm das ganze Geschwafel einfach abgekauft, während ich ihn so verliebt ansah, wie er mich neckte und seine blonden Haare von seiner Stirn streifte … so sexy.
Scheiß Liebe, sie kann so blind machen.
Als er mir vorschlug, mit ihm nach Hause zu gehen, dachte ich deshalb an nichts Schlimmes, packte schnell meine Bücher in meine Tasche und lief mit meiner rosaroten Brille hinter ihm her …
Gerade als wir aus dem Leseraum der Bibliothek in die Flur gehen, zerrt er mich auf die Toilette. Verständnislos blicke ich noch kurz in seine Augen, als er mich an die Wand kleistert und mit einem Kuss überfällt. Dieser Kuss ist der erste in meinem Leben und das auch noch mit dem Jungen, den ich liebe. Zugegeben, der Kuss ist der helle Wahnsinn und ich genieße ihn sehr. Das Gefühl des inneren Knisterns, dieses Feuer in mir, ist mir noch gänzlich unbekannt. Es ist beängstigend und berauschend schön zugleich … bis David weitergeht, viel zu schnell, viel zu grob, viel zu bedrängend. Er zieht mein Shirt hoch und seine Hand schlüpft in meine Hose.
»Warte!«, keuche ich atemlos.
»Hab dich nicht so, du liebst mich doch«, raunt er an meinem Ohr und beißt mich am Hals, an dem er mich dann bis zu meiner Schulter liebkost. Wahnsinn …
Seine Finger kriechen weiter in meinen Slip und ich beginne, mich nun zu wehren, bitte ihn aufzuhören, was ihn aber nicht davon abhält, und er wird nur noch aufdringlicher.
»Komm schon, du bist schon nass.«
Mit meinen Händen drücke ich ihn an seiner Brust von mir weg. Erfolglos.
»Ich habe meine Tage«, wimmere ich beschämt.
»Was?!«, quiekt er entsetzt und springt sofort von mir weg, als hätte er sich an mir verbrannt. »Fuck!«, zischt er angewidert und starrt seine Finger an, die er sofort in einem kleinen Becken zu waschen beginnt. »Gott, ist das widerlich!«
Mir ist es auch zuwider, ich fühle mich elendig und ungemein beschämt. Ich wäre am liebsten im Boden versunken.
»Scheiß auf die Wette!« Sein abstoßender Blick wandert auf mich, bevor er hastig die Toilette verlässt.
Ich rutsche an der kalten Fliesenwand herunter und beginne zu weinen. Mir wird bewusst, dass er mit seinen Kumpels womöglich eine Wette abgeschlossen hat, dass ich mich ihm hingeben würde … Mir geht es nun noch dreckiger.
Die durchdringenden Blicke in der Schule spürte ich seitdem tagtäglich auf mir, bestimmt erzählte er allen davon. Jeden Morgen quälte ich mich dazu, mich aufzuraffen und den Tag in der Schule zu überstehen. Seine Freunde lachten mich aus, wenn ich an ihnen vorbeiging, während er mich nur anfunkelte oder einfach ignorierte. Ich war überzeugt davon, dass es viel schlimmer hätte ausgehen können, wenn ich keine Tage gehabt hätte, – da hätte ich mir gleich einen Strick genommen.
Darüber mit jemandem reden konnte ich nicht, nicht mal mit meiner Freundin Rebekka, ich schämte mich dafür, fühlte mich gedemütigt. Außerdem hat meine Freundin David abgrundtief gehasst und mir ständig eingeredet, dass ich mich auf ihn bloß nicht einlassen sollte, weil er allen Mädchen den Kopf verdrehte und sie ausnutzte, – und ich musste mich ausgerechnet noch in ihn verlieben.
Mein Leben schien mir nichts mehr wert. Ich hasste David, ich hasste mich und hasste mein Leben, das solch eine drastische Wendung genommen hatte.
In solchen Situationen begeht man meistens Fehler.
Ich wollte nicht mehr leben und beichtete meine Sorge einem Unbekannten auf Facebook, der mir dann helfen wollte. So lässt es sich leichter verarbeiten, dachte ich, wenn man seine Probleme jemandem erzählt, der einen nicht kennt …
Doch das entpuppte sich nun als ein böser Fehler, den ich nicht mehr rückgängig machen kann.
Das Telefonklingeln lässt mich zusammenzucken. Furcht und Adrenalin preschen gleichzeitig durch meine Adern, und ich atme zitternd aus. Es ist aber wieder Thomas. Die Uhrzeit sagt mir, dass momentan die zweite große Schulpause ist und mein Bruder mich deswegen anrufen kann. Als er aufgibt, bemerke ich, dass mein Handy inzwischen etliche Nachrichten empfangen hat, deren Eingang ich in meinen Gedanken nicht mitgekriegt habe. Nachrichten, die mein Inneres genauso verbrennen wie diese tagtäglichen Anrufe, Aufforderungen und Videos.
Mein Herz hält diesen Druck langsam nicht mehr aus. Ich will ein Ende haben, Frieden finden und mich fallen lassen … Gerade eben habe ich gekniffen und bin vom Dachboden wieder nach Hause gelaufen.
Der Teufel weiß es mit Sicherheit schon, und wenn ich selbst es nicht tue, wird er das an meiner statt beenden. So wie mit Clara, ein Mädchen, das ich zwei Tage nach dem Einstieg in diese Gruppe auf Facebook kennengelernt habe und plötzlich verschwunden ist. Sie antwortet nicht mehr auf meine Nachrichten und ist seit mehr als einer Woche offline.
Schon wieder ruft mich Thomas an. Diesmal nehme ich das Gespräch zögernd an.
»Luna, verdammt! Wo bist du?«, grollt er. Dass er mit mir in letzter Zeit nicht mehr normal spricht, ist für mich auch nichts Neues.
»Schrei mich nicht an! Ich habe Kopfschmerzen und bin früher vom Unterricht heimgegangen«, blaffe ich zurück. Eine Lüge natürlich. So wie viele in letzter Zeit, die ich jedem aufgetischt habe, der mich angesprochen hat, ob bei mir alles in Ordnung sei. Nein, ist es nicht! Schon lange nicht mehr.
»Dafür, dass du Kopfschmerzen hast, kannst du aber noch ordentlich schreien. Bist du jetzt zuhause?«
»Wo denn sonst?!«
»Hast du eine Schmerztablette eingenommen?«
»Ja!«, erwidere ich genervt.
»Wenn dir etwas besser geht, mach deine Hausaufgaben und räum bitte die Wohnung etwas auf.«
»Sonst noch irgendwelche Sonderwünsche?! Mach es selbst, ich bin nicht deine Bedienstete. Außerdem weiß ich selbst, wann ich meine Hausaufgaben machen soll und wann nicht!« Dieser Spießer kann einen wirklich fertigmachen. »Und du bist nicht mein Vater, der mir Befehle erteilt!«
»Tu es einfach, wenigstens einmal ohne Widerworte! Der Morgen heute mit dir hat mir echt schon gereicht.«
Ich schalte ihn ab, will nicht mit ihm diskutieren. Es hat auch keinen Sinn, er hat nämlich immer recht und ich bin die rotznäsige Schwester, die er, wie er glaubt, noch erziehen und unseren Vater dabei ehrenvoll vertreten müsste. Und ja, der heutige Morgen fing bereits mit einem Streit zwischen uns an, dabei war ich nur so wütend geworden, dass er ohne Vorwarnung in mein Zimmer stürmte und mich weckte. Auch wenn ich in den letzten Tagen wenig Schlaf – und vor allem keinen erholsamen – hatte, konnte ich mich noch rechtzeitig zudecken. Meine Narben durfte er auf keinen Fall sehen, schon gar nicht erfahren, in welchem Zusammenhang ich sie habe. Das würde bei ihm nicht nur viele Fragen aufwerfen – das wäre das kleinste Übel, wenn sie mich deswegen in einer psychiatrischen Anstalt eingeschlossen hätten –, sondern auch ihn in Gefahr bringen können. Thomas konnte sich durchsetzen, würde nie locker lassen, bis er die Wahrheit herausfindet.
Unwillkürlich streife ich mir über meine Arme … Ich bin entstellt … Den körperlichen Schmerz empfinde ich nicht mehr, nur den seelischen. Vielleicht wäre das gar keine so schlechte Idee, dass ich in der Psychiatrie eingeschlossen werde, somit würde ich vielleicht diesem Horror entgehen können. Aber will ich so weiterleben, ständig in Angst um mich und meine Familie? Der Teufel würde nicht aufhören, bis er meine Seele hat … bis mein Herz nicht mehr schlägt.
Weitere Nachrichten gehen auf meinem Handy ein. Ich atme tief durch und öffne sie. Tränen schießen mir in die Augen, während ich die Bilder von Thomas entdecke, der auf dem Basketballplatz der Schule mit seinen Jungs zu sehen ist, und von Elise, wie sie mit anderen Kindern auf dem Kindergartenhof spielt, und diese mit Wischbewegungen durchblättere. Ich lese die Nachrichten vom Teufel.
»Ach Luna, Luna, Luna … Ich kriege dich so oder so, du kannst nicht flüchten. Du solltest es tun!«
»Ich habe doch eigentlich noch Zeit!«, schreibe ich mit den Tränen in den Augen zurück.
»Du hast aber deine Zeit selbst verkürzt. Abgemacht ist abgemacht!«
Zittrig und weinend atme ich aus. Warum habe ich das bloß gemacht?
»Mein guter Freud ist schon auf dem Weg zu Elise, soll er sie holen?«
»Nein!«, schreie ich sofort heraus. »Ich werde es gleich tun«, schreibe ich. »Bitte, lass Elise in Ruhe!«
»Du hast fünf Minuten! Ich beobachte dich!«
Tränen fließen mir über die Wangen, während ich mich zu meinem Fenster bewege und hinausschaue. Ich sehe niemanden da unten, weder vor unserem Haus noch auf dem Rasen vor dem Fenster, auf dem Bürgersteig oder im gegenüberliegenden Park. Aber er ist da, das spüre ich!
Kapitel 1
»Schade, dass du schon gehen musst«, murrt Alexandra an meiner Brust. Sie streift zart mit ihren Fingerspitzen über meinen Körper, sodass ich an den Stellen Gänsehaut bekomme.
Schmunzelnd öffne ich meine Lider und ihre leuchtend azurblauen Augen schauen mich an. »Ich finde es auch schade«, gebe ich zu.
Alex rollt ihren nackten Körper auf mich. Ich streiche ihr langes blondes Haar, das ihr zartes Gesicht umrandet, hinter ihre Schulter und gleite mit meinen Händen sanft über ihren Körper, bis ich sie an ihrem Po parke. Bis zum heutigen Tag habe ich ihre samtige Haut auf meiner nicht spüren können und ihre Kurven nicht so wahrnehmen wie gerade jetzt.
»Du weißt doch, warum.«
»Natürlich«, haucht sie und blickt mich an. Sie liebt es – wie sie es mir gesagt hat –, in meine grünen Augen zu schauen.
Sie jetzt so neben mir zu spüren, beflügelt mich, und dennoch holt es mich in die Realität zurück. Ich verfluche bereits, dass ich gezwungen bin zu gehen. Die Wohnung muss noch aufgeräumt werden, bevor ich Elise aus dem Kindergarten abhole, weil Luna mal wieder ihre Trotzphase hat und es mit Sicherheit nicht machen wird. Ich höre Luna jetzt schon keifen: »Du bist nicht mein Vater und hast mir nichts zu sagen!« Wenn es denn unser Vater tun könnte. Als Notarzt ist er leider kaum zuhause und überlässt mir, als älterem Sohn, die Verantwortung für meine Geschwister zu übernehmen, wenn er nicht da ist. Um ehrlich zu sein, ist das gar nicht so einfach und manchmal schon richtig anstrengend, insbesondere mit Luna. Oft knallt sie einfach ihre Zimmertür vor meiner Nase zu, mit den Worten: »Leck mich, es ist mein Problem!« Oder: »Misch dich nicht ein, das ist mein Leben!« Tja, mit vierzehn Jahren hat Luna kein einfaches Alter und hat natürlich vom Leben noch keine Ahnung.
Alexandra löst sich von meiner Brust und schiebt sich höher, sodass ich ihren warmen Atem auf meinen Lippen spüre. »Es war gerade so schön.«
»Das finde ich auch.« Ich küsse ihre Lippen und sie vertieft leidenschaftlich meinen Kuss.
Ja, dieser Moment war sehr schön, schließlich war das ihr und auch mein erstes Mal im Leben. Wir wollten zwar nichts überstürzen, wollten aber dieses Ereignis seit Langem zusammen erleben, und endlich haben wir es getan.
Nach einem quälenden Seufzer breche ich unseren Kuss ab, da es mich wieder anheizt. »Alex, ich übernehme keine Haftung mehr, wenn du jetzt nicht damit aufhörst«, warne ich sie spielerisch, während sie kichernd versucht, weiter meine Lippen zu liebkosen und unter der Decke mit ihrer Hand an meinem Körper entlangfährt. Lächelnd wehre ich ihre Versuche, mich zu verführen, ab.
»Das ist so unfair.« Sie wirft sich stöhnend ins Bett zurück. »Warum müssen denn die schönsten Dinge immer enden.«
Lächelnd schaue ich sie an, doch wende schnell meinen Blick von ihrem perfekten Körper ab, bevor es mich wieder nach ihr verlangt. Ich richte mich auf, um mich anzuziehen.
»Hätten wir nicht die letzte Doppelstunde geschwänzt, hätten wir auch diese Zeit nicht gehabt.«
»Meinst du, wir bekommen Ärger? Schließlich dürfte es Frau Wetter aufgefallen sein, dass wir als Pärchen zur gleichen Zeit nicht da waren.«
Ich ziehe meine Jeans an und drehe mich zu ihr um. »Darauf kannst du wetten.«
Sie legt sich auf ihren Bauch und mustert meinen Körper, während ich meinen Pulli überstreife und mich zu ihr rüberbeuge. Sofort springt sie zum Sitzen auf und legt ihre Arme um meinen Hals. Wir küssen uns.
»Ich muss wirklich los«, sage ich gepresst inmitten des Kusses, den ich abbrechen will, sie aber nicht. Verdammt noch mal, ich will das auch nicht, will mehr von ihr … So ein Mist! Ich beginne zu lachen.
Seufzend lässt sie mich los und schlingt ihre Bettdecke um sich. »Sehen wir uns am Wochenende?«
Nach einem Schulterzucken ziehe ich meine Jacke an. »Das kann ich dir leider noch nicht sagen, mein Vater hat am Wochenende Dienst. Ich kann ja dann Elise nicht alleinlassen.« Ich schaue mich in ihrem Schminktischspiegel an und richte meine schwarzen Haare in ihre ursprüngliche Form.
»Und Luna? Sie kann doch auch mal auf Elise aufpassen, schließlich ist sie ja auch ihre Schwester. Warum musst immer nur du das machen?«, regt sie sich leicht auf.
»Alex, wir hatten das Thema schon mal … Weil ich –«
»Weil du der Älteste bist, ja«, bringt sie leise und enttäuscht hervor.
»Thomas, sie wird in einem Monat schon fünfzehn, also, so ein Kind kann sie nun nicht mehr sein. Und du bist schließlich nur zweieinhalb Jahre älter als sie.«
»Kann sein … Aber Luna durchlebt gerade den Höhepunkt ihrer Pubertät, was echt anstrengend ist.« Ich versuche, die angespannte Situation wegzulächeln. »Mal schauen, vielleicht lässt sich da was machen. Wir schreiben uns heute Abend noch, okay?«, beruhige ich sie.
Ihre Mundwinkel heben sich leicht und sie nickt schließlich. »Ich vermisse dich jetzt schon.«
Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals so einen Kitsch mit meiner Freundin durchleben würde, was mich nun zum Schmunzeln bringt. »Du weißt doch, ich vermisse dich immer.«
Wir verabschieden uns mit einem langen Kuss.
Von meinen wundervollen Erlebnissen mit Alexandra sind meine Sinne noch wie betäubt vor Glück und in meinen Gedanken ist momentan nur sie.
Als sie vor einem Jahr hierhergezogen ist, dachte ich nicht mal im Traum daran, dass gerade wir zusammenkommen würden. Sie galt prompt als das hübscheste Mädchen der Schule. Alle Jungs bewunderten sie und wollten mit ihr zusammen sein, doch niemanden ließ sie an sich ran. Vor einem halben Jahr hat sie mich dann in einer Bibliothek angesprochen, ob ich genauso süchtig nach Büchern sei wie sie. Nein, in die Bibliothek ging ich meist nur, um in Ruhe meine Hausaufgaben machen zu können, während ich auf Luna wartete, bis ihr Tanzkurs zu Ende war. Drei Monate lang haben Alexandra und ich uns häufiger in der Bibliothek getroffen, bis wir uns schließlich zum ersten Mal geküsst haben. Ab dem Moment waren wir dann ein Paar.
Aus meinen Gedanken werde ich erst vor meinem Wohnhochhaus herausgerissen, als ich eine kleine Menschenansammlung vor dem Eingang bemerke. Einige Blicke heften sich sofort auf mich. Meine Schritte verlangsamen sich automatisch, weil es in mir etwas Komisches auslöst. Kurz kommt mir der Gedanke, ob einem Siebzehnjährigen sein erstes Mal so deutlich anzusehen ist, was ich aber sofort als Schwachsinn auffasse. Eine Nachbarin, die zwei Stockwerke unter uns wohnt, hält ihre Hand an die Wange und schüttelt mit einem mitfühlenden Blick den Kopf. Die andere Nachbarin seufzt schwer und flüstert etwas vor sich hin, ihre Augen füllen sich prompt mit Tränen. Die Menschen machen mir Platz, als ich näherkomme, um mich ins Haus zu lassen. Im Augenwinkel bemerke ich auf dem Rasen unter den Fenstern einen großen Blutfleck im Schnee, bevor ein Mann mir die Sicht mit seinem Körper versperrt. Eine andere Frau legt sich die Hand auf ihren Mund und ich höre sie dann aufschluchzen, ehe ich ins Treppenhaus gehe. Hinter mir ist Geflüster zu hören und noch so etwas wie: »Was wird bloß aus …« Weiter bekomme ich nichts mehr mit, weil ich in den Fahrstuhl steige und sehr froh bin, den Blicken entronnen zu sein.
Ein unangenehmes Gefühl breitet sich langsam in mir auf. Mein Herz schlägt schneller, löst in mir so eine Art starkes Flackern aus. Unfassbar, wie Blicke in einem solch eine Unruhe verursachen können. Als der Fahrstuhl im sechsten Stock, unserer Etage, stehen bleibt, habe ich immer noch kein gutes Gefühl. Kurz taucht Luna in meinen Gedanken auf, die bereits zuhause sein sollte, als ich sie von der Schule anrief. Kurz bevor ich mit Alex losging, nahm Luna meinen Anruf an und sagte, dass sie Kopfschmerzen habe und von der Lehrerin früher nach Hause entlassen worden sei. Bestimmt sitzt sie bereits an ihrem Laptop und würde mich als Erstes mit ihrem Blick töten, wenn ich sie dabei gleich störe, sobald ich sie nach ihren Hausaufgaben frage.
Ich schließe die Wohnungstür auf und rufe nach ihr. Keine Antwort. Sie tut es manchmal aus Trotz und reagiert nicht. »Luna!«, wiederhole ich noch mal, während ich meine Schuhe mit den Füßen abstreife, doch es bleibt still. Vielleicht hat sie ihre Kopfhörer auf und hört mich nicht.
Ich werfe meinen Rucksack auf den Boden und gehe durch den Zwischenflur in ihren Raum, der sich gegenüber dem Wohnzimmer befindet. Da sehe ich bereits vom Flur aus, dass bei ihr das Fenster sperrangelweit offensteht, und die Vorhänge, die zur Seite geschoben sind und in den Raum wehen. Gerade als ich feststelle, dass ihr Zimmer leer ist, nehme ich gleichzeitig einen Schatten im Wohnzimmer wahr und bemerke im Augenwinkel jemanden im Sessel sitzen.
»Luna?!« Doch da sitzt mein Vater in der Stille. Alleine. Regungslos. Die Hände vor dem Gesicht wie in einem Gebet gefaltet und damit seine Augen verdeckend.
Tausende von Fragen schießen mir durch den Kopf und ich weiß gar nicht, welche ich ihm als erste stellen soll. Warum ist er jetzt schon zuhause? Als Notarzt arbeitet er meistens so lang, dass wir ihn manchmal über vierundzwanzig Stunden nicht zu Gesicht bekommen.
»Vater … Was machst du schon zuhause?«, frage ich vorsichtig und leise, weil mich diese bedrückende Atmosphäre im Raum dazu zwingt. Er antwortet nicht. Ich habe den Eindruck, dass er gar nicht atmet, so still ist er.
Sein Anblick löst in mir ein seltsames Gefühl aus. Mir wird heiß und kalt zugleich. Mein Herz rast. Mich erfasst eine böse Vorahnung. Das Bild der Nachbarn vor unserem Haus schießt mir in den Kopf, der Blutfleck auf dem Schnee … das offene Fenster in Lunas Zimmer.
Wie auf Knopfdruck laufe ich in ihr Zimmer und bleibe vor dem offenen Fenster stehen. Meine Atmung beschleunigt sich. Die kalte Luft, die ich einatme, brennt plötzlich in meiner Brust. Langsam und schwerfällig lehne ich mich nach draußen. Als ich sehe, dass das Blut genau unter Lunas Fenster ist, reiße ich mit einem Ruck meinen Oberkörper zurück und möchte lauthals aufschreien, doch bringe nur ein elendes Keuchen hervor. Das kann nicht sein! Das ist nicht wahr!
Adrenalin breitet sich schlagartig in meinen Adern aus, lässt mir das Blut in den Kopf schießen und ich höre das laute Pochen meines Herzens in den Schläfen. Aus einem Impuls heraus mache ich mit einem lauten Knall das Fenster zu, als ob ich damit die Realität wegsperren würde. Meine Gedanken überschlagen sich. Es ist bloß die Situation, die einen so irre macht, und eine Illusion im Gehirn herbeiruft, die gar nicht passiert ist. Doch genau diese Vorstellung werde ich einfach nicht los und bete innerlich, dass sie nicht der Wahrheit entspricht. Das kann unmöglich sein. Luna würde so etwas nie tun! Aber der Blutfleck, die Blicke, Vater … Verdammt!
Ich stampfe zurück ins Wohnzimmer. »Wo ist Luna?« Meine Stimme hört sich panisch an, sodass sie mir selbst unbekannt vorkommt.
Er sitzt immer noch so da. Der einzige Unterschied ist, dass sein Kopf jetzt tiefer in die Hände gesunken ist und ihm ein paar seiner grauen Haarsträhnen in die Stirn gefallen sind.
»Vater!« Meine Stimme ist einen Ton höher. »Wo ist Luna?« Ich trete näher und nehme ihm die Hände selbst vom Gesicht.
Mein Herz hämmert noch schneller gegen die Brust, als ich seine vom Weinen angeschwollenen und geröteten Augen sehe. Der Anblick versetzt mich in eine Starre und löst ein innerliches Feuer in mir aus. Ich will es nicht glauben, aber meine Vorahnung bestätigt mir nur das Schlimmste.
Sein Blick wandert auf mich und seine Augen beißen sich in meine. »Du hättest zuhause sein sollen!« Seine Stimme ist heiser, wehleidig … aber boshaft. Ruckartig steht er auf und in der nächsten Sekunde trifft mich seine Hand im Gesicht. Von der Ohrfeige fliege ich zur Seite und lande halb auf dem Sofa. Ich halte schützend meine Hände vor das Gesicht, widersetze mich den folgenden Schlägen nicht. Ich bin zu geschockt, verstehe selbst alles nicht, und dennoch tue ich es, wehre mich aber dagegen, diesen Gedanken zu akzeptieren. Ich will es einfach nicht wahrhaben.
»Du hättest sie beschützen sollen!«, höre ich ihn wütend schreien und seine Hand trifft meinen Rücken. »Wärst du da gewesen, hätte sie sich nicht in den Tod gestürzt!«
Ich weiß gar nicht, wo sein nächster Schlag landet, denn seine Worte sind viel schmerzhafter, fahren mir wie ein Messerstich mitten ins Herz. Durch meine Hände sehe ich erschüttert meinen Vater an, als plötzlich nichts mehr nachkommt.
Seine Hand hängt in der Luft, als ob er sich dabei zurückhält, mich weiterhin zu schlagen. In seinen Augen kann ich erkennen, dass ihm bewusst wurde, dass er mich gerade zum ersten Mal in seinem Leben verprügelt hat. Mein Vater ist immer die Ruhe in Person gewesen und hat nie gegen uns Kinder jemals die Hand erhoben, ganz gleich, wie sehr wir ihm auch seine Nerven strapaziert haben. Ich nehme es ihm jetzt nicht mal übel, denn sein innerliches Chaos kann man ihm förmlich am Gesicht ablesen. Er beginnt stark zu zittern und lässt zuerst seine Hände fallen, dann sich selbst auf die Knie. Sein unbändiger Atem geht in ein lautes Wimmern über.
Mein Herz hämmert noch wie verrückt, doch verkrampft sich immer mehr vor Wehmut. Die Tränen brennen in meinen Augen. Ein dicker Kloß steckt mir wie eine Gräte im Hals. Ich lasse meine bebenden Hände sinken und richte mich langsam auf. Mein Vater beginnt laut und aus tiefster Inbrunst zu weinen. Der letzte Satz von ihm hallt immer noch in meinem Hirn echomäßig nach. Meine Tränen rollen meine Wangen herunter. Ich kann es immer noch nicht begreifen, mein Verstand wehrt sich, die Information aufzunehmen, dass Luna aus dem Fenster gesprungen ist. Diese Nachricht ist der einzige wirklich schmerzhafte Schlag, als die Hiebe meines Vaters. Langsam und wie gelähmt von dieser Erkenntnis, lasse ich mich vom Sofa auf den Boden rutschen. Mit jeder Faser verspüre ich die Schwere, die mich ins Bodenlose zieht. Mein Körper beginnt zu beben und ein undefinierbarer Laut entgleitet mir.
Vaters Hände greifen plötzlich nach meinen Schultern, wobei ich erschrocken zusammenzucke, weil ich mir denke, er verpasst mir eine weitere Ohrfeige. Doch er zieht mich an meiner Jacke heftig zu sich und drückt mich in seine Umarmung. Tiefe Schluchzer brechen in meiner Halsbeuge aus ihm und er wiegt sich mit mir im Arm, wobei er mich immer wieder krampfartig an sich presst und laut weint. Seinen Schmerz spüre ich sehr, denn meinen kann ich gar nicht aus mir herausschreien oder herausweinen, kann es nicht glauben, will es nicht akzeptieren … Verzweiflung reißt mich beinahe auseinander. Mir tut alles so leid. Mein Vater tut mir leid. Luna tut mir leid. Ich erinnere mich plötzlich auch noch an meine verstorbene Mutter und weine noch mehr. Was hätte sie jetzt dazu gesagt? Ich trage genauso die Verantwortung für meine jüngeren Schwestern.
Mein Brustkorb brennt plötzlich vor Wut – auf mich, auf die ganze Welt - und selbst auf Luna. Wie konnte sie bloß einfach so springen? Warum hat sie Selbstmord begangen? Was hat Luna sich bloß dabei gedacht? Hat sie an unseren Vater gedacht? An Elise, die ohne sie nicht leben kann? Wie nur sollen wir der Kleinen beibringen, dass Luna nicht mehr da ist?
Ich will Antworten auf diese Fragen finden, die in meinen Gedanken wie in einem Labyrinth umherirren. Nichts ergibt einen Sinn für mich. Wenn mein Vater nicht in so einer Verfassung wäre, hätte ich alldem auch nicht glauben können. Das letzte Mal, als ich ihn so aufgelöst gesehen habe, war meine Mutter gestorben. Es scheint mir, dass diese Nachricht ihn gerade viel schlimmer getroffen hat. Logisch, er verliert jetzt auch noch seine Tochter … und dann auch noch auf so eine Weise.
Lunas braune Augen und ihr lachendes Gesicht tauchen plötzlich in meinem Kopf auf. Da war sie im Alter von circa zehn Jahren. Sie lief mit ausgestreckten Händen auf der Wiese am See im Kreis, dort, wo wir immer picknicken waren, mit Mutter und Vater zusammen. Sie liebte es, sich in einem Kleid zu drehen und zu sehen, wie es dabei wirbelte. Da war Luna noch Luna – ein fröhliches Mädchen, ein Energiebündel, das Tanzen und Lachen liebte. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Ich will die Augen aufmachen und Luna im Türrahmen sehen, die vielleicht einen blöden Spruch parat hat, wie: »Und ich habe gedacht, Elise ist eine Heulsuse.« Wir würden sie in die Arme schließen und dieses Missverständnis aufklären. Es ist so unbegreiflich und unfassbar, sodass es mir wie ein großer Irrtum vorkommt, wie ein Albtraum, aus dem ich schnell erwachen will.
Kapitel 2
Die Welt erscheint mir erdrückend, schwer und einfach nur leer. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben.
Vom vielen Weinen tun mir die Augen weh. Mein Herz hört auch gar nicht mehr auf zu heulen, fühlt sich taub an, so wie alles an mir und in mir. Doch viel schlimmer ist die Gewissheit, dass Luna nie mehr nach Hause kommt und ich nie mehr ihre Stimme hören werde, die immer noch in meinem Kopf hallt.
Sie ist tot. Das muss ich endlich begreifen, als ich fünf Tage nach ihrem Suizid vor ihrem weißen Sarg stehe und gezwungen bin, für immer Abschied von ihr zu nehmen. Auf meine Brust drückt eine tonnenschwere Last, ebenso wie meine Gewissensbisse und Schuldgefühle. Es wäre nicht passiert, wenn ich zuhause gewesen wäre, wenn ich nicht länger bei Alexandra geblieben und gleich heimgefahren wäre. Dass Luna Selbstmord begangen hat, schmerzt mehr als jedes andere Gefühl, was ich bis jetzt nach dem Tod meiner Mutter verspürt habe. Damit jemals fertigzuwerden und das zu akzeptieren, erscheint mir unmöglich. Nach wie vor vermisse ich meine Mutter und nun Luna … Beide werden in meinem Herzen weiterleben, aber sie zu vergessen oder nicht mehr zu vermissen, das wird nie passieren.
Aus diesem Grund waren die Weihnachtsferien ein Graus, Weihnachten ohne Freude, ein stilles Silvester für uns, während die ganze Welt feierte. Das Geschenk, das ich Luna zu Weihnachten machen wollte, betrachte ich immerzu – eine silberne Kette mit einem kleinen Herzanhänger. Ich konnte ihr das nicht mal am Tag der Beerdigung umhängen oder mit in den Sarg legen, dieser war gar nicht geöffnet. Einerseits wäre es mir so schwerer gefallen, Lunas Tod zu akzeptieren, weil ich mit eigenen Augen gesehen hätte, dass sie nicht mehr atmet, aber andererseits wollte ich sie so in meiner Erinnerung behalten, wie sie zu ihren Lebzeiten war und nicht wie eine zusammengenähte Puppe mit einem entstellten Gesicht.
Die Weihnachtsferien waren daher sehr trist und ermattend, reichlich mit Tränen erfüllt, mit Appetitlosigkeit und schlaflosen Nächten. Mein Vater war stark in sich gekehrt, sprach kaum, außer wenn es unbedingt nötig war, und antwortete nur mit Ja oder Nein. Dank Elise versuchte ich mich wenigstens in ihrer Gegenwart aufrecht zu halten, versuchte meine Trauer nicht zu zeigen oder sie an Luna zu erinnern. Ich wollte nicht, dass sie weinte und nach ihr verlangte, denn mit ihren fünf Jahren konnte sie noch nicht wirklich begreifen, was der Tod bedeutet. Mein Vater wusste nicht so recht, wie er ihr das schonend beibringen sollte, und da sagte ich, dass Luna jetzt bei unserer Mutter sei.
»Ist sie jetzt ein Engel mit großen weißen Flügeln?«, fragt sie am Abend schmollend in ihrem Bett eingekuschelt.
Zögernd nickt Vater ihr zu, ehe er ihr einen Gutenachtkuss auf der Wange hinterlässt und an mir vorbei aus ihrem Zimmer geht. Brummend verabschiedet er sich auch von mir und verlässt Minuten später die Wohnung, um zur Nachtschicht anzutreten. Er versucht sich mit seiner Arbeit abzulenken. Im Gegensatz zu mir.
Die alltäglichen Dinge führe ich wie automatisch aus. Jeder Tag sieht dem nächsten und denen davor gleich. Alle scheinen sie mir so dunkel und lang zu sein, als ob Luna mit ihrer Tat die Zeit verlangsamt hätte. Dennoch vergehen Tage, Wochen … der Schmerz aber nicht. Ich zwinge mich morgens aus dem Bett, wecke Elise, die nach dem Aufwachen schlaftrunken an Lunas Zimmer vorbeigeht und voller Kummer hineinschaut, so als ob sie genauso wie ich jeden Morgen hofft, aus diesem Albtraum zu erwachen und Luna in ihrem Bett sitzen zu sehen, die sie mit den Worten »Morgen, Krümel« verschlafen begrüßen würde.
Jeden Tag versuche ich, Elise spielerisch abzulenken, blödle etwas mit ihr beim Zähneputzen und Anziehen herum und komme mir vor wie das Plappermaul Kermit, der Frosch, der sie nur vollsabbelt, damit wir nicht auf unsere Vergangenheit zu sprechen kommen. Damit sie nicht traurig ist, mache ich alles für sie und spiele lieber Hampelmann, bevor ich ihre Traurigkeit verspüre, die ich ihr am liebsten weggenommen hätte. So krass, wie es sich anhört und ich den Gedanken grausam finde, aber um ihr dieses Leid zu ersparen, hätte ich ihr am liebsten auch sämtlichen Erinnerungen an Luna genommen, irgendwie aus ihrem Kopf gelöscht, damit sie nicht trauert. Ob ich das alles richtig mache, weiß ich nicht. Ich bin mit der Situation leicht überfordert und habe das Gefühl, dass ich selbst noch nicht so richtig getrauert, keine Zeit gehabt habe oder es einfach unterdrücke. Manchmal, nachts, da kommen mir die Tränen, heiß wie ich sie noch nie gespürt habe, doch sobald der Tag anbricht, habe ich dann wieder Kraft und halte durch … man darf mich nur nicht anfassen oder gewisse Dinge ansprechen, sonst würde alles, was ich in mir einsperre, herausbrechen.
Nachdem ich Elise einen Pferdeschwanz gebunden habe, bereite ich ihr zum Frühstück Müsli mit Milch vor.
»Oh, die Milch ist alle«, stelle ich dabei fest.
Sie sieht erschlagen zu mir auf. »Und was isst du dann?«, brummt sie müde und umarmt ihr Plüscheinhorn.
Ich nehme mir einen Apfel und zeige ihn ihr grinsend. »Schon was gefunden!«
»Du hast doch gesagt, dass Männer … Äh, was mögen Männer zum Essen?«
»Iss, Krümel, sonst kommen wir zu spät in den Kindergarten«, sage ich lächelnd und sie nimmt den Löffel in die Hand. »Und das, was du meinst, heißt def-ti-ges Essen«, erkläre ich ihr, ehe ich herzhaft in den Apfel beiße.
Sie nickt nur kauend. Beinahe teilnahmslos sitzt sie da, mustert mich eingeschüchtert, was mich dazu zwingt, sie genauer zu beobachten. Aus ihren grünen Knopfaugen ist der frühere Glanz gewichen. Sie scheint so erschlafft, das Einhorn an ihre Brust gedrückt, und wirkt auf mich plötzlich noch kleiner, als dass sie in sieben Monate schon sechs Jahre wird. Ihr nächster Geburtstag wird gleichzeitig auch der sechste Todestag unserer Mutter sein. Doch wir haben Elise nie die Schuld gegeben, schließlich konnte sie nichts dafür, dass unsere Mutter Komplikationen bei der natürlichen Geburt bekommen hat. Ein Notfallkaiserschnitt wurde ausgeführt und Elise dadurch auf die Welt geholt. Aber die Blutungen unserer Mutter konnten nicht gestoppt werden und sie verblutete noch auf dem OP-Tisch. Wir haben Elise als ihr hinterlassenes Geschenk an uns betrachtet. Dennoch hat sich seitdem vieles verändert, vor allem unser Leben: Vater musste mehr arbeiten, Luna war nicht mehr das fröhliche und unbeschwerte Kind, wirkte ruhiger und ich musste schnell erwachsen werden.
Elise nimmt einen zweiten Löffel voll, er scheint ihr so schwer, als würde er etliche Kilos wiegen, hält ihn jedoch vor ihrem Mund an. Sie schneidet eine Fratze und legt ihn wieder zurück in ihren Teller.
»Ich bin satt«, sagt sie und umarmt ihr Einhorn noch fester. Luna hat ihr das Kuscheltier zu ihrem fünften Geburtstag geschenkt. Vielleicht ist es deswegen nun zu ihrem allerliebsten Spielzeug geworden, was es ohnehin schon gewesen ist, denn sie hat es die letzten Wochen gar nicht mehr aus der Hand gegeben und selbst auf dem Klo damit geschmust.
Seufzend kaue ich meinen Apfel zu Ende, der mir eigentlich auch nicht in den Hals will, und merke, dass ich ihn nur esse, um ihr ein Vorbild zu sein, dass das Frühstück die wichtigste Mahlzeit am Tag ist. »Du musst etwas essen, Elise, wie willst du sonst groß werden?«, rede ich auf sie ein.
»Ich will aber nicht mehr«, trotzt sie.
Nach ein paar weiteren Überredungsversuchen gebe ich schließlich auf, packe ihre kleine Tasche und bringe sie zu Fuß in den Kindergarten. Heute, zum ersten Mal nach Lunas Tod, hat sie sich ohne Flennen von mir getrennt. Ein kleiner Fortschritt in den letzten Wochen.
In der Schule werde ich von meinen Mitschülern bemitleidend angeguckt. Ich habe so gehofft, da es einen Tag vor Weihnachtsferien passiert ist, dass sich niemand mehr an Luna erinnern würde. Doch wie sagt man so schön: Die Menschen sehen einen erst dann, wenn man tot ist. Diese Blicke gehen mir unter die Haut, ich versuche sie deshalb kalt zu ignorieren, weil es meinen Kummer wieder stärker aus mir herausholt.
Am Unterricht nehme ich nur körperlich teil, hänge ständig in meiner Trauer durch, obwohl ich mich krampfhaft auf die Unterrichtsthemen zu konzentrieren versuche … was nicht einfach ist. Ich quäle mich durch den Tag.
Die Pausen sind noch schlimmer. Alexandra und meine wenigen Freunde versuchen, mich dann von der Trauer abzulenken, mit mir Gespräche anzufangen. Waith kenne ich noch aus der Grundschule. Nicht nur sein Gesicht spricht mir ein wortloses Beileid aus, sondern auch seine etwas distanzierte Haltung. Er nervt auch nicht und beherrscht sich, im Gegensatz zu den anderen, die mir ihr Mitleid aussprechen. Das reizt mich und ich ziehe mich zurück. Ich will momentan nichts und niemanden sehen, will allein mit meiner Trauer sein, sie alleine bewältigen, ohne ein »Es tut mir leid« oder »Mein herzliches Beileid«, – das alles würde mir nicht helfen, das würde Luna nicht wieder lebendig machen. Ich wäre am liebsten geflüchtet, irgendwohin, wo ich mich von diesem elenden Schmerz befreien könnte … Doch würde mir das wirklich helfen?
Besonders schwer ist es, wenn ich im Flur an Lunas Klasse vorbeigehen muss. Neben ihrer früheren Klassentür hängt an der Wand ihr Porträt, das im Gedenken an sie angebracht worden ist. Langsam gehe ich daran vorbei und habe das Gefühl, dass mich nicht nur die Blicke einiger Schüler verfolgen, die daneben stehen und wissen, dass ich ihr Bruder bin, sondern auch Lunas Augen auf dem Bild. Ich will nicht stehen bleiben, denn ich habe bereits von meiner Schwester Abschied genommen. Ihr Foto anzuschauen ist wie Salz auf meiner Wunde im Herzen.
Nach dem Schulunterricht setze ich mich in der Pausenhalle an einen Tisch und mache meine Hausaufgaben, weil es zuhause noch schlimmer ist und ich es dort allein nicht aushalten würde. Es erinnert mich zu sehr an die Zeit, als Luna noch da war. Ihre Sachen liegen noch genauso chaotisch zerstreut in ihrem Zimmer herum, und ich kann sogar immer noch einen Hauch von ihrem Duft in der Luft spüren. Ich vermisse sie so sehr, und immer mehr alte Erinnerungen tauchen in meinem Kopf auf …
»Das hast du nicht zu Frau Wetter gesagt!« Luna lacht herzhaft auf, sitzt am Esstisch und kaut an M&Ms, die sie sich nach Farben sortiert hat. Die blauen hat sie in ein extra Häufchen gepackt, weil ich sie für sie essen soll, da sie sie nicht mag.
»Doch, das habe ich!«, scherze ich mit dem Kochlöffel in der Hand und rühre den Topf mit Chili con Carne um. »Frau Wetter, lassen Sie mich bitte alles erklären, bevor Sie jetzt zum Donnerwetter werden.«
Luna lacht so auf, dass ihre dunkelblonden Locken in ihrem langen Haar hüpfen. »Und was hat sie gemacht? Sie hat dich natürlich zum Nachsitzen verdonnert!«
»Da tobte dann im wahrsten Sinne das Donnerwetter! Natürlich, Frau Wetter würde nicht Frau Unwetter sein, wenn sie einen nicht nachsitzen ließe!«
Ihr Lachen hallt in meinem Kopf nach und hinterlässt mir eine Gänsehaut, die ich mit meinen Händen wegzustreifen versuche. Doch solche Momente waren seit dem Tod unserer Mutter selten geworden. Ich hörte sie immer weniger lachen, bis sie es in den letzten Monaten gar nicht mehr tat. Luna hat sich immer mehr verschlossen, wirkte in letzter Zeit aggressiv und ließ mich nicht mehr an sich ran. An manchen Tagen habe ich mir gedacht; lass gut sein, sie braucht es vielleicht in ihrem Alter, sich auch zurückziehen zu können und einfach ihre Ruhe zu haben. Das kann manchmal helfen, um mit sich selbst klarzukommen. Doch an manchen Tagen konnte ich ihr Gezicke und ihren Trotz gar nicht aushalten.
»Du kannst mir nicht verbieten, Musik zu hören!«, regt sie sich auf, nachdem mir aufgefallen ist, dass sie ihre Hausaufgaben abends noch nicht mal angerührt hat, dafür aber ständig Musik hört oder jemandem schreibt.
»Ich sehe dich entweder am Laptop, mit den Kopfhörern oder am Handy«, werfe ich ihr wütend vor. »Wann willst du heute endlich lernen? Mit wem chattest du überhaupt die ganze Zeit?«
»Das geht dich gar nichts an, hau ab aus meinem Zimmer!«, schreit sie, als ich in ihrem Laptop nachschauen möchte. Sie klappt ihn prompt zu und schubst mich in die Brust. Das war für mich allerdings neu, das habe ich bei ihr noch nicht erlebt.
»Sag mal, geht’s noch?« Ich schubse sie zurück in den Stuhl. »Und jetzt lern lieber, bevor ich es Vater erzähle.« Sie brummt etwas, was ich nicht verstehen kann. »Wie bitte?«, hake ich nach.
Doch sie bleibt still sitzen, mit dem Rücken zu mir. Aber im Augenwinkel, bevor ich mich umdrehe, bemerke ich, wie sich ihre Hand auf dem Tisch zu einer Faust ballt. In dem Moment ignoriere ich es aber. Sie hat sich noch nie getraut, mir eins überzubraten. Das würde ich auch schnell unterbinden, falls sie damit auch noch anfangen sollte.
Das war ungefähr eine Woche vor ihrem Tod.
Die Tränen nehmen mir die Sicht in mein Lehrbuch, das ich zwar anschaue, als ob ich es lesen würde, doch ich sehe nur den Film meiner Vergangenheit darin. Ich fühle mich erbärmlich. Plötzlich kommen mir all unsere Streitigkeiten so sinnlos vor. Damit haben wir die letzten Wochen ihres Lebens ausgefüllt. Die Furcht, dass ich sie zu ihrem Selbstmord womöglich auch noch mit meiner Härte angestachelt habe, schnürt mir die Kehle zu.
»Mist«, zische ich wütend, werfe das Buch auf den Tisch und meinen Kopf in die abgestützten Hände. Das war wohl etwas zu laut, sodass ich damit einige Blicke der wenigen Schüler auf mich ziehe, die an den anderen Tischen sitzen und chillen.
»Hey«, höre ich hinter mir Alexandra und ihre Hand legt sich auf meiner Schulter ab. »Hier steckst du also.«
Rasch wische ich mir unbemerkt die feuchten Augen trocken, ehe sie sich mir gegenüber hinsetzt. Ich atme durch und sehe zu ihr auf. Natürlich ist sie nicht dumm und erkennt meinen Zustand. Sie schaut mich mitleidig an.
»Selbst die Bibliothek erinnert mich an sie«, erkläre ich ihr, obwohl es unnötig ist, warum ich nicht dort, sondern hier hocke.
Sie versucht für mich da zu sein, eine stützende Schulter zu sein, doch ich kann mich ihr momentan nicht hingeben, mich ihr völlig öffnen oder mit ihr darüber reden, wie es in mir wirklich aussieht. Bis jetzt hat sie das meiste nur von anderen Schülern erfahren. Ich habe Angst, dass sie auch Schuldgefühle bekommen wird, weil wir zusammen waren, als Luna sich das Leben genommen hat. Alexandra gibt mir Zeit, spricht allgemein nicht viel mit mir, weder über den Vorfall noch über meinen Zustand oder meine Verhältnisse zuhause. Warum auch? Es ist auch so ersichtlich, verständlich und offenkundig, was in mir vorgeht. Ich brauche einfach meine Zeit zum Trauern, – jeder braucht sie.
Als ich Elise nachmittags aus dem Kindergarten abhole, sitzt sie auf dem Schoß ihrer Erzieherin, im Arm ihr Einhorn. Die Kleine bemerkt mich, noch bevor ich sie rufe, springt sofort runter von den Knien der Frau und läuft zu mir. Ich schaffe es noch rechtzeitig, in die Hocke zu gehen, da wirft sie sich mir um den Hals. Ich drücke sie sanft an mich, begrüße sie und stehe mit ihr auf dem Arm auf, bevor ich sehe, dass die Erzieherin zu uns herübergeht.
Mein Inneres beginnt leicht zu zittern. Ein Gefühl der Nervosität entsteht in mir. Jeder spricht uns ständig sein Beileid aus, was mich innerlich immer wieder zurück in die verfluchte Leere wirft und die schmerzliche Trauer um den verlorenen Menschen erneut durchleben lässt. Und dann haken sie dezent nach, ob wir vorher etwas von Lunas Tat gewusst oder etwas gemerkt haben und wie es uns jetzt damit ergeht. Es ist verblüffend und schlimm zugleich, dass Menschen nur aus reiner Neugier die Fakten und Tatsachen hinterfragen wollen, und nicht, weil sie sich tatsächlich um uns kümmern wollen. Das fremde Leben interessiert die Menschen mehr als ihr eigenes. Vielleicht sehe ich das aber nur so, weil es momentan so extrem ist. Wäre das meine Oma gewesen, die eines natürlichen Todes gestorben wäre, so wäre es wahrscheinlich auch anders und es hätte mich womöglich auch nicht so sehr gestört, verärgert oder … weiß der Geier was, was ich gerade in mir durchlebe. Ich spüre nur ein Chaos in mir, das ich nicht bändigen kann, und verirre mich allmählich darin.
»Elise hat heute schon gut zu Mittag gegessen«, meint die Erzieherin liebevoll und streichelt sie sanft am Rücken. Ja, Elise zum Essen zu bewegen, war in den letzten Tagen eine Katastrophe. Deswegen freut es mich, dass sie wenigstens hier unter Gruppenzwang gut essen konnte. Das beruhigt mich sehr. Auch, dass die Erzieherin nicht mehr nach Luna fragt.
Freundlich verabschieden wir uns von ihr, besser gesagt ich als Elise, die ihre Nase in meiner Halsbeuge versteckt und mich fest am Hals umarmt.
»Wie war dein Tag? Was hast du Schönes gemacht?«, frage ich munter, als ich sie auf die Bank absetze und versuche, meine innerlichen Empfindungen wegzustecken.
Sie streift ihre Hausschuhe ab und seufzt so schwer, als ob sie den ganzen Tag hätte schuften müssen. »Eigentlich ganz gut … Wir waren im Wald und dann haben wir gespielt und gespielt … und gespielt.«
Ich reiche ihr die Straßenschuhe, die sie nimmt. »Das muss ja richtig anstrengend gewesen sein«, äußere ich schmunzelnd und sie nickt mit einer Miene, als würde sie sagen wollen: ›Du hast es erfasst.‹ »Und was gab es denn zum Mittagessen?«
»Etwas ganz Ungesundes!«, betont sie klug das letzte Wort mit großen Augen.
»Oh, etwa Schokolade?!« Ich öffne für sie die Jacke zum Anziehen.
»Häh, Schokolade ist doch nicht ungesund! Wir haben Brokkoli gegessen und ich mag ja keinen Brokkoli!« Sie rümpft angewidert die Nase, während ich ihre Jacke zumache.
»Aha, verstehe! Also alles, was du nicht magst, ist ungesund.«
»Genau, Schokolade ist gesund! Und Kekse auch!« Zum ersten Mal sehe ich ihr Lächeln wieder, was mich selbst so beflügelt, dass es mir sofort warm ums Herz wird.
»Natürlich, wie konnte ich bloß die Kekse vergessen … Na komm, wir gehen noch kurz einkaufen, wir brauchen ja die Milch für dein Müsli.« Ich strecke ihr lächelnd die Hand hin und sie nimmt sie.
Im Laden erinnere ich mich noch an ein paar Sachen, die wir brauchen, und lege sie in den kleinen Einkaufswagen, den Elise unbedingt schieben wollte. Ich bleibe dann beim Müsliregal stehen, als Elise sagt, dass sie auch mal Kelloggs möchte, weil sie das schon lange nicht mehr gegessen hat … und natürlich weil es gesund ist. Ich gebe nach und suche nach etwas, was ihr Spaß beim Essen bereiten könnte. Zwischen den farbenfrohen Verpackungen mit Teddybärenköpfchen, bunten Ringen und Sternchen, die sich in Müslischalen schütten lassen, bleibe ich mit den Augen auf einer Verpackung mit Puffreis hängen.
»Die schmecken wie Popco«, höre ich Lunas niedliche Kinderstimme in meinem Kopf, während die Bilder meiner Erinnerungen ablaufen, wie wir gemeinsam am Tisch beim Frühstück sitzen.
»Nicht Popco, sondern Popcorn«, korrigiere ich sie. Die warme Hand streift mir über die Haare und meine Mutter gibt mir lächelnd einen Kuss auf die Wange. Sie muss schmunzeln, als Luna es wieder falsch ausspricht, und betüddelt sie, wovon Luna kichert.
Mir kommt es vor, als ob Lunas Stimme und Lachen nie meinen Kopf verlassen würden. Erst jetzt stelle ich sogar fest, dass meine beiden Schwestern nicht nur das gleiche Lächeln, sondern auch das gleiche Lachen haben.
Schmunzelnd greife ich nach der Verpackung, mit der ich mich zu Elise umdrehe. »Was meinst du, wollen wir die kau…?« Ich bekomme einen Schock, der wie ein Blitz durch meinen Körper zuckt, als ich sie plötzlich nicht mehr neben mir sehe. »Elise!«, rufe ich und schaue mich um. Ich finde sie nicht. Panik kommt in mir auf, während ich zum nächsten Gang laufe und sie dann bei einer Frau entdecke, die vor ihr in der Hocke sitzt. Ich atme schwer aus, doch mein Adrenalin sinkt nicht sofort.
»Elise«, rufe ich und gehe zu ihr hin. Die Frau richtet sich auf und ich erkenne Frau Wetter, meine Lehrerin.
»Hallo Thomas«, begrüßt sie mich freundlich, ehe ich Elise am Arm nehme und meine Atmung wieder zu beruhigen versuche. »Entschuldige, ich wollte gerade nach dir suchen, aber Elise meinte, dass sie weiß, wo du bist.« Ich nicke ihr nur zu.
»Elise, ich habe dich doch gebeten, nicht von mir wegzulaufen«, bringe ich besonnen aus mir heraus, aber dennoch streng. »Nur so weit, dass ich dich noch sehen kann, und du mich.« Elise nickt eingeschnappt. Man darf mit ihr nicht in einem rauen Ton sprechen, da schmollt sie sofort. Ein zartes Mädchen eben … so wie Luna es war … früher, als sie noch Kind war.
Mein Blick wandert auf Frau Wetter, die in den letzten Wochen krank war und erst in diesen Tagen von Luna erfahren hat. Nun erscheint sie mir zu einem Sonnenschein gewandelt, so nett sah sie noch nie im Gesicht aus. Doch das wird bestimmt bald vergehen, wenn das Mitleid mit mir schwindet und sie wieder ihren Donner über mich erschüttern lässt. Von Beginn an hat sie ständig an mir etwas auszusetzen, findet immer etwas, woran sie bei mir nörgeln kann.
»Danke Ihnen, wir müssen los«, versuche ich schnell wegzukommen und wende mich um.
»Thomas«, bremst sie mich. Ihre Stimme ist viel zu weich für ihre strenge Art. Ich drehe mich wieder halb zu ihr. Sie wirkt unsicher und schaut Elise an, dann wieder mich. »Ich wollte es dir oder deinem Vater eigentlich nicht mehr sagen, aber …«, beginnt sie und sieht wieder vieldeutend auf Elise, die die bunten Verpackungen im Regal mustert.
Ich begreife, weshalb sie noch Bedenken hat, mit mir über Luna zu sprechen, weil Elise das womöglich besser nicht hören sollte.
»Elise, willst du vielleicht für dich Kekse aussuchen«, schlage ich ihr vor und zeige zum Ende des Gangs, wo ich sie noch sehen kann. Ihre Augen sind plötzlich runder und glitzernder. Der Anblick bringt mich zum Schmunzeln, schließlich hat Luna sie nicht umsonst ›Krümel‹ genannt, denn die Kleine liebt Kekse mehr als Schokolade und knabbert daran wie ein Hamster, sodass ihre Kleidung immer mit Krümeln übersät ist.
Als Elise sich von uns entfernt hat, trete ich näher zu Frau Wetter und sehe sie erwartungsvoll an. Für einen Augenblick denke ich mir, dass sie nur zögert, dass sie nicht weiß, wie sie mit mir über meine Trauer sprechen soll. Da ich das aber nicht hören will, möchte ich ihr das bereits selbst sagen, doch da holt sie schon Luft.
»Luna war an ihrem … Todestag …«, spricht sie das Wort sehr leise aus, als dürfte man es nicht benutzen, »gar nicht in der Schule.«
Mein Atem setzt für Sekunden aus. Stirnrunzelnd sehe ich sie baff an. Das hätte ich doch mitkriegen müssen. Gedanklich beginne ich in meinen Erinnerungen an den Tag zu grübeln, ob ich Luna damals in der Schule gesehen habe: Ich hatte Doppelstunde in Chemie, das findet in einem anderen Gebäude statt, danach hatte ich Doppelstunde in Mathe in dem anderen Flügel, weit von Lunas Klasse entfernt. Dann … habe ich geschwänzt, um mit Alex zusammen zu sein, und rief davor Luna an, die mich informierte, dass sie von der Schule früher nach Hause entlassen worden sei.
»Äh, soweit ich weiß, ist Luna nach der zweiten Doppelstunde nach Hause entlassen worden, weil sie Kopfschmerzen hatte. So hat sie es mir am Telefon gesagt, bevor sie …« Ich stocke und schlucke die Vorstellung, die bereits in meinem Kopf weiterläuft, herunter.
»Thomas … Ich hatte in den ersten Doppelstunden in ihrer Klasse Unterricht … und sie war nicht da!«
In meinem Kopf versuche ich meine Gedanken von den Erinnerungen auszusortieren. Ich habe Luna in der Schule nicht immer zu Gesicht bekommen, höchstens in den großen Pausen und da habe ich sie an dem Tag tatsächlich nicht gesehen. Verloren streife ich mir mit der Hand über das Gesicht und blicke wieder meine Lehrerin an, weiß gar nicht, was ich sagen soll … Es überfordert gerade mein Gehirn, das überlastet ist.
»Ich weiß, dass es dir noch schwerfällt, über deine Schwester zu sprechen … wenn du willst, lasse ich dich jetzt auch in Ruhe«, meint sie dann.
Kopfschüttelnd sehe ich kurz zu Elise, die mit ihrem Einhorn am Regal steht, bereits eine Kekspackung in der einen Hand hält und noch eine zweite unschlüssig in der anderen dreht, weil sie sich einfach nicht entscheiden kann.
»Luna war ganz komisch in den letzten Monaten, Wochen. Ich dachte, es lag an ihrer Pubertät, aber … ich habe das Gefühl, dass sie sich irgendwie verändert hat, wirkte so …« Ich suche nach passenden Worten, als ob ich damit jetzt Luna verletzen könnte.
»Impulsiv?«, vermutet Frau Wetter, und das auch noch richtig.
»Vielleicht … Eher verschlossen … Ist es Ihnen auch aufgefallen?«, will ich wissen, denn es lässt mir einfach keine Ruhe, was meine Schwester zu dieser Tat bewogen hat.