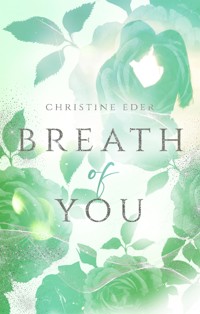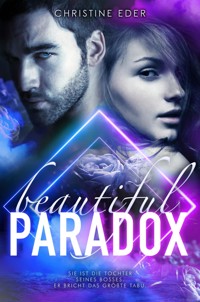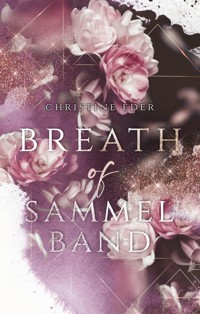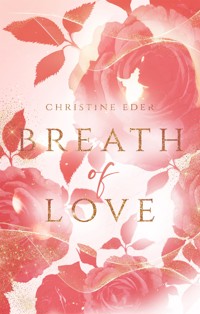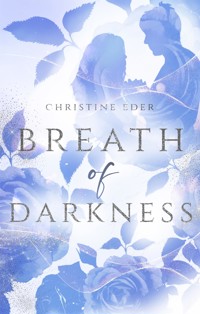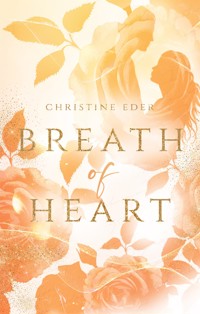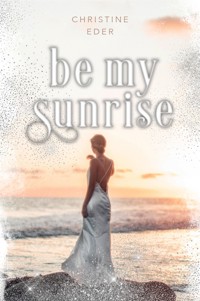3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HeroIn
- Sprache: Deutsch
*Überarbeitete und korrigierte Auflage. Stand: Januar 2018*
Als Sohn eines Top-Managers sind Valentin Wohlstand und eine sorgenfreie Karriere-Zukunft in die Wiege gelegt worden. Mit Partys, Alkohol- und Drogenexzessen und illegalen Straßenrennen verbringt er seine Nächte; Langeweile und Einsamkeit treiben ihn an. Valentin lässt sich zwar auf zahlreiche One-Night-Stands, aber nie auf Gefühle ein. Bis er auf Elena trifft.
Elena weiß genau, was sie will: ihr Studium beenden, einen Mann finden, heiraten und dann den kleinen Vince aus dem Kinderheim adoptieren. Doch sie trifft auf Valentin – genau den Falschen für ihre Pläne.
Elena berührt mit ihrer Ruhe etwas in Valentin; bei ihr kommt er runter. Doch das schätzt und hasst er zugleich. Er verliebt sich in sie, doch liebt er auch sein exzessives Leben. Elena und die Liebe zu ihr werden für ihn zu einer der härtesten Drogen.
Dies ist keine stürmische Lovestory oder erotischer Roman, sondern eine gesellschaftskritische Geschichte mit ungewöhnlicher Romanze
Empfohlenes Lesealter ab 16/17 Jahre
Der zweite und letzte Teil erscheint im Februar 2018.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
HeroIn - Band 1
Liebesroman
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenHeroIn
du fragst mich, ob ich pessimistisch sei
Verlag:
BookRix GmbH & Co. KG
Implerstraße 24
81371 München
Deutschland
Coverdesign: © Licht Design – Kristina Licht
Korrektorat/Lektorat: Andreas März/Sabrina Heilmann
2. Korrektorat: Sandra Nyklasz
Gedichte: © Andreas März
Alle Rechte vorbehalten.
Kein Teil dieses Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Autorin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Alle handelnden Personen und Handlungen dieses Buches sind frei erfunden und nur aus reinen Vermutungen entstanden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder bereits verstorbenen Personen wäre rein zufällig.
© Christine Eder 2017
2. Auflage 2021
Prolog
Ich habe mich in meinen Zielen verirrt, in der Zeit, in meinem Leben, in den Gefühlen und vor allem … in der Liebe.
Was ist eigentlich Liebe? Liebe – das ist Glück, Emotionen und Begeisterung. In ihr rauschen tausende unvorstellbar große, innige und bis dahin noch unentdeckte Gefühle, die einen süchtig und abhängig machen. Liebe ist wie eine Droge, nach der unser Körper verlangt, bis wir irgendwann in die Sucht abstürzen.
Die Liebe belebt uns, stellt uns auf die Beine, bringt uns zum Lachen und zum Weinen. Sie ist jenseits von Gut und Böse, ein Geschenk und ein Fluch zugleich, Verlust und Selbstfindung. Liebe ist ein sehr schönes Erlebnis, das unser Inneres aus dem Gleichgewicht bringt, uns bis zum Himmel ragen und an nichts anderes mehr denken lässt.
Je mehr man durch das unbegrenzte Glück der Liebe aufsteigt, desto tiefer fällt man und erlebt den Untergang auf Erden. Plötzlich sind Herz und Verstand nicht mehr auf einer Wellenlänge. Die Liebe kann nun mal vergänglich sein. Nichts im Leben ist ewig, auch das Leben selbst nicht. Liebe und Tod sind sehr starke Ereignisse im Leben eines jeden. Sie schlagen gnadenlos zu, wenn es an der Zeit ist und wir es am wenigsten erwarten.
Kapitel 1
Valentin
Der Wecker meines Handys klingelt vibrierend auf meinem Nachttisch, sodass es meinen Schädel zerreißt. Es fühlt sich so an, als würde jemand auf meinem Hirn wie auf dem Becken eines Schlagzeugs scheppern.
Ich strecke meine Hand aus, taste mit meinen Fingern danach, suche den verdammten Nervtöter, finde und schalte ihn ab. Stöhnend drehe ich meinen Kopf zur anderen Seite und spüre, dass noch jemand neben mir in meinem Bett liegt und vor meiner Nase atmet. Ich bemühe mich, meine schweren Augenlider ganz zu öffnen und klar zu sehen. Aber das Bild verschwimmt wie ein ziehender Nebel, der mein Bewusstsein davontreiben lässt.
Scheiße, ich habe gestern wieder mal übertrieben. Ich seufze und fahre mir mit der Hand über das Gesicht. Blinzelnd schaue ich mir den fremden Körper in meinem Bett genauer an. Eine Frau, und sie ist nackt. Habe ich eine Prostituierte mitgenommen? Oder einfach nur eine Bereitwillige?
Einige Minuten brauche ich noch, um ganz zu mir zu kommen und meine Sinne wieder in den Urzustand zu bringen. Mein Schädel brummt, vor meinen Augen dreht sich immer noch alles. Meine Kehle ist wahnsinnig trocken und verlangt nach Wasser. Meine Nase klebt und zieht, als würde da drin jeden Moment die Haut reißen. Ich reibe an ihr, ziehe ständig die Luft ein und bewege meine Nase hin und her.
Stöhnend richte ich mich auf, klettere aus dem Bett, lasse sie – wer auch immer sie ist – liegen und schaue mich um. Klamotten liegen zerstreut um das Bett herum, und dazwischen eine leere Kondomverpackung.
Schlaftrunken halte ich mein Handy in der Hand und gehe barfuß und nackt ins Wohnzimmer. Ich bemerke eine halbleere Wasserflasche, die ich vom Couchtisch nehme, und kippe den Inhalt hinunter. Jetzt muss ich nur noch schnell duschen gehen, denn ich stinke wie ein Müllsack mit verwesendem Inhalt.
Im Badezimmer blickt mir mein Spiegelbild entgegen: kurze dunkelbraune Haare und blaue Augen, unter denen braune Augenringe leuchten, die auf eine durchzechte Nacht deuten. Schleunigst bringe ich mein Aussehen in Ordnung, indem ich mein Gesicht mit kaltem Wasser wasche, dann nehme ich Nasenbefeuchter aus dem Schrank und inhaliere tief.
Nachdem ich die Zahnbürste in meinen Mund gesteckt habe, schreibe ich nebenbei eine Nachricht an meinen Freund Enzo: Hey, weißt du vielleicht, wer die Nackte in meinem Bett ist? Nutte?! Die gleiche Frage schicke ich an Thomas und Rudolf.
,Freunde‘ habe ich viele, doch sie alle tatsächlich als solche zu bezeichnen, kann ich nicht wirklich. Eher als Bekannte, mit denen ich mal etwas unternehme und mir die Zeit vertreibe, wenn sie oder ich jemanden zum Feiern brauchen.
Enzo, Thomas und Rudolf sind die einzigen Freunde, denen ich vertrauen kann und mit denen ich meistens auch abhänge. Mit ihnen bin ich seit der Schule befreundet. Enzo und ich kennen uns bereits seit dem Kindergarten und haben früher nach der Schule Fußball und Autorennen, genauer gesagt Gran Turismo, auf der Play-Station gespielt. Aber daraus sind wir sehr schnell herausgewachsen und haben begonnen, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Wir haben schnell das Nachtleben entdeckt. Am Gymnasium habe ich dann Thomas kennengelernt, während Enzo die Realschule besuchte und auf Rudolf traf. Von da an verbrachten wir zu viert unsere Zeit, was sich bis heute nicht geändert hat.
Aber ich gelange allmählich an einen Wendepunkt in meinem Leben, an dem ich mir denke, dass meine Grenze wohl bald erreicht sein wird. Junge, du wirst langsam alt.
Nicht wirklich alt. So alt, dass man den Jugendquatsch einfach nicht mehr machen kann – oder eher darf, aus Sicht der Erwachsenen. Thomas hat das von uns wohl als Erster begriffen. Er zeigt sich inzwischen immer seltener, weil er eine Freundin gefunden hat, mit der er es ernst zu meinen scheint. Im Gegensatz zu uns übrigen drei.
Ich warte, bis sie mir antworten, und nehme in der Zwischenzeit eine ausgiebige Dusche, wo ich versuche, meine Erinnerungen an den gestrigen Abend zu sortieren. Vergeblich. Das ist ja eine Weltmeisterschaftsaufgabe: Finde die Nadel im Heuhaufen. So kommt mir gerade auch mein Gehirn vor. Tausend bunte Bilder huschen durch meinen Kopf: lachende, betrunkene, kreischende und tanzende Gesichter. Alles sind nur Fetzen, nichts Klares ist dabei.
Gestern war ich mit einigen Geschäftspartnern nach der Arbeit in einem Club, wo wir etwas getrunken haben. Davor hatten wir ein ausgiebiges Gespräch, in welchem ich sie von den Produkten meiner Firma überzeugen wollte, damit sie den Vertrag mit uns unterschreiben. Ich hoffe, meine Überzeugungsarbeit war erfolgreich.
Ich weiß noch, dass ich mich danach mit den Jungs verabredet habe und wir in eine Bar gegangen sind, die voll mit feiernden Menschen war. Darunter waren auch unzählige Mädels, aus denen wir uns die Schönsten heraussuchten. Wir tanzten mit ihnen, tranken nicht wenig Champagner, welcher dann in härtere Drinks überging, und liefen aufs Klo, um Snow zu schnüffeln. Je länger der Abend wurde, desto unverschämter und hemmungsloser wurden die Mädels. Und dann … Ende im Gelände. Ein Riss. Loch. Keine Erinnerungen mehr an gestern.
Ich steige aus der Dusche und schaue auf mein Handy. Keiner von meinen Freunden hat mir geantwortet. Ich rufe sie an, doch keiner geht ran. Die Säcke pennen bestimmt noch ihren Rausch aus! Angepisst stapfe ich aus dem Badezimmer.
Als ich in mein lichtdurchflutetes Schlafzimmer trete, sitzt die Fremde, nur mit ihrem Höschen bekleidet, auf dem Bett und zieht sich gerade das Kleid über den Kopf. Als ihr Gesicht erkennbar wird, schaut sie mich musternd von oben bis unten an und bleibt mit ihren dreisten Augen an meinem Glied hängen.
»Wow!« Ein Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus und sie schaut flirtend wieder zu mir.
»Natürlich, wow!«, gebe ich zurück. Ich fühle mich in meinem Körper sehr wohl und habe daher keinerlei Komplexe, mich nackt zu zeigen.
Sie sieht hübsch aus, trotz ihrer verschmierten Wimperntusche unter den Augen, hat einen schlanken Körperbau und verdammt lange Beine. Genau mein Geschmack. Lange dunkelblonde Haare mit unregelmäßigen Locken, die ziemlich zerzaust aussehen, umrahmen ihr Gesicht. Wahrscheinlich waren sie gestern noch topgestylt. Ich kann mich aber überhaupt nicht an sie erinnern.
Ich gehe an ihr vorbei und stelle mich mit meinem ihr zugewandten, blanken Hintern vor meinen Schrank, den ich öffne. »Entschuldige, ich habe deinen Namen vergessen«, sage ich und ziehe mir die Calvin-Klein-Unterwäsche an.
»Alice«, antwortet sie hinter mir, und ich höre, wie sie vom Bett aufsteht.
Mir kommt plötzlich der Song von Smokie in den Kopf, und ich muss schmunzeln. Alice, Who The Fuck Is Alice? Muss ich sie bezahlen oder nicht?
Ich nehme das weiße Ralph-Lauren-Hemd vom Bügel, streife es über und drehe mich dann zu ihr um, während ich es schnell zuknöpfe.
»Und ähm, du … Valentin«, errät sie – oder erinnert – sich, im Gegensatz zu mir.
»Da ist ja jemand bestens informiert.« Ich lächle sie an und ziehe mir die Paul-Smith-Anzughose an.
»Na ja … wer kennt dich nicht?«, meint sie neckisch, schlüpft in ihre Pumps und nagt dann an ihrer Unterlippe.
Doch bezahlen? Wartet sie auf das Geld?
Sie lächelt mich kurz an und stöckelt aus dem Schlafzimmer. Ich nehme das Jackett meines Anzugs und dann mein Handy in die Hand, das ich in der Hoffnung auf Antworten inspiziere. Da es mir nichts Neues anzeigt, stecke ich es in die Hosentasche und nehme noch mein Portemonnaie mit.
Alice sieht sich in meiner Penthouse-Wohnung um und geht mit der geschmeidigen Bewegung einer Katze durchs Wohnzimmer zu den Doppeltüren der Dachterrasse. Sie schaut aus den großen Fenstern, aus denen sie unsere Stadt aus der achten Etage einige Sekunden bewundert, während ich ihren knackigen Hintern studiere.
Sie dreht sich plötzlich zu mir um und geht auf mich zu. Ich werde nervös, weil ich sie dennoch langsam loswerden möchte. Also bleibe ich einfach stehen und betrachte desinteressiert mein Möbeldesign.
Als sie vor mir stehen bleibt, sehe ich sie wieder an. »Hör mal … Alice! Ich muss mich für die Arbeit fertigmachen. Also …«
»Ach so, ja klar.« Sie nickt, bleibt aber noch vor mir stehen, was für mich so aussieht, als ob sie nach Worten suchen würde.
Scheiße, sie wartet tatsächlich auf ihr Geld. Aber wie eine Hure sieht sie doch nicht aus. Obwohl … In den Clubs ist es immer schwer nachzuvollziehen, wer nur einen One-Night-Stand sucht und wer das professionell macht. Komischerweise stylen sich alle irgendwie gleich, ganz egal, ob es sich nun um ein braves oder eher freizügiges Mädchen handelt. And who the fuck is Alice?
Mir bleibt nichts anderes übrig, als mein Portemonnaie zu zücken und in meinen Scheinen zu wühlen.
»Was schulde ich dir für die Nacht?«, frage ich und hebe meinen Blick. Oh, oh!
Ihre flache Hand trifft mich hart an der Wange. Von allen Ohrfeigen, die ich bereits von zahlreichen Weibern kassiert habe, hat es diese wirklich in sich. Kraft hat sie, das muss ich zugeben.
»Arschloch!«, faucht sie, dreht sich um und stöckelt in den Flur.
»Ja, da bist du auch bestens informiert.« Ich gehe grinsend hinter ihr her und reibe meine brennende Wange.
»Ich wollte nur nach deiner Nummer fragen«, keift sie und dreht sich vor der Tür noch mal halb zu mir um.
»Oh, da bist du aber schlecht informiert! Ich gebe nie meine Nummer raus.«
Sie reißt die Tür auf, die dann laut hinter ihr zuknallt. Ich höre mein Handy in der Hosentasche klingeln und hole es heraus. Auf dem Display leuchtet Enzos Fratze auf, und ich nehme ab. Er krächzt noch mit ziemlich verschlafener Stimme: »Sie ist keine Nutte!«
»Danke, aber die Info kommt zu spät«, sage ich und gehe zurück in mein Wohnzimmer, dann nach links in meine offene Küche. »Ich wollte sie bezahlen, und sie hat mir eine gescheuert.« Enzo lacht auf. »Was lachst du? Konntest du mir nicht sofort antworten?«, wettere ich, lächle aber dennoch und stelle meinen Kaffeeautomaten an, um mir einen Espresso zu machen. Ich höre, wie er ächzt, was sich anhört, als würde er sich nebenbei anziehen.
»Sorry, mec.« Er spricht mich wie so oft mit dem französischen Wort für ,Macker‘ an. »Ich bin selbst gerade aufgewacht, habe meinen Wecker nicht mal gehört«, behauptet er jetzt in Eile. »Sag mal, was war gestern eigentlich los?«
»Das fragst du mich? Ich habe doch selbst keine Ahnung!« Ich nehme lachend die Tasse in die Hand und nippe an dem heißen Espresso.
»Hey, nachdem wir das Zeug geschnüffelt haben … Bzzz, kein Licht mehr da«, parodiert er lachend den französischen Akzent, den er selbst kaum hat, weil er in Deutschland geboren wurde. »Shit, wo sind meine Socken? … Ah, da.«
»Das hat Thomas irgendwo herbekommen. Fragen wir ihn dann später.« Ich öffne die Terrassentüren und gehe raus.
Blauer Himmel. Sonne. Hochsommer. Geil. Ich atme kräftig die frische Luft ein.
»Na okay, ich muss jetzt zur Arbeit«, sagt Enzo. »Heute bleibt alles, wie wir es abgesprochen haben, oder?«
»Na klar.« Ich grinse breit.
»Ich werde in der Werkstatt auf dich warten«, schnauft er in den Hörer.
»Ja, tschüss.«
»Au revoir!«, blödelt er und legt auf.
Ich nehme lächelnd das Handy vom Ohr und sehe Thomas’ Antwort auf meine auch an ihn gerichtete Frage: Sie ist keine Hure!
Ich tippe zurück: Danke, das weiß ich schon selbst. Was hast du uns gestern für ein Zeug gegeben?
Seine Antwort kommt sofort: »Ich dachte, es wäre Koks. Scheint aber Heroin gewesen zu sein.«
Du Hirni! Sieh beim nächsten Mal genauer hin und pass auf, von wem du das Zeug bekommst, schreibe ich ihm, während ich meinen Espresso trinke und nebenbei eine rauche.
Ich schaue in der Galerie meines Handys die Fotos vom gestrigen Abend durch: Ein schiefes Bild, auf dem ich Enzo, breit in die Kamera grinsend, umarme, auf dem nächsten bin ich – vermutlich mit Alice – mit einem Glas Whisky in der Hand, wir albern und tanzen auf der Tanzfläche. Die Gesichter werden mit jedem Blättern durch die Bilder klarer und klarer. Es folgt ein Selfie, auf dem ich noch ziemlich fein rausgeputzt aussehe. Ich habe es gemacht, kurz bevor ich auf die Party gegangen bin. Genau das stelle ich auch rein! Ich lade mein Foto bei Facebook und Instagram hoch und sehe, wie die ersten Likes vergeben werden.
In meiner Garage gehe ich an meinem kirschroten, getunten Mazda MX-5 vorbei, setze mich aber in meinen Geschäftswagen, einen schwarzen 3er-BMW, und fahre in die Arbeit. Die Stadt ist belebt wie eh und je, und natürlich sind die Staus hier einfach unvermeidbar.
Hamburg. Meine Heimatstadt. Hier lebe ich. Hier regieren Tourismus und Business. Die Stadt ist aufgrund ihrer vielen Sehenswürdigkeiten nicht nur eines der attraktivsten Ziele, sondern durch den Hafen auch ein Zentrum für Handel und Industrie. Hamburg und Reichtum – das ist eins. Die Reichen sind der größte Bevölkerungsteil der Stadt. Ihnen hat die Schuldenkrise in Europa nicht zugesetzt, sondern sie noch reicher gemacht.
Auch ich gehöre zu der wohlhabenden Sorte und arbeite in der Firma meines Vaters. Er zählt zu den größten Top-Managern Deutschlands; seine Firma gehört zu der G & G – Unternehmensgruppe im Industriekonzern Elektrotechnik und Elektrik. Ich werde häufig damit konfrontiert, dass ich den Luxus nur meinem Vater zu verdanken habe, was zum größten Teil auch stimmt. Doch im Gegensatz zu den anderen jungen wohlhabenden Kindern, die ihr Vermögen geerbt oder von ihren reichen Eltern zugesteckt bekommen haben und nicht arbeiten wollen, habe ich fleißig gelernt, studiert und arbeite für mein Geld. Meine schicke Wohnung, meine Autos, die Rechnungen der Restaurants, Clubs oder Bars kann ich mir selbst leisten. Also sollte ich doch mein Leben in vollen Zügen genießen dürfen. Mit dem Neid kann ich sehr gut umgehen. Die Meinungen über mich, mein Vermögen oder was ich damit anstelle, gehen mir am Arsch vorbei. Ich lebe meine Momente. Ich lebe mein Leben. Alles Weitere und die anderen sind mir echt egal.
Elena
Mein Zimmer ist mit Sonnenlicht durchflutet. Das schöne Wetter beflügelt meine Laune, und ich strecke mich genüsslich in meinem Bett. Draußen höre ich schon das hektische Gewusel der Stadt und die vorbeirauschenden und hupenden Autos. Das Haus steht direkt an einer stark befahrenen Hauptstraße.
Ich freue mich wahnsinnig, dass heute Freitag ist. Wenigstens am Wochenende werde ich diesem Lärm entfliehen. Ach, ist es schön, schon am frühen Morgen mit dem Gezwitscher der Vögel und einer frischen Brise Morgenluft, die vom offenen Fenster hereinweht, aufzuwachen und wenigstens für ein paar Tage dem Druck dieser Stadt zu entgehen.
Leicht beschwingt springe ich aus meinem Bett auf die Beine. Ich nehme meine am Vorabend bereitgelegte Kleidung vom Stuhl und schlüpfe in ein leichtes Sommertop und in die durchgescheuerte Jeans. Zufrieden betrachte ich mich im Schrankspiegel und gehe anschließend aus meinem Zimmer.
So wie an jedem anderen Tag bemerke ich auch heute wieder, dass meine Mitbewohnerin Roma noch nicht wach ist. Ich habe sie vor einem Jahr hier in Hamburg kennengelernt und kurz darauf mit ihr eine WG gegründet.
Nachdem ich in der Küche den Wasserkocher angestellt habe, gehe ich zu ihrem Zimmer. Ich öffne die Tür, presse lächelnd meine Lippen zusammen und bleibe im Türrahmen stehen. Sie schläft bis auf den letzten Drücker und verbreitet dann auch gleich in Windeseile ihre schlechte Laune.
Ich kann es auf den Tod nicht ab, wenn mich Menschen sinnlos reizen. An sich bin ich ein sehr ausgeglichener und ruhiger Mensch, und mich so richtig aus der Bahn zu werfen, hat bis jetzt noch keiner geschafft. Ich weiß sogar ehrlich gesagt gar nicht, ob ich schreien kann, wenn ich so richtig wütend bin.
Romas Gesicht wird von ihren schwarzen gewellten Haaren verdeckt, ihre Beine und Arme sind quer über das Bett verteilt. Das ist vielleicht ein Dornröschen.
»Aufstehen!«, rufe ich laut und lache leise drauflos, als sie zusammenzuckt, aber weiterhin stöhnend im Bett liegen bleibt.
»Oh Elena, musst du so schreien?«, brummt sie in das Kissen, wälzt sich etwas hin und her und entspannt sich schließlich wieder auf dem Bauch liegend.
»Los, steh auf. Sonst wirst du wieder stinkig, weil du dich beeilen musst.«
»Uhu«, murrt sie und rührt sich nicht.
»Also, ich werde dich kein zweites Mal wecken«, drohe ich ihr an.
»Uhuu«, wiederholt sie nun etwas leiser.
»Wie du willst«, sage ich.
»Uhuuu.« Sie rührt sich immer noch nicht.
Ich gehe dennoch aus ihrem Zimmer und verschwinde im Bad, putze meine Zähne, kämme meine dünnen dunkelblonden Haare und lasse sie offen über meine Schultern fallen.
Als ich rauskomme und an Romas Zimmer vorbeigehe, liegt sie immer noch regungslos im Bett. »Roma!«, rufe ich.
»Ah?«
»Steh auf.« Ich bleibe wieder in der Tür stehen.
Sie richtet sich langsam und schaukelnd in eine halbwegs sitzende Position auf, lässt aber ihre Augen noch zu.
»Uhuuu.« Sie streift eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Bin … wach«, brummt sie verschlafen.
»Deine Augen sagen was ganz anderes«, kichere ich, und sie versucht diese aufzumachen.
»Ich bin wach«, krächzt sie und klimpert mit ihren langen Wimpern.
»Okay.« Ich lächle über diesen Anblick und gehe in die Küche.
Beim Frühstück esse ich mein Müsli mit Milch und lese nebenbei in aller Ruhe die regionale Zeitung. Doch diese Ruhe geht dahin, als Roma in die Küche poltert und sich währenddessen ihre Haare zu einem wilden Pferdeschwanz bindet.
»Oh, du hast mir schon einen Tee gekocht?«, sagt sie breit lächelnd, als sie ihren Becher sieht. Mit einem Schritt ist sie bei mir. »Du bist die Beste.« Sie gibt mir einen Kuss auf die Wange.
»Ich weiß«, schmunzle ich und lese kauend weiter.
Sie nimmt den Becher in beide Hände und trinkt hastig, ohne sich zu setzen. »Was liest du da?«, fragt sie.
»Einen Artikel darüber, dass Cannabis im Schanzenviertel kontrolliert verteilt wird, um den illegalen Drogenhandel einzudämmen«, informiere ich sie und blättere weiter.
»Aha … hm«, bringt sie nur hervor und nippt erneut an ihrem Becher.
»Pff, Schanzenviertel«, schnaube ich und blättere die Seiten der Zeitung durch. »Als ob das nur da ein Problem wäre!«
»Wo sonst?«, hakt Roma nach, schaut auf ihre Uhr und trinkt noch schneller, als ich es für möglich halten würde.
»Hast du dir schon mal die Reichen angeschaut? Denkst du wirklich, dass sie nur in den edlen Restaurants sitzen, wo sie ihre Champagnerflasche von Moët Dom Pérignon extra mit dem Etikett nach außen zum Saal stehen haben, damit es alle genau sehen können? Nein! Sie veranstalten die wildesten Partys, wo auf keinen Fall nicht nur Alkohol fehlen darf, sondern auch Drogen. Aber niemand will ja von solchen Ausschweifungen sprechen oder etwas bemerken. Man kann das Schniefen mit der Nase einfach auf eine Pollenallergie schieben, wo in Deutschland fast jeder darunter zu leiden scheint«, rede ich mich in Rage. »Sie sind doch bloß ein scheinbar zivilisierteres Ghetto.«
Roma kichert amüsiert auf. »Hast du dich jetzt mal wieder ausgesprochen?«
»Ja, jetzt habe ich mich etwas beruhigt!«
Sie stellt ihren Becher in die Spüle. »Du und deine große Liebe für die Reichen«, spöttelt sie breit lächelnd, woraufhin ich nur schmunzelnd meine Lippen zusammenpresse.
Ja, mit den Reichen habe ich so meine Probleme. Sie zeigen von sich nur die besten Seiten und verbergen die Wahrheit und ihre Macken hinter ihrer Etikette. Sie sind doch alle sehr intellektuelle und nennenswerte Menschen, die natürlich nie davon sprechen, wer Kokain schnüffelt, in der Pornografie mitwirkt, Plagiate vertreibt, sein Image pflegt oder sich irgendeinen Titel kauft. Alle wissen, dass sie es tun, und dennoch weiß niemand, dass es getan wird. Verdrängung und Ignoranz sind wohl in unserer heutigen Gesellschaft zu weit verbreiteten Krankheiten geworden.
Ich falte die Zeitung zusammen, während Roma zurück in ihr Zimmer geht. Sekunden später prescht sie mit ihrer Tasche in den Flur, während ich meine Müslischale und ihren Becher abspüle und anschließend meine Hände abtrockne.
Sie schaut aus dem Türrahmen heraus. »Sehen wir uns heute noch, bevor du fährst?«
»Ja. Ich fahre erst am Abend.«
»Na gut, dann bis später.«
»Bis dann.« Wir geben uns Wangenküsse zum Abschied, und sie schießt aus der Wohnung, um zu ihrer Ausbildungsstelle zur Einzelhandelskauffrau zu fahren.
Auch ich nehme meinen Rucksack, werfe ihn über die Schulter und gehe aus der Wohnung. Vor dem Haus bleibe ich neben meinem Yamaha-Motorrad stehen, ziehe meinen Blouson an, setze den Helm auf und bemerke bereits beim Aufsteigen, dass mir echt heiß wird. Also fahre ich rasch los zur Zeitungsredaktion, in der ich momentan ein Praktikum für mein Journalismusstudium absolviere.
Ich versuche, die Staus auf den Nebenstraßen zu umfahren. In solchen Situationen bin ich echt froh, dass ich ein Motorrad habe und kein Auto und dass der Fahrtwind mich in dieser Hitze abkühlt. Vielleicht gibt es heute ja endlich mal ein Gewitter.
Ich liebe Donnerwetter sowie lauwarmen Sommerregen und den Geruch, wenn er auf der heißen Erde verdampft. Ich halte mich gern in der Natur auf, genieße die Ruhe und ihre leisen Geräusche. Manchmal sitze ich stundenlang im Grünen und träume dabei einfach nur.
Wünsche habe ich wenig. Ich brauche keine teuren Sachen oder Klamotten. Mir ist nicht wichtig, viel Geld zu besitzen oder danach zu jagen, damit ich wie die Made im Speck leben kann. Ich bin ein bescheidener und kein materiell orientierter Mensch. Um in meinem Leben glücklich zu sein, brauche ich nicht viel – im Gegensatz zur heutigen Mehrheit der Menschen, die nur nach materiellem Vermögen zu urteilen scheint.
Vielleicht war es in unserer Welt immer so, aber heutzutage kommt es mir so vor, als würden sich die Reichen immer mehr bereichern, während die Armen noch ärmer werden. Die Menschen regieren die Welt, und Geld regiert die Menschen. Je mehr sie davon haben, desto mehr wollen sie. Die Kluft zwischen den Wohlhabenden und den Armen wird größer. Der Mittelstand stirbt langsam aus, als ob er die Pest hätte, die ihm nach und nach alles nimmt, bis er am Existenzlimit leben muss und in seinem Leben nur noch dahinvegetiert.
Die Wohlhabenden wissen einfach nicht, was das heißt, jeden Tag in Not zu leben, jeden Cent einzeln umzudrehen oder gar hungern zu müssen. Sie interessieren sich nicht dafür, wie viele Menschen auf der Straße leben. Empathie ist für die ein Fremdwort. Sie denken nur an sich selbst, fühlen sich wie die Helden der Welt, sind aber für mich nichts anderes als selbstverliebte Egoisten. Insbesondere die jüngeren Würstchen, die am Steuer der Autos ihrer Väter sitzen, betrachten sich als erfolgreich. Diejenigen, die tatsächlich ein wenig Macht besitzen, versuchen dir zu beweisen, dass du in deren Gesellschaft ein Nichts bist. Es gibt kein Konzept von Ehre und Würde, und Bescheidenheit wird schon längst als Schwäche angesehen. Die Menschen, die ein gutes Herz haben, werden heutzutage als Last angesehen, deren Leben als eintönig erscheint und nur als eine Verzögerung des Schicksals betrachtet wird.
Es ist kein Neid gegenüber den Wohlhabenden, nein. Ich halte mich für einen gütigen Menschen und würde nie jemandem etwas Böses wünschen. Nur komme ich aus einem schwierigen Ort und würde meine Kindheit niemandem wünschen. Daher kenne ich die Seite der Armut sehr gut. Ich hatte manchmal sogar tagelang Hunger gelitten, hatte keine anständige Kleidung und kannte weder Liebe noch Zärtlichkeiten in meiner Kindheit. Ich stand oft mit meiner kindlichen Hilflosigkeit allein, versuchte meine Wut mit Liebe zu bekämpfen, doch hatte nur noch mehr Druck auf meiner Seele.
Ich bin gerade erst neunzehn Jahre alt, und es scheint mir, als hätte ich bereits zwei Leben gelebt. Das Alter ist für mich nur eine Zahl, und diese Zahl zeigt nicht unbedingt das Wissen eines Menschen. Alles hängt von den erlebten Schicksalen und Rückschlägen im Leben ab und wie sehr das Ganze einen gezeichnet hat. Die einen werden davon schwach, bei den anderen stärkt es den Charakter, und bei einigen entwickelt sich für manche Handlungen eine Art Abneigung. Das Letzte spricht wohl für mich.
Kurz bevor ich die Redaktion erreiche, muss ich dennoch auf eine lebhafte Straße rausfahren und bleibe an einer roten Ampel neben einem dicken BMW stehen. Und da haben wir so einen Typen! Ich schaue ins Auto, in dem ein jüngerer Anzugschnösel sitzt und die typischen wischenden Handbewegungen an seinem iPhone macht. Die Ampel schaltet auf Grün. Er legt rasch sein Handy weg, fährt geradeaus und ich biege nach links ab.
Kapitel 2
Valentin
An der letzten Kreuzung bleibe ich an einer roten Ampel stehen und schaue im Terminplaner meines Handys, ob ich heute irgendwelche Meetings außerhalb habe. Ich versuche ernsthaft mich zu konzentrieren, während links neben mir ein Motorrad steht, das mir langsam auf den Senkel geht. Als die Ampel umschaltet und der Fluss der Autos sich voran bewegt, lege ich schnell mein Handy auf dem Sitz ab und fahre ebenfalls los.
Vor dem dreiundzwanzigstöckigen Geschäftsgebäude, in dem ich arbeite, parke ich mein Auto und steige aus. Meine Kollegen, die ich zum größten Teil nicht einmal kenne, beeilen sich pünktlich zu kommen. Sie laufen in der angemessenen Bekleidung mit ihren Akten- und Laptoptaschen ins Gebäude, während sie telefonieren oder noch schnell Nachrichten überfliegen oder schreiben.
Ich bleibe vor der Tür stehen und rauche auf die Schnelle noch eine, wie auch einige andere Leute, da uns vor kurzem das Rauchen im Gebäude untersagt wurde. Aus gesundheitlichen Gründen. Natürlich! Als ob sich jemand um unsere Gesundheit schert, außer wenn es ums Geld der Krankenversicherungen geht.
In der obersten Etage steige ich als einer der Letzten aus dem Fahrstuhl aus und marschiere durch das Großraumbüro zu meinem Büro. Die Geräusche der verschiedenen Drucker, klingelnden Telefone, Kopierer und der querbeet sprechenden Menschen durchdringen mein noch unausgeschlafenes und empfindliches Gehirn. Ich versuche allmählich meine Gedanken zu sortieren, um konzentriert meiner Arbeit nachgehen zu können. Ich hätte eine Aspirin nehmen sollen. Am liebsten wäre ich jetzt allein schon der Geräuschkulisse wegen geflüchtet.
Freundlich begrüße ich meine Kollegen und lächle sie an. Dieselben Reaktionen bekomme ich zurück. Ob sie tatsächlich froh sind, bei der Arbeit anwesend zu sein? Das bezweifle ich. Die Mehrheit der Leute arbeitet heutzutage nur notgedrungen, um nicht in die sozialen Problemsümpfe abzurutschen. Das war immer so und wird sich wohl auch nie ändern.
Ich schüttle freundlich die Hände meiner Kollegen, die überwiegend Leiter verschiedener Abteilungen sind. Einige von ihnen stopfen mir geradezu diese heuchelnde Freundlichkeit in den Arsch. Bei mir bringt das nichts. Allerdings haben es einige bei meinem Vater geschafft, sich hochzuschleimen und sich mit einer widerwärtigen Hochnäsigkeit in das lederne Sesselchen niederzulassen. Jetzt denken sie, nicht mehr denken zu müssen, und wälzen ihre Arbeit auf die untergeordneten Mitarbeiter ab.
Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich selbst Verkaufsleiter bin und meine Arbeit auch gerne weiterreiche. Der einzige Unterschied: Ich bin der Sohn des Chefs und musste meinem Vater Gott sei Dank weder damals, als ich die Stelle zugewiesen bekam, noch jetzt in den Arsch kriechen. Es war allein seine Entscheidung, mich mit der Leiterstelle zu krönen, die ich einfach so aus Bequemlichkeit hingenommen und akzeptiert habe.
»Herr Weber«, ruft eine weibliche Stimme hinter mir, an der ich sofort die Sekretärin meines Vaters erkenne.
Ich drehe mich bereits mit einem Lächeln zu ihr um. Sie trägt wie immer einen makellosen, eleganten Rock und eine Bluse.
»Ihr Vater will Sie sprechen«, setzt sie mich in Kenntnis.
»Danke, Sylvia. Er kann wohl nicht ohne mich leben.« Ich drehe mich um und gehe weiter.
Vor meinem Büro verlangsame ich meine Schritte und begutachte eine unbekannte junge Frau, die jetzt auf dem Platz meiner Sekretärin sitzt. Ich wusste schon, dass mein Vater jemanden für mich einstellen will, doch … Hat er etwa keinen Geschmack?
Sie sieht nicht wirklich anziehend aus, obwohl sie schöne Kleidung an ihrem knochigen Körper trägt, die aber nicht wirklich gut sitzt. Sie wirkt verbiestert, und ihre dunkelrote Ray-Ban-Brille und die strenge Frisur, zu der sie ihre schwarzen Haare arrangiert hat, verleihen ihr etwas Hartes.
Sie springt sofort von ihrem Stuhl auf, als ich vor ihr stehen bleibe.
»Hallo, oh, äh … guten Tag«, redet sie schnell und verwirrt drauflos, blinzelt etwas verloren und streckt mir ihre Hand entgegen. »Ich bin Melanie Groth, Ihre neue Sekretärin.«
Ich gebe ihr die Hand und zwinge mich irgendwie zum Lächeln.
»Valentin Weber«, stelle ich mich trocken vor.
Sie schaut mich mit halbgeöffnetem Mund an, als ob sie mit ihren Augen an meinem Gesicht kleben geblieben wäre. Ehrlich gesagt wirkt ihr Blick auf mich gerade so, als würde sie sich vorstellen, wie ich ihr die Bluse herunterreiße, sie auf den Tisch werfe und dann mit meiner Zunge über ihren Körper gleite. Eine schöne Vorstellung … Hm, aber nicht mit ihr.
Ich hebe erwartungsvoll eine Augenbraue und warte, ob sie mir noch etwas sagen möchte. Wie auf ein Schusskommando kommt sie erschrocken zu sich und beginnt in den Papieren auf ihrem Tisch zu wühlen.
»Äh … Herr Weber hat mir gesagt, dass Sie als Erstes immer die Liste mit den Umsatzzahlen sehen möchten.«
»Als Erstes möchte ich immer einen Espresso«, werfe ich ein und merke, wie schroff es rüberkommt.
Sie stockt leicht, wobei ihre Hand mit der Liste in der Luft hängen bleibt.
»Aber ja, ich möchte auch die Umsatzzahlen sehen«, sage in einem versöhnlichen Tonfall und nehme ihr diese ab.
Sie nickt und schaut verloren umher. »Okay … gut«, murmelt sie nervös. »Dann mache ich Ihnen jetzt einen Espresso.«
»Ich bin gleich nicht am Platz, Sie können ihn mir später bringen«, informiere ich sie. Sie schaut mich blinzelnd an, senkt dann aber ihren Blick mit einem leisen »Okay«.
Bevor die Kleine vor Nervosität noch völlig durchdreht, gehe ich in mein Büro, in dem in der Mitte mein Arbeitstisch steht. Durch die Glastür kann ich das Großraumbüro sehen und die Kollegen bei der Arbeit beobachten. Hinter mir aber kann ich Hamburg durch die großen Fenster betrachten, während ich in meinen Gedanken hänge oder mich einfach nur ausruhe.
Ich schaue durch die Glastür und sehe, wie Melanie an ihrem Platz mit den Händen über den Tisch huscht, als ob sie eine Marionette wäre. So kommen mir die Sekretärinnen meistens auch vor: Marionetten, deren Fäden man ziehen kann, wie man will. Ein erbärmlicher Gedanke, ich weiß.
Nachdem ich mich im Computer einloggt und ein paar Papiere von meinem Schreibtisch auf den unbearbeiteten Stapel geworfen habe, nehme ich mir eine Aspirin aus der Schublade und mache mich schließlich auf den Weg zu meinem Big Boss.
Mein Vater ist ein Perfektionist und bekannt dafür, einen irrezumachen. Ständige Predigten, was richtig und was falsch sei, wie wichtig die Arbeit im Leben sei und wie hart man arbeiten müsse, um gut leben zu können. Mich lässt es kalt. Allen anderen, glaube ich, kann er echt das Hirn aus dem Kopf quatschen. Da rauche ich lieber, als dass ich durch einen von meinem Vater verursachten Herzinfarkt schneller in einem Sarg lande als ein Nichtraucher.
Ich öffne die Tür zu seinem großen Büro. Mein Vater sitzt an seinem Arbeitstisch hinten im Raum. Das Büro wird aufgrund der bodentiefen Fenster mit viel Licht durchflutet. Vorne links steht noch ein großer, massiver und dunkler Konferenztisch. Sonst sieht es ziemlich leer aus. Nicht nur einmal habe ich ihm die Frage gestellt, warum er so viel Platz für zwei Tische brauche. »Ich liebe Freiraum«, war dann seine Antwort.
Freiraum? Vielleicht war das auch der Grund, warum er sich vor zehn Jahren von meiner Mutter hat scheiden lassen. Obwohl ich glaube, dass eher sie die Entscheidung getroffen hat zu gehen, weil sie zu viel Freiraum hatte. Sie hat ihn wegen seines Jobs kaum zu Hause gesehen.
Es kann aber auch sein, dass ich mich täusche. Wir waren nicht so eine engumschlungene »Piep, piep, piep, wir haben uns alle lieb«-Familie und haben deshalb nicht wirklich viel miteinander geredet. Jeder lebte irgendwie für sich allein und war mit sich selbst beschäftigt. Zu meiner Mutter habe ich nur gelegentlichen Kontakt, und in letzter Zeit meistens auch nur noch telefonisch. Wie gesagt: Jeder lebt sein Leben.
Mein Vater sieht streng zu mir auf. Viele sagen, dass er Ähnlichkeit mit George Clooney hat. Mir kommt es aber nicht so vor.
»Hast du dich auf dem Weg hierher verlaufen oder warum hat es so lange gedauert?«, fragt er zwar ruhig, doch die Schärfe in seiner Stimme ist nicht zu überhören.
»Dir auch einen guten Morgen, Vater«, antworte ich gespielt förmlich und pflanze mich grinsend ihm gegenüber in den ledernen Sessel.
»Guten Morgen«, sagt er jetzt. »Warum kannst du dir nicht angewöhnen, eine Krawatte zu tragen?«
Ich ziehe meine Nase kraus. »Ich hasse sie, das weißt du doch. Außerdem bin ich ein moderner Mensch; das wird heutzutage nicht mehr so eng gesehen.« Ich richte lässig meinen Kragen, aber er sieht mich immer noch streng an. Ich verdrehe stöhnend die Augen. »Beruhige dich, gestern hatte ich eine.«
»Du hast eine Fahne«, stellt er fest. Ich wende meinen Blick von ihm ab, schaue auf meine Schuhe, fühle mich aber eigentlich nicht schuldig. »Sag bloß, du warst mit ihnen in einer Bar und hast deine Schokoladenseite gezeigt«, reimt er sich zusammen – zu Recht.
Ich sehe ihm gelassen in die Augen. »Ja, ich war mit ihnen in einem Club und habe allen gezeigt, wozu ich fähig bin.«
»Bist du noch bei Trost?«, empört er sich.
»Sollte ich sie etwa in eine Sushi-Bar schleppen?«
»Ja, zum Beispiel.«
»Deine Partner kannst du einladen, wohin du willst! Meine sind doch keine Sechzigjährigen, sondern junge Geschäftsleute wie ich«, bringe ich belustigt hervor.
»Nur nicht solche, die immer noch Partys im Kopf haben! Ein Wunder, dass du deswegen noch nicht in der Zeitung gelandet bist.« Er steht auf, steckt seine Hände in die Hosentaschen und umgeht mit gemessenen Schritten und einer konservativen Haltung seinen Tisch.
Ich hingegen sitze locker. »Keine Angst, ich bin mir sicher, sie werden den Vertrag unterschreiben. Du wirst deine Kaffeemaschinen und Wasserkocher loswerden und dein Konto bekommt weitere Nullen.« Ich bemerke den Sarkasmus in meiner Stimme. »Und was die Zeitungen angeht, hast du dann noch ein weiteres süßes Foto von mir für dein Familienalbum«, lege ich noch frech grinsend oben drauf, weil es schon längst keine Familienfotos oder gar Familienalben mehr gibt.
Er stützt sich mit den Händen auf dem Tisch ab und beugt sich leicht zu mir herüber. »Wofür lebst du eigentlich, Valentin?«
Ich grinse noch breiter. »Für das Gleiche wie du, Vater«, kontere ich und meine damit Geld, was er auch sofort versteht.
»Das hast du bereits von Geburt an gehabt! Manche Menschen müssen für das, was du bereits besitzt, ihr halbes Leben arbeiten«, brummt er und atmet durch. »Ich meine, wann wirst du endlich dein Leben vernünftig leben?« Er fixiert mich mit seinem Blick. Ich verdrehe die Augen. »Valentin, du bist sechsundzwanzig. Es wird langsam Zeit, erwachsen zu werden!«
»Ich bin erwachsen«, erwidere ich und werde etwas ernster. »Ich mache doch meine Arbeit, oder? Das sollte dich doch am meisten interessieren. Die Arbeit, die ich gern und gut mache! Also warum kann ich dann nicht meine Freizeit so ausleben, wie ich es will?«
Er seufzt nur schwer, wobei er seinen Blick von mir abwendet. Wahrscheinlich denkt er, dass es keinen Sinn macht, weiter mit mir darüber zu diskutieren. Genau! Dickköpfigkeit war immer meine Stärke, und ausgerechnet die habe ich von ihm.
»Also, erzähle mir, wie es gestern gelaufen ist.« Sein Ton ist wieder ruhig. Er geht zurück zu seinem Tisch und sortiert seine Papiere – oder tut zumindest so.
Gerade als ich loslegen will, klopft jemand an der Tür. Sylvia bringt ihm eine Tasse Kaffee, die sie auf dem Tisch abstellt.
»Sylvia, kannst du mir bitte ein Glas Wasser bringen?«, frage ich sie neckisch, und sie nickt mir lächelnd zu.
Mein Vater atmet laut aus, weil er weiß, wofür ich das brauche, und bringt es auch noch zur Ansprache, als Sylvia durch die Tür verschwindet. »Irgendwann übertreibst du es mit deiner Sauferei«, spuckt er aus. Er sucht nach Dingen, die er mir noch dazu sagen will, findet aber doch nichts. Es ist hoffnungslos, mich noch weiter zu belehren.
Sylvia kommt mit einem Glas Wasser zurück und stellt es vor mir ab. Ich bedanke mich bei ihr und beobachte ihren Gang beim Rausgehen. Sie wäre – im Gegensatz zu meiner Sekretärin – die Richtige zum Vernaschen. Aber sie ist mir etwas zu alt.
»Lass die Augen von meiner Sekretärin«, brummt mein Vater ärgerlich, als sie aus der Tür geht. »Und deine Finger erst recht!«
Ich lache leise los. »Bist du etwa eifersüchtig?« Er erschießt mich förmlich mit seinem Blick. »Übrigens danke für die neue Sekretärin. War es so schwer, eine Hübsche einzustellen?«
Jetzt erwürgt mich sein Blick. »Damit du deine Hände an sie legen kannst?«, schnaubt er zurück.
»War doch bis jetzt nur einmal.«
»Und auch das letzte Mal«, meint er und faltet seine Hände auf dem Tisch zusammen.
Schmunzelnd werfe ich die Aspirin in das Wasserglas und schaue mir an, wie sich die Tablette sprudelnd auflöst. Ich spüre den bohrenden Blick meines Vaters auf mir, hebe fragend den Blick und grinse.
»Ach so, ja, du willst doch die Einzelheiten von den Geschäftspartnern wissen.«
Er seufzt ungeduldig. Also fange ich an, ihm alles von meinem Treffen zu erzählen. Er hört sich das Ganze genau an und scheint zufrieden zu sein, doch das zeigt er natürlich nie und bleibt bei seiner Strenge. Ein Lob auszusprechen oder Danke zu sagen, fällt meinem Vater irgendwie schwer.
»Jedenfalls melden sie sich telefonisch noch heute Morgen zeitig bei dir, ob sie auf den Vertrag eingehen werden oder nicht«, beende ich meinen Bericht. Er nickt nachdenklich und betrachtet dabei scheinbar interessiert sein Tacker.
»Okay, was sagen die Umsatzzahlen?«, fragt er dann.
»Die habe ich mir noch nicht angeschaut«, erwidere ich und er sieht mich an. Ich zucke mit den Schultern. »Was? Du hast dich so sehr nach mir gesehnt, deswegen kam ich noch nicht dazu.«
Er atmet tief durch und nimmt ein Blatt aus einem Papierstapel, das er mir reicht und mich bittet, mit diesem Kunden Kontakt aufzunehmen. Wir klären noch andere geschäftliche Angelegenheiten, als kurze Zeit später sein Telefon klingelt. Er nimmt den Anruf sofort entgegen.
»Ja … Stellen Sie durch«, sagt er und taucht in das Telefongespräch ein.
Währenddessen hole ich mein Handy aus der Hosentasche und sehe, dass ich eine Nachricht von Rudolf bekommen habe: Ich bin selbst neben einer Tussi aufgewacht, die ich nicht kenne. Und das auch noch in ihrer Wohnung am anderen Ende der Stadt.
Ich lache leise auf, was ich sofort wieder unterbinde, weil mein Vater mich scharf ansieht. Scheiße, Rudolf, dich hat es wohl am schlimmsten erwischt, denke ich mir und schreibe ihm das auch.
Nach ewig langen und langweiligen Minuten legt mein Vater endlich auf und sieht mich an. Ich warte auf seine Ansprache.
Er nickt, leicht in Gedanken versunken. »Ja … Sie sind einverstanden und unterschreiben den Vertrag«, bringt er leise hervor.
Ich neige mich etwas vor und lege stirnrunzelnd und demonstrativ meine Hand ans Ohr. »Bitte? Ich habe das irgendwie nicht gehört«, scherze ich.
»Sie unterschreiben«, wiederholt er jetzt lauter, und sein Gesicht entspannt sich etwas. Ich lehne mich grinsend wieder zurück in den Sessel. »Okay, gut«, murmelt er vor sich hin.
»Wo ist der Dank dafür?« Ich hole breit lächelnd meine Zigaretten heraus und zünde mir eine an.
Die Mimik meines Vaters verändert sich schlagartig, während ich den Rauch auspuste. »Für dich gelten hier die gleichen Regeln: Nicht rauchen!«
Ich ziehe wieder an der Kippe. »Ach, komm schon! Ich habe dir gerade einen fetten Vertrag klargemacht. Übrigens, meinen Bonus hast du nicht vergessen, oder?«
»Nein, habe ich nicht«, bringt er hervor, hebt währenddessen seinen Hintern vom Stuhl, reißt mir die Fluppe aus dem Mund und wirft sie in mein Wasserglas.
»Mann, ich habe kein Aspirin mehr«, empöre ich mich.
»Pech für dich«, entgegnet er. »Und jetzt los, an die Arbeit!« Er beginnt in seinen Papieren zu wühlen.
Ich sortiere und bearbeite meine Papierberge und führe etliche Telefonate, obwohl ich längst Feierabend hätte. Meine Konzentration leidet inzwischen auch stark, und ich massiere meine Schläfen, als ob das mein Denkvermögen vergrößern oder beschleunigen könnte.
Meine Bürotür geht auf, und ich sehe vom Tisch auf.
»Herr Weber, brauchen Sie mich noch oder kann ich Feierabend machen?«
»Nein, du kannst Feierabend machen«, entfährt es mir. »Ich kann dich doch duzen, oder?«, hake ich nach.
Sie wird nervös und ihre Wangen erröten. »Ja, das ist in Ordnung, Herr Weber«, antwortet sie unsicher, betont aber meine Nachnamen extra.
Erwartet sie etwa, dass ich ihr auch erlaube, mich zu duzen? Aber ich lasse es sein und grinse innerlich.
»Dann sehen wir uns in aller Frische am Montag«, sage ich, und sie nickt leicht.
»Schönes Wochenende wünsche ich Ihnen.«
»Danke. Das wünsche ich dir auch.«
Sie macht die Tür zu, und ich mustere sie durch das Glas. Melanie nimmt ihre Tasche und stöckelt in Richtung Fahrstuhl. Na, von hinten sieht sie etwas besser aus. Ich atme durch und lese noch schnell einen Vertrag … Shit, in meinen Schädel passt überhaupt nichts mehr. Ich nehme einen Schluck von meinem Kaffee, der widerlich kalt geworden ist, weshalb ich eine Fratze ziehe, und packe nun auch meine Sachen zusammen, um nach Hause zu fahren.
Elena
In der Redaktion wurde ich heute in die Abteilung Klatsch und Tratsch eingeteilt. Das ist das Thema, das mich eigentlich so gar nicht interessiert – oder, besser gesagt, das mich viel mehr auf die Palme bringt und nur noch reizt. Aber ich höre meiner Kollegin Mandy trotzdem genau zu, während ich neben ihr sitze. Sie gibt mir einen Ordner, der die ganzen Artikel, die sie verfasst und rausgebracht hat, enthält.
In aller Ruhe überblättere ich die Berichte, mache mich mit ihrer Arbeit vertraut und lese viele auch durch. Dabei bleibe ich an einem Artikel hängen, in dem sie über den Hamburger Topmanager Walter Weber geschrieben hat. Ich erfahre, dass dieser einen Sohn hat, Valentin, den er eingestellt hat und der irgendwann auch die Firma seines Vaters übernehmen wird. Ich lese auch die Artikel über Valentin selbst, über all das, was er bereits mit seinen jungen Jahren erreicht hat.
Beim Betrachten des Fotos, auf dem die beiden Webers – makellos in Anzügen – abgelichtet sind, schaue ich mir den Junior genauer an. Er sieht gut aus, ist aber ein reicher Schnösel, der bestimmt bis ins Knochenmark verzogen ist. Bestimmt so einer, der das elterliche Geld in teuren Clubs versäuft, bis zum Umfallen feiert und mit seinem primitiven Gegröle die Mädels anlockt. Wenn sie nicht gerade naiv darauf hereinfallen und sich anschließend unsterblich in ihn verlieben, nutzen sie ihn bestimmt nur aus, um ihm sein Geld für teuren Lifestyle abzuzocken. Mir fällt vermehrt auf, dass die Menschen immer mehr vergessen, was Liebe heißt. Sie suchen nur einen optimalen Partner, um gut zu leben und dafür nicht viel tun zu müssen.
»Oh, die Webers«, säuselt Mandy schmunzelnd neben mir, schaut kurz das Foto an und wendet sich wieder ihrem Computer und dem Artikel, den sie gerade schreibt.
»Tja, da wird einem der Reichtum gleich in die Wiege gelegt, nicht wahr?« Ich versuche, nicht zu angewidert zu klingen.
Sie nickt leicht. »Ich habe Herrn Weber damals interviewt. Er ist wirklich ein netter und sehr sympathischer Mann«, erklärt sie mir und tippt nebenbei weiter.
»Welcher jetzt?« Ich betrachte den Senior, doch meine Augen schweifen erneut zu seinem Sohn.
»Senior. Den Jüngeren habe ich nicht kennengelernt. Aber über Valentin Weber wird ohnehin sehr viel gesprochen«, meint sie.
»Aha, und was genau?«, will ich wissen. Nur aus reiner Neugier!
»Dass er sein Leben in vollen Zügen genießt. Du weißt schon: schicke Partys bis zum Morgengrauen mit hübschen Mädchen und natürlich jeder Menge Alkohol … so was halt. Und ich habe gehört, dass auch von Drogen die Rede sei.«
Stumm nicke ich, weil ich nichts anderes erwartet habe. Die dürfen doch alles.
»Aber sonst ist er, ein gutaussehender, heißer Typ, der jede Frau zum Schmelzen bringen kann! Da kann kein Mädchen widerstehen. Ich meine, wer würde nicht mit ihm ins Bett steigen? Ich hätte auch zu gerne eine Nacht mit ihm verbracht.« Sie kichert.
Nach ihrer Aussage zwinge ich mich zu lächeln. Sie wendet sich wieder dem Bildschirm zu, und ich rolle mit den Augen. Als ob er der einzige gutaussehende Typ auf dieser Welt wäre!
Ich blättere weiter und schaue mir die anderen Artikel über die bekannten Wohlhabenden und Sternchen Hamburgs, Niedersachsens und Deutschlands an. Nachdem ich mir Mandys Artikel durchgelesen habe, rücke ich mit meinem Stuhl ein wenig näher, um ihr über die Schulter zu schauen.
»Und worüber schreibst du jetzt?«
»Über das Nachtleben der jungen Reichen«, beginnt sie und erzählt mir, dass sie zeigen will, wie die wohlhabenden Kinder das Geld ihrer Eltern verprassen. »Deswegen wollte ich eigentlich heute oder morgen durch die Clubs ziehen und ein passendes Foto zu diesem Thema machen. Aber na ja, jetzt kann ich dieses Wochenende doch nicht. Also muss der Artikel bis übernächste Woche warten oder ohne Bild publiziert werden, weswegen er natürlich an Leserquote verliert. Viele reagieren beim Blättern als Erstes auf die Fotos, die einem ins Auge stechen. Die Texte ohne Bilder werden schneller ignoriert.«
»Ähm … ich habe einen guten Fotoapparat.« Ich blicke in ihr Gesicht mit den vielen Sommersprossen. »Ich könnte das für dich übernehmen und ein Foto machen«, schlage ich vor.
Sie presst ihre Lippen aufeinander und schüttelt leicht den Kopf. »Du bist die Praktikantin …«
»Na und?«, falle ich ihr ins Wort. »Ich mache es gern. Außerdem will ich sehen, was es heißt, auf die Suche zu gehen und ein passendes Bild für einen Artikel zu finden.« Ich schaue sie bittend an. »Warum kann es die Praktikantin nicht auch machen? Es muss doch auch niemand davon erfahren.«
»Ist das wirklich kein Problem für dich?«, fragt sie unsicher.
Die Arbeit zu machen nicht, aber mich unter die Reichen zu mischen eigentlich schon. Bevor ich es mir anders überlege und die Gelegenheit verpasse, mache ich meinen Mund auf. »Nein, es ist kein Problem. Ich fahre heute sowieso nach Hause, da hole ich meinen Fotoapparat und mache mich morgen auf den Weg in die Clubs.«
»Du kommst in solche Clubs nicht so leicht rein, deshalb brauchst du einen Presseausweis«, meint sie. Ich sehe sie enttäuscht an. »Aber zum Glück ist auf meinem Ausweis kein Foto von mir, daher gebe ich ihn dir«, beruhigt sie mich lächelnd und mir fällt ein Stein vom Herzen. »Also für morgen Abend bist du Mandy Witt.«
Ich nicke erfreut, während sie den Ausweis aus ihrer Tasche zückt und ihn mir reicht. Sie macht mich mit ihrem Artikel vertraut, damit ich auch weiß, auf was ich alles achten muss, und welches Foto sie dafür in etwa braucht.
Nach der Arbeit fahre ich in die WG und bereite mich auf die Abreise nach Hause, in meine Heimatstadt Lüneburg, vor. Ich freue mich riesig, meine Eltern wiederzusehen und wenigstens für einen Tag die Ruhe genießen zu können. Jetzt wurmt es mich doch etwas, dass ich Mandy zugesagt habe und deswegen früher nach Hamburg zurückfahren muss.
Beim Packen klingelt mein Handy. Ich lächle breit, als ich sehe, dass es mein Stiefbruder Clemens ist, und nehme ab. »Hi«, grüße ich.
»Na, machst du dich schon fertig?«, fragt er.
»Ja. Kommst du heute auch?«
»Nein. Ich bleibe dieses Wochenende hier.«
Ich atme laut aus. »Mama wird darüber nicht erfreut sein.«
»Sie kommt darüber hinweg. Ich muss mit den Jungs an unserem Projekt weiterarbeiten.«
»Hast du sie wenigstens angerufen?«, will ich wissen und schaue aus dem Fenster auf den dichten Verkehr in der Straße.
»Noch nicht. Aber kannst du ihr das nicht ausrichten?« Er klingt beinahe flehend.
»Damit du dir ihr Gejammer nicht anhören musst?«, meine ich kichernd und höre ihn leise lachen.
»So ungefähr … Bitte, von dir lässt sie sich besänftigen.«
Ich seufze. »Gut, ich sag es ihr. Aber ich bin trotzdem der Meinung, du solltest sie anrufen.« Er stöhnt leise. »Das habe ich gehört! Clemens, verdammt, sie vermisst dich doch auch!«
»Jaaa. Ich rufe sie morgen an«, bringt er etwas genervt hervor. »Manchmal denke ich, dass das alles nur reine Verarsche ist und du wirklich ihre Tochter bist!« Ich spüre, dass er grinst.
»Ich bin auch ihre Tochter«, entgegne ich lächelnd und mit Stolz.
»Okay, Elena, fahr vorsichtig. Wir sehen uns in einer Woche wieder.«
»Ja, mache ich. Bis dann.«
»Tschüü«, flötet er, bevor er auflegt.
Ich lege mein Handy auf den Tisch und schmunzle nachdenklich über seine Worte.
Nein, ich bin nicht ihre leibliche Tochter. Es war nie ein Thema, dass ich ein fremdes Kind in der Familie war und ich hatte nie das Gefühl, nicht dazuzugehören. Ich wurde gleich hundertprozentig als Familienmitglied akzeptiert und gehöre nun seit zehn Jahren zu ihnen. Sie sind für mich zu einer starken und zuverlässigen Stütze geworden. Ich fühle mich wie ihre leibliche Tochter. Mit ihnen teile ich alle Momente des Glücks. Das ist jetzt mein Zuhause. Dort riecht es nach Freude, dort werde ich mit Wärme und Liebe umsorgt und immer mit Wohlwollen begrüßt. Das hatte ich zuvor nie und schätze es deshalb umso mehr.
Mit neun Jahren adoptierten mich meine jetzigen Eltern aus Russland. Ich rede nicht gern über meine Kindheit, aber ich war sogar irgendwie auch froh darüber, dass das Ganze damals endlich ein Ende gefunden hatte. Vielleicht klingt es zu gleichgültig, was wohl daran liegt, dass ich zuvor nie die Wärme und Liebe, die ein Kind braucht, bekommen habe.
Meiner leiblichen Mutter war es wichtiger gewesen, zu saufen und, sich dann auch noch mit Drogen vollzupumpen.
Sie war ein Kind der Siebzigerjahre, denen die Perestroika in ihren Jugendjahren die Perspektivlosigkeit beschert hatte. Viele hatten sich in die Kriminalität begeben, waren im Drogenmilieu untergegangen und hatten dort Zuflucht vor der Armut gefunden. Meine Mutter war oft den ganzen Tag verschwunden, manchmal auch über Nacht, und kam dann völlig orientierungslos nach Hause. Ob sie nun betrunken oder zugedröhnt gewesen war, konnte ich damals nicht unterscheiden. Sie redete kaum mit mir und beachtete mich einfach nicht. Die einzige Aufmerksamkeit, die ich von ihr bekam, waren Geschimpfe und Geschrei, wenn sie mal wieder einen Kater hatte und nach Geld suchen musste, damit sie sich wieder volllaufen lassen konnte.
Und irgendwann tauchte sie plötzlich nicht mehr auf. Ich hatte Hunger und zu Hause gab es nichts zu essen. Wie sehr ich mich auch bemühte mein Knurren im Magen zu ignorieren, nach einigen Tagen war es nicht mehr auszuhalten. Ich sammelte die leeren Flaschen ein, die überall in der Wohnung verstreut waren, und brachte sie in den Laden nebenan. Ich wusste, dass das Pfand nicht ausreichen würde, um davon ein ganzes Brot kaufen zu können, aber auch, dass ich wenigstens ein Viertel bekommen konnte. So handhabte es meine Mutter manchmal, wenn sie mich »fütternmusste«, wie sie immer zu mir sagte.
Der Verkäuferin waren wir bekannt – eigentlich kannte jeder jeden in dem kleinen Örtchen. Ich wurde von ihr von Kopf bis Fuß gemustert. Sie bemerkte meinen ungepflegten Zustand und verstand somit auch versanden, dass meine Mutter wieder auf einem Trip war. Sie fragte mich nach ihr aus. Ich hatte Angst, es ihr zu sagen, fand es aber dennoch richtig, und erzählte die Wahrheit: dass ich meine Mutter bereits seit Tagen nicht mehr gesehen hatte. Die Verkäuferin seufzte daraufhin schwer, nahm meine Flaschen an und gab mir dafür ein ganzes Brot und eine Flasche Limonade mit.
Ich sah sie mit großen Augen an und zögerte, weil meine Mutter mich schon mal beschimpft und sogar dafür geschlagen hatte, als ich Essen von Nachbarn angenommen hatte, die mir nur helfen wollten. Ich sollte nicht zeigen, dass wir arm waren, und nicht um Essen betteln – so bläute sie es mir damals ein.
Als mein Magen vom frischen Brotgeruch ein lautes Knurren von sich gab und die Verkäuferin mich erneut bat, das Essen anzunehmen, tat ich es auch, während sie vor sich hinbrummte, dass meine Mutter nie mehr den richtigen Weg zurückfinden werde. Damals verstand ich die Ironie dieser Worte nicht und dachte mir dabei nur, dass meine Mutter sich vielleicht verlaufen hatte und den Weg nach Hause nicht mehr finden konnte. Oder wollte ich es so sehen und nicht glauben, dass sie mich im Stich gelassen hatte oder mich überhaupt nicht mehr haben wollte?
Heute weiß ich natürlich, dass meine Mutter sich eher in ihrem Leben verlaufen hat und aufgrund ihrer Sucht nicht mehr zurückfinden konnte.
Ich wartete damals viele Tage auf sie, bis eine Frau in einem streng geschnittenen Rockanzug mit der Polizei vorbeikam und mich dann mitnahm. So kam ich mit meinen sieben Jahren in ein Kinderheim.
Das war zwar auch kein Zuckerschlecken, aber zumindest hatte ich normale und saubere Bekleidung und warmes, vernünftiges Essen. Für mich war das schon der pure Luxus, den ich auch sehr schätzte.
Als ich nach zwei Jahren im Kinderheim meine jetzige Familie kennenlernen durfte, gewann ich sie sofort lieb und spürte auch, dass sie sehr nette und liebevolle Eltern werden würden Ich hätte mir zuvor niemals vorstellen können, jemals so glücklich zu sein wie in diesem Augenblick. Clemens wurde für mich zu einem richtigen Bruder. Er beschützt mich, wir verstehen uns wirklich sehr gut, und das auch gleich von Anfang an.
Ich höre, wie die Tür ins Schloss knallt. »Elena?«, ruft Roma.
»Ja«, erwidere ich laut.
»Hi!« Sie stürmt in mein Zimmer. »Willst du etwa sofort los?«, fragt sie überrascht, als sie meinen gepackten Rucksack sieht, und schaut mich verwirrt an. Ich nicke und will schon zu einer Antwort ansetzen, aber sie kommt mir zuvor: »Aber iss doch noch wenigstens mit mir zusammen.« Sie macht einen Schmollmund und sieht mich mit ihren großen Kulleraugen an.
Ich kichere über ihren bettelnden Blick. »Na gut. Was wollen wir essen?«, ergebe ich mich und gehe hinter ihr her, während sie schon tänzelnd in die Küche läuft.
»Wir haben Tiefkühlpizza«, schlägt sie vor.
Ich rümpfe die Nase. »Du und deine Pizza«, nörgle ich, weil wir das viel zu oft essen. In letzter Zeit reicht es mir, nur daran zu riechen, und ich bin davon bereits satt. »Wie wär’s mit Salat und Butterbroten?«, schlage ich vor und mache den Kühlschrank auf.
»Na guuut«, seufzt sie etwas missmutig.
Ich reiche ihr den Eisbergsalat, dann Gurken, Tomaten und Paprika. Wir beginnen mit der Zubereitung und währenddessen erzählt Roma mir von ihrem heutigen Arbeitstag und ich ihr anschließend von meinem.
»Echt jetzt?«, kreischt sie auf und wirft sich schwungvoll auf einen Stuhl am Tisch. Ich setze mich auch und beginne damit, mir ein Butterbrot zu schmieren. »Du kommst morgen schon wieder zurück, dann nimm mich bitte mit«, bettelt sie plötzlich.
»Roma, es ist doch nur rein beruflich.«
Sie zieht eine leidende Schnute. »Bitte!«
»Was willst du da?«
»Was wollen denn alle in solchen Clubs?«, fragt sie lächelnd.
»Keine Ahnung. Die Jungs wollen sich dort an den besoffenen Tussis aufgeilen, die Barbies ihre neuen Outfits vorzeigen«, witzle ich, obwohl es auch irgendwo die Wahrheit ist. »Und du?«
»Mann, manchmal kannst du echt spießig sein.«
»Du weißt ja: Ich kann in Clubs, Discos oder Bars gehen, aber nur, um meine Freunde zu treffen, und nicht, um die Sau rauszulassen und dann selbst zu einer zu werden!«
Roma lacht amüsiert auf. »Ich will nur eines: Endlich einen richtigen Mann treffen und mich so richtig verlieben«, meint sie verträumt.
»Oh mein Gott, Roma, das hört sich an, als wärst du bereits dreißig und nicht neunzehn!« Ich verdrehe lächelnd die Augen. »Willst du dir so einen geilen griechischen Gott angeln?« Ich grinse über diese Vorstellung und beiße in mein Brot.
Roma schnalzt mit der Zunge, lächelt aber, während sie an ihrem Salat pickt. »Wir sind Zigeuner«, korrigiert sie mich, und ich zucke mit den Schultern, weil ich keinen Unterschied sehe. »Aber nein, mir wäre es schnuppe, welche Nationalität er hat. Hauptsache, er ist lustig. Falls irgendein Mann das Kennenlernen mit meinem Vater übersteht …«, meint sie belustigt. Es tritt eine kurze Stille ein, die Roma dann auch gleich wieder unterbricht. »Also, dann gehen wir am Sonntag in einen Club, okay?«, lächelt sie mich erwartungsvoll an.
»Und am Montag kriege ich dich überhaupt nicht mehr aus dem Bett!«
Sie stöhnt laut und ich schmunzele. »Werden wir sehen«, lenke ich doch etwas ein.
»Übrigens, dir hätte es auch nicht geschadet«, sagt sie kauend.
»Was meinst du jetzt? In einen Club zu gehen?«
Sie lächelt. »Dir einen Mann zu angeln!«
»Jetzt redest du so, als wäre ich vierzig!«, meine ich und sie lacht auf. »Will ich auch … nur … ich will einen richtigen Mann finden, der aufrichtig ist, der mit dem Herzen liebt und der auch fremde Kinder lieben kann.«
Sie wird ernster. »Wegen Vince?«
Ich nicke. »Ja.«
»Du weißt aber, dass es schwer sein wird, einen Mann zu finden, der ein fremdes Kind akzeptiert. Überhaupt: Ist dir bewusst, dass das, was dich alles mit Vince erwarten kann, nicht einfach sein wird?«
Ich lehne mich gesättigt auf dem Stuhl zurück. »Ja, natürlich weiß ich das, es ist mir alles bewusst. Aber ohne es wenigstens versucht zu haben, werde ich nicht so einfach aufgeben!«
Sie schmunzelt über meine Sturheit. »Hast du keine Angst, dass dir jemand zuvorkommt?«
Ich wende meinen Blick von ihr ab und beiße mir auf die Lippe. Allein bei dem Gedanken tut mir das Herz weh.
»Davor habe ich sogar eine wahnsinnig große Angst«, gebe ich zu und hänge in meinen Gedanken nach. Ich schüttle die Stille ab und wende mich schließlich an Roma: »Na gut. Ich muss los.«
Ich helfe Roma noch beim Aufräumen und mache mich dann auf den Weg nach Lüneburg zu meinen Eltern.