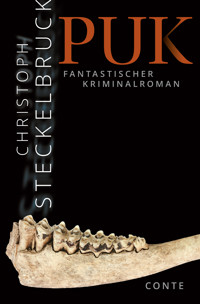
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Magrot und Koblenzka
- Sprache: Deutsch
» Magrot, sagt man, sei wie ein Geist. Er locke seltsame Dinge an. Und wirklich finden im wörtlichen Sinn solche Fälle zu Magrot, und so auch zu mir, die mit der Bezeichnung ›seltsam‹ nur schwach umschrieben sind. So ruft man ihn nur dann, wenn die Umstände sich entsprechend darstellen, lässt ihn aber sonst seine Runden drehen, weil die Polizei ein rationaler Verein ist, aber hin und wieder einen Schmuddelwinkel für das Unerklärliche braucht. « Was geht vor in Reifenbach? Wer geht um in Reifenbach? Zwei bizarre Leichenfunde, ein ewiger Sitzenbleiber, eine sorgenvolle Mutter und nicht zuletzt das merkwürdige Verhalten eines Backenzahns sind die Zutaten für einen der seltsamsten und unheimlichsten Fälle des Ermittlerduos Magrot und Koblenzka. Eine übelriechende, silbrige Substanz, der in Seide verpackte Zahn einer Kuh und der geheime Keller eines Richters führen die Beiden langsam auf die Spur des Täters. Und sie erkennen, das man manchmal rückwärts gehen muss, um voranzukommen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Cover
Christoph Steckelbruck - Puk
Motto
Magrot und ich
Hartmann
Die Lehrerin
Beim Zahnarzt
Atem
Der dicke Herr Möller
Silber
Der Unterirdische
In der Schule
Der blaue Mann
Stettdorfer versteht die Welt nicht mehr
Die Liebe der Euphrasia Kobolek
Zähne
Das unsichtbare Haus
Geburt
Die Mutter
Psycho
Die Hösslichkeit
Bergmanns zweite Nachricht
Schatten
Der ewige Sitzenbleiber
Die gläserne Haut
Frau Kobolek erstarrt
Rüdiger
Wer ist Puk?
Möllers Liebschaften
Der Richter Gnadenlos
Der Aufbruch
Der Flüsterer
Amok
Ursulinengasse 16
Stettdorfer räumt ab
Heimkehr
Bergmanns Aufbruch
Ende
Anmerkung
Autor
Impressum
Landmarks
Cover
Titelseite
Inhalt
Textbeginn
Öfter als wir denken überschreiten wir diese Grenze, ohne es zu bemerken. Ein kurzes Zögern, ein Schritt zurück, ein Innehalten, scheinbar ohne Ursache. War da etwas? Ganz am Rand des Sehfeldes, kaum für einen Augenblick zeigt sich die Fremdheit der Welt, tanzen Schatten und Geister. Meistens neigen wir dazu, den störenden Eindruck einfach zu verscheuchen, wie eine lästige Fliege. Der übliche Lärm der Welt hilft uns dabei, jene winzigen Abweichungen, die kleinen Risse in der Realität, zu übersehen. Erst wenn wir in die Stille kommen, wird das Gesumm der Störenfriede laut und lauter. Und dann klärt sich der Blick und man fragt sich: »Wie konnte ich das übersehen?«
Magrot und ich
Schon seit der Grundschule läuft mir Magrot immer wieder über den Weg. Nur seiner auffälligen Gestalt war es anfangs zu verdanken, dass seine Person mir überhaupt Aufmerksamkeit abverlangte. Schon als Sechsjähriger überragte Magrot seine Mitschüler um Haupteslänge. Selbst sein bedeutendstes Merkmal, der gewaltige Nasenerker, deutete sich schon zu einer Zeit an, als wir anderen noch stupsige Pünktchen im Gesicht trugen. Seit jeher schweigsam, grüblerisch, stumm und ruhend wie ein Findling in der Heide, fand er nicht in die Teilhabe des Schulhofgetümmels, welches sich wirr und ohne Sinn sammelte, sobald die Glocke zur Pause rief. Er stand dann dort inmitten der wirbelnden Kinderleiber wie die Kaaba zu Mekka im kreisenden Strom der Pilger. Nichts rührte ihn, oft blickte er in die Wolken oder in unsichtbare Fernen, sicher weit über die Horizonte seiner Mitschüler hinaus. Allen blieb er ein Rätsel und niemand machte sich daran, es zu lösen. Ja, selbst die übelsten Provokateure und Gewalttäter des Schulhofes schlugen einen weiten Bogen um den Sonderling. Auch ich, Matthias Koblenzka, der Autor dieser Zeilen, suchte nicht nach dem Kern dieser Erscheinung, obwohl sie mich faszinierte. Seine ausgeprägte Weltferne ängstigte mich, vielleicht weil ich damals schon spürte, dass die Weiten, in die er blickte, Dinge bargen, die besser im Verborgenen bleiben sollten. Doch fühlte ich mich ihm auf unerklärliche Weise verbunden und behielt ihn im Auge. Einmal, da warf er mir einen kurzen Blick zu, hinweg über die Köpfe des Gehudels. Da wurde mir klar, dass auch ich still stand im Fluss der lärmenden Körper. Kurz nickte er mir zu, dann wandte er sich ab und schaute wieder ins Unerklärliche. Dies blieb die einzige Kontaktaufnahme bis zu jener Geschichte, die uns für alle Zeiten miteinander verbinden sollte. Es lag ein Versprechen, vielleicht auch eine Drohung darin. Als wir nach dem initialen Erlebnis in Plums auseinandergingen, deutete sich nicht im Geringsten das Faktum einer lebenslangen Verbundenheit an. Im Gegenteil, wir gingen unserer Wege und glaubten, so der Heimsuchung der Erinnerung an das seltsame Geschehen entgehen zu können. Was für ein Trugschluss. Obwohl die Begegnung mit einer mythischen Geisterschar in dem ausgesprochen merkwürdigen Dorf Plums mir bis heute als ein verwaschener Traum erscheint, der nur wenig an meiner rationalen Denkweise kratzt, bleibt doch der Eindruck eines Moments absoluter Intimität, ja Identität, mit diesem Mann, dessen Vorname mir bis heute nicht bekannt ist. Wüsste ich es nicht besser, müsste ich zugeben, den Augenblick seiner Ermordung mit ihm nicht nur geteilt, sondern an seiner Stelle erlebt zu haben. Aber das müssen Traumgespinste gewesen sein, ausgelöst durch schwarzgebrannten Schnaps und der Gärung überhitzter Luft in stockdunkler Nacht. Zumal Magrot sich seitdem bei allerbester Gesundheit befindet.
Wir beide erhielten damals ein Geschenk. Ihm richteten die Ereignisse die verdrehten Füße, sodass er von seinem Watschelgang geheilt wurde. Ich fand Inspiration, überwand eine ewige Schreibblockade und nenne mich nun mit Fug und Recht einen Schriftsteller. Zu der freundlichen Gabe der Geisterschar, die von den Plumsern »Die guten Leute« genannt wurde, gehörte auch ein ambitionierter Verleger, der trotz geringer Umsätze, meine bislang vier Romane zur Welt brachte. Durchgreifender Erfolg war meinem Werk bisher nicht beschieden, obwohl die Kritik einhellig Begeisterung zeigte. Doch immerhin ermöglichte mir das damit einhergehende Prestige, meinem Chef ein höheres Gehalt abzuzwingen. Es liegt ihm etwas daran, einen echten Autoren zu beschäftigen, beziehungsweise, sich einen solchen zu halten. Seine eigenen Ambitionen in dieser Richtung mündeten bislang in eine Jugenderzählung, die laut Untertitel das interessante Leben des Autors beschreibt und Pornographie reinsten Wassers ist. Die eigenfinanzierte, sehr optimistische Erstauflage von 5000 Exemplaren lagert seither im Keller unter der Redaktion und findet im Wortsinn reißenden Absatz als Nistmaterial für die zahlreichen Mäuse. Ansonsten erfährt das Interesse der Leser selbst durch großformatige Werbeanzeigen in unserer Zeitung, gedruckt neben in verweslich blassen Farben beworbenen Fleischereiprodukten, keine Hebung. Da meine Bücher nach wie vor keine erwähnenswerten Beträge einfahren, bleibe ich an die »Allgemeinen Reifenbacher Nachrichten« gebunden. Der fette Sadist, Bernd Klotzmann, genannt der große Klotzky, weiß das und genießt es. Einmal ließ er mich eine Rezension seines Machwerks verfassen, was mich zwang, neben ihm der einzige Leser seines Buches zu werden. Ich kann mich nicht erinnern, jemals zuvor solcher Verzweiflung anheimgefallen zu sein.
»Denk an deinen Gönner, wenn du mal berühmt wirst, Koblenzka!«, sagt er mindestens zweimal am Tag, insinuierend, dass dies niemals der Fall sein werde. Nun, immerhin zwackt diese Art der Arbeit nur geringe Mengen von meiner kreativen Energie ab und es bleibt mehr als genug fürs Schreiben. Irgendwann wird schon ein Bestseller dabei sein.
Magrot, was gibt es da zu erzählen? Er ist Polizist. Schon immer und drei Tage. Mehr braucht es nicht, ihn zu beschreiben. Polizist, Bulle, Kommissar. Ein Polizist an sich. Schweigsam, mürrisch und in sich gekehrt wie seit Grundschulzeiten. Eine kosmische Konstante, ein Anker für die wirbelnde Welt. Vielleicht braucht die filigrane Realität solche Klötze, sich festzuhalten, damit sie nicht von ihrer eigenen Unglaublichkeit verblasen wird.
Wie kam es nun, dass Magrot und ich wieder zueinanderfanden und seither ein fast symbiotisches Verhältnis pflegen? Die Antwort scheint mir in der Vermutung zu liegen, dass weder unser erstes Zusammentreffen auf dem Schulhof, noch das seltsame Abenteuer in Plums, wo alle Bewohner den gleichen Nachnamen trugen, vom Zufall bestimmt waren, sondern einer zwingenden Notwendigkeit folgten. Unser Zusammentreffen konnte folgerichtiger nicht sein. Vielleicht wird sich mir der Sinn dahinter eines Tages erschließen. Es muss einen Sinn geben, da bin ich mir sicher.
Die meiste Zeit verbringen wir in unseren eigenen Sphären. Magrot schlurft sinnend durch Reifenbach und Umgebung. Obwohl seine Füße wundersame Reparatur erfuhren, kultiviert er nach wie vor den archetypischen Plattfußgang. Die Hände auf dem Rücken durchmisst er in langem Mantel die reizarmen Straßen unserer Heimatstadt, die, vor kurzem noch nicht mehr als ein Dorf, hefig aufquellend die Größe einer mittleren Kleinstadt angenommen hat. Das ist seine Hauptaufgabe, dafür wird er bezahlt. Obwohl seine Dienstzeit noch kaum die Nähe der Pension wittert, befindet er sich doch in einer Art Ruhestand. Als Beamter nicht kündbar, zieht er seine Bahnen auf einem Abstellgleis. Mit seiner Kompetenz hat das nichts zu tun. Aus schwer erfindlichen Gründen umwabert ihn der Nimbus des Unheimlichen. Magrot, sagt man, sei wie ein Geist. Er locke seltsame Dinge an. Und wirklich finden im wörtlichen Sinn solche Fälle zu Magrot, und so auch zu mir, die mit der Bezeichnung »seltsam« nur schwach umschrieben sind. So ruft man ihn nur dann, wenn die Umstände sich entsprechend darstellen, lässt ihn aber sonst seine Runden drehen, weil die Polizei ein rationaler Verein ist, aber hin und wieder einen Schmuddelwinkel für das Unerklärliche braucht.
Hartmann
Das Unterfangen des Erwachsenwerdens erfordert manchmal einen Lehrmeister in dieser Kunst. Diesen fand Hermann Poschwili in seinem Klassenkameraden Hartmann Nisse. Der schon zwei Jahre ältere Sitzenbleiber war der bewunderte und gefürchtete Heros der Klasse, den Schülern ein Vorbild, den Lehrern ein Dorn im Auge. Einigen wenigen nur gelang es, sich in seinem Wohlwollen zu sonnen, Poschwili gehörte nicht in diesen Kreis. Zunächst musste er sich zu den Opferlämmern zählen. So dicklich und puttenhaft wie ein Barockengel kam er daher, nicht allein Hartmann, sondern auch allen anderen willkommener Spielball. In der Hackordnung des Schulhofs stand Hermann Poschwili an letzter Stelle. Gern wurde er hergenommen, wenn Hartmann seine Laune hatte. Da wurde man plötzlich von hinten gepackt und in den Genickbrechergriff genommen. In diesem Fall erwies es sich als unklug, Gegenwehr zu leisten. Der ältere Junge verfügte über Bärenkräfte, die selbst den höheren Stufen, ja, sogar dem Lehrkörper des Ludwig-Prömmel-Gymnasiums Respekt abforderten. Und neben dieser Kraft beherrschte ihn ein furchteinflößendes Maß von Wahnsinn, das unverkennbar in solchen Momenten durch seine Augen flickerte. Es hieß, er sei nicht mehr bei sich, mithin sogar gefährlich, seit sein Bruder den Tod fand.
Dennoch brachte ihm die gesamte Schülerschaft der unteren Klassen, die zum überwiegenden Teil der Opferseite angehörte, eine kaum erklärliche, fast religiöse Verehrung entgegen. Er war der rasende Gott des Alten Testamentes, der wilde, ungerechte Wüstendämon Hiobs. Alles Volk drängte, den eifernden Jehova mit den brennenden Augen und der flammend roten Haarmähne anzubeten. So auch Poschwili, der ihm, wie alle, mit hündischer Hartnäckigkeit hinterherlief. Der Große ließ ihn heran, nannte ihn »Fettbeule«, aber mit einem Lächeln. Sagte gar »Freund« und schmeckte aus, wie der Jüngere sich darin suhlte. Wenn Poschwili dann fest im Glauben an das Wohlwollen seines Gottes stand, nahm dieser ihn in den Schraubstock, warf sich auf ihn, bis er bald erstickte, spuckte ihm ins Gesicht und verpasste ihm ein paar Ohrfeigen, die sich gewaschen hatten.
Wenn Poschwili beschmutzt und blutig nach Hause kam, nahm der Vater ihn ins Gebet. Von ihm bekam er ebenfalls Saures, weil er sich nicht wehrte. Ein Mann, ein »richtiger« Mann, fürchte sich nicht. Dabei hätte Hartmann Nisse den kleinen Mann ohne besonderen Kraftaufwand gegen die Wand werfen können. Diese Vorstellung stellte sich bildhaft ein, während der Vater mahnte und predigte und schlug. Ach, wie weich diese Schläge heranflogen, wie lachhaft, wie läppisch. Für diesen schwachen Mann erübrigte er nichts als Verachtung. Der schlug ihn, weil er selbst als Prügelknabe durchs Leben gehen musste, bevormundet von Frau und Schwiegermutter, in deren Haus sie lebten. Groß tat er, machte Pläne und fand doch nicht ins Leben. Seit Jahren, fern jeden Erfolges, meistens auch ohne Arbeit, gab er den Philosophen, las und zitierte ohne Verstand, aber mit Pathos, Nietzsche und Schopenhauer, hob die Welt aus den Angeln und gab sich der Lächerlichkeit preis.
Hermann Poschwili sah in eigener Schwäche und Scheu eine üble Kongruenz zum Wesen seines Vaters. Darum begehrte er den Hartmann als Freund, fand Lust in der Vorstellung, sich ihm ganz zu unterwerfen. Denn dessen Gewalttätigkeit entstammte einer wahrhaftigeren Quelle.
Eines Tages, als sie über die frisch abgemähten Stoppelfelder rannten, Hartmann, Krapper, Mundtschön und Poschwili ein ganzes Stück dahinter, da fühlte er Glückseligkeit. Auch, als Hartmann ihn griff und niederwarf, ihn mit seinem schweißigen Leib unter dem Gejohle seiner beiden Paladine fast zermalmte, als ein spitzer Stein sich schmerzhaft in seinen Rücken bohrte, da geschah es. Er blickte Poschwili in die Augen, das erste Mal wohl, und erkannte etwas, dass ihn stocken ließ.
»Du heulst ja gar nicht! Du heulst ja eigentlich nie!«, sagte er, aber es klang vorgeschoben. Der wahre Grund seines Wunderns zeigte sich darin nicht. Da stand plötzlich eine Idee im Raum, die, noch im Nebel, aber machtvoll, ihrer unausweichlichen Verwirklichung entgegenstrebte.
Sein stinkend warmer, männlicher Atem füllte ihm Nase und Mund. Poschwili nahm ihn in sich auf wie die heilige Kommunion. Hartmann ließ von ihm ab, was Poschwili fast bedauerte, reichte ihm die Hand und half dem Kleineren auf die Beine.
»Mensch, Kerl!«, sagte er. »Du hast Mumm.« Auch jetzt bemerkte er, dass Hartmann etwas anderes meinte.
Den anderen aber befahl Hartmann: »Haut ab, ihr Pisser!«
Warum Hartmann ihn auswählte, blieb Poschwili verborgen. Für ihn bedeutete es Glückseligkeit. Selten ist Freundschaft nur von Zuneigung geprägt. In diesem Fall musste sie ganz ohne diese Zutat auskommen. Die Zweckmäßigkeit dieser Verbindung, eine verborgene Absicht des Größeren, mündete am Ende für Poschwili in einen besonderen Weg.
In der Erinnerung erscheint diese Zeit als Dauerlauf. Das Bild über sommerlich gleißenden Asphalt rennender, über gelben Lehm und durch grüne Wälder jagender Jungen, ist ikonisch für das Glück der Kindheit. Atemlos, immer auf der Suche nach Abenteuern, Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Für Poschwili öffnete sich die Welt. Alles, was er mitbrachte, entwertete sich angesichts der neuen Schätze, die Hartmann ihm zeigte. Dem nun fast Zwölfjährigen bedeutete die hitzig körperliche Präsenz des zwei Jahre älteren Jungen, der zwar schlau im volkstümlichen Sinn, also gewitzt, aber keineswegs klug und gebildet war, Aussicht und Ziel seines noch in kindlicher Form verharrenden Entwicklungsstandes. Hartmann Nisse besaß die Aura der Männlichkeit, eine nach Leder und Pferdehof duftende Ausstrahlung, die so von der Verheißung echten Lebens prangte, dass sie dem Jüngeren zu einer Droge wurde. Nach wie vor lief er dem Großen hinterher, liebedienerte und scharwenzelte. Ein williger Sklave war er, ein gehorsamer Hund. Allein dadurch aber zeigte er sich allen anderen überlegen. Neuerdings fürchtete man ihn fast ebenso wie Hartmann selbst. So lernte er, dass der Mangel an eigener Kraft oder Befähigung durch Unterwerfung unter einen Stärkeren ausgeglichen werden konnte.
Die Lehrerin
Am Morgen klingelte das Telefon auf eine besondere Art und Weise, nachdem es, wie mir schien, seit etwa zwei Tagen eine geduckte, verschlagen lauernde Haltung eingenommen hatte. Natürlich war mir klar, dass kein Telefon ein solches Verhalten an den Tag legt. Diese Wahrnehmung ergab sich vielleicht aus der Ahnung, die mich schon eine Weile umtrieb. Es war etwas unterwegs zu mir, bedrohlich und doch willkommen, wie jedes Mal. Gefühlsmäßig so etwas wie die Wiederkunft des Herrn am Ende aller Tage, einerseits erhofft und willkommen, andererseits gefürchtet und lieber auf die lange Bank geschoben. Die merkwürdigen Träume der vergangenen Nacht und ein schwaches, aber schon hämisches Pochen im Backenzahn rechts unten vermeldeten, dass etwas heraufzog.
»Magrot hier«, sagte eine dunkle Stimme vom anderen Ende der Leitung. »Ja«, antwortete ich, »dachte ich mir schon.«
Damit war alles gesagt. Ich nahm es, wie es kam, als naturgegeben und unabwendbar. Schon Minuten später fuhren wir in seinem uralten Land Rover über die kurvige Straße hinaus an den Stadtrand Reifenbachs. Schweigend saßen wir nebeneinander, wie ewige Kollegen, die sich zwar nichts mehr zu sagen wissen, aber dies als normale Kommunikation begreifen.
»Wie geht’s, Magrot?«, versuchte ich. Seine Antwort erschöpfte sich in der Aussage: »Es geht, Koblenzka.«
»Wir haben eine Leiche«, fügte er hinzu. »Eine besondere.«
Bald standen wir inmitten einer Horde in weißes Papier gekleideter Gespenster. »Latscht mir nicht durch die Spuren, Magrot!«, maulte einer der Papiermenschen, dessen graumelierter Vollbart beim Sprechen raschelnd an der Kapuze schabte. Stettdorfer mit seinem diskreten Charme.
»Was ist da?«, fragte Magrot, ohne auf den Bärtigen einzugehen. Er wies auf eine Stelle auf dem abgenutzten Fischgrätenparkett, wo sich offensichtlich rein gar nichts befand.
»Na, nichts«, knisterte der Bart, »wie man sieht!« Seine Körperhaltung drückte deutlich mehr Unwillen aus, als er ohnehin schon vorsorglich mitgebracht hatte.
»Genau«, bestätigte Magrot, »ganz und gar nichts! Wie lange liegt die Dame schon hier? Und was stimmt mit ihr nicht?«
Stettdorfer erhob sich schwerfällig und trieb seinen massigen Körper in die lichte Höhe von etwas mehr als zwei Metern, was gerade ausreichte, um dem Störenfried in die Augen zu schauen. Magrot überragte ihn noch um ein winziges Stück.
»Nun, sie ist tot. Mehr kann nicht schieflaufen«, bemerkte er.
Magrot senkte das schwere Haupt, massierte die Nasenwurzel zwischen Daumen und Zeigefinger und grollte: »Natürlich ist sie das, Stettdorfer! Sonst wären wir ja nicht hier.«
»Was meinst du, Koblenzka?«, warf er in den Raum, ohne mir weitere Anzeichen der Aufmerksamkeit zu gönnen. Ich wusste ja, dass er mit sich selbst sprach, immer und mit jedermann. Mit mir im Besonderen. Daher enthielt ich mich einer Antwort und nickte nur zustimmend. Da lag eine dürre Frau mittleren Alters und starrte an die Decke. Ihr flammend rot gefärbtes Haar ringelte sich in leichten Locken wie eine Aureole um einen etwas zu klein geratenen Kopf. Den angehängten Körper verband ein dünner, zerbrechlicher Hals, der zwischen knochigen Schlüsselbeinen entsprang. Ansonsten ohne Schmuck und Schminke boten lediglich die dunkelrot übermalten Lippen einen starken Kontrast zur schon gelblich verfärbten Haut. Sie wirkte puppenhaft, unecht, vielleicht, weil ihre Augen schon eine Weile jeglicher Feuchtigkeit entbehrten und wie Pingpongbälle wirkten. Ich folgte ihrem leeren Blick. Wenn es dort oben eine Ursache für ihren offensichtlichen Schrecken gegeben hatte, war sie längst verschwunden. Ihr weit geöffneter Mund hielt einen stummen Schrei fest. Spitz suchte eine trockene, blau verfärbte Zunge einen Ausweg aus dem Dilemma. Während ihr linker Arm sich eng an den Körper legte und zusammen mit den gestreckten Beinen eine Habachtstellung einnahmen, zeigte der rechte Arm im Verhältnis zum Körper nach oben und mündete in einem wie arthritisch verkrümmten, pädagogischen Zeigefinger.
Inzwischen beugte sich Magrot tief über die zuvor angesprochene Stelle auf dem Parkett. Er trat einige Schritte zurück, veränderte die Höhe seines Kopfes und damit den Winkel zu dem lange nicht geputzten Boden. Ohne den Blick abzuwenden, winkte er mich heran.
»Was siehst du, Koblenzka?«, fragte er. Um nicht gleich seiner Erwartungshaltung zu entsprechen, sagte ich nicht »Nichts«, obwohl genau das meinem Eindruck entsprach, sondern beugte mich in gleicher Weise wie Magrot zuvor in wechselnde Winkel zu jener Stelle, die sich augenscheinlich in keinem Aspekt von dem Rest der Bodenfläche unterschied. Bald spürte ich meinen Rücken. Magrot nahm meine Bemühungen mit stoischer Ruhe zur Kenntnis. Ich wusste, er wusste, dass ich, seine Methode lediglich nachäffend, den Sinn dahinter nicht erkannte. Bis schließlich die Sonne kurz hinter den Schauerwolken hervortrat, die schon den ganzen Vormittag als leere Drohung über den Himmel zogen. Die großen Fenster warfen lichte Rauten auf das Parkett. Dahinter, vielmehr darunter aber zeigte sich eine umgedrehte Spiegelung des Fensters im Parkett.
»Und?«, forderte Magrot.
Durch das Auf- und Abwippen meines Kopfes wanderte das Bild, vor allem an der Stelle, wo die Sonne grell hinter gleißenden Wolkenrändern stand, über den Boden und offenbarte das Geheimnis, das Magrot natürlich sofort ins Auge gefallen war. Eine annähernd kreisrunde Stelle reflektierte das Bild klarer als die Umgebung. Zwar lag dort auch eine feine Staubschicht, die den Effekt minderte, aber außerhalb dieses Bereiches verlor die Erscheinung noch mehr an Klarheit.
»Da ist geputzt worden«, rief ich, ganz erfüllt von der wilden Genugtuung, dieses Rätsel gelöst zu haben.
»Da, Stettdorfer«, sagte Magrot, »findest du mit Glück Täter-DNA. Mit noch mehr Glück findest du den Lappen, den der Täter benutzt hat, um seine Spur zu verwischen.«
Wendelin Stettdorfer hob genervt den Kopf. »Bislang gibt es noch keinen Hinweis auf ein Verbrechen, Magrot. Wie du vielleicht bemerkt haben wirst, mussten wir die Tür gewaltsam öffnen. Es war abgeschlossen und der Schlüssel steckte von innen. Auch alle Fenster sind von innen verriegelt.«
»Aha«, machte Magrot auf genau die Art, die dem Gegenüber verdeutlichte, dass er nicht ein Wort ernstnahm. »Gut«, sagte er, »der Umstand, dass es sich um ein nicht verifiziertes Verbrechen handelt, erklärt aber nicht, warum wir überhaupt hier sind, bevor nicht ein unverkennbarer Geruch eine Ahnung von dem durchs Treppenhaus trägt, was Gevatter Tod hier angerichtet hat. Wie also sind wir auf das hier aufmerksam geworden?«
Aus dem Nebenraum drängte sich eine helle Stimme in den Monolog Magrots. Der verdrehte in gespielter, schicksalsergebener Verzweiflung die Augen gen Himmel wie der Petrus von El Greco. Die Ahnung eines Lächelns spielte um seinen Mund. Eine zwar nicht kleine, aber gegen Magrot fast winzige, Person trat herein, baute sich vor ihm auf und blickte von unten herauf auf ihn herab, wie nur sie das konnte. Oberwachtmeisterin Pia Dinkelmann, spitznasig hübsch zwischen den akkurat gestutzten Seitenschwellern eines frechen Bobs. Ihre giftgrünen Augen, immer weit geöffnet, strahlten offensiven Argwohn und die spöttische Gewissheit eigener Kompetenz in die Welt. Und das zu Recht, obwohl manchmal der Eindruck der Aufgesetztheit durch die perfekte Hülle hindurchschien. Ihre schlanke, vollkommen fettfreie Gestalt zeugte von immerwährender, Energie zehrender Aktivität. Sie war der genaue Gegenentwurf zu Magrots felsengleicher Behäbigkeit, die allerdings auch nicht in Fettleibigkeit mündete, sondern sich in einer ruhenden Kraft manifestierte, die der eines Wasserbüffels glich. Seine nach außen gespiegelte, tapsige Unrasiertheit, die düster von tiefen Gewölben überschatteten Augen, der gewaltige Nasenerker und das schwarze, zerzauste Haar verliehen ihm die Anmutung eines italienischen Mafiakillers, wie er den Stereotypen Hollywoods entsprach. Seine zwar nicht kleinen, aber feinen, schmalen Hände widersprachen dem Eindruck der Klobigkeit und standen als pars pro toto für das eigentlich filigrane Wesen dieses undurchschaubaren Mannes.
»Es hat tatsächlich gestunken, Magrot. Nach Stuhlgang, alten Socken und einem Hauch vergammelter Rosen, wie die Nachbarin von gegenüber, Frau Glocke, ausgesagt hat. Besser kann man Verwesungsgeruch kaum beschreiben. Hallo Koblenzka, wie geht’s? Was macht die Schreiberei?«
»Äh, gut. Ich…«, hob ich an.
»Der Mief hat sich inzwischen verflüchtigt«, fuhr sie fort. »Aber tatsächlich haben wir eine Leiche, etwa zwei Tage alt.«
»Äh, der Geruch«, meldete ich mich zu Wort. »Vielleicht Gasbildung in der Leiche? Ist doch möglich, oder?«
»Ein Totenfurz, Koblenzka? Keine dumme Idee. Allerdings, wenn die einmal anfangen, hören die nicht mehr auf. Bislang hält sich die Dame vornehm zurück.«
»Hier ist ein Lappen, der nach Stuhlgang, alten Socken und vergammelten Rosen stinkt, wenn ich mich nicht irre!«, quoll ein kehliges Organ über die Schwelle der Wohnungstür. Ein dicklicher Mensch, halb Mann, halb Molluske, uniformiert, stand plötzlich im Raum und präsentierte eine Tischdecke, wie die heilige Veronika das Schweißtuch des Schmerzensmannes. In der Mitte des quadratischen Damastlappens prangte ein dunkelgrauer, seltsam ölig schimmernder Fleck, der tatsächlich einem Gesicht ähnelte. Der penetrante Geruch breitete sich sofort im ganzen Zimmer aus. »War im Mülleimer unten im Hof«, erklärte der Finder. Deutlich lagerte sich ein leichter Brechreiz in seine Modulation ein.
»Pack’s in einen Beutel und dann ab ins Labor! Das stinkt ja wie die Hölle!«, brüllte Wendelin Stettdorfer seinen Untergebenen an. Dieser Mann hatte in seinem Leben schon einiges riechen müssen, aber das, wie er hinzufügte, »kann nicht von dieser Welt sein«. Dinkelmann und Magrot zeigten sich wenig beeindruckt.
»Wer ist denn nun die Tote?«, fragte Magrot.
»Ihr Name allein ist schon ein seltenes Stück«, antwortete Pia Dinkelmann. »Euphrasia Kobolek, Gymnasiallehrerin, alleinstehend und außerhalb der Schule ohne jeden Kontakt. Keine Auffälligkeiten, nichts Ungewöhnliches. Ein stilles, abgesondertes Leben ohne bemerkenswerte Ereignisse.«
Magrot ging zur Wohnungstür, zog den Schlüssel ab, winkte einen jungen Beamten heran. Er erklärte ihm kurz etwas. Der Uniformierte nickte eifrig und lief die Treppe hinab. Magrot kehrte zurück. Stettdorfer fand sich ebenfalls ein und warf giftige Seitenblicke in alle Richtungen. Wie immer sandte Magrot keinerlei Signale über seinen inneren Zustand. Dennoch meinte Stettdorfer, eine gewisse Genugtuung, ein spöttisches »Siehst du, ich hatte recht« in Magrots gesamte Erscheinung hineininterpretieren zu müssen. In seinem Gesicht las ich ganz deutlich und ohne die Notwendigkeit einer Deutung »Du blödes Arschloch«.
»War es nötig, die Tür aufzubrechen?«, fragte Magrot ganz ohne die Absicht eines Vorwurfs, den Stettdorfer dennoch sehr deutlich heraushörte.
»Ja, war es! Ich hab meine Zeit auch nicht gestohlen«, blaffte er. Ein wenig Spucke verfing sich in seinem Bart. Inzwischen hing die Papierkapuze zwischen seinen Schultern. Eine sich weit über den Schädel ziehende Stirn bezeugte durch ihre rote Farbe einen gefährlich erhöhten Blutdruck. Dieser Mensch war ein Schnellkochtopf mit schadhaftem Ventil, ein Choleriker, wie er im Buche steht. Die ihm zwar nicht direkt untergebenen Papiermännchen gingen sichtlich geduckt, wie in Erwartung eines Unwetters. Der eigentliche Chef der Spurensicherung hatte sich auf unbestimmte Zeit krankgemeldet, was gerüchteweise auch mit Stettdorfers spezifischer Art der Kommunikation zusammenhing. Der Rest der Truppe unterwarf sich ohne Kampf dem dicken Alphatier. Der übernahm gerne das Zepter.





























