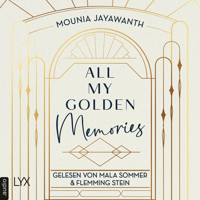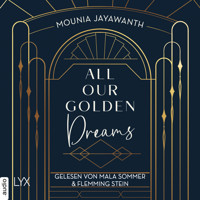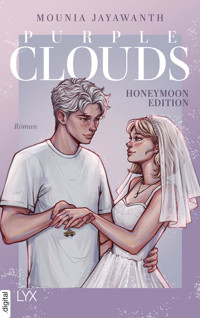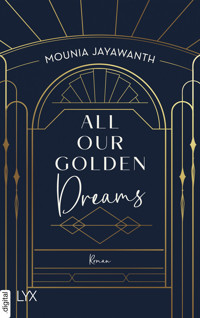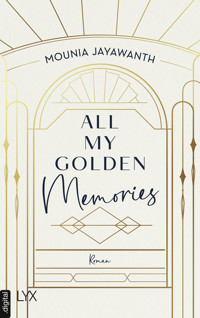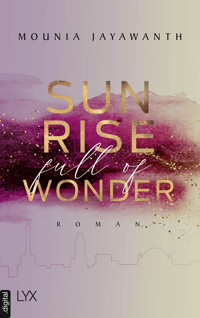11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
WENN DAS EIN TRAUM IST, DANN WILL ICH NIE MEHR AUFWACHEN
Riley Wang arbeitet erst kurze Zeit beim Purple Clouds Magazine, als sie dort über den Schauspieler Louis Thorne stolpert, der einem Interview entgehen will. Der Hollywood-Schwarm macht eine schwere Zeit durch und hat keine Lust auf die Kampagne, die sein Management geplant hat. Da Riley Mitleid mit ihm hat, hilft sie ihm, das Gebäude ungesehen zu verlassen - und versteckt ihn sogar in ihrer WG, als er nicht weiß, wohin. In der Abgeschiedenheit von Rileys Zimmer merken die beiden, dass sie trotz ihrer verschiedenen Lebensrealitäten einiges gemeinsam haben, und während heimlicher Ausflüge ins nächtliche New York schlagen ihre Herzen schneller, als sie jemals erwartet hätten. Doch was wird passieren, wenn Louis in seine Welt zurückkehren muss?
»Ein tiefgründiger Roman über die Zerbrechlichkeit von Menschen, die sich nach Halt sehnen und ihn genau dort verlieren, wo sie die Liebe finden. MEET CUTE ist unglaublich vielschichtig, klug erzählt und emotional mitreißend.« @AUTHORS_ROAD
Zweiter Band der PURPLE-CLOUDS-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Auszug aus: Vom Rampenlicht zur Selbstreflexion – Louis Thorne über das Trauern und Heilen
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
15 intime Fragen, um eure Beziehung zu stärken
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
Woran erkennst du, dass du eine Sucht entwickelt hast?
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Schmetterlinge im Bauch oder Anxiety?
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
6 Monate später
Danksagung
Auswertung: Woran erkennst du, dass du eine Sucht entwickelt hast?
Auswertung: Schmetterlinge im Bauch oder Anxiety?
Die Autorin
Die Bücher von Mounia Jayawanth bei LYX
Contenthinweis
Impressum
Mounia Jayawanth
Purple Clouds
MEET CUTE
Roman
ZU DIESEM BUCH
Riley Wang hatte schon mehr Jobs, als sie zählen kann – und hat es nirgendwo lange ausgehalten. Aber beim Purple Clouds Magazine fühlt sie sich, als hätte sie endlich einen Ort gefunden, an dem sie ankommen und ihr Leben ordnen kann. Doch als sie dort den Filmstar Louis Thorne trifft, der sich vor einem Interview versteckt, wird ihre Welt erneut auf den Kopf gestellt. Der Hollywood-Schwarm befindet sich gerade in einer Krise und hat keine Lust auf die Kampagne, die sein Management geplant hat. Riley erkennt seine Überforderung und den Wunsch, sich vor der Welt zu verbergen. Darum hilft sie ihm, das Gebäude ungesehen zu verlassen, ohne darüber nachzudenken, dass sie damit das Magazin um ein wichtiges Interview bringt – und damit ihren Job riskiert. Kurzerhand gewährt sie Louis Unterschlupf in ihrer WG, als er nicht weiß, wohin. In der Abgeschiedenheit von Rileys Zimmer merken die beiden, dass sie trotz ihrer verschiedenen Leben einiges gemeinsam haben, und während heimlicher Ausflüge ins nächtliche New York schlagen ihre Herzen schneller, als sie jemals erwartet hätten. Doch ein Hollywoodstar kann nicht ewig unerkannt bleiben – und was wird passieren, wenn die Realität sie einholt?
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier einen Contenthinweis.
Achtung: Dieser enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass alle Namen von und Verweise auf existierende Personen in einem fiktiven Zusammenhang verwendet werden. Die Schauspieler:innen, die mit Louis Thorne zusammenarbeiten und die Projekte, in denen er mitwirkt, sind ebenfalls rein fiktional.
Die im Buch vorkommenden Persönlichkeitstests und deren Auswertungen wurden von der Autorin selbst erstellt. Sie erheben keinen Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit und können keine psychologische Diagnose ersetzen. Solltet ihr euch von den Themen betroffen fühlen, dann wendet euch an entsprechende Anlaufstellen.
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Mounia und euer LYX-Verlag
Für alle, die schon mal gehört haben, dass sie ihr Leben endlich mal in den Griff kriegen müssen, aber selbst nicht wussten, wo sie anfangen sollten.
Ich sehe euch.
PLAYLIST
Stranger – Thomas Day
July – Noah Cyrus
Like The 90s – Here At Last
If This Was A Movie (Taylors Version) – Taylor Swift
Drunk Texts – Kode
Caffeine – Max Drazen
Phases – PRETTYMUCH
Vertigo – Griff
BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish
Mess It Up – Gracie Abrams
You’re Losing Me – Taylor Swift
i wish you cheated (acoustic) – Alexander Stewart
we can’t be friends – Ariana Grande
Heartbreak & Alcohol – BRELAND
DELIRIUM – Elley Duhé
How To Be Alone – Rachel Grae
I Quit Drinking – Kelsea Ballerini, LANY
I’m Different Now – Rosie Darling
For What It’s Worth – BRELAND
us. (feat. Taylor Swift) – Gracie Abrams
Meet Cute – Matilda Mann
AUSZUG AUS: VOM RAMPENLICHT ZUR SELBSTREFLEXION – LOUIS THORNE ÜBER DAS TRAUERN UND HEILEN
»Die Wahrheit ist, dass ich erst den Tiefpunkt erreichen musste, um zu erkennen, dass ich ein Problem hatte. Davor sah ich es einfach nicht. Aber wenn man den einen Menschen verliert, den man am meisten auf der Welt liebt, und von dem man dachte, dass man nicht mehr ohne ihn leben kann, hat man die Wahl, daran zu zerbrechen … oder endlich etwas zu ändern.«
1. KAPITEL
Louis
»Wenn dir jemand sein wahres Gesicht zeigt, dann glaub ihm.«
Der Lieblingsspruch meiner Mutter. Sie hat mich schon als Kind damit genervt. »Du bist zu naiv«, hat sie immer gesagt, und dabei das »zu« besonders in die Länge gezogen. »Zu gutgläubig. Die meisten Menschen machen uns nichts vor. Wenn dir jemand sein wahres Gesicht zeigt, dann glaub ihm.«
Das Problem ist, dass ich das »wahre Gesicht« oft missverstehe, als wäre es ein abstraktes Bild, dem ich eine andere Bedeutung beimesse, weil mein Fokus ein anderer ist. Ich sehe ein lächelndes Gesicht und nehme nur die netten Grübchen wahr, übersehe die Abgründe in den Augen, konzentriere mich auf die hellen Farben und nicht die dunklen.
Rückblickend ist es eigentlich total offensichtlich. Pete macht keinen Hehl aus seiner Art, steht dazu, dass er ein erbarmungsloses Arschloch ist. Ich habe das »wahre Gesicht« meines Agenten schon oft gesehen, war dabei, wie er seine Klienten fertiggemacht hat, auf ihre mentale Gesundheit gepfiffen und gedroht hat, Verträge aufzulösen. Pete geht es immer nur um den Erfolg. Er wringt seine Mitmenschen aus, bis sie nicht mehr länger profitabel sind. Dann lässt er sie fallen. Ich weiß das, und hätte trotzdem nie gedacht, dass er das jemals mit mir machen würde.
Weil ich mir eingebildet hatte, etwas Besonderes zu sein. Petes heimlicher Liebling. Wir waren von Anfang an ein Dream-Team, stiegen die Karriereleiter hinauf und zündeten wie eine Rakete. Pete war wie ein zweiter Vater für mich, hörte mir zu, war für mich da. Und er war geduldig. Sehr geduldig.
Das Schlimmste ist, dass ich ihm nicht alles vorwerfen kann. Ich war es, der sich in die Scheiße geritten hat. Der Shitstorm und dass mich jetzt alle canceln wollen, ist allein meine Schuld. Pete versucht nur, Schadensbegrenzung zu betreiben, und nachdem es mit liebevoller Strenge nicht geklappt hat, zieht er nun härtere Register.
Aber ich will das alles nicht. Weder das heuchlerische Interview, in dem ich mich für etwas entschuldigen muss, das ich nicht einsehe, noch die verfickte Realityshow, in die Pete mich im Anschluss einschleusen will. Um »meinen Ruf zu retten«. Wohl eher, um ihn zu zerstören.
»Du hast keine andere Wahl, Kumpel«, hallt Petes schmierige Stimme in meinen Ohren wider. »Die Zeiten haben sich geändert. Man kann Shitstorms nicht mehr länger aussitzen und warten, bis sich die Dinge beruhigt haben. Entweder du hörst auf mich oder du bist morgen weg vom Fenster. Ich verschwende meine Zeit nicht an Leute, die die Chance ihres Lebens bekommen und sie sich dann selbst verbauen.«
Ermattet schließe ich die Augen und reibe mir über das Gesicht. Mein Kopf fühlt sich heiß an, die Julisonne knallt auf meinen Scheitel. Mein Puls rauscht in meinen Ohren, mein Herz schlägt viel zu schnell. Als ich die Augen wieder öffne, betrachte ich das verschwommene Kaleidoskop aus unscharfen Wolkenkratzern. Meine Augen tränen, meine Finger zittern. Ich balle die Hände zu Fäusten, doch das Schlottern wandert nur weiter in meine Arme. Verdammt. Ich wollte einen Drink zur Beruhigung nehmen, aber Pete meinte, ich müsste beim Interview nüchtern bleiben. Das Problem ist, dass mein nüchternes Ich nicht immer kameratauglich ist. Und gerade bin ich so gestresst, dass ich es kaum verbergen kann. Nie im Leben könnte ich jetzt mit freundlichen Witzen jonglieren oder meine schlagfertige Seite zum Besten geben.
Ich stütze die Handflächen auf die Brüstung und lasse die Füße über den Dachrand baumeln, während ich den Blick von der Spitze des Crysler Buildings bis hin zu einer Brücke wandern lasse, auf die ich mich am liebsten rüberbeamen würde. Ich bin hochgekommen, weil ich etwas frische Luft schnappen wollte, doch beim Gedanken daran, wieder runterzugehen, zieht sich meine Lunge erneut zusammen.
Ich kann nicht dahin zurück.
Dem Interview hatte ich zugestimmt, aber nicht der Realityshow. Doch Pete wird nicht zulassen, dass ich eins von beidem versäume.
Ich muss hier weg.
Nur wohin? Ich befinde mich auf dem Dach eines vierzigstöckigen Gebäudes. Die einzigen Wege in die Freiheit führen entweder über die Aufzüge oder die Treppen – und auf beiden könnte mich Pete abfangen. Doch selbst wenn es mir tatsächlich gelänge, würde ich nicht lange unerkannt bleiben. Fans könnten meinen Standort verbreiten und nach zwei Kreuzungen wäre ich wieder zurück in Petes Klauen.
Meine Kehle schnürt sich zu, als mir klar wird, dass es keinen Ausweg gibt. Ich bin hier oben gefangen und kann nirgendwo sonst hin.
Zögernd lehne ich mich über die Brüstung. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht doch fliegen kann? Ich habe es noch nie versucht. Gut möglich, dass in mir irgendwelche verborgenen Talente stecken …
»Hey«, erklingt es plötzlich von hinten. Erschrocken zucke ich zusammen und fahre herum. An der Tür steht eine Frau. Sie ist klein und etwa so alt wie ich – Anfang zwanzig, vielleicht auch älter. Ihre rosa Haare sind schulterlang und mit einer Sonnenbrille zurückgesteckt. Sie trägt ein weißes bauchfreies Top und eine ebenso weiße Jeans, die an mehreren Stellen zerschlissen ist. In der einen Hand hält sie eine Salatbox, während sie mit der anderen ihre Augen vor der Sonne schützt.
»Hey«, erwidere ich mit leichtem Zögern.
»Ich bin Riley.« Sie hat die weichste Stimme, die ich je gehört habe, doch sie steht im Kontrast zu ihrer angespannten Miene.
»Louis«, sage ich und spüre, wie ungewohnt es ist, mich vorzustellen.
Sie nickt kurz, doch in ihrem Gesichtsausdruck erkenne ich nichts, das mir das Gefühl gibt, ihr bekannt vorzukommen.
»Schöner Tag, oder?« Sie lächelt, aber es wirkt ein wenig verkrampft.
»Ja«, erwidere ich und wische mir bemüht unauffällig über die Wangen. Meine Augen tränen immer noch, doch sie soll nicht denken, dass ich heule.
»New York im Sommer ist einfach unglaublich.« Vorsichtig macht sie einen Schritt in meine Richtung, hält aber dann inne, als wollte sie mich nicht verschrecken. »Kommst du von hier?«
»Nein.« Ich runzele die Stirn. Was wird das?
Sie nickt registrierend, ihr Brustkorb hebt und senkt sich, die Plastikverpackung in ihrer Hand quietscht, als würde sie sie zu fest drücken. Ich bin es gewohnt, dass Menschen in meiner Anwesenheit nervös werden, aber bei ihr ist es anders. Sie wirkt nicht aufgeregt oder ängstlich, sondern … überfordert, fast schon panisch.
»Okay … ähm, wollen wir vielleicht ein bisschen reden?«
Reden?
»Ich höre dir zu. Wir finden bestimmt eine Lösung.«
Lösung?
»Auch, wenn du glaubst, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Aber den gibt es. Immer.«
Da begreife ich. Der Small Talk. Die mit Vorsicht gewählten Worte. Die Panik in ihren Augen. Vielleicht ist es geschmacklos, doch ich kann nicht anders, ich muss lachen. Es klingt selbst in meinen Ohren manisch, aber das ist das Ding, wenn man seit Ewigkeiten nicht mehr richtig gelacht hat. Die Stimmbänder rosten ein und verirren sich bei der Suche nach der Tonlage.
»Ich will nicht springen, keine Sorge«, beruhige ich sie.
Sofort weicht die Anspannung aus ihrem Körper, und sie atmet so tief aus, als hätte sie die ganze Zeit die Luft angehalten.
»Oh Gott«, stößt sie erleichtert aus. »Wirklich nicht?«
»Nein. Aber jetzt bin ich neugierig.« Ich hebe das linke Bein und lasse es zurück auf die Dachseite schwingen. »Was hattest du vor?«
»Das weiß ich auch nicht.« Sie zuckt die Schultern und muss ebenfalls lachen. »Ich schätze, ich wollte dich … na ja, beruhigen. Keine Ahnung, was man bei so was macht.«
»Selbst, wenn ich gesprungen wäre, da unten ist doch dieses Netz«, sage ich und deute auf besagtes Konstrukt, das dem Ausblick einen Abbruch tut. Aber in einer Großstadt braucht es die Dinger.
»Netze können reißen. Außerdem hättest du dich trotzdem verletzen können.«
Ihr fürsorglicher Tonfall lässt meinen Puls schneller schlagen. Wann hat sich das letzte Mal jemand um mich gesorgt? Mich, den Menschen, und nicht den Schauspieler oder meine Karriere?
»Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken.«
»Schon okay.« Sie winkt ab und schüttelt lächelnd den Kopf. »Ich war wohl etwas paranoid. Aus der Ferne hast du nur so … verloren gewirkt.«
Ich bin verloren.
Mein Kiefer spannt sich an, hinter meinen Schläfen beginnt es wieder zu pochen. Doch ich wahre meine gelassene Miene und zucke mit den Achseln, als wüsste ich nicht genau, was sie meint.
»Darf ich mich zu dir stellen?« Sie deutet mit ihrer Salatbox in meine Richtung.
»Klar«, sage ich, überrumpelt, dass sie mich vorher um Erlaubnis bittet. Es gehört zum Job, gegen seinen Willen von Fremden verfolgt, gefilmt, umarmt und betatscht zu werden. Und wer es wagt, sich darüber zu beschweren, ist selbst schuld, denn »man hat es ja so gewollt«.
Inzwischen ist Riley bei mir angekommen. Sie ist noch ein Stück kleiner als erwartet, vielleicht eins sechzig. Ihre rosa Haare fallen ihr in die Stirn, während sie am Deckel des Behälters zerrt. Als sie wieder aufschaut, treffen sich unsere Blicke. Mein Atem gerät ins Stocken. Sie ist schön. Ihr Lächeln ist genauso zart wie der Rest ihres Gesichts. Sanfte Züge, kleine Stupsnase, volle Lippen. Ich frage mich, ob sie sich genauso weich anfühlen, wie sie aussehen.
»Sorry. Wie war dein Name noch mal?«, fragt sie und streicht eine lose Strähne hinter die Sonnenbrille zurück.
»Louis.« Weiß sie wirklich nicht, wer ich bin? Oder tut sie nur so, weil sie nicht aufdringlich wirken will?
»Ach stimmt, sorry. Ich kann mir Namen immer so schlecht merken.« Sie lächelt entschuldigend, wirkt aber sonst völlig entspannt, als würde sie meine Anwesenheit nicht im Geringsten nervös machen. Auch das hatte ich lange nicht mehr. Ein Gespräch auf Augenhöhe.Begegnungen mit Menschen außerhalb meiner Branche lassen sich inzwischen immer in dieselben Kategorien einteilen. Entweder sie sind so aufgeregt, dass sie mich mit Komplimenten überschütten, oder sie sind so aufgeregt, dass sie kein Wort herausbringen. Manchmal weinen sie, brechen zusammen, weil es so unfassbar ist, mich zu treffen. Und wenn es doch mal zu einem richtigen Gespräch kommt, dann ist es sehr einseitig. Ich werde mit Fragen bombardiert, und mein Gegenüber saugt die Antworten auf wie ein Ertrinkender den Sauerstoff. Selbst die Freunde meiner Eltern, die mich seit meiner Kindheit kennen, tun jetzt, als wäre ich ein anderer Mensch. Zugegeben, ein bisschen angehimmelt zu werden, schmeichelt dem Ego, aber manchmal fehlt es mir, ein ganz normales Gespräch zu führen.
So wie jetzt gerade.
»Du kommst mir irgendwie bekannt vor«, sagt Riley und kippt das weiße Salatdressing über ihren bunten Blätterhaufen.
Fast verrutschen meine Gesichtszüge.
»Arbeitest du hier?«
»Nein. Du?«
»Ja.« Sie schließt den Deckel und schüttelt die Box mit beiden Händen. »Im dreißigsten Stock. Beim Purple Clouds Magazine.«
Ich versteife mich.
»Aber da ist gerade das reinste Chaos, deshalb wollte ich meine Mittagspause nach oben verlagern.«
Ob sie hochgeschickt wurde, um mich zu holen? Nein. Ich presse die Lippen zusammen, dränge meine Paranoia zurück. Riley wusste nicht, wer ich bin, weiß es noch immer nicht. Ich komme ihr nur »bekannt« vor.
»Was ist passiert?«, frage ich tonlos.
»Ach, irgend so ein Schauspieler hat heute ein großes Interview.« Sie schiebt sich eine Gabel voll Salat in den Mund, kaut einen Moment. »Aber er ist wohl verschwunden, und sein Agent dreht gerade ein bisschen durch.«
Mein Handy. Instinktiv bin ich versucht, danach zu tasten, als mir wieder einfällt, dass ich es im Büro habe liegen lassen. Gott sei Dank. Dann kann mich Pete zumindest nicht orten.
»Er ist verschwunden«, wiederhole ich ihre Worte. Ob das meine Freikarte nach draußen ist? Wenn Pete glaubt, dass ich weg bin, wird er vielleicht ebenfalls gehen.
»Mhm.« Riley schluckt ihren Bissen runter, will sich gerade noch einen nehmen, als sie abrupt innehält. Langsam hebt sie den Blick, mustert mich forschend. Dann weiten sich ihre Augen. »Warte …«
Und damit bin ich aufgeflogen.
»Sag ihm nicht, dass ich hier bin!« Die Worte verlassen so hastig meinen Mund, dass ich sie selbst kaum verstehe.
»Wem?«, fragt Riley.
»Pete. Meinem Agenten.«
»Oh.« Sie blinzelt. »Okay.«
Okay?
»Ich mein’s ernst. Er darf es nicht wissen.« Ohne nachzudenken, greife ich nach ihrem Unterarm, zucke zusammen, als die Wärme ihrer Haut durch meine Nerven schießt. »Versprich es«, bitte ich und lasse sie mit einem leisen Räuspern wieder los.
»Versprochen.« Ihre Stimme knackt ein wenig, als hätten ihre Synapsen gerade ebenfalls kurz in Flammen gestanden. »Aber um ehrlich zu sein, hast du ziemlichen Trubel angerichtet.« Sie legt die Gabel in ihre Box und mustert mich aus schmalen Augen. »Dein Agent ist mir egal, aber meine Kollegen haben sich ziemlich ins Zeug gelegt.«
Schuldgefühle steigen meinen Rachen hoch, doch mit ihnen auch mein Widerstand. »Ich wollte das Interview gar nicht«, versetze ich und klinge wie ein trotziges Kind.
»Das hättest du früher sagen können.« Ein harter Zug legt sich auf ihr Gesicht, ihre Augen blitzen mich streng an. Wieder überrascht mich ihre Reaktion. Weil sie so ehrlich ist. Sie schmiert mir keinen Honig ums Maul, nein. Sie klatscht mir die Fakten direkt ins Gesicht. Egal, wer ich bin. »Außerdem dachte ich, wir täten dir damit einen Gefallen.«
Da ist was dran. Das Interview war dafür gedacht, die Dinge aus meiner Sicht zu erzählen. Weil mein Image bedroht ist und mich jetzt alle für ein misogynes Arschloch halten. Aber dass nur ich etwas davon hätte, stimmt auch nicht.
Ich will einwenden, dass das Magazin mit seinen Exklusivrechten ebenfalls profitieren würde, doch dann fangen meine Hände wieder an zu zittern, ich fühle mich, als würde der Boden unter mir wanken, und mich verlässt jede Kraft, mich zu verteidigen.
»Es tut mir leid«, sage ich schwach. »Ich wollte euch keinen Ärger machen, aber ich kann wirklich nicht dahin zurück.« Meine Brust krampft sich zusammen, mein Atem wird schneller. Nein, ermahnt mich eine innere Stimme. Sie darf mich nicht so sehen. Nicht so verletzlich, nicht so … schlagzeilenträchtig.
Riley bemerkt den Stimmungsumschwung, doch sie sieht nicht aus, als wollte sie meinen Zustand an die nächste Klatschseite verkaufen. Ihr Ausdruck ist eher … besorgt.
»Soll ich dir ein Taxi rufen?«, fragt sie sanft.
Ich schüttele den Kopf, reiße den Kopf hoch, als meine Augen erneut tränen. »Dann findet er mich trotzdem.«
»Dein Agent?«
Ich nicke müde. »Man darf mich nicht sehen«, versuche ich zu erklären.
Erkenntnis flackert in ihrem Blick. »Ach so, du brauchst einen Wagen und einen Fahrer, der nicht deinen Standort ausplaudert.«
Wow. So schnell hat es eine Person außerhalb meiner Branche noch nie begriffen. Ob sie vielleicht doch ein Teil meiner Welt ist?
»Dafür gibt es doch sicher irgendwelche Anbieter«, überlegt sie laut. »Oder halt, warte!« Sie schnappt nach Luft und drückt mir prompt ihren Salat in die Hand. Etwas perplex nehme ich ihn entgegen und beobachte sie dabei, wie sie ihre Taschen abklopft. Ihre Augen leuchten, als sie einen Schlüssel hervorzückt. »Soll ich dich fahren?«
Verdattert starre ich auf das schwarze Metallding. »Du hast ein Auto?«
»Mein Mitbewohner. Er arbeitet auch hier. Aber heute bin ich gefahren, weil er sich beim Joggen irgendwas verrenkt hat. Was für ein Zufall. Den Schlüssel habe ich sonst nämlich nie.« Sie wirft einen Blick auf ihre Armbanduhr und schürzt nachdenklich die Lippen. »Ich hab noch eine halbe Stunde Pause. Wenn du willst, bringe ich dich irgendwo hin.«
Das würde sie tun? Obwohl ich ihrem Team so viele Umstände bereitet habe?
»Und das Auto ist hier?«, vergewissere ich mich.
Sie nickt und deutet mit dem Kinn zu unseren Füßen. »In der Tiefgarage.«
»Wie kommen wir runter?«
»Mit dem Aufzug.«
Erneute Panik glimmt in mir auf. Pete könnte mich auf dem Weg nach unten erwischen. Aber vielleicht ist er schon weg.
»Einen anderen Weg gibt es leider nicht.« Sie lächelt zerknirscht. »Aber ich kann versuchen, dich zu decken.«
Ich bin einen halben Kopf größer als sie. Ich werfe ihr einen ironischen Blick zu. Rileys Mundwinkel zucken, als würde sie versuchen, nicht über ihren eigenen Scherz zu grinsen.
Da passiert irgendwas in meiner Brust. Ein … Flattern oder so.
»Also was sagst du?« Sie mustert mich forschend, dunkle Knopfaugen, die mir geradewegs in die Seele blicken.
Ich schlucke. »Okay.«
2. KAPITEL
Riley
Wir schaffen es unbemerkt zur Tiefgarage. Die Aufzüge sind leer, niemand kommt uns entgegen, und ehe wir uns versehen, sitzen wir in Xanders Range Rover. Heiße Mittagssonne begrüßt uns, als ich den Wagen aus dem Gebäude fahre. Ich schiebe mir die Sonnenbrille auf die Nase und lenke den Wagen auf die Fifth Avenue. Meine Finger beben noch immer leicht, die Aufregung flaut nur langsam ab. Auch Louis scheint ziemlich unter Strom zu stehen. Sein ganzer Körper ist angespannt, er hat die Sonnenblende runterklappt und sitzt so tief, dass er beinahe liegt. Vermutlich versucht er, sich zu verstecken, aber für mich wirkt er dadurch nur auffälliger.
Als wir an einer Kreuzung zum Stehen kommen, wage ich einen kleinen Blick in seine Richtung. Er hat das Kinn auf seine Schulter gesenkt, die schwarz gelockten Haare fallen ihm in die Stirn. Sein weißes T-Shirt spannt über seiner Brust, die Ärmel schmiegen sich an seinen gebräunten Bizeps. Unglaublich, dass es so lang gebraucht hat, bis ich ihn erkannt habe. Dabei hat er ein so einprägsames Gesicht; große ausdrucksstarke Augen, Züge, die wie gemeißelt wirken. Gerade Nase, sichtbare Wangenknochen, eine kantige Kieferpartie. Und es stimmt, was die Medien sagen: Er hat wirklich was von Prinz Naveen aus Küss den Frosch. Pinterest ist sich einig, dass er bei einer Live-Action-Verfilmung die Hauptrolle kriegen muss.
Meine Wangen werden heiß. Verlegen wende ich mich ab und bin dankbar für meine Sonnenbrille, von der mein Mitbewohner Rahim zwar meinte, dass ich damit aussehe wie ein Rieseninsekt, sie aber zumindest den Großteil meines geröteten Gesichts abschirmt.
Louis Thorne und ich in einem Auto …
Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen Prominenten sehe. Ich bin in LA aufgewachsen, da laufen einem ständig irgendwelche berühmten Persönlichkeiten über den Weg. Ich habe sie auf Partys getroffen, beim Joggen, vor der Gemüsetheke von Whole Foods oder morgens in meinem Bett, nach einem betrunkenen One-Night-Stand. Himmel, sogar meine eigene Großmutter war eine bekannte Schauspielerin. Nicht, dass ich sie großartig gekannt habe, aber was ich damit sagen will: Ich bin die Anwesenheit berühmter Menschen gewohnt, stelle sie nicht auf ein Podest und raste auch nicht aus, wenn ich sie sehe. Doch jetzt sitzt ein heißer Nachwuchsstar auf meinem Beifahrersitz, und ich würde lügen, wenn ich nicht zugäbe, dass das schon irgendwie krass ist.
Ich weiß nicht viel über Louis Thorne, doch ich erinnere mich, dass er seinen Durchbruch mit irgendeiner Teenie-Komödie hatte und seitdem ständig den heißen Bad Boy verkörpert. Letztes oder vorletztes Jahr wurde er von GQ, glaub ich, auch als Man of the Year gekürt. Von dem Shitstorm weiß ich nur Bruchstücke, aber es ging wohl um einen Streit mit einer Newcomerin, die als Nachfolgerin einer berühmten Agentenfilmreihe gecastet wurde. Dass sie die Rolle bekam, ist ein ziemlicher Meilenstein für die Branche, da die Vorgänger seit den Sechzigern alle Männer waren. Aber Louis Thorne war wohl auch im Rennen, und als er die Rolle nicht bekam, kam es zu einem hitzigen Gespräch, bei dem nicht allzu freundliche Worte von Louis gefallen sind. Nur hat jemand das Gespräch aufgenommen, und das Video ging leider viral. Und obwohl das Ganze schon zwei Wochen her ist, ist das Thema noch immer in aller Munde. Eigentlich wollte Louis ein exklusives Interview bei Purple Clouds geben, dem feministischen Magazin, bei dem ich arbeite. Geplant war, Stellung zu all den sexistischen Vorwürfen zu beziehen. Aber dann ist er abgehauen. Und ich fahre das Fluchtauto.
Meine Nackenhaare stellen sich auf, als mir klar wird, dass ich indirekt dazu beigetragen habe, dass das Interview geplatzt ist. Mist. Warum habe ich nicht versucht, auf ihn einzureden?
Weil er kurz vor einer Panikattacke stand.
Er hätte kein Interview führen können, selbst, wenn er es gewollt hätte. Dennoch war es vielleicht etwas voreilig, gleich meine Fahrdienste anzubieten. Ich kenne ihn doch gar nicht.
»Wo soll ich dich eigentlich hinbringen?«, breche ich das Schweigen.
Louis hebt leicht den Kopf und späht aus dem Fenster. Sein grünbrauner Blick fliegt unruhig hin und her. »Ich weiß es nicht.«
»In welchem Hotel wohnst du denn?«
»Im Sunrise.«
»Ah.« Das ist in Tribeca. Viele Stars residieren dort, was ich ziemlich unpraktisch finde, weil die Paparazzi das natürlich auch wissen und ständig vor dem Eingang lauern.
»Aber da kann ich nicht hin«, schiebt er nach, als ich gerade den Blinker setzen will. »Pete würde als Erstes dort suchen.«
Zu gern würde ich wissen, warum er solche Angst vor ihm hat. Er ist doch der Schauspieler, und Pete nur sein Agent. Was hat es mit dieser verdrehten Dynamik auf sich?
»Na gut, dann vielleicht zu einem Freund?«, schlage ich vor. »Kennst du hier jemanden?«
Er schüttelt den Kopf und hält sich die Stirn, als würde sich eine Migräne anbahnen.
»Oder vielleicht in ein Restaurant?«, versuche ich es weiter.
»Nein.« Er nimmt die Hand vom Gesicht und atmet frustriert aus. »Ich will einfach irgendwo hin, wo man mich nicht kennt.«
Tja, das wird nicht leicht in einer Stadt mit über acht Millionen Einwohnern.
Wir geraten in einen Stau. Ich drücke auf die Bremse, der Wagen kommt zum Stehen. Louis Thorne blickt auf die endlose Autokolonne vor uns, flucht leise. »Das ist ja wie in LA.«
Bei der Erwähnung meiner Heimatstadt zieht sich kurz alles in mir zusammen. »Liegt an der Uhrzeit«, murmele ich und atme gegen das Stechen in meiner Brust. LA … Wie sehr ich die Aneinanderreihung dieser beiden Buchstaben hasse. Sie klingt viel zu warm für den Ort, der er eigentlich ist, eine oberflächliche Scheinwelt voller kostümierter Menschen. Der Abklatsch von Disneyland, nur noch teurer und dreckiger. Ein Glück, dass ich da nicht mehr wohne und es auch nie mehr tun werde.
»Können wir nicht eine Seitenstraße nehmen?«, fragt Louis und sieht sich hektisch nach hinten um. Gilt seine Panik immer noch diesem Pete oder leidet er eventuell an Verfolgungswahn?
»Dann bräuchten wir immer noch ein Ziel«, erkläre ich freundlich.
Darauf folgt ein passiv aggressives Schweigen. Ich beiße mir auf die Zunge, um nicht zu lachen. Er ist gestresst, rufe ich mir in Erinnerung. Aber er ist auch ein berühmter Schauspieler, der es gewohnt ist, dass Menschen das Unmögliche für ihn möglich machen. So schätze ich ihn zumindest ein.
»Nur ein paar Stunden.« Er schließt die Augen, verzieht müde das Gesicht. »Ohne diesen ganzen Zirkus. Fuck, mehr will ich doch gar nicht.«
Ich frage mich, was er mit »Zirkus« meint. Etwa die Fans, die ihm überall auflauern? Oder die Sache mit dem Video?
Ich drehe den Kopf zur New York Public Library, betrachte die vielen Gruppen, die auf den Treppen sitzen. Ein Ort ohne Menschen … Hm. Wo gehe ich hin, wenn ich meine Ruhe will? Na ja, wenn ich ehrlich bin, bleibe ich einfach zu Hause.
Moment …
»Du könntest mit zu uns kommen«, höre ich mich plötzlich sagen.
Louis hebt den Kopf. Ganz langsam dreht er das Gesicht zu mir.
»Uns?«
»Meine WG«, erkläre ich und nehme die Sonnenbrille vom Gesicht, erschaudere, als mich das Braungrün in seinen Augen mit voller Wucht trifft. Eine solche Farbe habe ich noch nie gesehen. »Wir wohnen in einem kleinen Haus in Queens«, füge ich stockend hinzu. »Aber gerade ist da niemand.« Erneut halte ich inne, gehe im Geiste die mögliche Planänderung durch. »Ich könnte meiner Kollegin schreiben und ihr sagen, dass ich den Rest des Tages von zu Hause arbeite.«
»Okay?« Er klingt argwöhnisch.
»Ist das ein Ja?«
Plötzlich verändert sich sein Blick. Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen, machen seine Züge noch härter. »Du … bist aber keine Stalkerin?«
»Was?«
Dass ich es nicht sofort abstreite, lässt wohl die Alarmglocken in seinem System klingeln. Schrecken weitet seine Augen, seine Schultern spannen sich an wie bei einer Raubkatze, die kurz davor ist, einen anzuspringen.
»Du … Scheiße. Wer bist du eigentlich?«
»Hä?« Ich bin so verwirrt, dass ich nicht anders zu reagieren weiß.
Louis funkelt mich an, die Emotionen in seinem Blick flattern wie bei einem Daumenkino. Ich sehe Wut, Panik, Angst. Entschlossenheit.
»Okay, lass mich raus.«
Seine Worte sind wie eine Ohrfeige, die mich so schnell trifft, dass ich nicht schnell genug begreife, woher sie kam.
»W-Was?«, frage ich wieder.
»Ich gehe ganz bestimmt nicht mit dir nach Hause! Lass mich raus!« Eilig rüttelt er am Türknauf und hämmert mit der anderen Hand gegen das Fenster, als wäre er gefangen. »Lass mich raus!« Jetzt schreit er fast, sein Ruf hallt von den Blechwänden wider, und vor lauter Schreck rutscht mir das Herz in die Hose.
»Scheiße, ist ja gut!« Mit pochendem Herzen entriegele ich die Tür. Louis flieht so schnell aus dem Wagen, dass er fast auf den Boden stolpert. Hastig rappelt er sich wieder auf und rennt dann los, als wäre jemand mit einer Kettensäge hinter ihm her.
»Wichser«, murmele ich, während ich mich über die Mittelkonsole lehne und seine Tür schließe. Das hat man also davon, wenn man einem launischen Schauspieler unter die Arme greifen will. Ich wollte ihm doch nur helfen. Er hatte mir leidgetan, so ganz verloren in einer fremden Stadt, nicht zu wissen, wo er hinsoll. Ich war auch mal an dem Punkt. Nun, vielleicht nicht an genau demselben, aber auch ich bin einst in New York gestrandet, ohne zu wissen, wohin. Es war die Unterstützung anderer, die mir half, meinen Weg zu finden. Fremde, die irgendwann sogar zu Freunden wurden. Natürlich kann man alles allein machen. Doch es schadet auch nicht, sich ein bisschen Unterstützung zu holen.
Doch der berühmte Louis Thorne wollte wohl sein eigenes Ding durchziehen. Und ich hab sogar meine Mittagspause für diesen Arsch aufgegeben. Was für eine Zeitverschwendung.
Wenigstens setzt sich der Verkehr endlich in Bewegung. Ich drücke aufs Gas, komme allerdings nicht weit, bis mich die nächste Ampel wieder zum Stoppen zwingt. Seufzend halte ich an und werfe einen Blick in den Rückspiegel. Louis steht an der Straßenecke East 42nd Street, hinter ihm eine Kolonne an Menschen, die in Richtung Grand Central laufen. Verloren sieht er sich um, als wüsste er nicht, wo er jetzt hin soll. So berühmt wie er ist, wird es sicher nicht lange dauern, bis ihn jemand erkennt. In LA habe ich schon oft erlebt, wie irgendwo ein Star gesichtet wurde und sich eine Horde Fans praktisch aus dem Nichts materialisiert hat. Ihm scheint das wohl ebenfalls bewusst zu werden, selbst aus der Ferne spüre ich die Angst, die von ihm ausstrahlt. Ich unterdrücke die Sorge, die bei diesem Anblick in mir aufkeimt, und zwinge mich, wieder nach vorn zu sehen. Er wollte es so und ist sowieso nicht mein Problem. Fest umklammere ich das Lenkrad und sehe starr nach vorn, während ich innerlich bete, dass die Ampel endlich grün wird.
Ein dumpfes Klopfen von der Seite. Ich zucke zusammen und drehe den Kopf zum Beifahrerfenster. Louis Thorne hat sich zum Fenster gebeugt und sieht mich beinahe flehend an. Ein kleiner Funke Genugtuung flammt in mir auf, und kurz bin ich versucht, mich einfach abzuwenden. Doch dann seufze ich und deute mit einer Handbewegung an, dass er wieder einsteigen soll. Mit einem vertrauten Klacken öffnet sich die Autotür, und Louis huscht fast so schnell hinein, wie er hinausgestürmt ist. Im selben Moment springt die Ampel um. Ich drücke aufs Gas.
Ein paar Sekunden herrscht betretenes Schweigen.
»Tut mir leid«, sagt er leise.
Ich antworte nicht.
»Fahren wir noch zu dir?«
Ist das sein Ernst?
»Ich dachte, ich bin eine Stalkerin?«, frage ich schnippisch.
»Hey, ich muss so was fragen!« Er hebt beide Hände und lässt sie kurz darauf in seinen Schoß fallen. »Ich hatte nicht mal angeboten, dich zu bezahlen. Dass du mir einfach aus freien Stücken helfen willst …« Er bricht ab und sinkt zurück, als würde es keinen Sinn machen, es zu erklären. »Du verstehst das nicht.«
Die Verlorenheit in seiner Stimme drängt meine Kränkung für einen Augenblick zurück. Er hat recht. Louis Thorne ist ein berühmter Schauspieler, der in einer völlig anderen Realität lebt. Gut möglich, dass er schon viele negative Erfahrungen gemacht hat. Außerdem hat er sich entschuldigt …
»Ich bin keine Stalkerin«, stelle ich klar. »Und ich fahre dich gern irgendwohin, solange du mir nur sagst, wohin.«
Eine kurze Pause.
»Ich … war noch nie in Queens.« Vorsichtig sieht er zu mir auf, sein Blick ist verhalten, doch auf seinen Lippen liegt dieses freche Filmstarlächeln, dem vermutlich niemand widerstehen kann. Nicht einmal ich.
Verdammt.
3. KAPITEL
Riley
Ich hatte genau einen Neujahrsvorsatz, allerdings war es ein ziemlich großer. Er besagte, mich nicht mehr länger in irgendein Chaos zu verstricken, und zu meiner Überraschung lief das erste halbe Jahr ziemlich gut. Ich hörte auf mit exzessivem Trinken und Feiern und begann einen Job beim Purple Clouds Magazine. Mein Leben bekam Struktur, ich hatte regelmäßige Einnahmen, war zufrieden, bin zufrieden. Aber als ich nun in die Einfahrt unseres kleinen Stadthauses einbiege, nachdem ich mitten am Tag mit einem geborgten Auto von der Arbeit abgehauen bin, um einen berühmten Schauspieler spontan zu mir nach Hause einzuladen, beschleicht mich die Sorge, ob meine Strähne damit vorbei sein könnte …
»Da wären wir«, sage ich und schnalle mich ab.
Louis Thorne reagiert nicht. Nachdenklich blickt er durch die Windschutzscheibe auf unser kleines Backsteinhaus. Sein Ausdruck hat fast etwas Filmisches. Wie bei einer Szene, in der der Protagonist nach langer Zeit wieder nach Hause kommt.
Wir steigen aus. Um Louis Thorne nicht erneut zu verschrecken, bemühe ich mich um einen lässigen Gang und versuche, mich möglichst nicht stalkerhaft zu verhalten. Louis hingegen nimmt zwei Treppenstufen auf einmal und ist so schnell oben, als wäre das hier ein Wettrennen. An der Tür angekommen sieht er sich ungeduldig nach mir um, tippelt mit dem Fuß, als würde er schon ewig auf mich warten. Gern würde ich ihm sagen, dass er hier wirklich keine Angst zu haben braucht, uns ganz bestimmt niemand verfolgt hat und meine Straße um diese Uhrzeit sowieso menschenleer ist. Stattdessen beeile ich mich, die Tür aufzuschließen.
Im Flur empfängt uns angenehme Kühle. Matcha erwartet uns bereits schwanzwedelnd, das Glöckchen an seinem Halsband bimmelt, während er neugierig an uns schnuppert.
»Das ist unser Hund«, erkläre ich und schlängele mich am weiß-braun gefleckten Jack Russell Terrier vorbei. »Er heißt Matcha.«
»Süß«, murmelt Louis, beachtet ihn aber kaum. Ich kicke die Tür mit dem Fuß zu und Schatten fällt auf unsere Gesichter. Louis Thorne schließt kurz die Augen und atmet hörbar aus. Seine Schultern sinken herab, als würde jetzt schon ein ganzes Stück Anspannung von ihm abfallen. Als er wieder zu mir sieht, durchfährt mich ein kleiner Schauer.
Diese Augen …
»Schuhe ausziehen?«, fragt er mit einem Blick auf die herumliegenden Sneakers.
»Wie du willst.« Ich schlüpfe aus meinen Sandalen und hänge meine Tasche über das Treppengeländer. »Sorry für die Unordnung. Wir wohnen hier zu fünft und haben einfach zu viele Schuhe. Aber keine Sorge. Es ist wirklich niemand hier«, stelle ich erneut klar, als ich sehe, wie sich seine Schultern verkrampfen. »Hier ist das Wohnzimmer«, erkläre ich und deute mit einer Handbewegung in den offenen Raum, der mit der Küche verbunden ist. Auf dem Esstisch liegen noch benutzte Schüsseln, vereinzelte Lucky Charms und eine offene Milchpackung. Das Sofa ist ein Durcheinander aus Büchern, Decken und Kissen, auf dem Sessel stapelt sich frische Wäsche, die noch nicht zusammengelegt wurde.
»Ich, äh, hab nicht mit Besuch gerechnet. Normalerweise ist es hier aufgeräumter. Ich habe eine Mitbewohnerin, die voll auf Ordnung steht, aber die ist gerade verreist, und immer, wenn sie weg ist, herrscht im Haus die reinste Anarchie.«
Louis runzelt leicht die Stirn, als wüsste er nicht, wovon ich rede. »Ist doch voll schön.«
Ein kleines Lächeln stiehlt sich auf meine Lippen. »Danke.«
Erneut lasse ich den Blick umherwandern und versuche, mein Zuhause diesmal aus seiner Sicht zu betrachten. Es stimmt schon, die Einrichtung ist gemütlich, die Möbel passen farblich zusammen, auf dem Couchtisch steht immer eine Vase mit frischen Blumen, und der Kamin verleiht dem Raum selbst im Sommer eine romantische Atmosphäre. Wir alle haben viel Zeit und Liebe in die Einrichtung gesteckt, und wenn ich ehrlich bin, ist es gerade die Unordnung, die dem Haus Leben einhaucht. Persönliche Gegenstände, die unseren Abdruck hinterlassen haben. Zum Beispiel Rahims Stapel an Unibüchern, weil er immer im Wohnzimmer lernt. Oder Camillas herumliegende Gläser mit neuen Stecklingen. (Seit ihrer erfolgreich gezüchteten Avocado-Pflanze steht sie voll auf Ableger.) Außerdem noch Xanders ellenlange Ladekabel, über die wir ständig stolpern, und Emorys Arbeitsuniform, die schon seit Tagen über der Stuhllehne hängt und die ich längst für ihn bügeln wollte. Und dann wäre da noch mein verstreutes Make-up, weil ich mich immer morgens am Fernsehtisch schminke. (Da ist das beste Licht.)
»Ihr habt sogar einen Garten«, bemerkt Louis und sieht durch die Terrassentür hinaus zu dem kleinen Stück Wiese.
»Ja, aber der ist ein bisschen ranzig. Im Frühling haben wir versucht, ein paar Blumen einzupflanzen. Sie sind ziemlich schnell wieder eingegangen.«
Darauf erwidert er nichts, steht einfach nur mitten im Raum und blickt hinaus. Das Fenster ist gekippt, ein paar Vögel zwitschern ein Lied. Warmer Sonnenschein fällt in den Raum; es ist genauso ruhig, wie ich es versprochen hatte. Allerdings bringt die Stille eine so drückende Intimität mit sich, dass meine Brust ganz eng wird. Es ist das erste Mal, dass ich jemanden zu mir nach Hause eingeladen habe. Und dann auch noch einen Mann, den ich kaum kenne. Louis Thorne. Ich wollte ihm helfen, ja, aber Hand aufs Herz: Hätte ich es auch getan, wenn er kein berühmter Schauspieler wäre?
»Ähm … du kannst dich gern setzen, wenn du willst«, sage ich und räume ein paar Decken und Kissen vom Sofa. »Möchtest du was trinken?«
»Okay«, erwidert er verzögert, wie bei einem Ferngespräch.
Ich nicke und mache mich auf zur Küche. Im Kühlschrank finde ich eine Packung Eistee. Rahim ist der Einzige, der dieses süße Zeug trinkt. Hoffentlich verzeiht er es mir, dass ich mich an seinem Vorrat bediene. Ich fülle den Tee in zwei nicht zusammenpassende Gläser (wir müssen echt mal wieder spülen) und gebe noch ein paar Eiswürfel hinzu. Dann kehre ich zurück ins Wohnzimmer. Louis hat sich inzwischen aufs Sofa gesetzt. Seine Haltung ist ähnlich in sich eingesunken wie vorhin im Auto. Er hat sich ein Kissen gegen den Bauch gedrückt, umklammert es mit beiden Armen. Erschöpfung zeichnet seine Züge, trotzdem sieht er immer noch aus wie ein Armani-Model. Ich frage mich, ob ihm diese sexy Posen bereits in Fleisch und Blut übergegangen sind. Vielleicht kann er gar nicht unattraktiv aussehen, selbst, wenn er es versucht.
»Ich muss kurz meiner Kollegin schreiben«, sage ich und stelle erst das Getränk vor ihm ab, ehe ich mich ans andere Ende des Sofas setze. Um Abstand zu wahren. Und weil seine Nähe mich irgendwie nervös macht.
»Wenn du heimlich Fotos von mir machst, verklage ich dich auf alles, was du hast«, murmelt er, ohne aufzusehen. Es kommt wie aus der Pistole geschossen, als hätte er die Worte einstudiert. Oder schon sehr oft sagen müssen. Vielleicht sollte ich sauer sein, aber irgendwie macht es mich traurig.
»Klingt nach einem dicken Vertrauensproblem.« Ich lächele mitfühlend.
»Wohl kaum.« Er presst die Lippen zusammen. »Meine Mutter sagt immer, ich bin zu gutgläubig.«
»Hey, ich habe einen fremden Mann mit zu mir nach Hause genommen«, erinnere ich und lege die Füße auf den Tisch. »Statistisch gesehen ist das hier immer noch gefährlicher für mich als für dich.«
Aus dem Augenwinkel sehe ich, wie sein Kopf erschrocken in meine Richtung schießt. Doch ich ignoriere seinen Blick, weil ich keinen Bock auf einen von männlichem Ego gekränkten »Das denkst du von mir? So was würde ich doch niemals tun«-Ausdruck habe. Ungerührt wende ich mich meinem Handy zu. Auf meinem Display leuchtet eine neue Nachricht von Dylan auf.
Dylan: Wo bleibst du? Ist alles okay bei dir?
Oh nein. Ich hätte wissen müssen, dass meine Kollegin sich Sorgen machen würde. Es ist ungewöhnlich für mich, während der Pause so lange wegzubleiben. Meistens esse ich am Schreibtisch oder lasse die Pause ausfallen, weil ich mich nicht von der Arbeit losreißen kann.
Ich: Tut mir leid, ich wollte dir gerade auch schreiben. Ich bin nach Hause gefahren. Mir ist die Hitze etwas zu Kopf gestiegen. Aber alles halb so wild. Ich arbeite von hier aus weiter.
Dylan: Shit, das tut mir leid! Heute ist es aber auch echt heiß. Ruh dich aus, die Mails können warten.
Schuldgefühle drücken mir kurz die Luft ab, aber jetzt habe ich sie schon angelogen. Ich kann nicht wieder zurückrudern. Das Mindeste ist, von hier aus einen guten Job zu machen.
Ich: Es geht schon, wirklich.
Dylan: Alles klar, aber übernimm dich nicht!
Ich: Versprochen. Wie ist die Lage im Büro?
Dylan: Immer noch angespannt. Unser Superstar ist nicht zurückgekommen …
Nein, der Superstar sitzt gerade neben mir und hält sich ein kaltes Glas Eistee an die Wange …
»Krass«,schreibe ich und komme mir wie die größte Heuchlerin vor.
Dylan: Sein Agent meinte, dass es einen »persönlichen Notfall« gab, und er sofort wegmusste. Aber sicher doch.
Ich: Du glaubst ihm nicht?
Dylan: Nein, ich wette, der Typ hatte einfach nur keinen Bock mehr. Diese Stars sind daran gewöhnt, dass alle nach ihrer Pfeife tanzen.
»Ist Pete noch da?«
Ich zucke zusammen und hebe den Kopf. Louis Thorne sieht mir direkt in die Augen. Sein Ausdruck ist fragend, im Sonnenlicht wirken seine Iriden fast golden, warm und süß wie Honig. Mein Puls beschleunigt sich, und in meinem Innersten regt sich etwas, das ich schon lange nicht mehr gespürt habe. So lange, dass ich nicht genau benennen kann, was es ist.
»Äh …« Es braucht einen Moment, um seine Frage durch mein Erklärungssystem zu schicken. Pete. Woher wusste er … Ach stimmt, ich habe ihm ja selbst gesagt, dass ich mich bei einer Kollegin melden würde.
»Das weiß ich nicht, aber er hat die Ausrede vorgeschoben, dass du wohl dringend wegmusstest.«
Seine Miene erstarrt.
»Ist das nicht gut?«, frage ich überrascht.
»Nope, er wird mich umbringen.« Er lächelt kläglich. Dann seufzt er tief und hebt das Glas an, als würde er sich selbst zuprosten.
Ein schweres Gewicht legt sich um mein Herz. Mit meiner Einladung wollte ich die Dinge keineswegs noch schlimmer machen. »Tut mir leid«, sage ich mit belegter Stimme. »Soll ich dich lieber wieder zurückfahren?«
Er verschluckt sich an seinem Getränk. »Was? Nein.« Er hustet kurz und klopft sich gegen die Brust. »Ich meine … Ist es okay, wenn ich noch bleibe?«
»Doch, klar, natürlich!«, erwidere ich etwas überschwänglich. »Ich will nur nicht, dass du meinetwegen Probleme kriegst.«
»Die habe ich doch sowieso schon«, brummt er und zuckt die Achseln. »Aber was ist mit dir? Musst du nicht arbeiten?«
Erneut treffen sich unsere Blicke, und wieder bringen mich seine Augen kurz aus dem Konzept.
»Stimmt«, antworte ich, als ich meine Stimme wiederfinde. »Ich, äh, setze mich dann mal an den Esstisch.«
Mit weichen Knien rappele ich mich auf und verstehe nicht, warum mein Herz so klopft. »Du kannst trotzdem gern den Fernseher anmachen, wenn du willst.«
»Ach, alles gut.« Er kippt den Rest seines Getränks in einem Zug runter, und hält sein leeres Glas in die Höhe. »Aber kann ich vielleicht etwas Stärkeres haben?«
»Wir hätten sonst nur noch Hustensaft«, scherze ich und gehe um das Sofa rum zum Tisch.
Lous stützt den Unterarm auf die Sofalehne und sieht mich aus verwirrten Augen an. »Ihr wohnt hier zu fünft und habt keinen Alkohol? Nicht einmal ein Bier?«
»Ähm, nein.«
»Seid ihr Mormonen?«
Ich muss lachen, aber nicht wegen seines Kommentars, sondern wegen der Tatsache, dass er es so ungewöhnlich findet, keinen Alkohol im Haus zu haben. Na gut, in unserem Fall entspricht es tatsächlich nicht der Norm.
Und der Grund bin ich.
»Meine WG denkt, dass ich ein Alkoholproblem habe«, gebe ich seufzend zu.
Seine Augen weiten sich, doch sein Ausdruck ist überrascht, und nicht wertend. »Hast du?«, fragt er.
»Nein«, sage ich etwas forscher. »Ich mache gerade nur eine Pause, weil ich es davor ein bisschen übertrieben habe.« Plötzlich schiebt sich das Bruchstück einer Erinnerung in meine Gedanken. Ich, nackt, zwischen zwei ebenso nackten Männern auf einer Jacht und sternhagelvoll. Bis heute weiß ich nicht, wer diese Typen waren, und ein Anflug von Schwindel überfällt mich, als mir klar wird, dass es vielleicht sogar besser ist, dass der Verlauf des Abends aus meinem Bewusstsein gerissen wurde.
Zugegeben, die Nacht war krass, aber es war meine Entscheidung, eine Pause zu machen. Weil ich viel vernünftiger bin, als sie denken.
»Aber jetzt wollen alle Solidarität zeigen und haben nie was im Haus, aus Angst, es könnte mich ›triggern‹«, setze ich als Erklärung hinzu.
Louis’ Blick verändert sich. »Das ist … nett.«
»Es ist beleidigend«, widerspreche ich und spüre, wie meine Schultern heiß vor Scham werden. »Sie tun so, als ob ich … Ach egal.« Tief atme ich aus, und erinnere mich daran, dass ich ihn gar nicht kenne. Ich schulde ihm keine Erklärung, genauso wenig wie er mir. Wir verbringen nur einen Nachmittag als Fremde zusammen. Und nicht einmal das, eigentlich nur in der Anwesenheit des anderen.
»Aber bestell dir ruhig was, wenn du willst«, sage ich und bringe das benutzte Geschirr in die Küche. Seine Antwort höre ich nicht, und als ich wieder ins Wohnzimmer komme, sagt er auch nichts mehr.
Leise summend putze ich die Tischplatte. Im Anschluss laufe ich nach oben und hole meinen Laptop aus meinem Zimmer. Wieder unten mache ich mich gleich an die Arbeit. Louis sitzt immer noch einfach nur da. In meinem Haus. In meinem Wohnzimmer. Es ist so unglaublich, dass ich an meiner Wahrnehmung zweifeln würde, wenn ich nicht stocknüchtern wäre. Keine Ahnung, ob ich mich überhaupt konzentrieren kann, wenn er hier ist. Aber was muss, das muss. Ich löse mein Haargummi von meinem Handgelenk und binde mir einen Zopf. Dann fällt mir ein, dass ich Xander schreiben muss, dass ich seinen Wagen gekidnappt habe, und sein Uber heute auf mich geht. Glücklicherweise fragt er nicht nach dem Grund, antwortet bloß mit einem Daumen-hoch-Emoji. Xander ist kein neugieriger Mensch, und nie war ich ihm dankbarer dafür.
Ich logge mich in meinen Mailaccount und beantworte zwei Nachrichten, brauche aber doppelt so lang, weil Louis Thornes Anwesenheit tatsächlich etwas einnehmend ist. Obwohl er nur entspannt daliegt, flackert ständig mein Blick in seine Richtung. Ich versuche ihn, so gut es geht, auszublenden, und will mich gerade Mail Nummer drei widmen, als das leise Tapsen von kleinen Pfötchen erklingt. Matcha schleicht ins Wohnzimmer, schnüffelt erst an meinen Füßen und trabt dann weiter in Richtung Sofa. Eigentlich darf er nicht aufs Polster, aber wenn er dort jemanden zum Kuscheln findet, vergisst er alles. Mit einem uneleganten Sprung hüpft er auf Louis’ Schoß. Dieser zuckt überrascht auf, und ich öffne bereits den Mund, um mit unserem Hund zu schimpfen, als Louis nach einem kurzen Zögern die Hand auf sein Fell legt und ihn sanft streichelt. Matcha schmiegt sich an seinen Bauch, und plötzlich wird es in meiner Brust ganz warm. Geborgenheit durchflutet mich, und mit einem Mal habe ich das Gefühl, ich bin … zu Hause. Was eigentlich keinen Sinn ergibt, weil ich ja zu Hause bin.
Oh Mann, was ist los mit mir?
Leicht zerstreut wende ich mich ab und konzentriere mich auf meinen Bildschirm. Als ich das nächste Mal aufschaue, sind die beiden eingeschlafen.
4. KAPITEL
Louis
»Hey.« Eine weiche Stimme dringt in mein Bewusstsein, das Polster unter mir bewegt sich, als ich spüre, wie sich jemand neben mich setzt. »Bist du wach?« Ein warmer Druck an meinem Arm, ein sanftes Rütteln. Blinzelnd schlage ich die Lider auf, meine Umgebung ist undeutlich, nur langsam schärft sich meine Sicht. Eine Frau mit langen rosa Haaren beugt sich über mich. Als sich unsere Blicke treffen, lächelt sie vorsichtig. »Tut mir leid, dass ich dich wecke.«
»Wo … bin ich?«, frage ich träge.
»In meinem Zimmer.« Sie deutet auf sich, zögert einen Moment. »Weißt du noch, wer ich bin?«
Ich nicke langsam. Riley. Ihr Name war Riley.
»Erinnerst du dich noch daran, wie du hierhergekommen bist?«
Das Interview. Das Dach. Die Autofahrt.
Wieder nicke ich, und Rileys Züge entspannen sich, als wäre sie erleichtert, nicht alles von vorn erklären zu müssen. »Du hast erst auf dem Sofa geschlafen, aber dann habe ich dir gesagt, dass meine Mitbewohner gleich kommen. Daraufhin hast du gefragt, ob du in mein Zimmer gehen kannst, damit sie dich nicht sehen.«
Ihre Worte stoßen irgendwas in mir an, doch die Bilder sind so verschwommen, dass ich nicht ganz an sie herankomme. Mein Blick fällt auf ihre Kleidung, und erst beim zweiten Hinsehen bemerke ich, dass sie etwas anderes trägt; ein schulterfreies weißes Top und einen grauen Minirock. Moment … Ich versuche, mich aufzusetzen, doch mein Körper ist bleischwer.
»War ich … habe ich die ganze Nacht …«
»Ja, du warst ziemlich müde. Ich hab dich nicht mal zum Abendessen wach gekriegt.« Wieder eine kurze Pause. »Bestimmt hast du Hunger.«
Nein, ich bin einfach nur verwirrt … Ermattet fahre ich mir über die Stirn. Mein Kopf dröhnt, ich fühle mich wie bei einem Jetlag, bei dem Körper und Zeitgefühl die Orientierung verloren haben.
»Wo hast du geschlafen?«, frage ich und drehe den Kopf zur anderen Bettseite. Die Vorstellung, dass sie den ganzen Abend neben mir gelegen hat …
»Im Zimmer meiner Mitbewohnerin«, sagt sie schnell. »Keine Sorge, ich war nicht hier.«
Eine leichte Röte steigt ihr in die Wangen, dabei bin ich es, dem die Blöße bis zum Kopf steht. Ich kann nicht glauben, dass ich die ganze Nacht hier war. In ihrem Bett. In ihrem Zimmer! Noch nie habe ich mit einer Frau nicht geschlafen und mich trotzdem so verletzlich gefühlt.
»Ihr Bett war frei, weil sie erst morgen Abend zurückkommt«, setzt sie zur Erklärung hinzu.
»Wie spät ist es jetzt?« Meine Stimme klingt kratzig.
»Kurz nach sieben.«
Sieben Uhr morgens. Also habe ich vierzehn … nein, über sechzehn Stunden geschlafen.
Aber warum bin ich immer noch todmüde?
»Und deine Mitbewohnende wissen nicht, dass ich hier war?«
Sie schüttelt den Kopf. »Hab’s niemandem erzählt.«
Wow.
»Aber wir fahren gleich los.« Riley blickt kurz an mir vorbei, und sieht dann wieder zu mir. »Ich, äh, wollte nur Tschüss sagen.«
Mir schnürt sich der Hals zu. »Danke, dass ich hier sein durfte.«
Sechzehn Stunden konnte ich der Realität entfliehen. Doch es war trotzdem nicht genug. Ohnmacht erfasst meinen Körper, als ich daran denke, wie ich mich Pete und dem ganzen Chaos stellen muss, das ich mit meinem plötzlichen Verschwinden verursacht habe.
»Kein Problem. Du kannst auch noch bleiben, wenn du willst.«
Mein Puls springt in die Höhe. »Wirklich?«
»Klar.« Sie zuckt die Schultern, als wäre es keine große Sache. »Aber wenn du nicht möchtest, dass dich jemand sieht, musst du warten, bis alle weg sind. Rahim, Xander und ich gehen gleich, aber Emory macht sich erst gegen elf auf den Weg.«
Sekundenlang bin ich wie betäubt. »Ich darf wirklich noch bleiben?«
»Ja.« Ihre Miene wird noch weicher.
»Und wann kommst du zurück?«
»Ich versuche, um fünf da zu sein.«
Schweigend starre ich sie an. Ist das echt oder stecke ich in irgendeinem Fiebertraum?
»Wie kann ich dich erreichen?«, frage ich heiser.
»Ich kann dir meine Nummer geben.«
»Ich hab mein Handy nicht hier.« Wahrscheinlich hat Pete es mitgenommen.
»Oh, okay. Hm.« Riley beißt sich auf die Unterlippe. Mein Blick bleibt an ihrem Mund hängen, mein Kehlkopf hüpft, als es zwischen meinen Beinen zuckt.
»Du könntest mein iPad nehmen«, überlegt sie und beugt sich über meinen Oberkörper, um das Gerät von der gegenüberliegenden Kommode zu nehmen. Ihre Brüste streifen meinen Arm, und wieder schießt die Berührung bis in meine Eier. Ruckartig wende ich mich ab und unterdrücke den Drang, scharf Luft einzuziehen.
Okay, mein Körper ist wach …
»Wir können über Snapchat schreiben«, schlägt sie vor. »Dann schickst du mir von meinem Account Nachrichten an mich selbst.«
»Gute Idee.« Ich räuspere mich.
»Okay.« Sie will es mir gerade reichen, als sie erneut innehält. »Aber wehe du klaust es. Oder was anderes. Ich warne dich.« Sie hebt einen Zeigefinger und kneift spielerisch die Augen zusammen. »Wenn du uns ausraubst, verpetze ich dich bei Pete.«
Ich lächele schwach, bin aber insgeheim erleichtert, weil mir ihre Skepsis zeigt, dass auch sie ein Risiko eingeht. Wir haben beide was zu verlieren.
»Ich werde nichts klauen«, verspreche ich.
»Und geh bitte auch nicht in die Zimmer der anderen.«
»Mach ich nicht.«
»Gut. Dann, also … sehen wir uns vielleicht noch.« Ihre Stimme wird leiser und – wenn ich mich nicht täusche – auch eine Spur hoffnungsvoll.
Ich schlucke, will noch so viel sagen. Danke. Für alles. Das werde ich dir nie vergessen. Aber mein Kopf fühlt sich an wie ein Haufen loser Gedankenblätter, und das einzige, das ich herausbringe, ist: »Bis dann.«
Riley lächelt, ihre dunklen Augen schimmern im trüben Morgenlicht. »Bis dann.«
*
Als ich das nächste Mal wach werde, ist es nach eins. Auf dem iPad-Display finde ich eine neue Snapchat-Mitteilung von Riley. Durch halb geöffnete Lider klicke ich darauf. Der Snap zeigt ein Bild von ihrem Schreibtisch. Als Unterschrift steht dort:
Hab voll vergessen zu sagen, dass du natürlich auch duschen kannst. Im Wäschehaufen (Wohnzimmersessel) findest du ein paar frische Sachen. Die Klamotten von Xander müssten dir, glaub ich, passen!
Ich wische zur Seite und schieße ein verwackeltes Foto von ihrem Zimmer. Dann tippe ich: Guten Morgen. Danke!
Ihre Antwort lässt nicht lang auf sich warten. Noch ein Bild von ihrem Schreibtisch, doch diesmal sieht man nur die Tastatur und eine Salatbox derselben Marke, die sie schon gestern hatte.
Hast du so lang geschlafen???
Ich teile ihre Verblüffung. Stirnrunzelnd taste ich über den ungewohnten weichen Untergrund. Die Bettwäsche riecht blumig, in der Luft liegt eine holzige Note, die den Charakter des Dachzimmers spiegelt. Alles ist fremd und anders, und doch habe ich mühelos geschlafen. Sogar ganz ohne Hilfe. In den letzten Jahren konnte ich nicht einmal die Augen zukriegen ohne Schlaftabletten oder einen Drink oder Weed oder manchmal auch alles zusammen.
Ja, aber ich versuche, jetzt aufzustehen. Sicher, dass draußen die Luft rein ist?
Ganz sicher! Wir alle kommen erst später nach Hause.
Alles klar, danke!
Mit schweren Gliedern rappele ich mich auf. Ich bin in meiner Kleidung eingeschlafen, meine Beine sind verspannt, mein Gürtel schabt gegen meine Leiste, meine Schuhe drücken gegen meine Zehen. Dass Riley sie mir nicht ausgezogen hat, überrascht mich. Aber im taktvollen Sinne. Selbst als ich in meinen Straßenschuhen in ihren Laken gelegen habe, hat sie mich nicht angerührt. Das ist … ungewohnt. Mein Team zuppelt ständig an mir herum, häufig auch fremde Menschen, die meine Haare richten, mir das Shirt in die Jeans stopfen, meinen Kragen zurechtzupfen. Und wenn ich völlig fertig in der Gosse liege, bringen sie mich ins Bett, und ziehen mir Schuhe und Hose aus. In meiner Branche darf man nicht zimperlich sein, mein Körper fühlt sich schon lange nicht mehr an, als würde er nur mir gehören. Dass nun also ausgerechnet eine Fremde bedacht auf meine Grenzen sein soll, ist irgendwie … seltsam.
»Du bist zu naiv«, hallt die Stimme meine Mutter in meinen Ohren wider. Mein Magen zieht sich zusammen. Bitte mach, dass sie sich täuscht, denke ich, während ich zum Browser wechsele. Mit angehaltenem Atem gebe ich meinen Namen ein, Sekunden später springt mir eine Aneinanderreihung von Bildern meines eigenes Gesichts entgegen. Louis Thorne, amerikanischer Schauspieler. Die Auflistung meiner Filme, meine Wikipedia-Seite und ein paar Promiseiten, die über den Shitstorm schreiben. Seit gestern scheint allerdings nichts Neues dazugekommen zu sein. Riley hat ihr Wort gehalten. Keiner weiß, wohin ich gestern verschwunden bin.
Das Misstrauen verwandelt sich in Schuld. Riley war unglaublich freundlich, aber eben das ist es, was mich irritiert. Wer ist diese Frau, die mir einfach helfen wollte?
Auf der Suche nach Anhaltspunkten, mehr über sie zu erfahren, lasse ich den Blick durch ihr Dachzimmer wandern. Es ist ziemlich bunt und auf eine moderne Art Retro. Rosafarbene Wände, Vintage-Möbel in Pastelltönen, ein quadratischer Teppich in grün-weiß kariertem Schachbrettmuster. An der Wand entdecke ich etliche Polaroids, die Riley mit unterschiedlichen Haarfarben zeigen – blau, grün, blond, lila und am häufigsten rosa. Vorsichtig trete ich näher und betrachte ihre Erinnerungsschnipsel von Feiern, Reisen oder zu Hause in einer Gruppe, mit den immerzu selben Gesichtern. Vermutlich ihre WG. Wie sie zusammen die Wand streichen, in der Küche kochen, auf dem Sofa tanzen, im Garten Kürbisse schnitzen. Wie hypnotisiert stehe ich da, und spüre, wie die Atmosphäre jedes einzelnen Bildes auf mich einströmt. Irgendwann gibt mein Magen ein lautes Grummeln von sich, und ich beschließe, sie mir später weiter anzusehen.
Ich klemme mir das iPad zwischen Arm und Rippen und mache mich daran, die aufziehbare Dachboden-Treppe runterzukriechen. Während ich mit geducktem Kopf das wackelige Gerüst herababsteige, frage ich mich, wie ich es gestern im Halbschlaf nach oben geschafft habe, ohne mir irgendwas zu stoßen. Je tiefer ich komme, desto mehr spüre ich den Temperaturunterschied. Ich hab gar nicht gemerkt, wie heiß es auf dem Dachboden war.
Schließlich finde ich mich in einem kahlen Flur mit vier Türen wieder, die, bis auf das Bad, alle geschlossen sind. Vermutlich sind das die Zimmer der anderen.
»Hallo?«, frage ich zur Sicherheit.
Keine Antwort.
»Ist jemand da?«
Wieder nichts. Wie es aussieht, bin ich wirklich allein.
Im Badezimmer betrachte ich mein verschlafenes Spiegelbild. Mein Gesicht ist zerknautscht, meine Haare stehen wild vom Kopf ab. Dennoch wirken meine Züge nach langer Zeit mal wieder sichtbar entspannt.
Ich nehme eine lange Dusche. Das Pfirsichshampoo ist das gleiche, das meine Mutter auch benutzt. Der Duft hat etwas Heimisches, der Schaum fühlt sich vertraut zwischen meinen Fingern an. Fast eine halbe Stunde bleibe ich unter dem lauwarmen Strahl, spüre, wie sich meine Glieder entspannen, und mein ganzer Körper runterfährt.
Danach trockne ich mich mit einem Handtuch ab, das ich im Schrank unter dem Waschbecken gefunden habe, schlüpfe wieder in meine Kleidung, und gehe die Treppe nach unten.
Das Wohnzimmer sieht genauso aus wie gestern. Ich durchquere den Raum und steuere die Küche an, als ich plötzlich eine Regung von der Seite wahrnehme, und zu einer Salzsäule erstarre. Doch es ist nur der Hund, der hechelnd angeflitzt kommt.
»Fuck«, stoße ich aus und halte mir die Brust. »Mann, du hast mich echt erschreckt, Kleiner.« Ich gehe auf die Knie und streichele ihn, was ihn nur noch aufgedrehter macht. »Hey. Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Nein, bitte nicht an den Fingern lecken. Das finde ich eklig.«
Ich rappele mich wieder auf und laufe zur Küche. Matcha folgt mir und stürzt sich dann auf die Wasserschale, als wäre er völlig verdurstet. Ich weiche seinen Spritzern aus und öffne den Kühlschrank. Jedes Regal ist bis zum Rand vollgestopft und beherbergt ganz andere Produkte als mein Kühlschrank. Etwas überfordert starre ich auf die bunte Mischung, dann piept der Kühlschrank, und ich ziehe eine Packung Milch heraus. Die Lucky Charms haben mich schon gestern angelacht.
Ich setze mich an den Tisch und esse zwei volle Schüsseln. Im Anschluss mache ich mir noch ein Sandwich mit drei unterschiedlichen Käsesorten. Kauend halte ich inne und schließe kurz die Augen. Ich hatte vergessen, wie gut Essen schmecken kann, wenn es Fette und Kalorien hat. Würden Pete und mein Personal Trainer Joey das sehen, könnte ich mir sonst was anhören.
Danach trinke ich noch einen Kaffee – die WG hat eine ziemlich teure Kaffeemaschine, die sich von den sonst eher bodenständigen Küchengeräten deutlich abhebt. Mein Schlürfen klingt laut in meinen Ohren, und bis auf Matchas Tapsen ist alles vollkommen reglos. Die Stille bohrt sich in meine Haut, kratzt an meinen Nerven. Ich war seit Ewigkeiten nicht mehr komplett allein. All die Jahre habe ich mich nach etwas Ruhe gesehnt, jetzt überfordert sie mich. Wenn Stress zum Alltag wird, verlernt man, einfach nur … da zu sein.
In dem Versuch, irgendwas zu tun, angele ich nach Rileys iPad und entsperre das Display. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, mich in mein Instagram einzuloggen, aber dann bekommt mein Team vielleicht eine Benachrichtigung, dass sich der Account von einem unbekannten Ort eingeloggt hat. Vielleicht wäre es besser, über Rileys Profil nach meinem zu schauen. Hoffentlich ist das okay für sie. Ich habe nicht vor, in ihren Sachen zu schnüffeln.