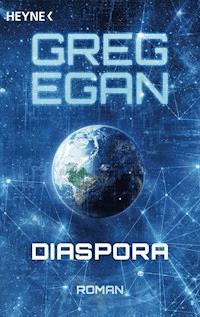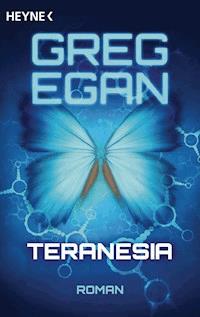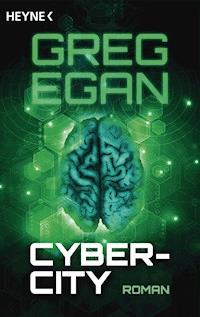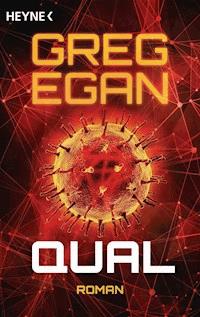
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Können wir die Wahrheit denn ertragen?
In den Neunzigerjahren vermutete der berühmte Physiker Stephen Hawking, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis wir eine vollständige Theorie der Natur entwickeln. Nun ist es soweit. Im Jahr 2055 sind wir endlich im Besitz der endgültigen Wahrheit über Sinn und Zweck unserer Existenz, über die Beschaffenheit der Welt und die Natur Gottes. Ein Segen für die Menschheit? Eher das Gegenteil, denn die Wahrheit ist alles andere als leicht zu ertragen – und dann gibt es auch noch jene Fanatiker, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Verbreitung zu verhindern …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 717
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
GREG EGAN
QUAL
Roman
Das Buch
In den Neunzigerjahren vermutete der berühmte Physiker Stephen Hawking, dass es nicht mehr lange dauern würde, bis wir eine vollständige Theorie der Natur entwickeln. Nun ist es soweit. Im Jahr 2055 sind wir endlich im Besitz der endgültigen Wahrheit über Sinn und Zweck unserer Existenz, über die Beschaffenheit der Welt und die Natur Gottes. Ein Segen für die Menschheit? Eher das Gegenteil, denn die Wahrheit ist alles andere als leicht zu ertragen – und dann gibt es auch noch jene Fanatiker, die vor nichts zurückschrecken, um ihre Verbreitung zu verhindern …
Der Autor
Titel der Originalausgabe
DISTRESS
Aus dem australischen Englisch von Bernhard Kempen
Überarbeitete Neuausgabe
Copyright © 1995 by Greg Egan
Copyright © 2016 der deutschsprachigen Ausgabe by
Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Covergestaltung: Das Illustrat
Ich danke
Caroline Oakley, Deborah Beale,
Anthony Cheetham, Peter Robinson,
Lucy Blackburn, Annabelle Ager
und Claudia Schaffer.
HINWEIS:
WICHTIGE ABKÜRZUNGEN:
Es ist nicht wahr, dass die Landkarte der Freiheit vollständig sein wird, wenn die letzte Grenze der Ungerechtigkeit ausgelöscht ist
wenn uns nur noch übrigbleibt, die Attraktoren des Donners auf Karten zu verzeichnen und die Arrhythmien der Dürren zu skizzieren
um die molekularen Dialekte von Wald und Savanne zu enthüllen, die vielfältig wie tausend menschliche Sprachen sind
und die tiefste Geschichte unserer Leidenschaften zu begreifen, die älter als alle Mythen sind
Also erkläre ich, dass kein Konzern das Monopol über Zahlen besitzt
dass kein Patent die Null und Eins umfasst
dass keine Nation über Adenin und Guanin herrscht dass kein Imperium die Hoheit über Quantenwellen innehat
Und zur Feier der Erkenntnis muss Platz für alle sein
denn es gibt eine Wahrheit, die nicht verkauft oder gehandelt werden kann
sie lässt sich weder aufzwingen noch abwehren
noch gibt es ein Entkommen.
- Aus Muteba Kazadi,Technolibération,
Erster Teil
1
Gut. Er ist tot. Sie können jetzt mit ihm reden.«
Der Bioethiker war ein lakonischer junger Asexueller mit blonden Rastalocken und einem T-Shirt, auf dem zwischen den bezahlten Werbebannern der Slogan UT – NEIN DANKE! aufblitzte. Hie setzte heine Gegenunterschrift auf den Genehmigungsantrag im Notepad der Gerichtsmedizinerin und zog sich dann in eine Ecke des Raums zurück. Der Traumatologe und der Sanitäter schoben ihre Wiederbelebungsapparate zur Seite, und die Pathologin trat eilig mit der Spritze in der Hand vor, um die erste Dosis Neurokonservator subkutan zu verabreichen. Das Präparat durfte nicht vor dem legalen Tod eingesetzt werden, da es im Verlauf mehrerer Stunden äußerst toxisch auf verschiedene Organe wirkte. Der Cocktail aus Glutamat-Antagonisten, Kalziumkanal-Blockern und Antioxidantien stoppte fast ohne Zeitverzögerung die gravierendsten biochemischen Veränderungen im Gehirn des Opfers.
Der Assistent der Pathologin folgte ihr mit dem Rolltisch, auf dem sich sämtliches Zubehör für eine postmortale Wiederbelebung befand: ein Tablett mit chirurgischen Einweginstrumenten, mehrere elektronische Apparate, eine Pumpe, die an drei Glasbehälter in der Größe von Trinkwasserkanistern angeschlossen war, und ein Gebilde aus supraleitenden grauen Drähten, das wie ein Haarnetz aussah.
Lukowski von der Mordkommission stand neben mir. »Wenn jeder genauso wie Sie ausgestattet wäre, Worth«, sagte er, »müssten wir solche Prozeduren gar nicht durchführen. Wir könnten das Verbrechen einfach von Anfang bis Ende abspielen. Als würde man Daten aus einem Flugschreiber auslesen.«
Ich antwortete, ohne den Operationstisch aus den Augen zu lassen. Unsere Stimmen konnte ich später problemlos herausschneiden, aber ich wollte ohne Unterbrechung aufzeichnen, wie die Pathologin die künstliche Blutversorgung anschloss. »Wenn jeder seine optischen Reize aufzeichnen ließe, würden Mörder in Zukunft ihren Opfern vermutlich die Speicherchips aus dem Körper schneiden.«
»Schon möglich. Aber in diesem Fall hat niemand versucht, am Gehirn des armen Kerls herumzupfuschen.«
»Warten wir ab, bis die Dokumentation gesendet wurde.«
Der Assistent sprühte ein Enthaarungsenzym auf den Schädel des Opfers und wischte dann die kurzen schwarzen Stoppeln einfach mit der Hand weg. Als er alles in eine Plastiktüte stopfte, erkannte ich, warum es eine zusammenhängende Masse blieb, statt sich wie beim Friseur über den Fußboden zu verteilen. Das Haar hatte sich samt der oberen Kopfhautschichten wie ein Skalp abgelöst. Nun klebte der Assistent das ›Haarnetz‹ – ein Geflecht aus Elektroden und SQID-Detektoren – auf die nackte rosafarbene Kopfhaut. Nachdem die Pathologin die Blutversorgung angeschlossen und überprüft hatte, machte sie einen Luftröhrenschnitt und schob einen Schlauch hinein, der von einer kleinen Pumpe gespeist wurde, die die Aufgabe der Lungen übernahm. Es war keine künstliche Beatmung, sondern lediglich eine Sprechhilfe. Es war zwar möglich, die Nervenimpulse zum Kehlkopf zu scannen und die beabsichtigten Laute durch rein elektronische Mittel synthetisch zu erzeugen, doch offenbar war die Stimme verständlicher, wenn das Opfer die gewohnten Sinnesempfindungen einer vibrierenden Luftsäule als Feedback spürte. Der Assistent legte dem Opfer eine gefütterte Bandage über die Augen, denn in seltenen Fällen kehrte sporadisch das Gefühl für die Gesichtshaut wieder, und da die Netzhautzellen absichtlich nicht wiederbelebt wurden, stellte eine vorübergehende Augenverletzung die einfachste Lüge dar, um dem Opfer die pragmatisch bedingte Blindheit zu erklären.
Ich überlegte mir einen möglichen Kommentar. Im Jahre 1888 versuchten Polizeiärzte, die Netzhäute eines Opfers von Jack the Ripper zu fotografieren, in der vagen Hoffnung, das Gesicht des Mörders könnte sich in die lichtempfindlichen Pigmente des menschlichen Auges eingebrannt haben …
Nein, viel zu vorhersehbar. Und irreführend obendrein, denn die Wiederbelebung war kein Prozess, bei dem Informationen aus einer leblosen Leiche gewonnen wurden. Aber welche möglichen Vorbilder gab es sonst noch? Orpheus? Lazarus? ›Die Affenpfote‹? ›Das verräterische Herz‹? Re-Animator? Weder im Mythos noch in der Literatur gab es ein Beispiel, das der Wahrheit nahegekommen war. Es war besser, keine eloquenten Vergleiche zu bemühen. Die Leiche sollte für sich selbst sprechen.
Der Körper des Opfers wurde von einem Krampf geschüttelt. Ein provisorischer Schrittmacher zwang das in Mitleidenschaft gezogene Herz, wieder zu schlagen. Das Gerät arbeitete mit Spannungswerten, die jede Herzmuskelfaser innerhalb von fünfzehn oder zwanzig Minuten mit elektrochemischen Abfallprodukten vergiftete. Mit Sauerstoff angereichertes Ersatzblut wurde in die linke Herzvorkammer gepumpt, um die Versorgung durch die Lungen zu umgehen. Das Blut wurde nur einmal durch den Körper geschickt, um anschließend durch die Lungenarterien wieder abgelassen zu werden. Ein offenes System machte weniger Probleme als ein geschlossener Blutkreislauf – zumindest kurzfristig. Die notdürftig geflickten Messerwunden in Unterleib und Brustkorb waren ein unappetitlicher Anblick, wenn die hellrote Flüssigkeit herausfloss und über die Rinnen im Operationstisch abgeleitet wurde. Aber durch diesen Vorgang drohte keine Gefahr, denn hundertmal soviel Blut wurde in jeder Sekunde absichtlich aus dem Körper abgelassen. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, die chirurgischen Larven zu entfernen, die ungestört weiterarbeiteten, als wäre nichts geschehen. Mit ihren Kiefern verschlossen sie die kleineren Blutgefäße und kauterisierten sie auf chemische Weise, während sie gleichzeitig das Wundgewebe säuberten und desinfizierten und blind nach nekrotischem Gewebe und Blutgerinnseln schnupperten, um sie zu verzehren.
Die Versorgung des Gehirns mit Sauerstoff und Nährsubstanzen war äußerst wichtig, aber sie konnte nicht den Zerfall rückgängig machen, der bereits eingetreten war. Die eigentliche Wiederbelebung wurde durch Milliarden von Liposomen bewirkt – mikroskopisch kleine Kapseln aus Lipidmembranen –, die zusammen mit dem Ersatzblut in den Körper geschwemmt wurden. In der Membran war jeweils ein Schlüsselprotein eingebettet, das an der Trennschicht zwischen Blutkreislauf und Gehirn aufgeschlossen wurde. Damit konnten die Liposomen aus den zerebralen Kapillaren in den interneuralen Raum vordringen. Andere Proteine bewirkten, dass die Membrane mit der Zellwand der ersten passenden Nervenzelle verschmolz, auf die das Liposom stieß. Dann wurde eine komplexe biochemische Maschinerie freigesetzt, mit der das Neuron reaktiviert, von den Abfallprodukten der ischämischen Schädigung gereinigt und vor dem Schock der Reoxigenation geschützt wurde.
Andere Liposomen waren auf andere Zelltypen zugeschnitten: die Muskelfasern des Sprechapparats – Kehlkopf, Kiefer, Lippen, Zunge – sowie die Rezeptoren des Innenohrs. Die verschiedenen Enzyme und anderen Substanzen dienten letztlich demselben Zweck. Sie brachten die absterbende Zelle in ihre Gewalt und zwangen sie dazu, ihre Reserven für einen letzten, kurzen Aktivitätsschub zu verfeuern.
Die Wiederbelebung war keineswegs eine glorreiche Rückkehr ins Leben. Sie war nur erlaubt, wenn das langfristige Überleben des Patienten nicht mehr berücksichtigt werden musste, weil jede Methode, mit der man dieses Ziel hätte erreichen können, bereits versagt hatte.
Die Pathologin warf einen Blick zum Monitor auf dem Rolltisch. Ich folgte ihrem Blick und sah unregelmäßige Gehirnwellenmuster und schwankende Balkenanzeigen, die die Messwerte der ausgeschwemmten Toxine und Abfallprodukte darstellten. Lukowski trat erwartungsvoll vor. Ich folgte ihm.
Der Assistent drückte auf eine Taste. Das Opfer zuckte zusammen und hustete Blut – zum Teil sein eigenes, das dunkel und klumpig war. Die Wellenmuster gingen steil nach oben, bis sie sich glätteten und regelmäßiger verliefen.
Lukowski nahm die Hand des Opfers und drückte sie leicht – eine Geste, dir mir irgendwie zynisch vorkam, obwohl tatsächlich ein ehrliches Mitgefühl dahinterstehen mochte. Ich blickte mich kurz zum Bioethiker um. Auf heinem T-Shirt stand nun GLAUBWÜRDIGKEITISTEINE WARE. Es war nicht ersichtlich, ob es sich um eine bezahlte Werbebotschaft oder eine persönliche Meinung handelte.
»Daniel«, sagte Lukowski. »Danny? Können Sie mich hören?« Es gab keine sichtbare körperliche Reaktion, aber die Gehirnwellen schlugen aus. Daniel Cavolini war ein neunzehn Jahre alter Musikstudent. Man hatte ihn gegen elf Uhr bewusstlos und blutüberströmt in irgendeinem Winkel des Town-Hall-Bahnhofs gefunden, – mitsamt Uhr, Notepad und Schuhen. Es war also unwahrscheinlich, dass er einem wahllosen Raubüberfall zum Opfer gefallen war. Ich begleitete die Mordkommission schon seit zwei Wochen und hatte nur auf eine solche Gelegenheit gewartet. Die Genehmigung für eine Wiederbelebung wurde nur dann erteilt, wenn in Anbetracht der Umstände damit zu rechnen war, dass das Opfer den Täter benennen konnte. Die Aussichten, einen Fremden aufgrund einer verbalen Beschreibung zu fassen – ganz zu schweigen von einem Phantombild vom Gesicht des Täters –, standen schlecht. Lukowski hatte erst kurz nach Mitternacht einen Staatsanwalt geweckt, in dem Augenblick, als eine eindeutige Prognose vorlag.
Cavolinis Haut nahm eine eigentümliche rötliche Färbung an, während immer mehr Zellen wiederbelebt wurden und Sauerstoff aufnahmen. Diese Färbung ging auf die anders gebauten Transportmoleküle im Ersatzblut zurück, die wesentlich effektiver als Hämoglobin arbeiteten, aber genauso wie alle anderen eingesetzten Mittel letztlich toxisch waren.
Der Assistent der Pathologin drückte einige weitere Tasten. Cavolini zuckte und hustete erneut. Das Ganze war ein schwieriger Drahtseilakt. Die kleinen Gehirnschocks waren notwendig, um die wichtigsten Funktionsrhythmen zu stabilisieren, aber zu starke äußere Einflüsse konnten die letzten Reste des Kurzzeitgedächtnisses auslöschen. Auch nach dem legalen Tod waren tief im Gehirn immer noch Nervenzellen aktiv und konnten mehrere Minuten lang die symbolischen Spannungsmuster aufrechterhalten, die die jüngsten Erinnerungen repräsentierten. Die Wiederbelebung konnte die neurale Infrastruktur wiederherstellen, die notwendig war, um diese Spuren zu interpretieren, aber wenn sie bereits vollständig erloschen waren – möglicherweise durch die Maßnahmen, mit denen man an sie herankommen wollte –, war die Befragung sinnlos.
»Sie sind jetzt in Sicherheit, Danny«, sagte Lukowski beruhigend. »Sie sind im Krankenhaus. Aber Sie müssen mir sagen, wer Ihnen das angetan hat. Sagen Sie mir, wer Sie mit dem Messer angegriffen hat.«
Ein heiseres Flüstern drang aus Cavolinis Mund, eine schwache, gehauchte Silbe, dann nichts mehr. Mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken – aber gleichzeitig geriet ich in eine idiotische Jubelstimmung, als würde ein Teil von mir sich einfach der Tatsache verweigern, dass dieses Lebenszeichen auf gar keinen Fall als Zeichen der Hoffnung anzusehen war.
Cavolini versuchte es erneut, und beim zweiten Mal war er schon etwas ausdauernder. Durch sein künstliches Keuchen, das keiner Willenskontrolle unterlag, klang es, als würde er nach Luft schnappen. Es war sinnlos, so etwas zu tun, aber in Wahrheit litt er gar nicht unter Sauerstoffmangel. Seine stimmlichen Äußerungen waren so brüchig und quälend, dass ich kein einziges Wort verstand. Doch seine Kehle wurde von einer Staffel piezoelektrischer Sensoren abgetastet, die ihre Daten an einen Computer weitergaben. Ich drehte mich um und blickte auf den Bildschirm.
Warum kann ich nichts sehen?
»Ihre Augen sind bandagiert«, erklärte Lukowski. »Einige Blutgefäße haben Schaden erlitten, aber man hat sie repariert. Ich versichere Ihnen, dass keine dauerhaften Schäden zurückbleiben. Sie sollten … einfach ruhig liegenbleiben und sich entspannen. Und mir sagen, was geschehen ist.«
Wie spät ist es? Bitte. Ich sollte zu Hause anrufen. Ich muss ihnen sagen, dass …
»Wir haben Ihre Eltern bereits verständigt. Sie sind unterwegs. Sie werden bald hier sein.«
Das entsprach sogar der Wahrheit – aber selbst wenn sie innerhalb der nächsten neunzig Sekunden eintrafen, würde man ihnen niemals den Zutritt zu diesem Raum gestatten.
»Sie haben auf den Zug gewartet, mit dem Sie nach Hause fahren wollten, nicht wahr? Bahnsteig vier. Erinnern Sie sich? Sie wollten den Zehn-Uhr-dreißig-Zug nach Strathfield nehmen. Aber Sie haben ihn nicht bestiegen. Was ist geschehen?« Ich sah, wie Lukowskis Blick zu einer Anzeige unter dem Protokollfenster wanderte, wo ein halbes Dutzend biologischer Parameter aufgezeichnet und vom Computer durch gepunktete Linien verlängert wurden. Alle extrapolierten Kurven stiegen zunächst an und erreichten etwa eine Minute in der Zukunft ihren Höchststand, um dann rapide abzufallen.
Er hatte ein Messer. Cavolinis rechter Arm begann zu zucken, und zum ersten Mal kam Leben in seine erschlafften Gesichtsmuskeln, die sich zu einer schmerzvollen Grimasse verzogen. Es tut immer noch weh. Bitte helfen Sie mir. Der Bioethiker betrachtete die angezeigten Werte auf dem Bildschirm, ohne zu intervenieren. Jedes wirksame Anästhetikum würde die neuralen Aktivitäten viel zu sehr dämpfen, um die Befragung fortsetzen zu können. Es ging um alles oder nichts, um Abbrechen oder Weitermachen.
»Die Schwester besorgt ein Schmerzmittel«, sagte Lukowski sanft. »Haben Sie Geduld, es wird nicht lange dauern. Aber sagen Sie mir bitte, wer das Messer hatte!« Jetzt glänzten die Gesichter beider Männer vor Schweiß. Lukowskis Arm war bis zum Ellbogen rot. Ich dachte: Wenn du auf dem Bürgersteig vor einem Sterbenden in einer Blutlache stehst, würdest du ihm dieselben Fragen stellen, nicht wahr? Und ihm dieselben Lügen auftischen, um ihn zu beruhigen?
»Wer war es, Danny?«
Mein Bruder.
»Ihr Bruder hatte das Messer?«
Nein. Ich kann mich nicht erinnern, was geschehen ist. Fragen Sie mich später noch einmal. Jetzt bin ich noch zu sehr durcheinander.
»Warum haben Sie gesagt, dass es Ihr Bruder war? War er es, oder war er es nicht?«
Natürlich war er es nicht. Erzählen Sie niemandem, ich hätte so etwas gesagt. Damit bringen Sie mich nur durcheinander. Könnte ich jetzt das Schmerzmittel haben? Bitte.
Sein Gesicht bewegte sich und erstarrte, es bewegte sich und erstarrte, wie eine Abfolge von Masken, was seinem Leid etwas Stilisiertes, Abstraktes gab. Er bewegte seinen Kopf vor und zurück, zunächst nur schwach, dann mit geradezu manischer Geschwindigkeit und Heftigkeit. Ich vermutete, dass er eine Art Anfall hatte, dass die Wiederbelebungsmittel irgendwelche beschädigten Nervenbahnen überreizten.
Dann hob er die rechte Hand und riss die Bandagen über den Augen fort.
Er hörte sofort mit den Kopfbewegungen auf. Vielleicht war seine Haut überempfindlich geworden, so dass er die Augenbinde nicht mehr ertragen konnte. Er blinzelte einige Male und starrte dann zur Deckenbeleuchtung hinauf. Ich sah, wie seine Pupillen sich zusammenzogen, wie seine Augen sich gezielt bewegten. Er hob ein wenig den Kopf und musterte Lukowski, dann blickte er auf seinen eigenen Körper und dessen ungewöhnliche Verzierungen: das farbige Kabel des Schrittmachers, die dicken Blutversorgungsschläuche aus Plastik, die Messerwunden voller blassweißer Maden. Niemand rührte sich, niemand sagte ein Wort, während er die Nadeln und Elektroden betrachtete, die in seiner Brust steckten, die seltsame rosafarbene Flüssigkeit, die aus seinen Wunden sickerte, seine zerstörten Lungen, die künstliche Luftzufuhr. Der Bildschirm befand sich hinter ihm, aber alles andere konnte er mit einem einzigen Blick erfassen. Es war nur eine Sache von Sekunden, bis er verstanden hatte. Ich konnte geradezu beobachten, wie die Erkenntnis über ihn kam.
Er öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Sein Gesichtsausdruck veränderte sich in rascher Folge. Nach dem Schmerz kam ein plötzliches Erstaunen und dann die beinahe amüsierte Erkenntnis der Fremdartigkeit der Situation. Vielleicht war darin auch eine Spur von Bewunderung für die perverse Virtuosität, mit der man seinetwegen diese Anstrengungen unternommen hatte. Einen Moment lang wirkte er tatsächlich wie jemand, der sich über einen genialen, boshaften, blutigen Scherz, der auf seine Kosten ging, amüsierte.
Dann sagte er deutlich, nur unterbrochen von gezwungenen, roboterhaften Keuchern: »Ich … glau … be … nicht … dass … das … eine … gute … Idee … war … ich … wer … de … nichts … mehr … sa … gen.«
Er schloss die Augen und ließ sich auf den Operationstisch zurückfallen. Seine Werte gingen rapide nach unten.
Lukowski drehte sich zur Pathologin um. Er war kreidebleich, aber er hielt immer noch die Hand des Jungen fest. »Wie konnte seine Netzhaut reaktiviert werden? Was haben Sie gemacht? Sie dumme …« Er hob seine freie Hand, als wollte er sie schlagen, führte die Bewegung aber nicht zu Ende. Auf dem T-Shirt des Bioethikers stand nun: EWIGE LIEBEISTEIN KUSCHELTIER, DASAUSDER DNS DEINES LIEBESPARTNERSGEKLONTIST.
Die Pathologin ließ sich den Vorwurf nicht gefallen und schrie zurück: »Aber Sie mussten ihn drängen! Sie mussten immer wieder von seinem Bruder anfangen, während sein Stresshormonindex längst in den roten Bereich geklettert war!« Ich fragte mich, wer entschieden hatte, wie hoch der normale Adrenalinpegel für jemanden liegen sollte, der keine weiteren Probleme hatte, außer dass er an einer Stichverletzung gestorben war. Irgendjemand hinter meinem Rücken stieß eine Kette zusammenhangloser Obszönitäten hervor. Ich drehte mich um und sah, dass es der Sanitäter war, der seit dem Eintreffen der Ambulanz nicht von Cavolinis Seite gewichen war. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass er sich immer noch in diesem Raum befand. Er starrte auf den Fußboden, hatte die Hände zu Fäusten geballt und zitterte vor Wut.
Lukowski packte mich am Ellbogen und beschmutzte mich mit synthetischem Blut. Er sprach in einer Art Bühnenflüstern, als hoffte er, dass seine Worte auf diese Weise nicht aufgezeichnet würden. »Sie können den nächsten filmen, okay? So etwas ist noch nie zuvor geschehen – niemals! – und wenn Sie der Öffentlichkeit den einzigen Ausrutscher unter einer Million zeigen, als wäre es die …«
Der Bioethiker versuchte zu beschwichtigen. »Ich denke, die Richtlinien des Taylor-Komitees hinsichtlich möglicher Einschränkungen reichen aus, um …«
Der Assistent der Pathologin drehte sich zornig zu hie um. »Wer hat Sie nach Ihrer Meinung gefragt? Die Verfahrensweise geht Sie überhaupt nichts an, Sie armseliges …«
Ein Alarmsignal schrillte ohrenbetäubend los, das von irgendwo aus den elektronischen Innereien der Wiederbelebungsapparate kam. Der Assistent beugte sich über die Geräte und hämmerte auf die Tastatur ein, wie ein frustriertes Kind, das seine Wut an einem kaputten Spielzeug auslässt, bis der Lärm aufhörte.
In der anschließenden Stille schloss ich kurz die Augen, rief Witness auf und schaltete die Aufzeichnung ab. Ich hatte genug gesehen.
Dann kam Daniel Cavolini wieder zu Bewusstsein und begann zu schreien.
Ich sah zu, wie sie ihn mit Morphin vollpumpten und darauf warteten, dass die Wiederbelebungsmittel ihn endgültig töteten.
2
Es war kurz nach fünf, als ich den Eastwood-Bahnhof verließ und zu Fuß weiterging. Der Himmel war bleich und farblos, die Venus verblasste allmählich im Osten – aber die Straße sah schon genauso aus wie bei Tageslicht. Nur erstaunlich verlassen. Der Eisenbahnwagen war ebenfalls leer gewesen. Es war die Zeit, in der man sich wie der letzte Mensch auf Erden fühlen konnte.
Vögel zwitscherten – recht laut – im üppigen Buschland entlang des Eisenbahnkorridors und im Labyrinth der Parkwälder, die die umgebenden Vorstädte durchzogen. Viele dieser Parks machten den Eindruck unberührter Natur, doch jeder Baum und jeder Strauch war künstlich. Die Pflanzen waren zumindest gegen Trockenheit und Feuer resistent und warfen keine unordentlichen Zweige, Blätter oder Rindenstücke ab, die sich entzünden konnten. Totes Material wurde resorbiert und wiederverwertet. Ich hatte in einer Zeitrafferaufnahme gesehen (eine filmische Technik, die ich niemals selbst anwendete), wie ein kompletter verdorrter brauner Ast sich in den lebenden Stamm zurückgezogen hatte. Die meisten Bäume erzeugten eine bescheidene Menge an Elektrizität, die hauptsächlich aus Sonnenlicht gewonnen wurde. Allerdings handelte es sich um einen komplizierten chemischen Prozess, und die gespeicherte Energie wurde kontinuierlich über vierundzwanzig Stunden am Tag abgegeben. Spezialisierte Wurzeln verbanden sich mit den unterirdischen Supraleitern, die die Parks durchzogen, und speisten ihren Energiebeitrag ein. Zweieinviertel Volt an Elektrizität waren an sich kein Sicherheitsrisiko, doch für eine wirksame Übertragung musste der Widerstand auf Null reduziert sein.
Auch ein Teil der Fauna war modifiziert worden. Die Elstern verhielten sich sogar im Frühling friedlich, die Moskitos mieden das Blut von Säugetieren, und die giftigsten Schlangen konnten nicht einmal einem menschlichen Kind Schaden zufügen. Innerhalb der manipulierten Vegetation hatten sie in biochemischer Hinsicht leichte Vorteile gegenüber ihren wilden Verwandten, wodurch die Dominanz der veränderten Spezies in diesem Mikrobiotop garantiert wurden. Andererseits verhinderten gewisse Handicaps, dass sie sich in den echten Wildreservaten fern von menschlichen Ansiedlungen vermehren konnten, sollten sie jemals entkommen.
Ich hatte eine alleinstehende Wohneinheit in einer Vierergruppe am Ende einer Sackgasse gemietet, die in einem wartungsfreien Garten lag, der nahtlos in den Ausläufer eines Parks überging. Ich wohnte dort schon seit acht Jahren, seit meinem ersten Auftrag für SeeNet, aber ich kam mir hier immer noch wie ein Eindringling vor. Eastwood lag nur fünfzehn Kilometer vom Zentrum Sydneys entfernt, was sich unverständlicherweise immer noch auf die Grundstückspreise auswirkte, obwohl im Grunde kaum jemand einen Vorteil von der Citynähe hatte. Selbst in hundert Jahren hätte ich den Kaufpreis nicht abzahlen können. Die gerade noch erträgliche Miete war nicht mehr als ein günstiger Nebeneffekt des ausgeklügelten Steuersparplans des Eigentümers – und es war vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis der Flügelschlag eines Schmetterlings auf den globalen Finanzmärkten die Großzügigkeit der Networks schwinden ließ oder mein Vermieter nicht mehr auf Abschreibungsobjekte angewiesen war. Ich konnte jederzeit mit einem Fußtritt fünfzig Kilometer westwärts versetzt werden, zurück an den äußersten Stadtrand, wo mein angestammter Platz war.
Ich näherte mich vorsichtig. Mein Zuhause hätte nach den Ereignissen dieser Nacht eigentlich meine Zuflucht sein sollen, doch ich zögerte etwa eine Minute lang an der Vordertür, den Schlüssel in der Hand.
Gina war bereits aufgestanden, angezogen und mit dem Frühstück beschäftigt. Ich hatte sie seit ziemlich genau vierundzwanzig Stunden nicht gesehen. Es war beinahe, als wäre ich gar nicht fortgewesen.
»Hast du gute Bilder gemacht?«, fragte sie. Ich hatte ihr aus dem Krankenhaus eine Nachricht geschickt und ihr mitgeteilt, dass wir endlich Glück gehabt hatten.
»Ich möchte nicht darüber reden.« Ich zog mich ins Wohnzimmer zurück und ließ mich in einen Sessel fallen. Die Tätigkeit des Hinsetzens erzeugte ein Echo in meinem Innenohr. Ich erlebte immer wieder, wie ich mich niedersinken ließ. Als ich meinen Blick auf das Muster des Teppichs konzentrierte, ließ die Illusion allmählich nach.
»Andrew? Was ist geschehen?« Sie war mir ins Wohnzimmer gefolgt. »Ist etwas schiefgegangen? Musst du noch mal drehen?«
»Ich sagte, ich möchte nicht …« Dann riss ich mich zusammen. Ich blickte zu ihr auf und zwang mich zur Konzentration. Sie war verwirrt, aber noch nicht wütend. Regel Nummer drei: Erzähle ihr alles bei der erstbesten Gelegenheit, ganz gleich, wie unangenehm es sein mag. Alles andere wird dazu führen, dass sie sich ausgeschlossen und persönlich beleidigt fühlt.
Also sagte ich: »Ich muss nicht noch einmal drehen. Es ist vorbei.« Dann erzählte ich ihr, was geschehen war.
Gina schien sich unwohl zu fühlen. »Und war das, was er sagte, die … Prozedur wert? Ergibt es irgendeinen Sinn, dass er seinen Bruder erwähnte – oder waren es nur die verworrenen Gedanken eines geschädigten Gehirns?«
»Das steht noch nicht fest. Anscheinend neigt sein Bruder tatsächlich zu Gewalttätigkeiten, denn er wurde zu einer Bewährungsstrafe wegen eines Angriffs auf seine Mutter verurteilt. Man wird ihn zu dieser Sache befragen … aber vielleicht hat es nichts zu sagen. Wenn das Kurzzeitgedächtnis des Opfers bereits ausgelöscht war, hat sein Gehirn möglicherweise nur die nächstliegende Person mit dem Messerstich in Verbindung gebracht, die seiner Ansicht nach zu einer solchen Tat fähig sein könnte. Und als er seine Aussage abänderte, hat er vielleicht gar nicht versucht, etwas zu vertuschen, sondern einfach nur erkannt, dass er sein Gedächtnis verloren hat.«
»Selbst wenn der Bruder ihn tatsächlich getötet hat«, überlegte Gina, »würde kein Gericht ein paar zusammenhanglose Worte, die nach einer sofortigen Wiederbelebung geäußert wurden, als Beweis anerkennen. Wenn es zu einem Urteil kommt, wird es sich nicht auf die Prozedur stützen.«
Es war schwierig, gegen diese Behauptung zu argumentieren. Ich musste mich anstrengen, um die Perspektiven zu überschauen.
»Zumindest nicht in diesem Fall. Doch bei einigen Gelegenheiten war die Befragung ausschlaggebend. Die Aussagen des Opfers allein haben juristisch kein großes Gewicht – aber es wurden Mordanklagen gegen Personen erhoben, die andernfalls niemals in Verdacht geraten wären. In diesen Fällen hat man die entsprechenden Beweise erst gefunden, nachdem die Ermittlungen durch die Aussagen des Opfers in die richtige Richtung gelenkt wurden.«
Gina war offensichtlich nicht überzeugt. »Das mag ein- oder zweimal geschehen sein, aber letztlich ist es den Aufwand nicht wert. Man sollte diese Prozedur verbieten, denn sie ist pervers.« Sie zögerte. »Du wirst diese Aufnahmen doch nicht verwenden, oder?«
»Natürlich werde ich sie verwenden.«
»Du willst einen Menschen zeigen, der unter Qualen auf dem Operationstisch stirbt? Jemanden, der erkannt hat, dass das, was ihn noch einmal zum Leben erweckt hat, ihn unausweichlich töten wird?« Sie sprach mit ruhiger Stimme. Sie klang eher fassungslos als erzürnt.
»Was soll ich deiner Meinung nach stattdessen tun?«, fragte ich. »Eine Dramatisierung zeigen, in der alles nach Plan verläuft?«
»Nein. Aber warum zeigst du nicht eine Dramatisierung, in der alles schiefgeht, und zwar genauso, wie es geschehen ist?«
»Wozu? Es ist doch genauso geschehen, und ich habe alles gefilmt. Wer hätte etwas von einer Rekonstruktion?«
»Zum Beispiel die Familie des Opfers.«
Möglicherweise, dachte ich. Aber würde eine Rekonstruktion wirklich ihre Gefühle schonen? Auf jeden Fall würde niemand sie dazu zwingen, die Dokumentation anzusehen.
»Sei vernünftig«, sagte ich. »Es sind spektakuläre Aufnahmen, ich kann sie nicht einfach wegwerfen. Und ich habe das Recht, sie zu benutzen. Ich hatte alle notwendigen Genehmigungen, mich dort aufzuhalten – von der Polizei und vom Krankenhaus. Und ich werde auch das Einverständnis der Familie einholen …«
»Du meinst, die Anwälte des Senders werden sie so lange bearbeiten, bis sie ›im Interesse der Öffentlichkeit‹ irgendeine Verzichtserklärung unterschreiben.«
Darauf wusste ich keine Erwiderung, denn es war genau das, was geschehen würde. »Du hast gerade erklärt, dass die Wiederbelebung pervers ist«, sagte ich. »Du willst, dass die Prozedur verboten wird? Damit könnte ich einen wichtigen Anstoß für die Kampagne liefern. Kein Maschinenstürmer könnte sich ein besseres Beispiel für Frankensteinologie wünschen.«
Gina wirkte getroffen, aber ich konnte nicht erkennen, ob sie mir möglicherweise etwas vorspielte. »Ich habe einen Doktor in Materialwissenschaft, du Bauer«, sagte sie, »also bezeichne mich nicht als …«
»Das habe ich gar nicht getan. Du weißt, was ich gemeint habe.«
»Wenn irgendjemand ein Maschinenstürmer ist, dann du. Das Ganze klingt allmählich nach Edeniten-Propaganda. ›Gepanschtes DNS!‹ Und wie lautet der Untertitel? ›Ein biotechnischer Alptraum‹?«
»Du bist nahe dran.«
»Ich verstehe nur nicht, wieso du nicht eine einzige positive Geschichte bringen kannst …«
»Das haben wir doch schon mehrfach ausdiskutiert«, erwiderte ich erschöpft. »Ich habe keinen Einfluss darauf. Die Sender kaufen nur Geschichten, die einen Skandal versprechen. In diesem Fall sind es die Schattenseiten der Biotechnik. Darum geht es, das Thema muss mit einem Standpunkt vermittelt werden. Es geht nicht um ›Ausgewogenheit‹. Ausgewogenheit irritiert die Marketingleute. Man kann nichts lancieren, in dem zwei sich widersprechende Botschaften enthalten sind. Es wäre zumindest eine Gegenstimme zu all den Lobeshymnen an die Gentechnik, mit denen in letzter Zeit jeder beträufelt wird. Und im großen Zusammenhang dient es letztlich dazu, ein ausgewogenes Gesamtbild zu liefern. Indem ich das hinzufüge, was alle anderen ausklammern.«
Gina blieb ungerührt. »Das ist unaufrichtig. ›Unsere Sensationsmache gleicht nur die Sensationsmache der anderen aus.‹ So ist es nicht. Damit werden nur die Meinungen polarisiert. Was ist so falsch an einer mäßigen, vernünftigen Vorstellung der Tatsachen – die durchaus dazu beitragen könnte, dass die Wiederbelebung und andere skandalöse Gräueltaten verboten werden –, ohne all den alten Unsinn über ›Sünden wider die Natur‹ aufzuwärmen? Warum kann man nicht die Exzesse zeigen und sie trotzdem in den großen Zusammenhang stellen? Du solltest den Menschen dabei helfen, ihre Entscheidungen auf der Grundlage von Tatsacheninformationen zu treffen, damit sie begründete Forderungen an die Kontrollinstanzen stellen können. Ein Titel wie Gepanschtes DNS dürfte sie eher dazu verleiten, einen Bombenanschlag auf das nächste biotechnische Labor zu verüben.«
Ich kauerte mich in den Sessel und stützte meinen Kopf auf den Knien ab. »Also gut, ich gebe auf. Alles, was du sagst, ist wahr. Ich bin ein mit Vorurteilen behafteter, wissenschaftsfeindlicher Unruhestifter.«
Sie runzelte die Stirn. »Wissenschaftsfeindlich? So weit würde ich nicht gehen. Du bist käuflich, bequem und verantwortungslos – aber du bist noch kein Anwärter auf die Mitgliedschaft in einem Ignoranzkult.«
»Dein Vertrauen rührt mich.«
Sie warf ein Kissen nach mir, ich glaube, in liebevoller Absicht, und kehrte dann in die Küche zurück. Ich vergrub mein Gesicht in den Händen, worauf der Raum zur Seite kippte.
Ich hätte jubeln sollen. Es war vorbei. Die Wiederbelebung war der allerletzte Filmbeitrag für Gepanschtes DNS. Keine paranoiden Milliardäre mehr, die sich in völlig autonome Ökosphären verwandelt hatten. Keine Versicherungsgesellschaften mehr, die Implantate konstruieren ließen, um Ernährung, sportliche Aktivitäten und Umweltbelastungen zu überwachen und daraus immer wieder neu die wahrscheinliche Lebenserwartung und vermutliche Todesursache der Versicherten zu berechnen. Keine Freiwilligen Autisten mehr, die um das Recht kämpften, sich die Gehirne chirurgisch verstümmeln zu lassen, um endlich den Zustand zu erreichen, der ihnen bislang von der Natur vorenthalten worden war …
Ich ging in mein Arbeitszimmer und zog das Ende des Glasfaserkabels aus der Schnittkonsole. Ich hob mein T-Shirt an und entfernte einige Überreste, auf die ich nicht weiter eingehen möchte, aus meinem Nabel. Dann zog ich den hautfarbenen Stecker mit den Fingernägeln heraus und legte eine kurze Röhre aus rostfreiem Stahl frei, die in einem opalisierenden Laserport endete.
Gina rief aus der Küche: »Gibst du dich wieder einmal sittenwidrigen Handlungen mit deiner Maschine hin?«
Ich war viel zu müde für eine intelligente Entgegnung. Ich steckte die Anschlüsse zusammen, worauf die Konsole zum Leben erwachte.
Der Bildschirm zeigte alles, was überspielt wurde. Acht Stunden auf sechzig Sekunden gerafft. Das meiste war unidentifizierbares Geflimmer, aber ich wandte dennoch den Blick ab. Ich hatte keine Lust, die Ereignisse der vergangenen Nacht noch einmal zu durchleben, nicht einmal in Form eines flüchtigen Eindrucks.
Als Gina mit einem Teller Toast hereinkam, drückte ich auf einen Knopf, um den Bildschirm abzuschalten. »Trotzdem würde ich gerne wissen«, sagte sie, »wie du mit viertausend Terabyte RAM in der Bauchhöhle herumlaufen kannst, ohne sichtbare Narben aufzuweisen.«
Ich blickte auf die Steckverbindung hinunter. »Wie nennst du das? Unsichtbar?«
»Zu klein. Achthundert-Terabyte-Chips haben einen Durchmesser von dreißig Millimetern. Ich habe im Katalog des Herstellers nachgesehen.«
»Sherlock lässt grüßen, wie? Oder sollte ich Shylock sagen? Narben lassen sich beseitigen, wie dir bekannt sein dürfte.«
»Ja, aber … hättest du die Narben deines wichtigsten Initiationsrituals entfernen lassen?«
»Erspare mir dieses Anthropologengeschwätz.«
»Ich hätte da eine alternative Theorie.«
»Ich habe weder etwas bestätigt noch abgestritten.«
Sie ließ ihren Blick über den leeren Konsolenbildschirm wandern, dann hinauf zum Repo-Man-Poster an der Wand dahinter. Es zeigte einen Motorradpolizisten, der hinter einem zerbeulten Auto stand. Sie schaute mich kurz an und deutete dann auf die Schlagzeile: SCHAUNICHTINDEN KOFFERRAUM!
»Warum nicht? Was befindet sich im Kofferraum?«
Ich lachte. »Du kannst es nicht mehr ertragen, wie? Dann wirst du dir den Film ansehen müssen.«
»Ja, ja.«
Die Konsole piepte. Ich entklinkte mich. Gina sah mir neugierig zu. Mein Gesichtsausdruck musste ihr irgendetwas verraten haben. »Ist es eher wie Sex … oder wie Defäkation?«
»Eher wie die Beichte.«
»Du bist in deinem ganzen Leben noch nie bei einer Beichte gewesen.«
»Nein, aber ich habe es paar Mal in Filmen gesehen. Und es sollte ohnehin ein Scherz sein. Es ist nichts von allem.«
Sie warf einen Blick auf ihre Uhr, küsste mich auf die Wange und hinterließ ein paar Toastkrümel auf meiner Haut. »Ich muss mich beeilen. Leg dich schlafen, du Idiot. Du siehst furchtbar aus.«
Ich setzte mich und hörte zu, wie sie in der Wohnung herumkramte. Sie machte an jedem Morgen eine neunzigminütige Zugfahrt zum CSIRO-Forschungszentrum für Windturbinen, das westlich der Blauen Berge lag. Meistens stand ich gemeinsam mit ihr auf. Es war besser, als allein aufzuwachen.
Ich dachte: Ich liebe sie wirklich. Und wenn ich mich konzentriere, wenn ich die Regeln beachte, gibt es keinen Grund, warum sich daran etwas ändern sollte. Ich stand kurz davor, meinem bisherigen Rekord von achtzehn Monaten zu übertreffen – aber deswegen musste ich mir keine Sorgen machen. Wir würden ihn mühelos brechen.
Sie erschien wieder im Türrahmen. »Wie viel Zeit hast du, um diesen Bericht zu schneiden?«
»Oh. Genau drei Wochen. Den heutigen Tag mitgerechnet.« Daran hatte ich nicht unbedingt erinnert werden wollen.
»Heute zählt nicht. Sieh zu, dass du etwas schläfst.«
Wir küssten uns. Sie ging. Ich drehte mich mit dem Stuhl herum und starrte auf die leere Konsole.
Nichts war vorbei. Ich würde mir noch hundertmal ansehen müssen, wie Daniel Cavolini starb, bevor ich ihn endgültig vergessen konnte.
Ich humpelte ins Schlafzimmer und zog mich aus. Ich hängte meine Kleidung ins Reinigungsgestell und schaltete den Strom ein. Die Polymere der verschiedenen Textilien stießen ihre Feuchtigkeit mit einem leichten Dunsthauch aus und verpackten dann den übrigen Schmutz und getrockneten Schweiß zu einem feinen Staub, den sie elektrostatisch abstießen. Ich sah zu, wie er in den Auffangbehälter rieselte. Er wies wie jedes Mal dieselbe beunruhigende Blautönung auf – was angeblich irgendetwas mit der Größe der Teilchen zu tun hatte. Ich nahm eine schnelle Dusche und stieg dann ins Bett.
Ich stellte den Wecker auf zwei Uhr nachmittags. Die Pharmaeinheit neben dem Wecker fragte: »Soll ich eine Melatonin-Kur vorbereiten, damit du morgen Abend wieder im gewohnten Tagesrhythmus bist?«
»Ja, meinetwegen.« Ich steckte den Daumen in die Teströhre. Der winzige Stich war kaum zu spüren, als mir Blut abgezapft wurde. Völlig schmerzfreie NMR-Modelle waren schon seit einigen Jahren im Handel, aber immer noch zu teuer für mich.
»Möchtest du etwas, das dir beim Einschlafen hilft?«
»Ja.«
Die Einheit summte leise, während sie ein Sedativum zusammenmixte, das auf meine gegenwärtige biochemische Konstitution und meine beabsichtigte Schlafdauer abgestimmt war. Die Syntheseeinheit arbeitete mit programmierbaren Katalysatoren – zehn Milliarden elektronisch rekonfigurierbare Enzyme, die von einem Halbleiterchip gesteuert wurden. Aus dem Vorrat von Basismolekülen konnte der Chip innerhalb kürzester Zeit wenige Milligramm einer beliebigen von zehntausend möglichen Substanzen herstellen. Oder zumindest diejenigen, für die ich die nötige Software hatte, solange ich die anfallenden Lizenzgebühren zahlte.
Die Maschine spuckte eine kleine Tablette aus, die immer noch ein wenig warm war. Ich biss vorsichtig hinein. »Orangengeschmack nach einer langen Nacht! Du hast es dir gemerkt!«
Ich legte mich zurück und wartete darauf, dass das Medikament seine Wirkung entfaltete.
Ich hatte den Ausdruck auf seinem Gesicht gesehen – aber seine Muskeln waren gelähmt und unkontrollierbar gewesen. Ich hatte seine Stimme gehört – aber die Luft, mit der er gesprochen hatte, war nicht seine eigene Atemluft gewesen. Ich würde niemals nachvollziehen können, was genau er empfunden hatte.
Es war nicht ›Die Affenpfote‹ oder ›Das verräterische Herz‹.
Es war eher ›Das vorzeitige Begräbnis‹.
Aber ich hatte kein Recht, um Daniel Cavolini zu trauern, denn ich würde seinen Tod an die ganze Welt verkaufen.
Und ich hatte kein Recht, Mitgefühl zu entwickeln, mir vorzustellen, ich wäre an seiner Stelle gewesen.
Wie bereits Lukowski gesagt hatte, würde ich niemals in eine solche Situation kommen.
3
In einem Museum hatte ich einmal eine 1950er Moviola in einer Glasvitrine gesehen. Fünfunddreißig Millimeter breites Zelluloid wurde auf verschlungenen Wegen durch das Innere der Maschine gezogen, bewegte sich vor und zurück zwischen zwei riemengetriebenen Spulen, die an vertikalen Armen hinter der kleinen Leinwand hingen. Das Summen des Motors, das Knirschen des Getriebes, das Hubschrauberrattern der Blendenflügel – alles Geräusche, die von einer Videoaufzeichnung der Maschine in Aktion kamen, die auf einem Bildschirm unter dem Schaukasten ablief – hatten eher nach einem Reißwolf als nach einem Instrument zur Filmmontage geklungen.
Eine reizvolle Vorstellung. Es tut mir sehr leid … aber diese Szene ist unwiederbringlich verloren. Die Moviola hat sie gefressen. Natürlich war es damals üblich gewesen, mit nur einer Kopie der originalen Kameraaufnahme zu arbeiten (zumeist mit einem Negativ), aber die Vorstellung, dass ein lockeres Zahnrad dazu führte, dass meterweise kostbares Zelluloid in Konfetti verwandelt wurde, hatte mich seitdem nicht mehr losgelassen – eine wunderbare verbotene Phantasievorstellung.
Meine drei Jahre alte Schnittkonsole von Affine Graphics, Baujahr 2052, war nicht in der Lage, irgendetwas zu zerstören. Jede Aufnahme, die ich einspeiste, wurde auf zwei unabhängige, nur einmal beschreibbare Speicherchips gebrannt und zudem automatisch in codierter Form an Archive in Mandela, Stockholm und Toronto weitergeleitet. Jeder folgende Schnittvorgang war lediglich eine Auswahl und Neuordnung des unberührbaren Originals. Ich konnte selektiv und nach Belieben aus der Rohfassung zitieren. Ich konnte paraphrasieren, substituieren und improvisieren. Aber nicht ein einziges Bild des Originals konnte jemals unwiderruflich zerstört werden oder verlorengehen.
Doch in Wahrheit hegte ich keinerlei Neid auf meine Kollegen aus der analogen Ära. Die komplizierte Mechanik ihres Handwerks hätte mich in den Wahnsinn getrieben. Der langsamste Arbeitsschritt bei der digitalen Montage war die menschliche Entscheidungsfindung, und ich hatte gelernt, beim zehnten oder zwölften Versuch zum richtigen Urteil zu kommen. Die Software konnte den Rhythmus einer Szene frisieren, jeden Schnitt feinabstimmen, den Ton verbessern und unerwünschte Passanten entfernten – sogar komplette Gebäude versetzen, falls es notwendig war. Um die Mechanik musste ich mich nicht kümmern, so dass es nichts gab, was mich von den Inhalten ablenkte.
Das einzige, was ich mit Gepanschtes DNS machen musste, bestand darin, Echtzeitaufnahmen von einhundertachtzig Stunden in etwas Sinnvolles von fünfzehn Minuten Länge zu transformieren.
Ich hatte vier Geschichten gedreht und wusste bereits, wie ich sie anordnen wollte, nämlich als allmählichen Übergang von Grau nach Schwarz. Ned Landers und die wandelnde Ökosphäre. Das Versicherungsimplantat der HealthGuard. Die Interessengruppe Freiwilliger Autisten. Und Daniel Cavolinis Wiederbelebung. SeeNet hatte nach Exzessen, nach Extremen und Frankensteinologie verlangt. Und ich würde keine Probleme damit haben, ihnen genau das zu geben, was sie wollten.
Landers hatte sein Vermögen mit Trockencomputern verdient, nicht mit Biotechnik, aber dann hatte er mehrere Molekulargenetik-Firmen gekauft, die über große Forschungs- und Entwicklungskapazitäten verfügten und ihm bei seiner persönlichen Mutation behilflich sein sollten. Er hatte mich angefleht, ihn in einer versiegelten geodätischen Kuppel voller Schwefeldioxid, verschiedenen Stickoxiden und Benzolverbindungen zu filmen – ich in einem Druckanzug, er selbst in Badehosen. Wir hatten es versucht, aber die Glasscheibe vor meinem Gesicht hatte sich immer wieder mit karzinogenen Ablagerungen beschlagen, so dass wir ein neues Treffen in Portland vereinbaren mussten. Obwohl die vergiftete Kuppel zunächst vielversprechend gewirkt hatte, erwies sich der tadellose blaue Himmel des Staates, dessen Gesetzgebung mit Kalifornien um die niedrigsten Emissionswerte jedes bekannten Schadstoffs wetteiferte, dann doch als wesentlich surrealerer Hintergrund.
»Ich muss überhaupt nicht atmen, wenn mir der Sinn danach steht«, hatte Landers mir anvertraut, während er von einem sichtlichen Überfluss an frischer, sauberer Luft umgeben war. Diesmal hatte ich ihn überreden können, das Interview in einem kleinen Park zu führen, genau gegenüber des bescheidenen Hauptgebäudes der NL-Gruppe. (Im Hintergrund spielten einige Kinder Fußball, aber die Konsole würde sich um alle Zwischenübergänge kümmern und im Problemfall auf Knopfdruck eine Lösung anbieten.) Landers war Ende Vierzig, aber er hätte sich problemlos als fünfundzwanzig ausgeben können. Mit seinem robusten Körperbau, dem goldenen Haar, den blauen Augen und der strahlend rosafarbenen Haut sah er eher wie die Hollywood-Version eines Farmers aus Kansas (aus den guten alten Zeiten) als ein reicher Exzentriker aus, dessen Körper mit genetisch manipulierten Algen und fremden Genen überschwemmt war. Ich betrachtete ihn auf dem Flachbildschirm der Konsole und hörte seinen Worten zu, die aus den simplen Stereo-Lautsprechern kamen. Ich hätte die Aufzeichnung direkt in meine Seh- und Hörnerven einspeisen können, aber die meisten Zuschauer benutzten einen Bildschirm oder einen Kopfhörer, weswegen ich mich davon überzeugen musste, dass die Software wirklich ein ruhiges, glaubwürdiges und rechteckiges Pixelmuster aus den stenographischen Skizzen meiner Netzhaut erzeugt hatte.
»Die Symbionten, die in meinem Blutkreislauf leben, können immer wieder neuen Sauerstoff aus dem Kohlendioxid zurückgewinnen. Sie erhalten die nötige Energie durch Sonnenlicht, das auf meine Haut fällt, und sie setzen jedes Glukosemolekül frei, das sie entbehren können. Aber das reicht nicht annähernd aus, um mich zu ernähren, und sie benötigen alternative Energiequellen, wenn es dunkel ist. Dafür sind die Symbionten im Magen- und Darmtrakt da. Ich habe siebenunddreißig verschiedene Typen, die sich gegenseitig ergänzen. Ich kann Gras essen. Ich kann Papier verdauen. Ich könnte mich von alten Gummireifen ernähren, wenn ich sie in Stücke schneide, die klein genug sind, um sie verschlucken zu können. Wenn morgen jedes pflanzliche und tierische Leben von der Erde verschwinden würde, könnte ich tausend Jahre lang mit Hilfe von Autoreifen überleben. Ich besitze eine Karte, auf der sämtliche Deponien alter Reifen in den USA verzeichnet sind. Die meisten sollen biologisch wiederverwertet werden, aber ich will per gerichtlichem Beschluss durchsetzen, dass einige Deponien erhalten bleiben. Ich glaube, dass sie, abgesehen von meinen persönlichen Interessen, ein Teil unseres kulturellen Erbes darstellen und wir verpflichtet sind, sie für kommende Generationen zu erhalten.«
Ich nahm einige mikroskopische Aufnahmen der Algen und Bakterien, die in seinem Blut und seinen Gedärmen lebten, und schnitt sie in das Interview, außerdem eine Reproduktion der Autoreifenkarte, die er mir auf seinem Notepad gezeigt hatte. Ich spielte ein wenig mit einer Animation herum, die ich vorbereitet hatte, ein Diagramm seiner Kohlenstoff-, Sauerstoff- und Energiezyklen, aber ich war mir noch nicht sicher, an welcher Stelle ich die Szene bringen sollte.
»Also können Ihnen Hungersnöte und Massensterben nichts anhaben«, hatte ich nachgehakt, »aber wie steht es mit Viren? Was ist mit biologischer Kriegsführung oder natürlichen Epidemien?« Ich schnitt meine Frage heraus, denn sie war überflüssig, und ich zog es vor, mich so wenig wie möglich einzumischen. Der Themenwechsel kam ein wenig unvermittelt, daher ließ ich eine Szene synthetisieren, in der Landers sagte: »Doch die Veränderungen betreffen nicht nur die Symbionten.« Dann ließ ich die Szene vom Computer nahtlos an seine tatsächlichen Worte anschließen: »Ich wechsele nach und nach alle Zellstämme meines Körper aus, die die geringste Widerstandsfähigkeit gegen virale Infektionen aufweisen. Viren bestehen aus DNS oder RNS, das heißt, sie funktionieren nach denselben biochemischen Prinzipien wie jeder andere Organismus auf diesem Planeten. Deshalb können sie in menschliche Zellen eindringen, um sich dort zu reproduzieren. Aber die DNS und RNS lässt sich durch völlig anders aufgebaute chemische Moleküle ersetzen – mit anderen Basenpaaren, die an die Stelle der üblichen treten. Es ist ein neues Alphabet für den genetischen Code: statt Guanin mit Cytosin und Adenin mit Thymin zu kombinieren, anstelle von G mit C und A mit T, lässt es sich genauso durch X mit Y und W mit Z realisieren.«
Nach ›kombinieren‹ änderte ich den Wortlaut ab und ließ ihn sagen: »… kann man genauso vier alternative Moleküle verwenden, die in der Natur nicht vorkommen.« Der Sinn war derselbe, aber so wurde es etwas klarer. Doch als ich die Szene noch einmal abspielte, klang sie irgendwie nicht richtig, also beließ ich es doch beim ursprünglichen Wortlaut.
Jeder Journalist paraphrasierte heine Themen; wenn ich mich weigern würde, diese Techniken anzuwenden, könnte ich nicht arbeiten. Der Trick bestand darin, ehrlich zu bleiben – was ungefähr genauso schwierig war, wenn dasselbe für den gesamten Prozess der Montage eines Berichts gelten sollte.
Ich schnitt eine graphische Darstellung aus dem Archiv hinein, die ein normales DNS-Molekül mit jedem einzelnen Atom der paarweisen Basen an den Helix-Strängen zeigte, dann wies ich je einem Beispiel beider Basenpaare einen bestimmten Farbcode zu. Landers hatte nicht verraten wollen, welche alternativen Basen er benutzte, aber in der Literatur hatte ich zahlreiche Möglichkeiten gefunden. Mit der Graphik-Software ersetzte ich die alten Basen durch vier plausible neue und wiederholte die langsame Zoom- und Drehbewegung der Eingangsszene mit dieser hypothetischen Landers-DNS. Dann schnitt ich auf sein Gesicht zurück.
»Doch ein simpler Austausch der DNS-Basen reicht natürlich nicht aus. Die Zellen benötigen völlig neue Enzyme, um diese neuen Basen synthetisieren zu können – und die meisten der Proteine, die mit der DNS und RNS interagieren, müssen entsprechend verändert werden. Das heißt, die Gene müssen in diese neue Sprache übersetzt und nicht nur mit neuen Buchstaben geschrieben werden.« Ich improvisierte eine passende Illustration, indem ich das Beispiel eines bestimmten Proteins aus einem der wissenschaftlichen Artikel klaute, die ich gelesen hatte. Allerdings zeichnete ich die Moleküle in einem neuen Muster um, damit man mir keine Copyright-Verletzung nachweisen konnte. »Es ist uns noch nicht gelungen, jedes menschliche Gen zu bearbeiten, das übersetzt werden müsste, aber wir haben einige Zelltypen moduliert, die hervorragend mit Mini-Chromosomen arbeiten, die nur die Gene enthalten, die sie benötigen.
Sechzig Prozent der Stammzellen in meinem Knochenmark und im Thymus wurden inzwischen durch Zellversionen mit Neo-DNS ersetzt. Aus diesen Stammzellen entstehen die Blutzellen, einschließlich der Immunzellen. Ich musste mein Immunsystem vorübergehend herunterfahren, damit der Übergang reibungslos verlief. Ich musste noch einmal sämtliche frühkindlichen Immunisierungsphasen über mich ergehen lassen, um jede mögliche Abstoßungsreaktion zu vermeiden. Aber im Prinzip könnte ich mir jetzt eine konzentrierte Dosis HIV spritzen, ohne dass ich irgendetwas zu befürchten hätte.«
»Aber es gibt einen hervorragenden Impfstoff …«
»Natürlich.« Ich schnitt meine Zwischenbemerkung heraus und ließ Landers sagen: »Natürlich gibt es dagegen längst einen Impfstoff.« Dann fuhr er in eigenen Worten fort: »Aber ich besitze ohnehin ein zweites, völlig unabhängiges Immunsystem. Und wer weiß, was als nächstes kommt? Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Nicht etwa durch eine Anpassung meiner Symbionten an mögliche künftige Krankheitserreger – wozu niemand in der Lage wäre –, sondern indem ich gewährleiste, dass jede gefährdete Zelle meines Körpers eine andere Sprache als die Viren spricht.«
»Und wie sieht es langfristig aus? Es war eine kostenintensive Infrastruktur nötig, um Sie mit all diesen Sicherheitsvorkehrungen auszustatten. Was ist, wenn die Technik für Ihre Kinder und Enkelkinder nicht mehr zur Verfügung steht?« Auch diese Frage war redundant, so dass sie herausflog.
»Langfristig habe ich mir selbstverständlich das Ziel gesetzt, auch die Stammzellen zu modifizieren, die meine Spermien produzieren. Meine Frau Carol hat bereits mit einem Programm zur Sammlung ihrer Eizellen begonnen. Und wenn es uns gelungen ist, das komplette menschliche Genom zu übersetzen, wenn wir alle dreiundzwanzig Chromosomen in Spermien und Ova ersetzt haben … dann ist alles vererbbar. Jedes unserer Kinder wird mit reiner Neo-DNS leben – und die Symbionten werden im Mutterleib auf die Kinder übertragen.
Und wir werden auch das Erbgut der Symbionten übersetzen – in ein drittes genetisches Alphabet –, um auch sie vor Viren zu schützen und jede Gefahr eines versehentlichen Genaustausches auszuschließen. Sie werden unsere Feldfrüchte und Viehherden sein, unser Geburtsrecht, unsere Untertanen, die für immer in unserem Blut leben.
Und unsere Kinder werden eine neue biologische Art begründen. Mehr als nur eine Art – ein völlig neues Reich.«
Die Fußballer im Hintergrund jubelten, als jemand ein Tor geschossen hatte. Ich ließ es drin.
»Das ist es, was ich schaffe. Ein neues Reich.«
Ich saß achtzehn Stunden pro Tag an der Konsole und zwang mich dazu, so zu leben, als wäre die Welt geschrumpft, nicht nur auf die Größe des Arbeitsraumes, sondern auf die Schauplätze und Zeiträume der Filmaufnahmen. Gina ließ mich in Ruhe. Nachdem sie die Montage von Jenseits der Geschlechtskategorien überstanden hatte, wusste sie bereits, was sie zu erwarten hatte.
»Ich werde einfach so tun, als wärst du nicht in der Stadt«, sagte sie mit einem Achselzucken. »Und dass das Ding im Bett eine riesige Wärmflasche ist.«
Die Pharmaeinheit hatte ein kleines Hautpflaster auf meiner Schulter darauf programmiert, nach einem exakten Zeitplan genau abgestimmte Melatonindosen abzusondern – oder Melatoninblocker zu verabreichen, je nach den biochemischen Signalen meiner Zirbeldrüse. Dadurch wurde die Wellenbewegung des Wach- und Schlafzyklus in Hochplateaus verwandelt, die durch steil abfallende Täler getrennt waren. Ich wachte jeden Morgen aus fünfstündigem, REM-reichem Schlaf auf und war sofort hellwach und energiegeladen wie ein hyperaktives Kind, während mir der Kopf vor tausend zusammenhanglosen Träumen schwirrte (die hauptsächlich aus kunstvollen Neumontagen der Szenen bestanden, die ich am Vortag bearbeitet hatte). Bis Viertel vor zwölf gähnte ich für gewöhnlich nicht ein einziges Mal, doch fünfzehn Minuten später ging ich wie eine abgeschaltete Lampe aus. Melatonin ist das Hormon, das den natürlichen Zeitrhythmus steuert, und damit viel sicherer und wirkungsvoller als primitive Stimulanzien wie Koffein oder Amphetamine. (Ich hatte es einige Male mit Koffein probiert, und es hatte mir das Gefühl gegeben, konzentriert und energiegeladen zu sein, aber mein Urteilsvermögen war dabei völlig zu Bruch gegangen. Der weitverbreitete Gebrauch von Koffein erklärte übrigens sehr viele Eigenarten des zwanzigsten Jahrhunderts.) Ich wusste, was geschah, wenn ich das Melatonin absetzte – ich würde eine kurze Zeit unter nächtlicher Schlaflosigkeit und täglicher Müdigkeit leiden, wenn mein Gehirn versuchte, den von außen aufgezwungenen Rhythmus auszugleichen. Aber die Nebeneffekte der Alternativen waren wesentlich schlimmer.
Carol Landers hatte ein Interview abgelehnt, was eine Schande war, denn es wäre ein echter Knüller gewesen, mit der künftigen mitochondrischen Eva zu plaudern. Landers hatte nicht verraten, ob sie bereits mit den Symbionten geimpft war. Vielleicht wollte sie abwarten, ob er die Prozedur überlebte oder ob er zum Opfer der Bevölkerungsexplosion eines mutierten Bakterienstammes wurde, der ihm einen toxischen Schock versetzte.
Ich hatte die Genehmigung erhalten, mit einigen von Landers’ führenden Angestellten zu reden – einschließlich der beiden Genetiker, die den größten Teil der Forschung und Entwicklung durchführten. Sie zierten sich, wenn sie über irgendetwas reden sollten, das über die technischen Details hinausging, doch generell schienen sie den Standpunkt einzunehmen, dass jede frei gewählte Behandlung, die im Dienst der Gesundheit des Individuums stand – und die keine Gefährdung für die Allgemeinheit darstellte –, ethisch völlig unbedenklich war. Damit hatten sie nicht ganz unrecht, zumindest was die möglichen Umweltgefahren betraf, denn die Arbeit mit Neo-DNS bedeutete, dass keinerlei Risiko einer unbeabsichtigten Rekombination bestand. Selbst wenn sie ihre gesamten gescheiterten Experimente in den nächsten Fluss kippten, könnte kein natürliches Bakterium irgendetwas mit den Genen anfangen.
Zur Erfüllung von Landers’ Vision einer biologisch autonomen Familie war jedoch mehr als nur Forschungs- und Entwicklungsarbeit nötig. Erbliche Veränderungen an menschlichen Genen waren zur Zeit in den USA (und den meisten anderen Ländern) illegal – mit Ausnahme einer Handvoll ›genehmigter Korrekturen‹, wenn es um die Eliminierung von Krankheiten wie Muskelschwund oder zystische Fibrose ging. Gesetze ließen sich natürlich widerrufen, obwohl Landers’ Anwalt, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Biotechnik, damit argumentierte, dass die Veränderung der Basengruppen – einschließlich der Übersetzung einiger dazugehöriger Gene – überhaupt nicht gegen den anti-eugenischen Geist der existierenden Gesetze verstieß. Es hatte keinen Einfluss auf das äußere Erscheinungsbild der Kinder (Größe, Statur, Pigmentierung). Es wirkte sich nicht auf ihren IQ oder ihre Persönlichkeit aus. Als ich auf ihre voraussichtliche Sterilität (die Inzest unmöglich machte) zu sprechen kam, hatte er den interessanten Standpunkt vertreten, dass es kaum Ned Landers’ Schuld war, wenn die Kinder anderer Leute in Bezug auf seine eigenen steril waren. Schließlich gab es keine unfruchtbaren Personen, sondern nur unfruchtbare Paare.
Ein Experte von der Columbia University sagte, dass all das völliger Quatsch war. Der Austausch ganzer Chromosomen war einfach illegal, ganz gleich, ob es sich auf den Phänotyp auswirkte oder nicht. Ein anderer Experte auf diesem Gebiet – von der University of Washington – war sich nicht so sicher. Wenn ich die Zeit gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich hundert verschiedene Meinungen wichtiger Juristen sammeln können, die jeden nur denkbaren Aspekt dieses Themas ansprachen.
Ich hatte auch mit einigen von Landers’ Kritikern gesprochen, einschließlich Jane Summers, einer freien Fachärztin für Biotechnik aus San Francisco, die zudem ein prominentes Mitglied der Gruppe Soziale Verantwortung für Molekularbiologen war. Sechs Monate zuvor hatte sie einen Artikel für das halböffentliche SVMB-Netmagazin (das mein Datenmaulwurf stets gründlich durchforstete) geschrieben und darin behauptet, sie hätte Beweise, dass sich mehrere tausend reicher Leute in den USA und anderswo ihre DNS ummodeln ließen, Zelltyp für Zelltyp. Landers, hatte sie geschrieben, sei lediglich der einzige, der an die Öffentlichkeit gegangen war. Er sollte als eine Art Köder auftreten – ein reicher Exzentriker, der die Debatte entschärfte, weil das Ganze anscheinend nicht mehr als die lächerliche (beinahe quichotteske) Phantasie eines einzelnen Mannes darstellte. Wenn die Forschungsergebnisse ohne eine bestimmte, damit assoziierte Person an die Medien gegangen wären, hätte sich allgemeine Paranoia breitgemacht. Es hätte keinerlei Mitgliedsbeschränkung unter der namenlosen Elite gegeben, die beabsichtigte, sich aus der Ökosphäre zu verabschieden. Aber nachdem alle Fakten auf dem Tisch lagen und es nur um den harmlosen Ned Landers ging, gab es im Grund keinen Anlass zur Befürchtung.
Diese Theorie ergab durchaus Sinn – aber Summers’ Beweise waren nicht sehr stichhaltig gewesen. Widerstrebend hatte sie den Kontakt zu einem ›Informanten aus der Industrie‹ hergestellt, der angeblich für einen anderen Arbeitgeber in der Genübersetzung tätig gewesen war. Doch mir gegenüber hatte dieser angebliche Informant alles abgestritten. Als ich weitere Anhaltspunkte verlangt hatte, war Summers immer ausweichender geworden. Entweder besaß sie gar keine stichhaltigen Beweise, oder sie hatte mit einem anderen Journalisten eine Vereinbarung getroffen, die Konkurrenz nicht in die Geschichte einzuweihen. Es war frustrierend, aber ich hatte weder über die Zeit noch die Mittel verfügt, um eigene Recherchen anstellen zu können. Wenn es tatsächlich ein Komplott genetischer Separatisten gab, würde ich genauso wie jeder den Exklusivbericht in der Washington Post lesen müssen.
Ich schloss mit einem Potpourri verschiedener Stimmen – von Bioethikern, Genetikern und Soziologen –, die allesamt die ganze Sache abtaten. »Mr. Landers hat das Recht, nach seinen eigenen Vorstellungen zu leben und seine Kinder so aufzuziehen, wie er es für richtig hält. Wir verfolgen die Amish nicht wegen ihrer Inzucht, ihrer ungewöhnlichen Technik oder ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit. Warum sollen wir Landers verfolgen – der im Wesentlichen dieselben ›Verbrechen‹ begeht?«
Die Endfassung des Berichts war achtzehn Minuten lang. Für die Sendung hatte ich jedoch nur zwölf Minuten. Ich schnitt gnadenlos weiter, indem ich zusammenfasste und vereinfachte. Ich gab mir Mühe, professionelle Arbeit abzuliefern, machte mir aber keine zu großen Sorgen wegen des Verlusts an Details. Die meisten Echtzeit-Sendungen in SeeNet dienten ausschließlich dem Zweck, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen und Reviews in den konservativeren Medien nach sich zu ziehen. Gepanschtes DNS war auf 23 Uhr an einem Mittwoch angesetzt, und die große Mehrheit des Publikums würde sich anschließend in die vollständige, interaktive Version einklinken. Diese war nicht nur länger, linearer und stringenter, sondern außerdem mit Links auf andere Quellen versehen: alle wissenschaftlichen Beiträge, die ich selbst für meine Recherchen gelesen hatte (und wiederum alle dort zitierten Artikel), andere Medienberichte über Landers (einschließlich der Verschwörungstheorie von Jane Summers), die betreffenden US-amerikanischen und internationalen Gesetzestexte – und sogar Hinweise, die in den Sumpf möglicher Vergleichsfälle führten.
Am Abend des fünften Tages – ich lag genau im Zeitplan, was ein Grund für triumphierenden Jubel war – verknüpfte ich die letzten losen Enden und schaute mir den Beitrag noch einmal an. Ich versuchte, meine Erinnerungen an die Dreharbeiten und sämtliche vorgefassten Meinungen zu vergessen, um die Geschichte möglichst genauso wie ein SeeNet-Zuschauer zu betrachten, der noch nichts über dieses Thema angeschaut hatte (abgesehen von einigen irreführenden Vorankündigungen dieser Dokumentation).
Landers wirkte überraschend sympathisch. Ich hatte gedacht, dass ich härter mit ihm umgegangen war. Ich hatte gedacht, ich hätte ihm die Gelegenheit gegeben, sich mit der ernsthaften Selbstdarstellung seiner bizarren Vorhaben selbst in den Dreck zu ziehen. Doch er wirkte überhaupt nicht griesgrämig, sondern eher gutmütig. Mit jedem Scherz schien er weitere Punkte zu sammeln. Sich von Reifendeponien ernähren? Sich HIVspritzen? Ich sah fassungslos zu. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob es tatsächlich einen leichten Unterton absichtlicher Ironie gab, eine Spur von Bescheidenheit in seiner Art, die mir zuvor irgendwie entgangen war – oder ob es am Thema lag, dass ein geistig normaler Zuschauer seine Worte einfach nicht auf andere Weise interpretieren konnte.
Was war, wenn Summers Recht hatte? Wenn Landers wirklich ein Lockvogel war, eine Ablenkung, jemand, der unübertrefflich die Rolle des Clowns spielte? Was war, wenn tatsächlich mehrere tausend der reichsten Menschen dieses Planeten planten, sich selbst und ihre Nachkommenschaft in die vollkommene genetische Isolation zurückzuziehen, um die absolute Immunität gegen jedes Virus zu erreichen?
Spielte es überhaupt eine Rolle? Die Reichen hatten sich schon immer vom Pöbel isoliert, auf die eine oder andere Weise. Die allgemeine Schadstoffbelastung würde auf jeden Fall weiter zurückgehen, ob symbiotische Algen die Versorgung mit Frischluft obsolet machten oder nicht. Und jeder, der in Landers’ Fußstapfen trat, war kein großer Verlust für den Genpool der Menschheit.
Es gab nur eine kleine Frage, die noch nicht beantwortet war, und ich versuchte, nicht zu ausführlich darüber nachzudenken.
Die absolute Immunität … wogegen?
4
Delphic Biosystems war viel zu großzügig gewesen. Sie hatten mir nicht nur zehnmal so viele Interviewtermine mit ihren Öffentlichkeitsleuten besorgt, als ich jemals bewältigen konnte, sie hatten mich außerdem mit ROMs überschüttet, die voller verführerischer Mikrographien und betörender Animationen waren. Software-Flussdiagramme für das HealthGuard-Implantat waren in Form von Airbrush-Phantasien unmöglicher chromglänzender Maschinen dargestellt, während pechschwarze Fließbänder strahlende Silberkügelchen – die Daten – von Subprozess zu Subprozess weiterleiteten. Molekülmodelle interagierender Proteine waren von hauchzarten, wunderschönen – und völlig überflüssigen – Elektronenwolken eingehüllt, Polarlicht-Schleier in Rosa und Blau, die ineinander übergingen und miteinander verschmolzen, die selbst die bescheidenste chemische Hochzeit in eine mikrokosmische Phantasmagorie verwandelten. Ich hätte es nur mit Wagner – oder Blake – unterlegen müssen, um es an die Mitglieder der Mystischen Renaissance verscherbeln zu können, die es mit offenem Mund in ehrfürchtiger Verständnislosigkeit als Endlosschleife abgespielt hätten.
Mühsam schleppte ich mich wacker durch den ganzen Sumpf – und es zahlte sich schließlich aus. Unter all dem Technoporno und der psychedelischen Populärwissenschaft fanden sich tatsächlich einige brauchbare Szenen.
Für das HealthGuard-Implantat hatte man den modernsten programmierbaren Prüfchip verwendet: eine Armee ausgefeilter Proteine, in Silikon gebettet, in vielerlei Hinsicht einem Pharmasynthesizer ähnlich, doch dazu gedacht, Moleküle zu zählen und sie nicht zu erschaffen. Die vorige Chip-Generation arbeitete mit einer großen Menge hochspezialisierter Antikörper, Y-förmigen Molekülen, die im Schachbrettmuster über der Halbleiterplatine verteilt waren, wie eine ordentlich parzellierte Ackerbauregion. Wenn ein Molekül Cholesterin oder Insulin oder was auch immer zufällig auf das richtige Feld traf und mit einem passenden Antikörper kollidierte, konnte diese kurze Bindung als winzige Spannungsänderung gemessen und von einem Mikroprozessor gespeichert werden. Mit der Zeit ergab sich aus diesen Aufzeichnungen der zufälligen Kollisionen die Menge jeder einzelnen Substanz im Blut.
Die neuen Sensoren verwendeten ein Protein, das nicht mehr wie eine passive, nur zu einem Zweck taugliche Antikörper-Schablone arbeitete, sondern eher wie eine intelligente Venusfliegenfalle. ›Examin‹ war im rezeptiven Zustand ein längliches, glockenförmiges Molekül, ein Schlauch, der sich zu einem weiten Trichter öffnete. Diese Konfiguration war metastabil, denn die Ladungsverteilung auf dem Molekül machte es äußerst empfindlich, wie eine gespannte Feder. Alles, was groß genug war, um nachweislich mit der inneren Oberfläche des Trichters zu kollidieren, verursachte eine lichtschnelle Welle der Deformierung, wenn der Eindringling gepackt und eingehüllt wurde. Der Mikroprozessor bemerkte nicht nur die zugeschnappte Falle, sondern konnte das eingefangene Molekül sogar identifizieren, indem es nach einer Form suchte, bei der es noch fester vom Examin umschlossen wurde. Es gab keine Vergeudung von erfolglosen Kollisionen mehr – keine Insulinmoleküle, die auf Cholesterin-Antikörper trafen und keine brauchbare Information lieferten. Examin wusste jederzeit genau, wovon es getroffen worden war.
Ein solcher technischer Fortschritt war es wert, kommuniziert zu werden, erklärt und entmystifiziert