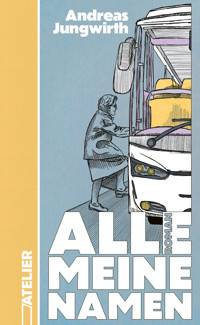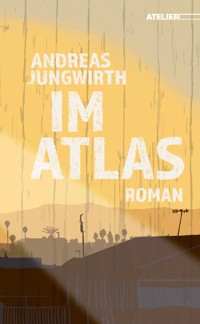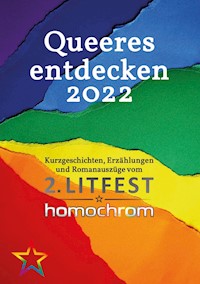
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Queeres entdecken 2022" ist der zweite Band des Litfests homochrom in Köln und bietet ein buntes Panorama aktueller, ausgewählt guter queerer Literatur. Im Juli 2022 lasen 36 Autor*innen ihre abwechslungreichen Texte beim 2. Litfest, dem bisher größten Festival für deutschsprachige Literatur mit LSBTIAQ-Bezug, welches im August 2021 erstmals stattfand. Neben den Lesevideos und Podcasts erscheinen in dieser Anthologie, die zu einem kostengünstigen Preis angeboten werden, auf prallen 376 Seiten stolze 24 der besten Kurzgeschichten, Erzählungen und Romanauszüge mit einer Leselänge von zirka 25-30 Minuten, einschließlich aller drei Publikumspreisgewinner und mehrerer unveröffentlichter Texte, um von dir entdeckt zu werden – und um dir hoffentlich Lust auf mehr queere Literatur zu machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
© 2022 homochrom e.V.
Abdruck mit freundlicher Genehmigung der Autor*innen oder der jeweiligen Verlage. Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved.
Gestaltung, Korrektorat & Herausgeber:
Martin Wolkner
Druck & Distribution:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN: 978-3-347-72285-9 (Taschenbuch)
ISBN: 978-3-347-72286-6 (gebundene Ausgabe)
ISBN: 978-3-347-72287-3 (E-Book)
Queeres entdecken 2022
Kurzgeschichten, Erzählungen und Romanauszüge vom 2. Litfest homochrom
Vorwort
Mehr Aufmerksamkeit für queere Literatur und die Menschen, die sie schreiben, das war die simple Idee hinter dem Litfest homochrom, welches im August 2021 zum ersten und im Juli 2022 nun bereits zum zweiten Mal in Köln stattgefunden hat. Und wie heißt es so schön: Einmal ist Ereignis, zweimal Tradition.
In den 2010ern hatte unser Verein in sechs NRW-Großstädten eine monatliche Kinoreihe für Filme mit vorwiegend lesbischen und schwulen, aber auch bi-, trans-, intersexuellen und queeren Themen ausgerichtet. Daraus entwickelte sich bald das Filmfest homochrom in Köln und Dortmund, das viele Deutschlandpremieren aufführte und einige Jahre lang das zweitgrößte von zwei Dutzend Queerfilmfestivals in Deutschland war. Nachdem ich bei QueerScope, dem Verband unabhängiger deutscher Queerfestivals, den Debütfilmpreis initiiert hatte, wurde ich 2017 in die Teddy-Jury der Berlinale eingeladen.
Obwohl unser Verein 2019 die Filmaufführungen einstellte, blieb das Interesse an allerlei Formen queerer Geschichten bestehen. Uns fiel zum Beispiel auf, dass es vergleichsweise wenige Dokufilme über die deutsche LSBTIAQ-Geschichte gibt, insbesondere aus NRW und Köln, einer Stadt, die nicht ganz unbedeutend für die Schwulen- und Lesbenbewegung der Nachkriegszeit war. Um die Geschichte(n) der allmählich älter werdenden Aktivist*innen für die Nachwelt festzuhalten, planten wir schon bald eine neue Veranstaltungsreihe, die »Couchgespräche«, bei der wir seit 2019 öffentlich mit Zeitzeug*innen sprechen und dies aufzeichnen. Zwischenzeitlich ist daraus die umfangreiche Living Library (living-library.eu) herangewachsen.
Weil ich selbst seit 27 Jahren schriftstellerisch tätig bin, dies aber wegen der Filmarbeit zu kurz kam, widme ich mich seit dem Ende des Filmfests wieder verstärkt dem Schreiben. Ich kenne und teile die Schwierigkeiten vieler Autor*innen, sich im allzu oft kapitalistisch geprägten Kulturbetrieb durchzusetzen – was mit queeren Themen in einer heteronormativen Welt nicht unbedingt leichter wird. Ein Kurzgeschichtenband oder gar ein Roman mit hunderten von Seiten erfordert viel Ausdauer und Muße, geschieht häufig aus eigenem Antrieb sowie auf eigene Kosten. Ist diese Herkulestat vollbracht, muss noch eine zweite unternommen werden, nämlich auf sich und sein Werk aufmerksam zu machen und zu versuchen, die bestmögliche Agentur zu finden, die einen vertritt, oder einen Verlag direkt zu erreichen – was fast genauso schwierig wie eine Audienz bei der Queen ist. Zum Glück hat das Internet einiges erleichtert: Sowohl das Auffinden von Kontakten oder Wettbewerbsausschreibungen (zum Beispiel vom Litfest homochrom) als auch die (Selbst-)Vermarktung.
Heutzutage kann man mit etwas Glück und einigem Einsatz auch als Selbstverleger erfolgreich werden. Es gibt gute Gründe, Selfpublisher zu werden: darunter künstlerisch-inhaltliche Freiheiten oder die Schnelligkeit – denn oft vergehen Jahre, bis man einen Verlag gefunden und dieser das Buch veröffentlicht hat, nur um schon nach kürzester Zeit von den nächsten Neuheiten verdrängt zu werden. Das Marketing und gegebenenfalls sogar der Vertrieb müssen hierbei jedoch selbst arrangiert und finanziert werden. Zudem erntet man auf diesem Weg am wenigsten professionelle Anerkennung.
Selbstverständlich haben große Verlagshäuser und Publikumsverlage viel breiter aufgestellte Vertriebs- und Werbemöglichkeiten, die mehr kommerziellen Erfolg versprechen. Dort verlegte Werke finden in der Presse, im Buchhandel und für gewöhnlich bei Veranstaltungen die stärkste Berücksichtigung, außerdem machen so einigen Wettbewerbe und Stipendien diesen Veröffentlichungsweg zur Voraussetzung. Andererseits verlegen sie nur wenige LSBTIAQ-Titel und noch seltener – will heißen: so gut wie nie – stellen sie diese in den Fokus ihres Mainstream-Marketings, selbst wenn es gute, für die Allgemeinheit lesenswerte Lektüre ist.
Eine Art goldene Mitte stellen die Indie-Verlage dar, die vielleicht nicht ganz so viel allgemeine Beachtung finden, dafür jedoch mit mehr Zielgenauigkeit bei der Leserschaft punkten. Gerade auf die queere Literatur haben sich in den letzten 25 Jahren gleich mehrere kleinere Verlage spezialisiert und bringen jedes Jahr zahlreiche neue Titel heraus. Durch ihr Programm zu stöbern, sollte sich lohnen.
Die Erfolgschancen bei Verlag und Publikum erhöhen sich, wenn man einen der begehrten Kunst- oder Förderpreise einheimsen kann. Die Wettbewerbsteilnahme gleicht allerdings in gewisser Weise dem Lottospielen, denn die Konkurrenz ist so riesig, dass man theoretisch richtig gut sein und dennoch lebenslang leer ausgehen kann, weil man in der Masse der Einreichungen ständig durch die Raster der Juryinstanzen fällt. Ob dies mit einem LSBTIAQ-Thema häufiger der Fall ist, kann ich nicht sagen, denn es gibt zumindest gelegentlich queere Literatur, die ausgezeichnet wird – wenn auch bislang noch nicht mit einem Nobelpreis, so doch mit dem Bachmann-Preis 2021.
Damit sollte alles gut sein, oder? Immerhin sind queere Künstler*innen und Themen längst Mainstream: Der Einfluss von Andy Warhol und Oscar Wilde ist unbestritten; Hape Kerkeling hat durch sein Zwangsouting nichts von seiner Beliebtheit eingebüßt; Melissa Etheridge outete sich vor ihrem großen Durchbruch sowie ersten Grammy und jeder will Lieder von Sia singen; queere (Neben-)Charaktere tauchen in scheinbar jeder zweiten Serie auf, Filme wie »The Danish Girl«, »Carol« oder »Moonlight« sind beliebt, letzterer mit Oscars bedacht; und wer weiß wie viele haben »Die Mitte der Welt« im Deutschunterricht gelesen. Die mediale Sichtbarkeit hat derart zugenommen, dass sich manche inzwischen genervt fühlen.
Dass in verschiedenen Ländern nach wie vor lebenslange Haft oder gar die Todesstrafe auf homosexuelle Handlungen gilt (wie auch von 1532 bis 1794 im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation), ist traurig, aber zum Glück in liberalen Ländern nicht (mehr) Lebensrealität. Was uns eher betrifft, ist, dass es hier in Deutschland nach Jahrhunderten der Kriminalisierung, erst 1994 endgültig abgeschafft, weiterhin queerfeindliche Gewalt gibt. Das schwule Anti-Gewalt-Projekt Maneo in Berlin verzeichnet stetig steigende Zahlen und in NRW soll bis 2023 eine eigene Meldestelle eingerichtet werden. Entweder nimmt die Gewalt zu oder immer mehr Menschen suchen Beistand nach Gewalterfahrung. Trauriger Fakt: Heute verstarb ein Trans-Mann, der beim CSD Münster Frauen gegen einen queerphoben Pöbler verteidigte und dafür lebensgefährlich geprügelt wurde.
Abgesehen von roher Gewalt berichten queere Künstler*, Sportler*innen wie auch Geschäftsleute nach wie vor von der gläsernen Decke, an die sie stoßen. Kein Wunder, dass sich selbst heutzutage einige TV-Persönlichkeiten nicht trauen, mit gleichgeschlechtlichen Partnern öffentlich aufzutreten, und bisher hat sich hierzulande kein aktiver Profi-Fußballer geoutet – trotz der großen Solidaritätsaktion im letzten Jahr mit Bekundungen in deutschen Stadien. Dagegen wirkte die Kampagne #outinchurch im Januar 2022 richtig progressiv – und stellte ihr Buch beim 2. Litfest vor. Bezeichnenderweise wurde ebenfalls Anfang 2022 das Amt eines Queer-Beauftragten der Bundesregierung geschaffen. Es gibt wohl doch noch einiges zu tun.
Hier kommt auch wieder das Litfest homochrom ins Spiel, denn egal wie viele queere Kurzgeschichten und Romane entstehen, Lesemöglichkeiten für nicht-heterosexuelle Inhalte gibt es nur wenige. Doch gerade queere Kultur ermöglicht Begegnungen und Gespräche. In englischsprachigen Ländern zelebrieren darum neben allgemeinen ebenfalls queere Literaturfestivals die schreibenden Künste und sorgen so für zusätzliche belletristische Zugänglichkeit: mehrere in Nordamerika und dort teils seit zwanzig Jahren, einige in Großbritannien, vier in Indien, wo Homosexualität erst 2018 entkriminalisiert wurde, und seit 2021 in Sydney. Im deutschsprachigen Raum gab es meines Wissens bisher lediglich das Festival QUEER gelesen, das von 2014 bis 2019 mit etwas über einem Dutzend Lesungen in Wiesbaden bzw. Mainz und nach einer Pause (nicht wegen Corona) 2022 in kleinerem Rahmen stattfand.
Immerhin erfreuen sich hierzulande einige queere Poetry-Slams wachsender Beliebtheit. Sie zeichnen sich durch lebhaft vorgetragene Texte aus, die gerne humorvoll oder aber zum Nachdenken anregend sind, im besten Fall prägnant, aber immer relativ kurz, meist in einem Rahmen fünf bis sieben Minuten Leselänge. Zwar muss ich ausgerechnet in der Literaturstadt Köln einen Queer-Slam verpasst oder übersehen haben, aber vermutlich sind Autor*innen von LSBTIAQ-Texten ganz selbstverständlich in den allgemeinen Slams der westlichen Homohauptstadt vertreten, oder etwa nicht?
Für Wortkunstwerke, die länger als zwei oder drei Seiten sind, gibt es in Köln dank der lit.Cologne, einem der größten Literaturfestivals Deutschlands, dank Literatur in den Häusern der Stadt sowie der Kölner Literaturnacht eigentlich herausragende Lesegelegenheiten, doch Queer-Themen wurden dort bisher kaum berücksichtigt. Die q[lit]*clgn wiederum, die 2018 und 2019 stattfand, war feministisch ausgerichtet. Deshalb waren es in Köln bislang eher vereinzelte LSBTIAQ-Lesungen, die von Buchläden, von Institutionen wie damals dem SCHuLZ oder heute dem anyway, im Rahmen des Cologne Pride oder von Autor*innen selbst organisiert wurden.
Mein Eindruck war, dass längere Queer-Texte sowie ihre Autor*innen noch nicht die Wahrnehmung und Wertschätzung erfahren, die sie verdienen. Natürlich ist längst nicht alles erstklassig, doch es gibt sie wirklich, die gute queere Literatur –sogar mehr davon, als manche glauben. Daher kam mir aufgrund unserer Festivalerfahrung die Idee, diese Lücke zu füllen. Dank der Förderung im Rahmen von »Neustart Kultur« der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. war homochrom in der Lage, etwas aus der Taufe zu heben, das in Köln und NRW erstmalig und in diesem Umfang im deutschsprachigen Raum noch nicht dagewesen ist: das Litfest homochrom, das hybrid vor Publikum und Kamera bei kostenlosem Eintritt stattfindet und die Autor*innen untereinander vernetzt. Eine Förderung durch die Kunststiftung NRW sowie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglichte die Fortsetzung. Vielen Dank!
Wenn ihr mögt, so könnt ihr nun gut sechzig Videos oder Podcasts der ersten beiden Litfest anschauen oder nachhorchen (Infos findet ihr unter homochrom.de/litfest). Die sich jeweils an die Lesungen anschließenden, moderierten Gespräche haben zusätzlich angeregte tiefergehende Punkte behandelt. Diese kostenlose Onlinestellung ist nicht üblich, jedoch eine deutliche Bereicherung, die diese Literatur über Zeit und Raum hinweg verfügbar macht. Das Litfest homochrom schafft damit neue Chancen für deutschsprachige Queer-Literatur.
Viele der eingeladenen Schriftsteller*innen sprachen positiv über ihr Erlebnis in Köln und hoffen darauf, dass das Format fortgesetzt wird, und wie oben geschrieben ist zweimal bereits eine Tradition. Allerdings ist die Kulturarbeit immer wieder eine Herausforderung: Nicht nur muss man jedes Jahr neu bangen, ob genug Interesse und Geld für die Förderung der eingereichten Projekte besteht, sondern auch immer wieder frische Eigenmittel einbringen, die vom Projekt verschlungen werden. Wollen wir weiterhin auf Eintrittsgelder verzichten, die eine Hürde in der Beschäftigung mit LSBTIAQ-Kultur oder für finanzschwache Menschen darstellen, so sind wir auf Spenden angewiesen.
Das Buch, was du in den Händen hältst, ist möglichst günstig kalkuliert, damit das Nachlesen und Entdecken neuer Texte leichterfällt. Denn wenn dir zum Beispiel Romanauszüge gefallen haben, so wirst du weitere Bücher kaufen müssen, um zu erfahren, wie die Geschichten weiter- und zu Ende gehen. Aufgrund der nicht-kommerziellen Ausgerichtung geht pro gedruckter Litfest-Anthologie weniger als 1 € an den gemeinnützigen homochrom e.V. Das wird definitiv nicht für die Finanzierung eines 3. Litfests homochrom ausreichen. Wenn du also zusätzlich ein bisschen was für queere Kultur übrig hast – oder gar finanzstarke Mäzene kennst –, dann unterstütze uns doch gerne zusätzlich.
Mit freundlicher Genehmigung der Autor*innen und Verlage haben wir abermals einen Großteil der vorgetragenen Texte in einem Sammelband zusammengestellt, damit du dies nach Belieben an jedem Ort und zu jeder Zeit selbst nachlesen kannst. Mehrere der sehr abwechslungsreichen Kurzgeschichten und einige der Romanauszüge sind sogar erstmals hier veröffentlicht.
Ich hoffe, du entdeckst vieles, was dir gefällt, dich überrascht und bewegt, und wünsche dir kurzweilige, spannende Unterhaltung mit der hier versammelten queeren Literatur des 2. Litfests homochrom.
Martin Wolkner
Dortmund, 02.09.2022
Inhalt
Andreas Jungwirth – Wir haben keinen Kontakt mehr
Anne Schelzig – Nicht die Liebe macht blind, sondern die …
Bettina Barkhoven – Der Fuckepott
Dima Lubimov – Liebe mit gesenktem Blick
Emilia Grace – Schicksalshelfer Mehl
Gepo Lynx – Perfektion
Hanna Bertini – Valkyrenglück
Hansjörg Nessensohn – Mut. Machen. Liebe.
Jan Ranft – Vereiste Zuckerwatte
Jenny Wood – Totenfluch – Ein Fall für Mafed und Barnell
Juliane Seidel – Der goldene Ritter
Katharina Lucas – Liebe (oder so)
Klaus Berndl – Bisley Boy
Lena Richter – Das Innerste der Welt
Lilienne Erie – Wenn wir Vögel wären
Nicole Eick – Wer kennt diese Frau?
Nicole Stranzl – Tür im Sand
Sabine Reifenstahl – Nuancen von Liebe
Saskia Rönspies – natida ni fylur – Die Prophezeite der Sonne
Sina Vogt – Hand zum Glück
Stefan Zumkehr – Bettgesichter
Sunil Mann – Totsch
Talia May – Ein Sommer und der Duft von Freiheit
Tanja Meurer – Helden
Ursula Knoll – Lektionen in dunkler Materie
Andreas Jungwirth
»Wir haben keinen Kontakt mehr«
Bernd
Er würde gerne ein Reh schießen, hat David gesagt. Um es bluten zu sehen, hat er gesagt. Er hat ein Gewehr angelegt – eines, das gar nicht da war. Und er hat die Luft angehalten, als würde er wirklich mit einem Gewehr auf ein Reh zielen.
Drück schon ab!, hab ich gesagt.
David hat nicht abgedrückt. Stattdessen hat er das Gewehr in meine Richtung bewegt, hat mir die Mündung auf die Brust gesetzt.
Hast du Angst?, hat er gefragt.
Nicht ich habe gezittert, warum auch, es war ja kein Gewehr da. Er hat gezittert. Und plötzlich flüstert er, das Gewehr immer noch im Anschlag: Was ich an dir mag, ist das Geheime / jedes Wort zu viel ist schon Gefahr / denn so schnell verfällt ins Allgemeine / was zuvor so ganz besonders war …
Ich habe jedes Wort gehört, aber kein Wort verstanden: Ist das von dir?
Was denkst du? Hab ich Talent?
Wir waren vierzehn. Ich hatte ein eigenes Zimmer, er nicht. Wir trafen uns immer bei mir. Immer nur zu zweit. Sein Zimmer habe ich nie gesehen. Von ihm zu mir zu kommen, bedeutete fünfundvierzig Minuten Fahrradfahren, an der Kirche und am Wirtshaus im Dorf vorbei, beim Elektrogeschäft rechts abbiegen, in die Straße mit den Einfamilienhäusern. Dort hatten auch meine Eltern direkt am Waldrand in den Sechzigerjahren ein Haus gebaut. So hieß auch die Straße: Am Waldrand.
Als Kind stand ich in der Dämmerung auf der Wiese hinter dem Haus, sah zwischen den Bäumen die Schatten der Indianer und Cowboys und wilden Tiere, wie sie in den Büchern vorkamen, die ich damals las. Mit pochendem Herzen und rotem Kopf lauschte ich auf das Donnern in der Ferne. Aber erst viel später habe ich kapiert: Das waren keine Büffelherden. Es waren LKWs, die über die Autobahn donnerten, die hinter dem Wald vorbeiführte.
David und ich verbrachten unsere Nachmittage auf einem Hochstand auf einer Lichtung des Waldes hinter dem Haus meiner Eltern. Wir redeten tiefsinniges Zeug. Nicht-Tiefsinniges war nicht unsere Sache. Hat das Weltall ein Ende? Ja. Nein. Was wird sein, wenn wir tot sind? Wir waren uns einig: nichts. Und dass wir uns dieses Nichts nicht vorstellen können. Auch darin waren wir uns einig. Und deshalb haben wir gesagt, es würde doch etwas sein, nämlich alles genauso wie jetzt, nur seitenverkehrt.
Nach der Matura bin ich nach Salzburg gegangen, um Soziologie zu studieren, David nach Wien. Er fing mit Zoologie an, sattelte aber nach zwei Semestern auf Germanistik um. Aber da hatten wir schon keinen Kontakt mehr … bis ich Ende September 2001 David in Berlin zufällig wiederbegegnete. In Neukölln. Am Kanal. Das Wetter ungewöhnlich warm für die Jahreszeit. Er kam direkt auf mich zu gejoggt. Schweißperlen auf der Stirn wie Schmuck. Diese funkelnden Perlen waren mir aufgefallen, noch bevor ich wusste, wer das war, der da plötzlich vor mir stand.
Hallo!
Hi!
Eigentlich gab es damals kein anderes Thema als 9/11, auch wir haben darüber geredet.
Was für ein Spektakel!, sagte David und lachte.
Er redete über 9/11, als wären Worte egal, als wäre überhaupt alles egal, als müsste man alles als Phänomen betrachten, Dinge passieren, weil sie passieren können. Auch über sich selbst redete er, als müsste man nichts von dem, was er sagte, so genau nehmen. Eigentlich wollte er gar nicht mit mir reden, eigentlich wollte er weiter, aber er schaffte den Absprung einfach nicht.
Ich werde übrigens demnächst den Jagdschein machen, sagte ich in eine plötzliche Stille.
David sah schweigend durch mich hindurch.
Gehst du mit mir auf die Jagd? Schießen wir ein Reh?
Machst du wirklich den Jagdschein?, fragte David ohne wirkliches Interesse.
Was ich an dir mag, ist das Geheime / jedes Wort zu viel ist schon Gefahr … das Gedicht war auch nicht von dir.
Nein, sagte David.
Aber du hast es behauptet.
Und du hast es geglaubt.
Wieder zitterte er, so wie damals, als Vierzehnjähriger auf dem Hochstand, als er das Gewehr auf mich richtete.
Mir ist kalt, erklärte David, ich bin verschwitzt, ich will nicht krank werden.
Er stand auf und schaute eine Weile völlig reglos auf das träge Wasser des Kanals. Zwei Enten ließen sich stromabwärts treiben. Dann ließ er seinen Oberkörper nach vorne fallen, bis seine Fingerspitzen den Boden berührten. Wirbel für Wirbel richtete er sich wieder auf, streckte sich, dann lief er davon, ohne ein weiteres Wort.
Matthias
The Beggar’s Opera von John Gay? Kennt niemand. Brechts Dreigroschenoper? Kennt jeder. Die Oper von Gay wurde in Wien zuletzt Anfang der Achtzigerjahre in der Volksoper aufgeführt.
In der Pause nach dem zweiten Akt habe ich ihn um eine Zigarette gebeten. Vor über dreißig Jahren. Dreißig Jahre sind eine echt scheißlange Zeit. David hat noch exakt eine Zigarette gehabt, er hat sie angesteckt, und dann ist sie zwischen uns hin- und her, wie ein Joint.
Wie findest du die Aufführung? Er hat mit den Schultern gezuckt. Also nicht gut?
Du?
Auch nicht gut.
Ich auch nicht.
Warum sagst du es dann nicht einfach?
David ist rot geworden. Er hatte nichts Falsches sagen wollen.
Wir haben die Zigarette fertig geraucht, dann habe ich auf die Uhr geschaut.
Damals bin ich mindestens dreimal pro Woche in die Oper gegangen, bezahlt habe ich selten, ich hatte meine Tricks. Ich habe gewusst, wenn wir jetzt ein Taxi nehmen, kommen wir rechtzeitig zur zweiten Pause der Walküre in die Staatsoper.
Am Opernring aus dem Taxi raus, die Leute sind tatsächlich gerade zurück auf ihre Plätze, wir einfach hoch in den obersten Rang, niemand hat eine Eintrittskarte verlangt oder hat uns sonst irgendwie daran hindern wollen, die Walküre zu sehen.
Die Walküre ist damals für mich der Hammer gewesen. Überhaupt Wagner. Besser als jeder Rausch.
Ich habe so viele Jahre nicht an David gedacht, und jetzt fällt mir eins nach dem anderen wieder ein: David hatte gerade die Matura gemacht und war für ein paar Tage nach Wien gekommen, hat bei seinem Cousin am Nestroyplatz übernachtet, das war damals noch eine wilde Gegend, kein ATV gegenüber, keine chicen Lokale, kein Ansari, kein Mochi, dort hat damals noch niemand wohnen wollen.
Nach der Oper etwas essen, im ersten Bezirk, das Lokal gibt es heute nicht mehr, geredet: Ich wollte damals ein bekannter Pianist werden, berühmt wie Vladimir Horowitz. David wollte Verhaltensforscher werden, berühmt wie Konrad Lorenz.
Es war fast Mitternacht, als wir am Donaukanal entlanggegangen sind.
Der Vollmond hat sich im Wasser gespiegelt. Das Wasser hat gestunken. Nicht nur an diesem Tag, es hat immer gestunken, egal welche Jahreszeit. Und neben mir dieser duftende Maturant, siebzehn, achtzehn Jahre alt …
Schritte, Schweigen, dann: Ich möchte dir gerne meine Wohnung zeigen. Was Besseres fiel mir nicht ein.
Und er: Okay. Echt?
Falsch.
Was?
Scherz.
Im Wohnzimmer stand ein Bösendorfer.
Eine Weile habe ich improvisiert, immer wilder in die Tasten gegriffen, schließlich bin ich bei Rachmaninow gelandet, bis mein Nachbar gegen die Wand gehämmert hat. David und ich haben gelacht und sind aufs Sofa übersiedelt. Wieder geredet: David war in der Mansarde eines Einfamilienhauses aufgewachsen, hat das Zimmer mit seinem älteren Bruder geteilt, ihre Betten standen unter der Dachschräge, über ihm ein Poster von Franz Klammer, Abfahrtsolympiasieger, Innsbruck 1976, in einem hautengen gelben Rennanzug. Für den Bruder war das einfach nur der Goldmedaillengewinner. 1976 war David neun und schaute ausschließlich auf die Muskeln unter der zweiten Haut. Und ich habe erzählt, wie ich drei Wochen zuvor Besuch von Bea hatte, einer Freundin von früher, aus Baden bei Wien, wo ich groß geworden war. Sie hat damals in Strasbourg gelebt und hat einen Typen mitgebracht, Philippe, und nachts habe ich plötzlich gespürt, wie jemand in mein Bett kriecht. Erst habe ich gedacht, es ist Bea, aber es war nicht Bea, es war Philippe, er hat mich in den Arm genommen.
Willst du es nicht?, hat mich Philippe gefragt.
Doch, habe ich geflüstert, ich will es auch.
Dann musst du auch atmen, sonst erstickst du.
Eine Weile ist es vollkommen still gewesen … zwischen David und mir. Wir haben uns nicht gerührt, aber mein Herz hat wie wild geschlagen.
Es ist fast vier Uhr früh. Wollen wir uns nicht hinlegen? Dann können wir noch besser reden.
David hat den Kopf geschüttelt.
Während er seine Schuhe angezogen hat, habe ich gewusst, dass er es später bereuen würde.
Ich hab mich aufs Bett gelegt, mir vorgestellt, wie er am Donaukanal entlangmarschiert, unter den Brücken durch, die den zweiten Bezirk mit dem ersten Bezirk verbinden. Vermutlich hat er schon am Weg zu seinem Cousin diesen Brief im Kopf entworfen.
Ich habe mir dann noch einen heruntergeholt und dabei abwechselnd an Philippe und an David gedacht, an schulterlange Haare, einen knochigen Körper, weiße Haut, einen samtigen Schwanz, der zu meiner Überraschung ohne jeden Schmerz in mich eingedrungen ist.
Eine Woche später ist dieser Brief an die Adresse meiner Eltern gekommen. Darin hat David geschrieben, wie sehr er es bereut hat, nicht geblieben zu sein, dass ihm erst später klar geworden ist, dass er auch will, was Philippe gewollt hatte, ohne in dem Brief zu sagen, was das war. Er schrieb, dass ich ihm schreiben soll, dass er mich wiedersehen möchte, sobald er nach Wien kommen würde, um zu studieren.
Ich verstehe immer noch nicht, warum der Brief an meine Eltern und nicht an meine Wiener Adresse kam. Kann sein, er hat sie sich nicht gemerkt … aber wenn er die andere Adresse herausgefunden hat, hätte er auch meine … und so weiter, keine Ahnung. Ist ja auch egal. Ist über dreißig Jahre her.
Meine Mutter hat den Brief aufgemacht, mit der Begründung, es könnte ja was Wichtiges sein. Sie hat mich angerufen. Hallo Matthias. Ihre Stimme klang merkwürdig. Ich war gewarnt, ohne zu ahnen, worauf es hinauslaufen würde.
Und dann hat meine Mutter mit leiser, ängstlicher, ungläubiger Stimme gefragt: Wer ist dieser David?
(…)
Liliane
Alle denken, bei diesen katholischen Polen redet niemand drüber, nicht offen, nur im Geheimen, oder gar nicht. Alles richtig. Es darf in unserer Familie über nichts gesprochen werden, nichts, was Tomasz angeht. Aber es war nicht Aids, es war Hautkrebs, und wenn du jung bist und Hautkrebs hast, geht das genauso schnell wie bei Aids in den
Achtzigerjahren, als es noch keine so guten Medikamente gegeben hat, das weiß ich von einer Freundin, die Ärztin ist und auch Polin.
Tomasz wurde im selben Jahr geboren, in dem ich nach Wien gekommen bin, lange vor dem Zusammenbruch des Ostblocks. Statt in Wien zu studieren, habe ich in einer Konservenfabrik gearbeitet. Die haben dort auch Ehen zwischen Österreichern und osteuropäischen Frauen vermittelt, damit man ohne Probleme bleiben konnte. Ohne Probleme mit den Ämtern. Auch ich bin so zu meinem Mann gekommen. Von ihm habe ich zwei Kinder. Es ging um meine Aufenthaltsgenehmigung und um seinen Sex. So war das damals.
Tomasz ist ohne Voranmeldung vor der Tür gestanden, der Ostblock war da gerade am Zerbröckeln. Er hat bei uns geputzt und auf die Kinder aufgepasst. Dafür hat er gratis bei uns gewohnt und gegessen, und wenn ich ihn gefragt habe, was er vorhat mit diesem Leben, hat er gesagt, Theaterstücke schreiben, Stücke wie von Beckett, aber das ist auch typisch polnisch, immer nur davon reden, was einmal sein wird, aber nie wirklich was machen. Also ich wüsste nicht, dass Tomasz jemals eine Zeile geschrieben hätte.
Dass Tomasz schwul ist, hab ich nicht gewusst, erst, nachdem dieser David aufgetaucht ist.
Bei Schwulen, habe ich immer gedacht, geht es um Liebe, um wirkliche Liebe, anders als bei Heteros, da geht es um Fortpflanzung und Sicherheit, nicht um so was Unnützes wie Liebe … bis zu diesem einen Vorfall: David war das dritte oder vierte Mal bei uns. Auch polnische Freunde sind dagewesen. Wir haben Wodka getrunken, und plötzlich fing Tomasz von der Nazizeit an, erst redete er nur so blöd rum, aber dann sagte er zu David, wenn du damals gelebt hättest, wärst du auch ein Nazi gewesen und hättest polnische Männer und Frauen und Kinder umgebracht, und dann hat Tomasz plötzlich so einen dicken schwarzen Filzstift in der Hand, und zwei halten David fest und Tomasz malt ihm ein Hitlerbärtchen auf, und wir lachen uns kaputt, wir waren betrunken, beschimpften ihn auf Polnisch, da kam was hoch, was ganz tief in uns Polen drinnen ist.
(…)
Ich weiß nicht mehr, wie das Ganze zu Ende gegangen ist, aber als er weg war, war ich mir sicher, den sehe ich nie wieder. Falsch. Als wäre nichts gewesen, ist David am nächsten Tag wiedergekommen. Tomasz war gerade den Familieneinkauf machen und ich habe mich bei David entschuldigt: wegen gestern. Er hat gesagt, ich soll mir deswegen keine Gedanken machen. Also habe ich mir deswegen keine Gedanken mehr gemacht. Bis ein halbes Jahr später mein damaliger Mann wollte, dass Tomasz auszieht. Es gab deswegen einen Riesenstreit. Tomasz war meine Familie. Aber mein Mann war der Vater meiner Kinder. Ich konnte mich nicht entscheiden. David entschied. Tomasz zog zu ihm, das war ’91, im April. Ein paar Wochen lang hörte ich nichts von meinem Cousin. Es gab ja in den Neunzigern noch keine Handys, und ich habe keine Adresse gehabt.
Dann stand Tomasz wieder vor der Tür, dieselben Klamotten an, dieselbe Tasche wie beim ersten Mal, als er für eine Weile bei uns hatte wohnen wollen. Und wieder: Kann ich für ein paar Tage bei euch …? Wie in einem Stück von Beckett. Als würde alles nochmals von vorne beginnen. Mit dem Unterschied: David hatte eine tiefe Wunde im Gesicht.
Was ist passiert?
Nichts.
Das muss genäht werden!
Da er nicht krankenversichert war, bin ich mit ihm nicht ins Krankenhaus, ich habe diese befreundete polnische Ärztin angerufen, die hat sich, so gut es ging, um Tomasz’ Verletzung gekümmert. Es ist eine ziemlich scheußliche Narbe zurückgeblieben, quer über die rechte Wange. Richtig hässlich. Ich konnte da nie hinsehen.
Nur einmal habe ich beobachtet, wie Tomasz im Bad vor dem Spiegel stand und den Fleischwulst in seinem Gesicht betrachtete und vor sich hin flüsterte: To scierwo! – diese Drecksau, to nazista!
(…)
Theres
Mein Sexleben war damals so: Wenn ein Schwuler Sex mit einer Frau wollte, konnte er mit mir Sex haben.
Merke: Nicht alle Frauen können nur Sex haben, wenn auch Emotionen im Spiel sind.
Und: Es gibt mehr Schwule, die Lust auf eine Muschi haben, als man denkt.
Außerdem: Je fetter … je weiblicher die Frau, umso besser.
Ich war schon als Kind in Schleswig-Holstein ein Koloss und fand das nie ein Problem. Auch in Cliquen habe ich mich immer schon wohlgefühlt. Ich war die Anführerin der Wild Robots, einer Mädchenbande, die den Schlosspark von Eutin kontrollierte. Meine Berliner Clique bestand hingegen nur aus Schwulen, darunter kein einziger Deutscher, insgesamt vier Leute: ein Italiener, ein Chilene, ein Däne und ich, die immer gute Laune hatten. Meine Boygroup und ich trafen uns jeden Samstag im Anderen Ufer in Schöneberg, von dort zogen wir los, in den Hafen, ins Roses, ich war eine der wenigen Frauen, die sogar ins Tom’s durften.
David saß im Anderen Ufer alleine an der Bar, mit krummem Rücken auf einem Hocker … Total verspannt, war mein erster Gedanke. Verspannte Leute passten nicht zu uns, fanden wir. Trotzdem hat der Chilene ihn angesprochen, und David kam zu uns herüber, blablabla, ich fragte ihn, ob er Ausländer sei. Erst kapierte er nicht, was die Frage soll …
Nur dann du können mit uns losziehen.
Meine Boygroup lachte. David fand mein Deutschtürkisch nicht lustig, aber er sagte: Ja. Ich Ausländer. Ich Österreicher. Das war sein einziger Witz an diesem Abend.
Er brach mit uns auf, die übliche Tour, wobei er die ganze Zeit in meiner Nähe war, immer irgendwelche ernsthaften Fragen stellte, er wollte über interkulturellen Quatsch und was weiß ich reden, er verstand nicht, dass wir einfach nur Spaß haben wollten.
Kannst du mal lachen? Nur ein einziges Mal? Für mich!
Im Tom’s überließen der Chilene und die anderen David mir und verschwanden im Keller. Na, super! Doris, die Transe hinterm Tresen, erkannte mein Schicksal, schenkte ihm nach und flötete: Entspann dich doch mal! Aber er lächelte nur gequält. Warum haute er nicht einfach ab? Der Italiener war seit einer Stunde nicht aus dem Keller heraufgekommen, der Chilene war mit jemandem abgerauscht, hatte mir im Vorbeigehen einen Kuss auf die Wange gedrückt und ins Ohr geflüstert: Viel Spaß mit dem Österreicher!
Willst du ficken?, fragte ich David, da war es bereits ein Uhr morgens.
David schüttelte den Kopf, aber er hatte mich missverstanden, also nochmals genauer: Willst du mit mir ficken?
Wenig später nahmen wir das Taxi, eines stand immer vorm Tom’s, um Leute, die es eilig hatten, irgendwohin zu bringen.
Es ist immer das Gleiche: Vorher tun sie so, als würden sie es nicht wollen, währenddessen tun sie so, als wäre ich nicht anwesend, nachher tun sie so, als wäre es nie geschehen.
David war eine echte Überraschung: Er roch an mir, als wäre ich eine Blume. Er schaute sich jeden Teil meines Körpers an, als wäre er noch nie einem menschlichen Wesen begegnet. Aber auch David machte Sex mit einer Frau traurig, so wie alle Schwulen, mit denen ich in die Kiste stieg. Es fühlt sich an wie der Verrat an einer größeren Sache, hat einmal einer gesagt. Aber vielleicht war es bei David auch was anderes, vielleicht war für ihn der Sex mit mir etwas anderes als Verrat an einer größeren Sache. Wer weiß? Kann ja sein.
Am Morgen schien die Sonne zum Fenster herein. David kam mit Kaffee und frischen Croissants, die er vom Bäcker an der Ecke geholt hatte. Das Telefon klingelte. Davids Vater rief an, wie jeden Sonntag. Ich lag auf dem Bett, hatte die Augen geschlossen. David erzählte von der Universität, von einem Buch über Beckett, an dem er gerade arbeitete, er sagte, dass die Sonne scheinen, dass es ihm gut gehen würde, er erkundigte sich, was seine Mutter heute für seinen Vater kochen würde, dann legte David auf und es war still im Zimmer.
Du bist Germanist. Warum über Beckett?, wollte ich wissen.
David zuckte mit den Schultern, sah vor sich hin, wusste nicht, ob er davon erzählen sollte oder nicht. Dann sagte er es doch, er habe einmal jemanden gekannt, der Stücke wie Beckett habe schreiben wollen.
Und hat er es gemacht?
Nein.
Aber der hat dir etwas bedeutet? David nickte.
Viel bedeutet?
Er war Pole.
Und?
Wir haben keinen Kontakt mehr. Wie lange nicht?
Mindestens fünfzehn Jahre.
Und was kocht sie?, fragte ich nach einer Weile.
David verstand nicht.
Deine Mutter, was kocht sie?
Statt auf meine Frage zu antworten, sagte er, dass während des Telefonats mit seinem Vater im Hintergrund die Kirchenglocken seines Heimatdorfes zu hören gewesen waren.
Aha, sagte ich.
Und David: Ich haben schrecklichen Heimweh.
Dann lachte er. Ich sollte es wieder für einen Witz halten. Aber es war ein trauriger Witz.
Es war überhaupt kein Witz.
(…)
Richard
David war ungefähr Anfang vierzig, ziemlich groß, leichter Bauchansatz, kräftiges Kinn, dieser typische Berliner Vollbart, irgendwie zu viele Haare oder einen zu großen Kopf. Er bräuchte mal einen guten Friseur, dachte ich jedes Mal, wenn ich ihn im Jaxx gesehen hatte. Nicht, dass wir uns nicht interessiert gemustert hätten, aber weil einer von uns immer rechtzeitig abgebogen ist, sind wir nie gemeinsam in einer Kabine gelandet.
David kam an dem Tag etwa eine halbe Stunde nach mir ins Jaxx. Kaum hatte er mich bemerkt, machte er mit dem Kopf eine Bewegung, er wollte, dass ich ihm folge. Als ich die angelehnte Tür zu der Kabine ganz hinten im Eck aufstieß, saß David auf der Bank unter dem Monitor, auf dem Pornos liefen, die Beine übereinandergeschlagen, die Hände im Schoß, gefaltet, in das Glory Hole hatte er Papier gestopft. Ich schloss die Tür hinter mir und lehnte mich dagegen, warf einen Blick auf den Bildschirm, dort spritzten gerade ein paar Schwarze einem Weißen ins Gesicht, der lag am Boden und leckte sich das Zeugs von den Lippen. Die Lautstärke war auf Maximum gedreht, aus den Boxen in den Gängen wummerte Techno. Ohne den Blick vom Bildschirm zu nehmen, öffnete ich meine Gürtelschnalle …
He, sagte David, ich will nichts machen. Okay.
Wirklich?
Sollen wir woanders hingehen?
Nein.
David rückte ein Stück zur Seite und ich hockte mich neben ihn. Es stank nach Zigarettenrauch, Schweiß, Sperma und Poppers. Er starrte auf den Spiegel an der Tür, durch den man den Porno sehen konnte.
Erst kapierte ich nicht, wovon David sprach. Bis ich mir nach und nach die Geschichte zusammenreimte: Es ging um einen Polen, mit dem er vor über zwanzig Jahren in Wien zusammen gewesen war. Er hieß Tomasz. David hatte gerade erfahren, dass Tomasz tot ist. Er ist schon vor mehreren Jahren verstorben. Hautkrebs. Kann man von einer schlecht vernarbten Wunde Hautkrebs kriegen? Keine Ahnung. Aber David war überzeugt, dass es kein Hautkrebs gewesen war, wie Tomasz’ Kusine behauptete, sondern Aids, auch wenn er dafür keine Beweise hatte. Aber das war nicht der eigentliche Punkt …
Tomasz war David in Wien vor der Albertina aufgefallen, wo gerade Dürer-Zeichnungen ausgestellt waren – und zwar die Originale, nicht nur Kopien wie sonst. Tomasz sprach Leute um Kleingeld an, er wollte so das Eintrittsgeld zusammenschnorren. David zahlte für ihn ein Ticket. Tomasz redete über die Bilder, als hätte er sie gemalt. Er konnte in ihnen lesen, als wären es Bücher. Er sprach über die Zeichnungen von Dürer und gleichzeitig über sich selbst, seine Ängste, seine Sehnsüchte, seine Pläne, sein Fremdsein in Wien. Und David kam es vor, Tomasz spreche nicht nur über Dürer und sich, sondern auch über ihn, über Davids Fremdsein in der Welt. Aber auch das war nicht der eigentliche Punkt.
Der eigentliche Punkt war: David hatte Tomasz vor über zwanzig Jahren verletzt. Tatsächlich. Körperlich. Mit einem Messer. Im Gesicht. Nur, weil Tomasz mit jemandem auf Polnisch telefoniert hatte. Als David ihn fragte, worum es ginge, hat er gelacht und auf Polnisch weitergeredet und David hat gesagt, er soll deutsch reden, hat er aber nicht, da hat David das Messer genommen, und Tomasz hat sich irgendwie komisch bewegt, und David traf Tomasz mit dem Messer im Gesicht. Überall war Blut. Jahrelang hatte er sich einzureden versucht, dass es ein Unfall war. Es war kein Unfall, sagte David, ich hasste ihn in diesem Augenblick, weil er auf Polnisch telefonierte.
Tomasz hat David nie angezeigt, er konnte sich das nicht leisten, das war in den Achtzigerjahren, Tomasz hatte keine Aufenthaltsgenehmigung.
Ich wollte immer mit ihm darüber reden, sagte David.
Wolltest du dich entschuldigen?
Ich wollte mit ihm reden, sagte David nochmals, als hätte er meine Frage nicht verstanden. Sie hatten seit damals keinen Kontakt mehr. Und es hatte zwanzig Jahre gedauert, ehe David den Mut aufbrachte, ihn ausfindig zu machen, sich wieder bei ihm zu melden. So hat er erfahren, dass Tomasz tot ist und seine Eltern ihn in seinem polnischen Heimatdorf begraben haben.
David starrte auf den Porno, dort wechselten ein Typ mit Vollbart und ein extrem junger, extrem dünner Boy gerade die Stellung. Flipflop. Eine Weile schauten wir beide teilnahmslos zu.
Ich hoffte, wenn ich noch mal mit Tomasz reden würde, dann würde es aufhören, sagte David plötzlich. Dann würde die Angst aufhören, dass es wiederkommt, dass ich es eines Tages wieder tue, aus irgendeinem lächerlichen Grund. Ich habe diese Angst gut versteckt. Aber sie ist immer da.
Ich gab David an diesem Tag meine Telefonnummer. Ich sagte, wenn du jemanden zum Reden brauchst.
Eineinhalb Jahre. Es vergingen ein wenig mehr als eineinhalb Jahre, bis das Telefon klingelte und ich sofort an David dachte, als eine österreichische Nummer am Display erschien. Ich habe sonst nie jemanden aus Österreich kennengelernt. David sagte, er lebe jetzt wieder in Wien. Dann schwieg er und ich fragte nach einer Weile: Warum rufst du eigentlich an?
Ich habe beim Auspacken deine Telefonnummer gefunden, hörte ich seine Stimme. Er sagte: Ich kann mich noch erinnern, wie wir den Spaziergang am Lietzensee gemacht haben.
Warum bist du nach Wien zurückgekehrt?
Wieder schwieg er eine Weile, dann sagte er leise: Es ist wieder passiert.
Was ist passiert?
Ich hörte David atmen. Nachdem abermals nichts von ihm kam, sagte ich es ihm: Wir sind nicht um den Lietzensee gegangen. Obwohl ich seit fast dreißig Jahren in Berlin lebe, bin ich nie am Lietzensee gewesen. Wir sind uns nur einmal begegnet. Du hast mir im Jaxx von Tomasz erzählt.
Bist du nicht Erik?
Nein, sagte ich. Ich bin Richi, Richard.
Das tut mir leid.
Nein, macht nichts. Erzähl lieber, was passiert ist!
Mike
Anfangs war es nur ein Balgen, wie unter Jungs, hilflos, ein bisschen lächerlich für Männer in unserem Alter, ungelenk, Luftboxen, Schläge andeuten, in Deckung gehen, Gelächter, Gegner, jung fühlen, Fremde, Freunde, alles gleichzeitig, abschätzen, hingezogen fühlen,
Verachtung, Gier, spiel mit mir!, ich spiel mit dir, ein angedeuteter Haken, einer packt den anderen am Handgelenk, zieht sein Gegenüber zu sich …
(…)
Der Schlag in den Bauch kam so plötzlich, so unvermittelt, dass mir keine Zeit blieb, ihn abzuwehren. Im ersten Augenblick dachte ich, mein Bauch sei geplatzt, seine Faust direkt in die Eingeweide gefahren und stecke dort fest, zwischen den Organen verheddert. Meine Kehle war zugeschnürt, als würde sie jemand zudrücken. Ich presste intuitiv die Augen zusammen, klappte gleichzeitig nach vorne, hörte ein Röcheln und brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass es aus meinem Mund kam. Ich wollte dieses scheppernde Geräusch hinunterschlucken oder abwürgen … aber es röhrte, ohne dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, es zu beenden.
(…)
Ich ersticke. Ich versuchte es auszusprechen, ich versuchte mit den Lippen und meiner Zunge diese beiden Worte zu formen: Ich ersticke – war nur eine Beschreibung dessen, was gerade passierte. Nicht einmal das gelang mir. Wieder war es nur unverständliches Krächzen. Im Reflex riss ich die Arme hoch, machte zwei unsichere Schritte, aber bevor ich mich nach ihm umdrehen konnte, um zu sehen, wo er war, kam wieder ein Stoß, diesmal in meinen Rücken. Dieser zweite Angriff riss mir die Beine unter dem Boden weg, meine Stirn schlug gegen den Glasrahmen, hinter dem ich ein altes Filmplakat aufgehängt hatte, Das Gesetz der Begierde von Almodóvar. Mein Kopf schlug gegen den Kopf des jungen Antonio Banderas. In meinen Ohren klang es, als hätte eine Detonation alle Fensterscheiben mit einem Knall zum Zerbersten gebracht, träge rutschte ich zu Boden, Scherben rieselten auf mich herab, sprangen auf das Parkett, unter Davids Schuhen knirschte Glas, dann stand er über mir, stand nur da, reglos, und ich konnte zum ersten Mal seit dem Schlag in den Bauch einen halbwegs klaren Gedanken fassen. Das ist kein Spiel mehr, dachte ich, das hier ist eine Riesenscheiße.
David sah auf mich herab. In seinem Gesicht war kein Bedauern, kein Mitleid, keine Wut, keine Befriedigung, einfach nichts.
Es war noch nicht vorbei.
(…)
Ich weiß nicht, warum das alles geschehen ist, auch heute noch nicht. Ich weiß nicht, warum es angefangen hat und warum es aufgehört hat. Am allerwenigsten weiß ich, warum er wortlos gegangen ist. Dass er nichts zum Abschied gesagt hat, tut jetzt, da alle Wunden verheilt sind, am meisten weh.
Meinen Leuten im Büro habe ich gesagt, es sei ein Fahrradunfall gewesen, ein verdammt dummer Sturz, nicht ungefährlich. Aber auch nicht so bedenklich, wie es aussah. Von nun an würde ich immer einen Helm tragen, versprach ich ihnen hoch und heilig. Den geplanten Besuch bei meiner Mutter habe ich um einen ganzen Monat aufgeschoben.
Niemand in meinem Umfeld weiß, dass ich ein, zwei Mal pro Woche Typen treffe, die ich nicht oder kaum kenne, denselben Typen nie öfter als drei, vier Mal. Dann wird es langweilig. Man meldet sich einfach nicht mehr oder erzählt irgendeine Scheißlüge.
Jedes Mal nehme ich mir vor, dass ich irgendwann damit aufhöre, aber dann bist du nachts einsam und im Fernsehen läuft irgendein Schwachsinn und du klappst den Laptop auf und loggst dich bei einer dieser Plattformen ein und sagst dir: Nur noch das eine Mal. Dieses eine Mal noch, vielleicht triffst du diesmal den Einen, den Einen, der so richtig ist wie sonst keiner … bei dem du dann bleibst, für immer … zumindest für den Rest deines Lebens.
Stefan
Seit drei Jahren sind David und ich jetzt ein Paar. Wir können das: zusammensein. Wir können uns nah sein. Wir können für den anderen da sein. In letzter Zeit reden wir sogar übers Heiraten. Zwei Punkte wären uns dabei wichtig: Genauso heiraten zu dürfen wie Heterosexuelle, gleiche Rechte, gleiche Pflichten … und … es soll ein großes Fest geben, ein Fest für seine Familie, meine Familie, seine Freunde, meine Freunde, unsere gemeinsamen Freunde. Auch über Kinder reden wir. Aber nicht so ernsthaft wie übers Heiraten. Schließlich sind wir beide über fünfzig! Doch es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir uns um einen dieser jungen unbegleiteten Flüchtlinge kümmern. Dafür müsste man natürlich Zeit haben. Wir sind beide beruflich eingespannt und reisen viel. Wir lieben Asien, die asiatische Küche, die asiatische Philosophie, einmal im Jahr geht es nach Sri Lanka zum Ayurveda. In der Nähe von Galle haben wir bei einer Bootstour vor Sonnenaufgang einen Tempel auf einer Insel mitten in einem Fluss entdeckt. Dort lebt ein Mönch, der gegen eine Spende von ein paar Tausend Rupien buddhistische Hochzeitszeremonien durchführt, auch für Schwule. Vielleicht machen wir das im kommenden Januar, wenn wir wieder in unserem Lieblingsresort sind, vielleicht heiraten wir dann, nur David und ich, nur wir zwei, ohne Familie, ohne Freunde, ohne österreichische Behörden …
Woran denkst du gerade?
Früher habe ich David das oft gefragt. Eine richtige Antwort habe ich nie bekommen. Er wich aus, hat sich noch mehr verschlossen, sich noch mehr in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Ich brauche auch nicht unbedingt auf alle meine Fragen Antworten. Aber wenn man mir eine Antwort gibt, dann will ich nicht angelogen werden!
Was ist das, das David mir nicht zeigt, das er vor mir versteckt?
Einmal habe ich ein paar seiner Freunde danach gefragt. Sie haben mich ausgelacht. David ist einer der charmantesten, liebenswürdigsten, vertrauenswürdigsten Menschen! Außerdem bist du ihm am nächsten. Du kennst ihn wie keiner von uns.
Aber ihr kennt ihn länger.
Jetzt schwiegen sie. Jetzt schwiegen auch sie.
Mit fünfzig ist man einer Menge Menschen begegnet: Eltern, Geschwistern, Schulfreunden, zufälligen Bekanntschaften, Kommilitonen, Lehrern, Professoren, Schülern, Nachbarn. Einige, die man kennenlernt, treffen aufeinander, daraus entstehen erneut Freundschaften,
Beziehungen, flüchtige und tiefergehende, manchmal sogar Ehen. Um jeden breitet sich ein Netz aus, jeder Knoten ist ein Mensch, jeder Mensch ein Mittelpunkt. Viele der Menschen aus Davids Netzwerk habe ich in den vergangenen drei Jahren kennengelernt.
Aber in jedem Leben gibt es noch eine kleinere oder größere Anzahl an Menschen, die nicht mit diesem Netz verknüpft werden, sie werden nie den Freunden vorgestellt, sie werden vor den anderen verborgen gehalten, über sie wird nie gesprochen.
Es gab eine Menge, hat David einmal gesagt. Er meinte, eine Menge solcher Menschen, die niemals Teil seines Netzes geworden waren. Diese Menschen würde ich gerne alle um einen Tisch versammeln. Von ihnen würde ich gerne hören, was sie über David zu erzählen haben. Ich würde sie fragen, wie sie ihn getroffen haben, was sie mit ihm verbunden hat, was sie zusammen erlebt haben, wie ihre Begegnung wieder endete.
Aber ich weiß nichts über sie. Es gibt keine Fotos. Ich kenne keine Namen. David hat hin und wieder eine vage Andeutung gemacht. Außerdem bin ich nicht sicher, ob ich ihre Geschichten überhaupt hören will, auch nicht, ob ich ein Recht habe, sie zu erfahren.
Andererseits ließ mich dieser Wunsch gerade in letzter Zeit nicht los, er hielt mich von der Arbeit ab, verfolgte mich bis in meine Träume.
Gestern habe ich mit David darüber gesprochen. Nicht, damit er mir hilft, meinen Wunsch zu verwirklichen, ich wollte hören, ob er auch solche Gedanken hat, ob er auch solche Wünsche hegt.
Heute Morgen fand ich ein Blatt Papier auf meinem Schreibtisch, darauf stand ein Gedicht, Davids Handschrift: Was ich an dir mag, ist das Geheime / jedes Wort zu viel ist schon Gefahr / denn so schnell verfällt ins Allgemeine / was zuvor so ganz besonders war / Ist es deine Stimme / sind es deine Hände / ach – dein ganzes Wesen fesselt mich / um dich zu beschreiben, bräucht es Bände / besser sag ich schlicht: Ich liebe dich …
Während ich las, merkte ich, dass David hinter mir in der Tür stand. Als ich mich nach ihm umdrehte, sah er mich ruhig an.
Ist das von dir?
Ja, sagte David, ich habe es vor Ewigkeiten geschrieben. Damals war ich vierzehn. Ich habe jahrelang nicht daran gedacht. Ich hatte es vollkommen vergessen, es war aus meinem Gehirn gelöscht. Gestern, nachdem wir gesprochen hatten, fiel es mir wieder ein. Wort für Wort, Zeile für Zeile.
Dieser Ausschnitt stammt aus der 80-seitigen Erzählung »Wir haben keinen Kontakt mehr« von Andreas Jungwirth, die im September 2019 im Verlag der Edition Atelier erschienen ist (ISBN: 978-3-99065-016-5). Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Verlags. editionatelier.at
Anne Schelzig
»Nicht die Liebe macht blind, sondern die Sehnsucht danach«
3. November
Heute wieder meinen Traum gehabt. Hätte damit eher an ihrem Geburtstag gerechnet. Ich sehe ihr Gesicht vor mir, sehe, wie sie vom Zug erfasst wird, wie sie mir hinterher blickt, ich sehe ihren abgerissenen Kopf, obwohl das gar nicht sein kann. Sie hat mich ja erst angesehen, und sich dann umgedreht. Hätte sie sich nicht umgedreht, wäre sie ja gar nicht erst vor den Zug gelaufen. Und trotzdem – dieser Blick.
Dann bei Frau Richter gewesen. Habe mich schon wieder gefragt, ob es irgendwie sein kann, dass ich diese Steffi-Träume absichtlich vor den Tagen bekomme, an denen ich zu Frau Richter gehe. Sie wollte, dass ich mich an den perfekten Tag mit Steffi erinnere.
Natürlich – und das war wohl von Anfang an der Sinn der Übung – gab es keinen perfekten Tag.
Nur solche, die fast perfekt waren.
Die hätten perfekt sein können, wenn ich genügend Arsch in der Hose gehabt hätte.
Wie der Tag, an dem wir im Strandbad rumknutschten. Es war nicht perfekt, aber um Längen besser als die Knutschversuche, die ich bisher mit Jungen unternommen hatte.
„Na, übt ihr schon mal?“, riefen zwei Typen von der Bank schräg gegenüber. Sie grinsten dämlich. „Sollen wir euch helfen?“, nervten sie weiter, als wir nicht reagierten.
„Ja, von mir aus, macht doch.“ Ich wollte frech und trotzdem lässig klingen – und ging natürlich keine Minute lang davon aus, dass sie tatsächlich zu uns rüberkommen würden.
Steffi neben mir erstarrte. Ihre Scham, ihre Abscheu übertrugen sich innerhalb von Sekundenbruchteilen auf mich.
Als sie weg waren, versuchte ich trotzdem, Steffi nochmal zu küssen, aber sie wollte nicht mehr. Ich habe mich tierisch aufgeregt. Dass sie eine Spaßbremse ist und mich nicht wirklich liebt, wenn sie sich von so ein paar Honks aus der Fassung bringen lässt. Ich war so dumm damals. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Hat schon meine Oma immer gesagt. Alles Perfekte ist für mich Heuchelei.
10. November
Frau Richter meinte, ich hätte ein „negativistisches Weltbild“. Dafür könne ich nichts, das sei wohl eine Folge der kontinuierlich negativen Erfahrungen, die ich gemacht habe, und die durch meine Mütter leider nur unzureichend aufgefangen wurden, da sie mit den negativen Erfahrungen beschäftigt waren, die sie selbst machen mussten. Ich sagte, mehr, damit ich es gesagt hatte, dass meine Eltern doch ihr Möglichstes getan hätten, um mir eine Stütze zu sein.
„Manchmal ist das Möglichste eben nicht genug. Sie können ja beides akzeptieren – dass Ihre Eltern Sie lieben und sich um Sie gekümmert haben, dass ihnen das aber nicht immer gelungen ist“, sagte sie, als sei ich ein vernachlässigtes geschlagenes Heimkind, das seine prügelnden Eltern trotz allem mit Zähnen und Klauen verteidigt.
Dabei hatte ich nur nicht den Eindruck erwecken wollen, ich würde meine Eltern hassen und sie bei jeder Gelegenheit in die Pfanne hauen.
Außerdem, einerseits soll ich akzeptieren, dass es nichts gibt, was perfekt ist, andererseits aber auch nicht alles so negativ sehen. Was denn jetzt?
11. November
Alles, was ich mit Steffi Schönes erlebt habe, ist mit irgendeiner Kacke verknüpft. Schon allein, wie ich sie kennengelernt habe. Auf einem Ausbildungskurs zur Jugendleiterin bei der evangelischen Kirche. Bei einem Bezirksjugendreferenten, der den guten alten Zeiten hinterhertrauerte, als die Betreuer noch bei den Jugendlichen im Zelt schliefen, weil das nun mal „zum Erwachsenwerden“ dazu gehörte, dass Erwachsene und Kinder gewisse Zeiten gemeinsam verbrachten. Er heulte rum, dass das nun alles nicht mehr erlaubt sei, weil einige hysterische Eltern sich beschwert hätten, dass da auf einer von hundert Freizeiten mal irgendetwas passiert sei, was die mutmaßlichen Opfer im Nachhinein als „übergriffig“ interpretiert hätten.
Ich war natürlich gleich mal bedient.
Steffi sah mich an. „Jedes Opfer ist eines zu viel“, verkündete sie, ohne sich vorher gemeldet zu haben, und ohne mich noch mal anzusehen. „Außerdem ist doch die Frage, von wem dieser Wunsch nach gemeinsamen Aktivitäten ausgeht. Es sind doch wohl meistens Erwachsene, die Kindern diesen Wunsch unterstellen. Ich fand es als Kind total gut, meine Nächte im Zelt nur mit anderen Kindern verbringen zu können.“
„Kinder wissen halt manchmal nicht, was sie eigentlich brauchen“, behauptete Herr Schödl.
„Igitt. Sie hören sich doch hoffentlich selber, oder? Außerdem, voll diskriminierend, zu behaupten, Kinder würden ihre eigenen Bedürfnisse nicht spüren.“
„Diskriminierend, ach je. Hab ich mir da etwa wieder eine von diesen Progressiven eingefangen?“
„Doch wohl nur, weil Erwachsene ihnen abgewöhnt haben, ihre Bedürfnisse ernst zu nehmen“, sprach Steffi über ihn hinweg.
Plötzlich bekam ich richtig Lust, mich auch mit diesem Vollpfosten zu streiten. „Wenn man es wirklich korrekt benennen will“, sagte ich, „sind es doch vor allem weibliche Kinder, denen ihre Wahrnehmung absozialisiert wird.“
Zumindest stand das in einer von Ronnis Bettlektüren, wo sich das Lesezeichen innerhalb der letzten fünf Jahre allerdings nur um siebzehn Seiten weiterbewegt hatte. Ich wusste das, weil ich gelegentlich durch dieses Buch blätterte, seit ich entdeckt hatte, dass darin das Wort „Orgasmus“ vorkam – den Frauen unter patriarchalen Bedingungen so gut wie nie erreichten, weil sie sozialisationsbedingt nie gelernt hatten, eigenständiges Begehren zu entwickeln, sondern ihre sexuelle Empfindungsfähigkeit darauf konditioniert worden war, nur auf Reize zu reagieren, die von außen an sie herangetragen wurden.
Alles Weitere war mir zu kompliziert.
„Oh, eine Feministin haben wir auch noch.“ Herr Schödl sah nach Lachern heischend in die Runde. „Ach, bist du nicht die mit den beiden Elterinnen?“, fragte er, als keine kamen.
Hier lachten tatsächlich ein paar Leute, aber ich glaube eher, um ihre Fremdscham zu überspielen und um zu verhindern, dass er noch weiter peinliche Witze machte.
Wir waren jedenfalls gleich vom ersten Tag an unten durch.
Spoiler Alert, wir sind nach einem halben Jahr aus dem Kurs geflogen, weil wir das christliche Gedankengut nicht überzeugend genug vermittelten. Ich muss zugeben, damit hatte er sogar recht.
Sowohl Steffi als auch ich waren schon Atheistinnen gewesen, als wir uns für diesen Kurs angemeldet hatten, und nach diesem ersten Wochenende wussten wir auch, wieso. Wir meldeten uns nur nicht ab, weil wir das Wochenende darauf schon zusammen waren und uns sonst nicht mehr hätten sehen können.
Ja, auch mit zwei lesbischen Müttern kann so was kompliziert sein, und für Steffi war es das sowieso.
Ihre Familie waren Bauern, die von der Milchwirtschaft, Kartoffel- und Gemüseanbau und, seit die Großmutter sich im Wald hinter dem Haus erhängt hatte und ihre Wohnung von Grund auf saniert worden war, auch von Feriengästen lebten. Offiziell war die Oma dement gewesen, hatte während eines Sommergewitters die Orientierung verloren, sich völlig durchnässt unter einen Baum gekauert und war im Laufe der Nacht erfroren.
„Im Sommer?“, fragten einige.
„Der Alkohol wird wohl auch noch seinen Teil dazu beigetragen haben, dass sie so schnell ausgekühlt ist“, mutmaßten andere.
Die familieninterne Version war, dass sie Steffis unnormales Verhalten, ihren lächerlichen Aufzug und überhaupt ihre abartigen
Neigungen nicht mehr ertragen hatte, vor allem, da Steffi ihre Perversionen auch noch so öffentlich zur Schau trug.
Steffi wusste, dass das nicht stimmte, ihre Oma war nämlich die Einzige, die sie von Anfang an so akzeptiert hatte, wie sie war.
Deswegen war der Großteil ihres Erbes auch an Steffi gegangen und nicht an Steffis Vater, oder wenigstens an ihren Bruder.
Der drehte nach dem Tod ihrer Oma völlig durch. Seinen Freunden gegenüber nannte er sie nur noch „die fette Steffi Manzer – halb Mann, halb Panzer“, und regte sich darüber auf, dass so was wie sie überhaupt den Namen „seiner Familie“ benutzen durfte. Was er sonst noch sagte oder machte, erfuhr ich nicht.
Ich habe mich oft gefragt, ob gewisse Probleme in unserer Beziehung vielleicht gar nicht erst aufgetaucht wären, wenn ich Steffi meinen Eltern vorgestellt und ausnahmsweise auf Irinas dummes Gelaber geschissen hätte. Aber selbst wenn, Steffis Eltern hätten ihr doch nie erlaubt, dass sie mich besuchen kommt, geschweige denn, dass sie bei mir übernachtet. Da ließ ich es mir lieber gefallen, dass Steffi behauptete, ich würde unsere Beziehung nur geheim halten, weil ich mich auch mal interessant fühlen wollte.
Dabei ging es mir nur darum, dass wir beide gleiche Ausgangsbedingungen hatten. Irgendwie spürte ich schon ganz am Anfang, dass es ein Ungleichgewicht in unsere Beziehung bringen würde, wenn sie immer nur bei mir wäre und wir beide uns vor ihren Eltern geheim halten müssten.
Am Ende hatte ich ja recht behalten, wenn auch aus anderen Gründen als gedacht.
„Ich lass mir da schon was einfallen, mach du dir mal keinen Kopf“, sagte Steffi immer.
Sie hätte ihren Eltern erzählt, dass sie weiterhin zu diesem Kurs ging, und hätte am Ende sogar das Zertifikat gefälscht. Dafür, dass sie solche Arschloch-Eltern hatte, war sie erstaunlich naiv. Sie glaubte allen Ernstes, sich in den Sommerferien zwei Wochen lang bei mir verstecken zu können, während sie offiziell als Betreuerin an der
Sommerfreizeit teilnahm, die wir als Prüfung gebraucht hätten, um besagtes Zertifikat zu bekommen.
Irina fand schon heraus, dass ich sie angelogen hatte, als ich nach dem zweiten Kurswochenende behauptete, Herr Schödl habe überzogen und ich hätte einen späteren Zug nehmen müssen. In Wirklichkeit war ich mit Steffi einen Döner essen – unser Ersatz für das, was für normale Menschen das erste Date war.
Irina rief bei den Eltern von Emma an, die auch bei uns im Kurs war, unter dem Vorwand, sie wolle wissen, ob es schon eine Liste gebe, wer was zum Erntedankfest im Oktober mitbringe. Im Laufe des Gesprächs bemerkte sie nebenbei, dass zwei ganze Tage am Wochenende ja schon ziemlich lang seien und man nur hoffen könne, dass Herr Schödl es sich nicht zur Gewohnheit machte, zu überziehen. Schließlich mussten die Kinder ja auch noch Hausaufgaben machen.
„Also die Emma ist gerade zur Tür rein und ist auch das letzte Mal pünktlich nach Hause gekommen“, meinte Emmas Mutter, und ich war (mal wieder) enttarnt.
„Wir sind wirklich enttäuscht. Wir würden dir doch alles erlauben, wenn du einfach normal fragen würdest wie andere Kinder in deinem Alter“, behauptete Irina. „Wieso hast du uns nicht einfach gefragt, ob du noch mit ein paar anderen Leuten aus deinem Kurs einen Döner essen darfst? Ich verstehe nicht, wieso du uns unterstellst, wir würden dir so etwas nicht erlauben. Ich nehme an, du möchtest nur noch kalt essen?“ Sie hielt das gefüllte Salatbesteck über meinen Teller. Ich wollte gar nichts mehr essen, aber was sollte ich denn sonst sagen außer „ja, bitte“?