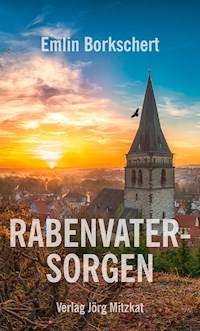
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitzkat, Jörg
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Warburger Börde im Herzen Deutschlands: Hier, zwischen Diemel und Desenberg, scheint die Welt noch in Ordnung. Bis eines Tages der alleinstehende Bankangestellte Lothar Menne in seinem Haus überfallen und mit mehreren Messerstichen getötet wird. Hauptkommissar Emil Storck von der Kripo Höxter, der sich nach seiner Scheidung eigentlich eine Auszeit gönnen wollte, übernimmt den Fall zunächst widerwillig. In akribischer Kleinarbeit und mit oftmals unkonventionellen Methoden taucht er in das Leben des Mannes ein und bringt die Fassade des ruhigen Nachbarn und ach so zuverlässigen Arbeitskollegen zum Bröckeln…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Emlin Borkschert
Rabenvatersorgen
Krimi
Verlag Jörg Mitzkat
Holzminden 2019
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
ISBN 978-3-95954-100-8
E-Book-Ausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil dieses Buches darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Verlag Jörg Mitzkat
Holzminden 2020
www.mitzkat.de
Prolog
Ein Geräusch schreckte sie aus ihren Gedanken auf; das Rufen der Wildgänse mit seinem charakteristischen, fast wehmütigen Klang. Als wollten die Tiere ihr klarmachen, dass das Schlimmste überstanden war und es nicht mehr ewig dauern würde bis zum Frühlingsanfang. Ein Versprechen von Weidenkätzchen, zartem Grün auf den Wiesen und Tulpen in hübschen Blumenvasen.
Paula wischte sich die Tränen aus den Augen und hob den Kopf. Mit der anderen Hand hielt sie ihren Kragen zusammen. Der Wind war hier oben eisig. Immerhin hatte es sich zum Abend hin aufgelockert, nur ein paar Wolken am Horizont waren übriggeblieben. Die Sonne, die in Kürze verschwunden sein würde, tauchte den Himmel über der See-Siedlung in tiefes Rot. Manche nannten das Wohngebiet nördlich des Verler Sees auch verächtlich Klein Istanbul, wegen des hohen Anteils türkischer Mitbewohner in den drei Wohnblocks, die das Bild prägten. Paula suchte den Himmel ab, bis es plötzlich da war, das riesige, ungleichmäßige V, das die Zugvögel auf ihrer Reise zurück gen Heimat geschrieben hatten.
Auch sie würde jetzt auf eine Reise gehen. Auf eine besondere, eine Reise ins Glück. Paula hatte extra ein Kleid dafür angezogen, obwohl sie sonst nur Hosen trug, doch die bekam sie in ihrem jetzigen Zustand kaum mehr zu. Schnitt und Stoff, eine dunkelblaue Baumwolle mit kleinen, bunten Blüten, mochten bestenfalls als Vintage durchgehen, aber der Gedanke zählte doch. Und heute war ein Grund zu feiern, oder? Sogar geschminkt hatte sie sich, was seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr vorgekommen war. Eine dicke Schicht Puder, um alles abzudecken, dazu Wimperntusche, Rouge und Lippenstift. „Mit dem Zeug auf den Lippen siehst du aus wie eine Nutte!“ Wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen. Es waren sicher Freudentränen. Die Kälte spürte sie fast gar nicht.
Paula umklammerte das Geländer und gab sich Mühe, kontrolliert ein- und auszuatmen. Sie hatte keine Angst. Ihr Herz raste zwar, aber vor Aufregung. Die Zeit hatte heute überhaupt nicht vergehen wollen. Um auf andere Gedanken zu kommen, hatte sie sich gezwungen, so zu tun, als wäre alles wie immer. Also die Wäsche machen, überall Ordnung schaffen und in dem kleinen Supermarkt an der Ecke zur Libellenstraße das Nötige für die nächsten Tage einkaufen. Das Abendessen vorbereiten, denn er hasste es, wenn ihm etwas Aufgewärmtes vorgesetzt wurde. Anschließend hatte sie geduscht, sich feingemacht und war hinaus auf den Balkon gegangen.
Die Wildgänse kamen auf ihrer Reise gut voran. Während Paula, ohne es zu merken, mit ihren Fingern über die violetten Stellen an ihrem Unterarm fuhr, veränderte sich das V am Himmel fortwährend. Einzelne Vögel brachen aus der Reihe aus und flogen für eine Weile in der Mitte weiter, einfach so. Der Instinkt sagte ihnen wohl, dass sie das tun mussten.
Und etwas Ähnliches hatte Paula gesagt, was sie zu tun hatte. Dazu war es nötig gewesen, eine Sache in ihrem Tagesablauf unterzubringen: einen vierseitigen Brief an ihre Eltern. Rotz und Wasser heulend hatte sie ihn geschrieben, mit tausend Küssen versehen und in den Postkasten in der Grillenstraße eingeworfen. Und auf dem Weg dorthin gleich eine Mülltüte mit ihren besten Anziehsachen vor die Wohnung ihrer Nachbarin Zekya vier Stockwerke tiefer abgestellt. Die brauchte man da, wo sie hingehen würde, nämlich nicht.
Vorsichtig kletterte Paula auf das Balkongeländer. Der Verler See sah von hier viel kleiner aus, natürlich, aber auch unspektakulär, was vielleicht daran lag, dass er erst vor wenigen Jahren durch Sandabbau entstanden war. Unzählige Male hatte sie ihn umrundet, zuerst allein, ob aus Neugierde oder Langeweile, später – zu zweit – als tägliche Pflicht. Aus den Weidenkätzchen war Laub geworden, das irgendwann braun geworden und abgefallen war, bis alles von vorn angefangen hatte. Immer längere Strecken hatten sie gemeinsam zurückgelegt und dabei nicht selten das Zeitgefühl verloren beim Grübeln. Beim Träumen. Beim Die-Welt-um-sich-herum-vergessen. Was war sie dann zurückgerannt, so schnell es eben ging mit Kinderwagen. „Wo treibst du dich die ganze Zeit herum? Hast du wieder mit diesem Mann geredet?“
Paula atmete tief ein, als sie hörte, wie ein Schlüssel in das Schloss der Wohnungstür gesteckt und umgedreht wurde. Der Moment, Lebewohl zu sagen. Oh Gott, der Schmerz zerriss ihr das Herz. Aber sie hatte keine andere Wahl. Es würde nie aufhören. Sie flehte, dass ihr Kind das eines Tages verstehen und ihr verzeihen möge.
Als sein Gesicht hinter der Fensterscheibe auftauchte, die Augen weit aufgerissen, als würde er dem Teufel persönlich begegnen, winkte sie ihm zum Abschied zu.
1
„Das traust du dich eh nicht.“
„Nicht bei Frankenstein“, krächzte ein Zweiter und deutete in die Dunkelheit hinter ihm.
Theo versuchte, die beiden zu ignorieren, was ihm jedoch nicht richtig gelingen wollte.
„Oder willst du erst deine Mama fragen?“, wieder der Erste.
„Sehr witzig, Mädels“, sagte Theo und zog sich die Jeanshose hoch, die ihm fast bis in die Knie gerutscht war. Seine Freunde waren älter als er und das würden sie immer bleiben, er konnte sie schlecht überholen. Frankensteins Auto stand in der Einfahrt. Das war Gesetz, das Monster musste zuhause sein. Alles andere wäre feige gewesen.
„Verbietet sie dir eigentlich immer noch ein Handy? Alter, du musst dich endlich mal durchsetzen.“
Das stimmte leider. Seine Mutter meinte tatsächlich, er wäre zu jung für eines. Nicht nur, dass Mobiltelefone eine katastrophale Ökobilanz hätten; niemand wüsste, wie sich die ganzen Strahlen auf den Körper eines Heranwachsenden auswirkten. Seine Mutter war in den meisten Dingen echt ok, jedenfalls nicht so schlimm, wie seine Kumpels behaupteten. In diesem Punkt allerdings tickte sie nicht ganz richtig.
„Ruhig“, rief Rouven-Martin und streckte seine Zigarette in die Luft. „Ich kann hören, wie es in seinem kleinen Kopf rattert.“ Er lachte und nahm einen Zug. Die Zigarette glomm auf und strahlte für eine Sekunde sein Gesicht und den allmählich dunkler werdenden Flaum über der Oberlippe an. Normalerweise würden sie draußen nicht einfach so rauchen. Aber es war einundzwanzig Uhr durch, stockduster, und das Osterwäldchen bot genügend Schutz.
Theo stopfte lässig beide Hände in die Taschen seiner Winterjacke, um nicht zu zeigen, dass ihm trotz aller Aufregung kalt war. Er wusste, Frankensteins Kellertür blieb auch nachts meist unverschlossen. Ein Leichtes, sich ins Haus zu schleichen und etwas mitzunehmen. Problem war, dass sie sich gegenseitig überbieten mussten. Es reichte nicht mehr, bloß in den Keller zu gehen. Leander hatte es neulich bis ans Ende des Kellerflures geschafft, wie das Foto auf seinem Mobiltelefon bewies. Rouven-Martin sogar die Treppe hinauf, wo er grinsend und mit ausgestrecktem Mittelfinger ein Selfie gemacht hatte.
Wollte Theo also nicht als Weichei dastehen, musste er a) mindestens bis zum Wohnbereich kommen und b) einen Beweis erbringen, was ohne Handy schlecht ging, folglich c) etwas Eindeutiges mitgehen lassen. Und das ausgerechnet bei Frankenstein, dem Schrecken der Straße. Sie hatten den Mann so getauft, weil er wirklich zum Fürchten war. Weniger vom Aussehen her, sondern von seiner Art. Er lebte allein. Er redete kaum, und wenn, dann in dieser monotonen Stimmlage und ohne einen anzuschauen. Dafür beobachtete er alles und jeden. Er musste auch sie beobachtet haben. Zwar hatte keiner von ihnen je etwas davon mitgekriegt, aber woher hätte er sonst so viel von ihnen wissen können?
„Mensch, guck doch mal, das Küchenlicht brennt die ganze Zeit. Einfacher geht’s nicht.“
Theo schluckte. Eines war jedenfalls so sicher wie das Versteck vom Playboy, den Rouven-Martin ihm neulich besorgt hatte: Sollten seine Eltern hiervon Wind kriegen, konnte er einpacken. Sie würden ihm den Computer sperren, das Handy könnte er sich ein für alle Mal abschminken und vielleicht auch den Führerschein in zweieinhalb Jahren.
„Klar, ich mach’s“, sagte Theo und gab sich Mühe, cool rüberzukommen.
„Du machst es? Krass!“ Leanders Stimme überschlug sich, während er seine knallrote Baseballkappe mit den Buchstaben NY vom Kopf riss.
„Logisch. Brauchst du es erst schriftlich oder wie?“
„Alter.“ Rouven-Martin ballte eine Faust und presste sie ihm gegen den Oberarm. „Ich hab’ ja gewusst, dass du nicht kneifst.“
„Bist du fertig? Ich will nämlich los, bevor ihr ins Bett müsst“, sagte Theo und hätte sich dabei fast in die Hose gemacht. Wenn ihm das gelingen würde, wäre er mit einem Schlag der König. Was bitteschön sollte danach noch kommen? Dem Monster ein Haar rausreißen? Zu ihm ins Bett steigen? Lieber nicht darüber nachdenken, geschweige denn, den beiden davon erzählen, hinterher nahmen sie ihn beim Wort.
„Hey“, rief Leander ihm nach, jedoch in gedämpfter Lautstärke. „Du musst das nicht tun, hörst du? Nur, wenn du ...“
Theo bedachte ihn mit einer abwertenden Geste, ohne sich umzudrehen.
„Sag mal, was ist denn mit dir los, du Memme“, hörte er Rouven-Martin zetern und Leander sich verteidigen, dass er ja nur gemeint hätte ... Ja, was denn? Theo hörte gar nicht mehr zu.
Er überquerte die Schöne Aussicht, ein echt dämlicher Name für eine Straße, als wären der Burgberg, die Altstadtkirche oder der Chattenturm mit seiner neuen Plattform weiß Gott wie toll, und erreichte wenige Schritte später Frankensteins Grundstück. Im Schein der Straßenlaterne wirkte das Haus mit dem dunkelgrünen Anstrich und den schiefen Fensterläden gruselig, dabei kannte Theo es in- und auswendig. Immerhin wohnte er sein Leben lang direkt nebenan. Sein Zimmer lag sogar auf der passenden Seite, um in Frankensteins Wohnzimmer hineinschauen zu können. Zumindest nahm er an, dass der triste Raum eine Etage tiefer das Wohnzimmer war. Er war nie drin gewesen und hatte es auch nicht vor. An was für Sachen man dachte, nur um sich abzulenken.
Ihm fiel nicht einmal auf, dass in einem der Gärten ein Hund jaulte und es ansonsten völlig still war. Denn wer gescheit war, ging bei der Kälte hinein ins Warme oder hielt sich nur so lange wie unbedingt nötig draußen auf. Was allerdings nicht für eine Bande verrückter beinahe Fünfzehnjähriger galt, denen zuhause die Decke auf den Kopf fiel.
Theos Sneakers verursachten keinen Laut, weder in der Einfahrt, noch auf der Außentreppe an der Seite des Hauses, wo es so finster war, dass seine Augen erst eine gewisse Zeit brauchten, um sich daran zu gewöhnen. Eine Stufe nach der anderen trat er hinunter, bis ihn vollkommene Dunkelheit empfing. Zum Glück hatte er ein Feuerzeug dabei. Er ließ das Rädchen ratschen, Licht glomm auf. Theo riss die Augen auf.
Die Kellertür stand einen Spalt offen! Sofort ging seine Fantasie mit ihm durch. Bestimmt hatte das Monster längst Witterung aufgenommen und sich auf die Jagd begeben, schnüffelnd und gierend nach jungem Blut. Sie hätten gestern nicht diesen Horrorfilm gucken dürfen, den Leanders Bruder ausgeliehen hatte, ging ihm durch den Kopf. Der war doch zu heftig gewesen. Und einen Tag vorher hatte er sich mit seiner kleinen Schwester noch Das Dschungelbuch ansehen müssen.
Vorsichtig drückte Theo die Tür auf und horchte in den Keller hinein. Kein Mucks war zu hören, keine Schritte, kein Husten, kein Klappern. Gar nichts. Über das Warum machte er sich keine Gedanken, nur, dass er am liebsten umgedreht und davongerannt wäre. Doch dann hätten Rouven-Martin und Leander jeglichen Respekt vor ihm verloren.
Ein Schmerz ließ ihn aufjaulen, das Feuerzeug hatte seinen Daumen angeschmort. Theo zündete es erneut an, diesmal vorsichtiger mit der anderen Hand, und fasste den Entschluss, so schnell wie nur irgend möglich zu handeln. Also durch den Kellerflur rennen, die Treppe hinaufstürzen, in die Wohnung hinein, das Erstbeste mitnehmen und sofort den Rückweg antreten. Schnell und absolut geräuschlos, das wäre seine einzige Chance, wofür trainierte er denn seit gut zwei Jahren in der Schulmannschaft und lief die Einhundert-Meter-Strecke unter dreizehn Sekunden.
Theo holte tief Luft, spürte den Schlag seines Herzens und sprintete los. Triste, graue Wände zogen an ihm vorbei. Doch nur kurz, denn keine zwei Schritte später ging das Feuerzeug wieder aus. So viel zu seinem Plan. Er müsste wohl oder übel langsamer weitermachen. Zum ersten Mal im Leben verfluchte er seine Jeanshose, die ständig herunterrutschte. Dass der Keller zugig war und muffig roch, anders als bei ihnen zuhause, entging ihm völlig.
Plötzlich ein lautes Klirren. Scheiße, was war das? Theo zuckte zusammen und presste seinen Körper reflexartig gegen die nächste Wand. Es hatte sich angefühlt, als hätte sein Fuß irgendetwas umgestoßen, das daraufhin in tausend Stücke zersplittert war, vielleicht eine Flasche. Der Lärm war ohrenbetäubend gewesen, genauso gut hätte ein Silvesterböller explodieren können.
Spätestens nach dieser Aktion wüsste das Monster Bescheid! Es würde in den Keller stürzen, ihn packen und bei lebendigem Leibe die Eingeweide herausreißen. Theo lauschte, krampfhaft bemüht, ein Geräusch wahrzunehmen, doch nichts. Außer seinem eigenen Ein- und Ausatmen war immer noch alles ruhig. Zumindest hoffte er, dass das laute Schnaufen von ihm selber kam. Er leuchtete auf den Fußboden. Scherben lagen überall verstreut, mehr ließ sich auf die Schnelle nicht erkennen. Wenigstens waren die Türen zu beiden Seiten des Gangs verschlossen. Bis auf die am Ende. Ohne weiter darüber nachzudenken, schlüpfte Theo hindurch. Licht von der darüber liegenden Etage fiel auf die Stufen und machte das Feuerzeug überflüssig.
Für einen kurzen Moment genoss er das Gefühl, mit dem Betreten der Treppe genauso weit gekommen zu sein wie Rouven-Martin. Jedoch nur, bis es ihm auffiel: Auch die Glastür, die in den Wohnbereich führte, stand offen. Wenn es nicht so absurd gewesen wäre, hätte man meinen können, dass jemand ihn erwartete. Frankensteins Fratze tauchte vor seinem inneren Auge auf, nicht die der Horrorgestalt, sondern seines seltsamen Nachbars, grinsend, als freute er sich darauf, ihm zu zeigen, was man mit Jungs machte, die einfach so in fremde Häuser eindrangen ...
Theo schluckte den Kloß in seinem Hals herunter und lauschte erneut, doch außer dem Ticken einer Uhr war es auch hier oben absolut still. Voller Anspannung drückte er die Glastür weiter auf und betrat den Korridor. Durch die Beleuchtung in der Küche ließ sich alles gut erkennen. An der Garderobe hingen ein Hut und mehrere Jacken, auf dem Schränkchen darunter lagen Dinge wie Handy, Autoschlüssel und Portemonnaie. Frankenstein war also tatsächlich zuhause. Theo hoffte inständig, dass er nicht ausgerechnet in diesem Moment aus der Küche kommen würde. Denn es war so klar wie nur irgend möglich, dass man ihn genauso gut sehen konnte.
Ein Schal als Beweisstück? Theo entschied sich anders. Und wenn ihm nicht auf einmal dieser vertraute Geruch nach Pizza in die Nase gestiegen wäre, hätte er sicher sofort kehrtgemacht. Vielleicht waren die Nerven mit ihm durchgegangen oder seine Sinne zu benebelt, dass sie ihn Zentimeter für Zentimeter weiter zur Küchentür wandern ließen. Als eine Bodendiele unter seinem Gewicht knarzte, spürte er, dass es zu spät war.
Da, eine Hand tauchte auf. Dann ein Arm. Ein Gesicht. Und schließlich Frankenstein in voller Größe. Oh Mann, ich will hier weg!schoss es Theo durch den Kopf, anstatt einfach umzudrehen und wegzulaufen. Das Monster sah schrecklicher aus, als er es sich je vorgestellt hatte. Augen wie glühende Kohlen. Der Mund blutrot verschmiert.
Das nächste, was Theo spürte, war etwas Warmes an seinem Bein.
2
Das Zimmer, laut Exposé ein großzügiger Wohnraum mit Küche und Schlafnische, war inzwischen völlig ausgekühlt. Das Balkonfenster hatte die Nacht über offen gestanden, und gäbe es Vorhänge, würden sie hineinflattern wie garstige Gespenster. Nach einem vielversprechenden Wochenende und sonnigem Montag war es wieder frisch geworden. Im April hätte man gesagt, dass das Sprichwort zu Recht bestand, doch bis dahin dauerte es noch zwei Wochen. Die braune Maus reckte ihr Näschen in die Luft, in der Hoffnung, dass irgendjemand endlich etwas Essbares dagelassen hätte, und kehrte resigniert in ihren Bau zurück, um sich aufzuwärmen. Vielleicht hörte sie auch von draußen das schrille Piepen näherkommen.
Der Mann, der nur wenige Schritte weiter auf einer Luftmatratze lag, in eine Wolldecke gewickelt, den Mund aufgerissen, schien sich daran nicht zu stören. Auch, dass das Kissen unter seinem Kopf einen Affen mit Sonnenbrille zeigte, der durch einen neongelben Strohhalm aus einem Glas Limonade trank, ließ ihn kalt. Seine Tochter hatte es ihm vor Jahren zum Vatertag geschenkt. Der Geruch nach Keller war mittlerweile nicht mehr so ausgeprägt wie zu seinem Einzug.
Auch das Chaos überall war ihm egal. Der komplette Inhalt der Regalwand lag auf dem Parkettboden verteilt, Dutzende von Büchern, noch mehr Zeitschriften und seine Schallplattensammlung, obenauf die in rotem Leinen bezogene Klappbox, die er am meisten liebte: La Traviata von Guiseppe Verdi, als Live-Mitschnitt einer Aufführung aus dem Jahr 1956. Vom Sofa davor, eigentlich ein schönes Stück mit seinem graugestreiften Bezug, war vor lauter Klamotten nichts mehr zu sehen. Dazu passte das großflächige Blumenmuster der Tapete, die sich an etlichen Stellen gelöst hatte, und die gelbe Einbauküche, die im Mietpreis inbegriffen war.
„Um das Türschloss machen Sie sich keine Sorgen, Herr Storck, darum kümmern wir uns noch“, hatte die Maklerin ihm bei der Besichtigung mit einem Lächeln versichert. Und mit dem permanenten Zurückstreichen ihrer blonden Haarsträhne wahrscheinlich von weiteren Übeln ablenken wollen. Dabei hätte sie gar nicht mit ihm flirten brauchen. Selbst der Schimmel im Bad, effektvoll unter alten Stuckleisten platziert, war ihm egal gewesen. Die Wohnung hatte drei Pluspunkte: Sie war bezahlbar, lag in fußläufiger Entfernung zu seiner Arbeitsstelle und – am allerwichtigsten – er hatte sofort einziehen können.
Doch heute würde er nicht den Hoffmann-von-Fallersleben-Wall entlanglaufen, wie es für trockene Tage sein Plan gewesen wäre. Und beim Anblick des Grüns, das aus dem Boden schoss, kaum, dass sich die ersten Sonnenstrahlen zeigten, nicht dem Irrglauben verfallen, es wäre alles halb so schlimm und mit ein bisschen Zeit wüchse Gras über alles. Erfreulicherweise brauchte er das auch nicht. Er konnte ausschlafen. Dass hieß, wenn man ihn nur ließe. Als das Piepen draußen unerträglich wurde, schlug Emil die Augen auf.
Es war schon hell, ein Zustand, auf den er gut hätte verzichten können, der sich aber ebenso wenig leugnen ließ wie die Kälte, die ihm gnadenlos deutlich machte, dass er nur Socken und Boxershorts trug. Auf dem Fußboden neben ihm lag eine Flasche Chianti, leer zum Glück, oder auch nicht, denn als Emil den Kopf anhob, fühlte er erst ein Stechen, dann ein hämmerndes Klopfen in der linken Schläfe, und ließ sich zurück auf das Affenkissen fallen.
Stöhnend fuhr er mit den Händen über sein Gesicht. Sein Barthaar, das bereits grau wurde, war eine Spur zu lang, um als Dreitagebart durchzugehen. Wen juckte es bei drei Wochen Urlaub, von denen erst ein einziger Tag verstrichen war; darüber hinaus war er seit Neuestem wieder ein freier Mann, der tun und lassen konnte, was er wollte. Den halben Tag vorm Laptop verbringen zum Beispiel, Pizza direkt aus dem Karton essen und darauf scheißen, die Umzugskisten auszupacken oder die Anziehsachen in den Kleiderschrank zu räumen, fein säuberlich auf Bügel gehängt. Emil kratzte sich durch die Boxershorts und spürte zu allem Überfluss den Druck seiner Blase.
Das Piepen wurde bereits leiser. Die Kälte jedoch blieb, und da sich das von alleine so bald nicht ändern würde, klappte er die Wolldecke zurück und erhob sich von der Luftmatratze. Leider einen Tick zu rasch, was sofort durch einen weiteren Stich quittiert wurde, wieder an derselben Stelle. Die Hand am Kopf, als ob das etwas bringen würde, schleppte er seinen Körper zum Fenster, das er in einem Zustand geistiger Umnachtung offen gelassen haben musste. Emil ahnte, woher das rührte. Der Rotwein hatte gut getan, zumindest die erste der beiden Flaschen. Er hatte das Mühlrad in seinem Kopf langsamer drehen lassen. Diese zermürbende Grübelei, ob es die richtige Entscheidung gewesen war. Oder zu übereilt. Aber hatte er nicht endlose Jahre verschwendet? War der Drang nicht schier unerträglich geworden? Eines stand zumindest fest: Es zu tun war endgültig gewesen, irreversibel, nun gab es kein Zurück mehr. Und mit der zweiten Flasche intus war ihm diese Erkenntnis weitaus weniger erschreckend vorkommen. Jetzt fing das Grübeln von Neuem an.
Erst durch Anwendung von Gewalt ließ sich das Fenster schließen. Emil streckte die Arme in die Luft und verharrte in dieser Position einige Atemzüge lang. Drei Etagen unter ihm fuhr der Müllwagen mit seinem orange blinkenden Licht die Albaxer Straße hinauf. Auf dem großen Platz vor der Schule am Nicolaitor parkten bereits etliche Autos. Eine Frau zog ihren Hund auf den Grünstreifen zwischen Hoffmann-von-Fallersleben- und Hindenburgwall, wo er direkt sein Geschäft verrichtete. Das Leben war nach Höxter zurückgekehrt, unter wolkenverhangenem Himmel, der die ostwestfälische Stadt in trübes Licht tauchte. Er hätte gut darauf verzichten können.
Nachdem Emil die Heizkörper voll aufgedreht hatte, fischte er seine Fleecejacke aus dem Klamottenberg und zog sie über. Im Vorbeigehen nahm er die Flaschen mit und warf sie in den Verpackungskarton seines neuen Fernsehers, der ihm, wie das Scheppern verriet, seit ein paar Tagen als Glascontainer diente. Und wenn schon. Die letzten Wochen waren die Hölle gewesen, von der Arbeit an dem Pflegedienst-Fall ganz zu schweigen. Da war ein kleiner Schlaftrunk doch erlaubt, und immerhin nahm er keine Drogen, kiffte nicht, trank nicht mal Hochprozentiges wie der Kollege in der Abteilung für Betrugsdelikte, überlegte Emil, als er die Shorts herunterzog, sich auf das Klo setzte und mittendrin das Klingeln seines Handys vernahm. Praktischerweise lag es griffbereit auf dem Waschbecken neben einer Zahnbürste voller Zahncreme. Offenbar hatte er vorm Schlafen gehen das Putzen vergessen und stattdessen seine Nachrichten gecheckt.
„Ja, Storck?“ Seine Stimme hallte an den hellblauen Kacheln wider. Fußmatte, Duschvorhang, irgendetwas, das den Schall absorbierte, gab es nicht.
„Ego?“, meldete sich eine Frauenstimme. „Ich bin’s, Marion.“
„Das höre ich“, erwiderte er. „Und gesehen habe ich es auch. An dieser merkwürdigen Buchstabenfolge, die im Display erscheint, sobald du anrufst.“
„Oje. Offensichtlich habe ich dich geweckt.“
„Nein, diesmal ist die Müllabfuhr schuld. Die ist in dieser Gegend ziemlich früh auf den Beinen.“
„Früh? Es ist elf Uhr durch.“
„Was, echt?“ Emil schielte auf die Zeitanzeige seines Mobiltelefons.
„Hör zu“, sagte Marion währenddessen. „Wie schnell bist du startklar?“
„Warum? Willst du mit mir Möbel kaufen fahren oder was?“
„Nicht ganz. Wir haben Arbeit.“
„Oh Mann, Marion, lass gut sein, sie hat gestanden.“ Emil erhob sich und drückte die Toilettenspülung. „Ich weiß, dass du die Frau magst, ihr seid Seelenverwandte und so weiter, aber du kannst nicht immer nach neuen Beweisen für ihre Unschuld suchen.“ Die Mitarbeiterin einer ambulanten Pflegeeinrichtung hatte eine ältere Dame mit Krebs im Endstadium von ihren Leiden erlöst, wie sie es ausgedrückt hatte. Emil wusste, dass seiner Kollegin das naheging, wo ihre eigene Mutter ebenfalls pflegebedürftig war.
„Bist du fertig? Zocher hat mich gerade informiert. Wir haben eine Leiche. In Warburg. Er will, dass wir sofort hinfahren.“
„Ach so?“ Emil schnaufte. „Ich bin im Urlaub, falls du das vergessen haben solltest. Wobei mir einfällt, du übrigens auch. Ich habe gedacht, für den Fall gibt es Teamkollegen. Oder wofür hat man die?“ Er war in die Küche gegangen oder besser gesagt zu der gelben Küchenzeile an einer Seite des großzügigen Wohnraums, wo er eine Flasche O-Saft aus dem Kühlschrank nahm und daraus trank. Auch das wäre bis vor Kurzem noch undenkbar gewesen. Dass Zocher ihn jetzt zurückholte, war mieses Timing, aber so richtig mies.
„Müller und Piet Hanke sind an der Rauschgift-Sache dran“, erklärte seine Kollegin. „Und Tanja ist krank. Lass gut sein. Zocher versteht, dass du das nicht machen willst.“
„Hat er das gesagt?“
„Nicht so direkt.“
„Wie, was heißt das, nicht so direkt? Was hat er gesagt? Hallo?“ Befand seine Kollegin sich plötzlich mitten in einem Funkloch oder warum antwortete sie nicht?
„Er hat gar nichts gesagt. Ok? Er hat nach dir gefragt, mehr nicht. Ich habe mir nur gedacht, dass du ... nun, in deiner Situation vielleicht froh bist, wenn er nach dir verlangt.“
Emil wollte nicht laut zugeben, dass sie damit einen Punkt hatte. Er fragte nach, wie der Leiter vom KK1 dabei geklungen hatte.
„Ach, Ego.“
„Ach Ego, ach Ego. Vielleicht hat er es ja noch gar nicht mitbekommen.“
„Dass glaubst doch du selbst nicht. Bei dem Flurfunk? Und du kennst seine Sekretärin. Mensch, du hast es bei der Abschlussbesprechung am Freitag groß verkündet, oder etwa nicht?“
„Was heißt verkündet. Ich habe gesagt, was los ist.“
„Na bitte.“
Emil lehnte sich gegen den Esstisch, der momentan eher als Computerplatz genutzt wurde. Das war gerade mal dreieinhalb Tage her und viel weniger als geplant. Verdammt, doch nur deswegen hatte er die Bombe platzen lassen, wegen der drei Wochen Urlaub im Anschluss. Immer noch viel zu kurz, um das besagte Gras über eine Sache wachsen zu lassen, aber das hatte er in Kauf genommen. Knapp vier Tage waren dagegen ein schlechter Scherz. Er massierte mit der freien Hand seine Schläfe. „Worum geht es eigentlich? Eine Leiche in Warburg. Und sonst?“
„Folgendes.“ Marion erzählte ihm, was sie kurz zuvor vom KK3 erfahren hatte, eine männliche Leiche, in der Küche eines Einfamilienhauses liegend, blutverschmiert. Die Informationen waren dürftig, dafür ausnahmsweise nach Emils Geschmack. Regelmäßig versetzte es ihn in Erstaunen, dass im beschaulichen sogenannten Kulturlandkreis Höxter nicht mehr gemordet wurde. Allein vor lauter Langeweile müssten sich die Leute hier gegenseitig die Köpfe einschlagen. Jetzt allerdings wäre ihm lieber gewesen, wenn sie es nicht getan hätten.
„Ich bin schon auf dem Weg dorthin“, beendete die Kollegin ihren Vortrag.
„Dann gib mir ein paar Minuten, ok? Ich will mich nur halbwegs tageslichttauglich machen.“ Emil schaute in den Spiegel seines leeren Kleiderschranks und verzog das Gesicht. „Oh Gott, da ist nichts mehr zu retten.“ Sein Blick fiel auf das Sofa. All die Hosen, T-Shirts und Pullover wirkten so altbacken, farblos, sie entsprachen vielleicht seinem alten Ich, aber so wollte er auf keinen Fall mehr sein. Hatte er sich deshalb gesträubt, sie einzuräumen, unterbewusst? „Wohin genau soll ich kommen?“
„Oben auf die Hüffert.“ Marion gab ihm die Anschrift durch.
Emil kannte sich dort etwas aus. Vor einigen Monaten hatte er dort im Fall der vermissten achtjährigen Lina eine Zeugenbefragung durchgeführt, die den entscheidenden Hinweis gebracht hatte. „Dann also bis gleich. Ich muss mir nur meine Garderobe zurechtlegen. Du glaubst gar nicht, wie schwer das gerade ist.“
„Keine Zeit zu verschnaufen, was, Ego?“
„Nein.“ Vielleicht war es gut so, dachte er. Bloß keine Gelegenheit haben, sich Gedanken darüber zu machen, was um ihm herum gerade passierte.
Emil beendete das Gespräch und kontrollierte den Gesendet-Ordner seines Mobiltelefons, erleichtert, dass er gestern im Rausch keine leichtsinnigen Nachrichten mehr verschickt hatte.
Er beschränkte seine Morgentoilette auf das Nötigste, wie üblich, wenn ein Einsatz ihn überrumpelte, fischte sich aus dem Klamottenberg Jeanshose und Pulli und zog sein marineblaues Lieblings-Sakko über. Es dauerte nur ein paar Minuten, dann trat aus seiner Wohnungstür ein großer, dunkelhaariger Mann, ohne gefrühstückt zu haben, unrasiert und auch die Haare nicht gestylt oder so, einfach, wie er war, aber auf diese Weise fühlte er sich eh am wohlsten.
Und Emil hätte gewettet, dass niemand, der ihn beobachtete, wie er durchs Treppenhaus lief, weder die alleinerziehende Mutter von gegenüber, die ständig durch ihren Türspion schaute, weil sie offenbar ein Auge auf ihn geworfen hatte, oder die Hausälteste aus dem Erdgeschoss, die immer wissen musste, was vor sich ging, noch sonst irgendwer gemerkt hätte, dass er gerade in der beschissensten Phase seines Lebens steckte.
Das Haus befand sich in der Berliner Straße, oben auf der Hüffert. So hieß das Stadtgebiet von Warburg, das westlich des historischen Zentrums lag, auf dem Plateau und den Südhängen eines ins Diemeltal vorgerückten Hügels. Die Siedlung darauf war in den Fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts entstanden. Die Wohnlage galt als bevorzugt, zumindest teilweise. Die Bodenpreise lagen höher als im übrigen Warburg, waren allerdings im Vergleich zu größeren Städten geradezu lächerlich, trotz der unmittelbaren Nähe zu Schulen, Schwimmbad und Krankenhaus. Letzteres, wusste Emil, war gerade modernisiert worden und nun ein Klinikum, wobei nicht nur die grässliche, stadtbildprägende Erweiterung aus den Siebzigern abgerissen worden war, sondern zum Leidwesen vieler Warburger auch der viel ältere Teil. Willkommen in einer Zeit, in der das Gesundheitswesen marktwirtschaftlichen Aspekten unterlag.
Emil parkte seinen dunkelblauen Golf Cabrio einige Meter von der Adresse, die seine Kollegin ihm genannt hatte, entfernt, um sich das Umfeld anzuschauen. Der Großteil der Häuser war ordentlich in Schuss, die Vorgärten gepflegt. In etwa der Hälfte der Einfahrten stand selbst um diese Tageszeit ein Auto. Ein paar Jugendliche hockten auf dem Bürgersteig und hatten Skateboards dabei. Sie trugen Markenklamotten und legten Wert auf ihr Äußeres, wie unschwer zu erkennen war. Hatten sie keine Schule mehr? Ein Rentner mit Spazierstock, der Emil entgegenkam, wechselte kurz vor ihrer Begegnung die Straßenseite. Eine Frau putzte ihr Fahrrad, ohne das Treiben der Polizei schräg gegenüber aus den Augen zu lassen. Jeder von ihnen konnte ein wichtiger Zeuge sein.
Das besagte Haus war anderthalbgeschossig, wie alle in der Berliner Straße, hatte im Gegensatz zu den meist hellen Häusern aber einen dunkelgrünen Anstrich. Holzläden zierten die Fenster, die ihrem Zustand nach kaum regelmäßig auf- und zugeklappt wurden. Über einen Weg aus Waschbetonplatten gelangte Emil durch einen Torbogen, an dem eine Kletterrose ihre schwarz geworden Hagebutten vom Vorjahr zeigte. Unkraut wuchs zwischen den Fugen und selbst in den Ritzen der Stufen, die zur Haustür hinaufführten. Offenbar war dieser Vorgarten nicht die Visitenkarte des Hauses. Oder doch? Eine Einsatzbeamtin, die ihm unbekannt vorkam, regelte den Zugang. Emil hielt ihr seinen Ausweis hin, worauf sie „Guten Tag, Herr Storck“ sagte und ihm Handschuhe und Füßlinge übergab.
„Vielen Dank. Sagen Sie, haben Sie zufällig Frau Redeker gesehen? Nein, hat sich erledigt.“
Seine Kollegin sprach gerade mit einem Beamten, als Emil durch die Haustür trat und die Schutzausrüstung anlegte. Ihre kurzen Haare ließen Marion Redeker vom Gesicht her manchmal wie einen Mann aussehen, die breite Hüfte und der Hintern waren eindeutig weiblich. Eine gefütterte Weste gegen Kälte kaschierte nebenbei etliche Speckrollen. In der Hand ihr obligatorischer Notizblock, der ihr in Höxter den Spruch „Frau Redeker, zum Diktat bitte“ eingebracht hatte. Beim Anblick ihres Vorgesetzten ließ sie den Mann in Uniform stehen. „Ego. Da bist du ja. Stimmt, du hast wirklich schon mal besser ausgesehen.“
„Seit wann verstehst du was von solchen Dingen?“
Emil marschierte an ihr vorbei ins Innere des Hauses, wodurch ihm entging, wie sie mit den Augen rollte.
„Erklär mir bitte eines“, sagte er. „Wieso hat Zocher eigentlich dich angerufen und nicht mich?“ Die Frage war ihm während der Fahrt hierher eingefallen, als er über das Telefonat mit ihr nachgedacht hatte.
„Ach das. Hat nichts mit dir zu tun, Ego. Keine Bange. Genaugenommen hat er mich gar nicht angerufen.“
„Willst du sagen, du bist im Büro gewesen?“
„Ganz kurz. Ich hatte was vergessen.“
„Du hast noch nie was vergessen.“
Seine Kollegin straffte sich. „Also schön. Ich habe mir die Aussage von der Pflegerin noch mal durchgelesen.“
„Dir ist echt nicht zu helfen.“ Emil ließ sie stehen und verschaffte sich im Flur einen ersten Überblick.
Die Menschen in Overalls, die wie fleißige Ameisen umherliefen, interessierten ihn jedoch weniger. Dass die Spurensicherung bereits vor Ort war, zeigte höchstens die Eindeutigkeit der Sachlage. Vielmehr wollte er die Atmosphäre des Hauses auf sich wirken lassen. Die braune Mustertapete zum Beispiel hatte sicher einiges erlebt, wahrscheinlich sogar die Erweiterung des Warburger Krankenhauses in den Siebzigern. An der Garderobe hing ein Trenchcoat, wie man ihn aus alten Filmen kannte, auf dem Boden lag eine Sporttasche exakt parallel zur Wand. Ein paar Zeitschriften, darunter Warburg zum Sonntag und Desenbergbote, die kostenlos in der Region verteilt wurden und kaum Nachrichten, dafür umso mehr Werbung enthielten, sahen daneben achtlos weggeworfen aus. Emil nahm einen aktuellen Mr. Frost-Katalog, wobei ihm einfiel, dass er noch einkaufen musste, und Tiefkühlware war nicht nur praktisch, sondern auch vitaminschonend, wie es hieß.
„Und, was hast du für mich?“ Er ging weiter den Flur entlang in Erwartung, dass Marion ihm folgen würde.
Selbstverständlich tat sie es. „Das Opfer heißt Lothar Menne. Einundfünfzig Jahre alt. Wohnt hier allein, zumindest laut der Nachbarin, einer Frau Krull, mit der ich vorhin kurz gesprochen habe. Ich habe Helmut gebeten, das zu checken. Hier, das ist er. Aus seiner Jacke.“
Seine Kollegin zeigte auf den Garderobenschrank und überreichte ihm ein Portemonnaie. Emil öffnete es und zog den Personalausweis heraus. Das Foto zeigte einen dunkelhaarigen Mann mit strengem Blick. Der restliche Inhalt war überschaubar: ein paar Scheine Bargeld, der Führerschein, eine Bankkarte und eine weiße Karte im selben Format. „Wofür hältst du das?“ Er hielt die Karte hoch, auf der in winziger Schrift Signum Dienste stand sowie ein Buchstabencode und eine Telefonnummer.
„Keine Ahnung. Vielleicht ist er Mitglied einer Geheimorganisation?“
Emil runzelte die Stirn.
„War’n Witz“, beeilte sich Marion.
„Ruf dort mal an, ok?“
„Geht klar. Hier entlang. Er liegt in der Küche.“ Sie führte ihn zur nächsten Tür.
Eine Allerweltsküche kam zum Vorschein, die Hänge- und Unterschränke an einer Wand aufgereiht, am Ende ein Kühlschrank, die Fronten in Holzoptik, was man auf den ersten Blick erkannte. Typisch der Herd mit den vier bemalten Abdeckplatten. Dass es sauber wirkte, konnte daran liegen, dass selten gekocht wurde. Emil hob die Nase. „Riechst du das?“
„Das ist der Teppichboden im Flur. Wahrscheinlich Urin.“
„Urin?“
„Nicht viel, wie es aussieht. Hoffentlich reicht’s für eine Analyse. Das ist mal was anderes, oder? Ein Täter, der sich vor Aufregung in die Hose macht.“
„Oder vor Angst“, erwiderte Emil. „Aber das meine ich nicht. Da ist noch was anderes. Es riecht nach ... Keine Ahnung.“
„Wenn du es nicht bist, könnte es unser Freund hier sein.“ Der Mann von der Gerichtsmedizin, der auf den Küchenfliesen kniete, hob die Hand zum Gruß. Vor ihm lag ein männlicher Körper: die Leiche von Lothar Menne.
Das Erste, was Emil durch den Kopf ging, war nicht, wo denn bitteschön das viele Blut geblieben wäre, von dem KK3 gesprochen hatte, sondern: Oh nein, bitte nicht Lars! Lars Gievers, ein Typ, der auf nüchternen Magen schwer zu ertragen war in seiner Perfektion. Groß, schlank und schlau, mit rosigen Bäckchen und blondem Haar, das er schmierig zur Seite gescheitelt trug. Mit einem Hauch Schadenfreude bemerkte Emil, dass die kahle Stelle am Hinterkopf allmählich größer wurde. Er hatte keine Lust zu erklären, dass er das mit Geruch natürlich nicht gemeint hatte. Es roch eher nach Erbrochenem, fiel ihm beim Anblick des Rechtsmediziners ein, was er aber für sich behielt. Ein bisschen Zurückhaltung konnte im Moment nicht schaden. Hatte Gievers die Neuigkeiten etwa noch nicht gehört? „Also ist Lother Menne bereits länger tot oder wie meinst du das?“ Er ging in die Hocke und blickte den Leichnam an, als könnte ihn das erhellen.
„Länger ist ein dehnbarer Begriff. Für Ephemeroptera ist eine Stunde schon ziemlich lang.“ Lars Gievers legte seinen Kopf schief und zwinkerte. „Eintagsfliegen, falls du den Begriff nicht kennst.“
Emil ersparte sich auch dazu einen Kommentar, was ihm schwerfiel.
Die Leiche von Lothar Menne lag auf dem Rücken und war noch vollständig bekleidet. Der Körper wirkte normal groß, mit ein paar Kilo zu viel auf den Rippen, wie man am Bauchumfang ablesen konnte. Falsche Ernährung gepaart mit Bewegungsmangel, vermutete Emil, der die Auswirkungen allmählich selber spürte. Das Gesicht war stark verzerrt, die Augen aufgerissen, mit wenig Ähnlichkeit zum Passfoto. Lediglich das Hemd wies Blutflecken auf. Emil hatte mehr davon erwartet, deutlich mehr. Für ihn war auf den ersten Blick nicht ersichtlich, woran der Mann gestorben war, selbst auf den zweiten nicht. Aber dafür gab es zum Glück Lars. Jemand machte Fotos, denn kurze Lichter blitzten auf. „Kannst du mir nun sagen, wie lange er hier schon liegt oder nicht?“
Gievers runzelte die Stirn mit dem blonden Scheitel darüber.
„Nur eine grobe Schätzung, ich bitte dich. Je eher ich was erfahre, desto schneller bist du mich wieder los.“
„Na gut, weil du’s bist.“ Der Rechtsmediziner nahm Pullover und Unterhemd des toten Mannes zwischen die behandschuhten Fingerspitzen und legte einen Teil von dessen Oberkörper frei. Die Haut, die zum Vorschein kam, war am Rücken komplett violett gefärbt. „Wie du siehst, sind die Livores voll ausgeprägt“, sagte er und presste den Daumen gegen die dunkelste Stelle der Totenflecken, wodurch sie wieder hell wurden. „Aber man kann sie wegdrücken. Im Normalfall geht das, wie du weißt, bis circa zwanzig Stunden post mortem.“
„Klar!“
Als Nächstes bewegte Gievers den Kiefer der Leiche sowie einige Fingergelenke – oder versuchte es vielmehr. „Auch die Totenstarre ist stark ausgebildet. Ich würde vermuten, unser Freund hier ist seit mindestens acht Stunden tot.“
Emil sah auf die Uhr. „Also irgendwann zwischen sechzehn Uhr gestern Nachmittag und vier Uhr heute früh. Du weißt schon, dass wir hier einen Fall zu lösen haben?“
„Eine grobe Schätzung, wie du sie gewollt hast. Für ein genaueres Ergebnis brauche ich etwas Zeit. Entweder du geduldest dich oder rufst mich später an.“
„Ich rufe an.“
„Sehr gut. Und, ist dir nichts aufgefallen?“
„Aufgefallen?“
Vorsichtig zog der Rechtsmediziner die Kleidung des Toten weiter nach oben, bis der gesamte Brustkorb zu sehen war. „Na da!“
„Ach so, ja. Keine Ahnung. Was ist da?“
„Na eben, gar nichts.“
Emil war nur die Brustbehaarung aufgefallen, weder Wunde noch Schnitt. „Dann weiß ich nicht, was du meinst.“
„Das Blut. Er muss es gespuckt haben. Hast du nicht die Reste in seinem Mund bemerkt? Auch Kleinigkeiten sind wichtig, wie mein Lehrer früher immer gesagt hat. Ich würde mir gerne mal den Rücken anschauen, oder hast du Einwände?“
Emil hatte keine.
Mit geübtem Griff brachte Gievers den Leichnam in die Seitenlage. „Na bitte. Ein, zwei, drei, nein fünf Stichwunden. Da dürfte einiges kaputtgegangen sein.“
Emil nahm im Hintergrund eine Veränderung wahr; seine Kollegin, die bisher geräuschlos dabeigestanden und sich nun in Bewegung gesetzt hatte. Sicher nicht, weil ihr schlecht geworden war oder so. Marion war verdammt taff, und wenn sie einen Wutanfall bekam, wollte er ihr nicht in die Quere kommen.
„Hier fehlt eins“, sagte sie, den Zeigefinger auf einen Messerblock gerichtet, der ansonsten voll bestückt war.
Emil dachte darüber nach. Gut möglich, dass dort die Tatwaffe gesteckt hatte.
„Das bedeutet“, fuhr sie fort, „dass er dem Täter den Rücken zugedreht hat. Er kannte die Person.“
Emil wusste ebenfalls, dass seine Kollegin manchmal voreilige Schlüsse zog. „Man würde auch einem Unbekanntem den Rücken zudrehen, nämlich wenn noch jemand zweites vor einem steht. Vielleicht heben wir uns solche Überlegungen für später auf.“ Während er das sagte, fiel ihm die Kommode auf, vor der die Leiche lag und deren oberste Schublade einige Zentimeter offen stand. Hatte Lothar Menne dort hineinschauen wollen, als er getötet wurde oder war es reiner Zufall?
Emil erhob sich und zog die Schublade ganz auf. Sie enthielt ein Sammelsurium an Gegenständen: Zettel und Kugelschreiber, das Warburger Telefonbuch, zwei Tuben Schuhcreme, ein kaputter Gürtel, Schuhanzieher und so weiter. Kein Bargeld, kein Handy, dabei erschien ihm die Stelle dafür ideal. „Könnte es denn ein Küchenmesser gewesen sein?“, wandte er sich zurück an den Rechtsmediziner. „Eine grobe Schätzung reicht mir vorerst.“
„Nicht ausgeschlossen“, lautete die Antwort. „Ich werde mir das ansehen, wenn ich ihn auf dem Tisch habe.“
„Mach das.“ Emil ahnte, dass mehr nicht kommen würde. Andererseits überraschte ihn gerade das. Er hätte wenigstens einen dummen Kommentar bezüglich seiner Bekanntmachung letzten Freitag erwartet. Entweder war es Rücksichtnahme oder die Neuigkeit war noch nicht bis an Gievers’ Ohren herangedrungen. Er fragte, ob er gegen Nachmittag mit der Autopsie rechnen konnte, doch daraus wurde nichts. In Driburg waren bei einem Feuer in einer Kindertagesstätte drei Kinder verbrannt sowie ein nicht identifizierter Mann, das hatte Vorrang.
Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, sah Emil sich weiter um. Neben der Kommode befand sich der Essbereich mit der altbewährten Eckbanklösung, rechts davon führte eine schmale Holztür – ja, wohin überhaupt? Emil öffnete sie und verzog sogleich das Gesicht. Nicht wegen der Vorratskammer an sich, die war durchaus praktisch, sondern weil der Gestank von eben hier extrem wurde. „Da drinnen soll sich mal jemand umschauen“, sagte er zu Marion, die es mit einem Schmunzeln entgegennahm.
„Komm mit ins Wohnzimmer“, erwiderte sie. „Das wird dir gefallen.“
Emil folgte seiner Kollegin in das große Zimmer am Ende des Flures. Optisch dominiert wurde es von einer beigefarbenen Sofagarnitur, bestehend aus Dreisitzer, Zweisitzer, Sessel und dem obligatorischen Couchtisch, auf dem die Fernsehzeitschrift samt Fernbedienung thronte. Die Wand zur Rechten wurde fast komplett von einem Schrank in Eiche rustikal eingenommen, dessen Türen offen standen und unter anderem einen alten Röhrenfernseher enthüllten. Mehrere Schubladen waren ebenfalls geöffnet und dem Anschein nach durchwühlt. Auf dem Fußboden lag zwischen Kissen, Zeitschriften und Büchern auch ein Schachbrett aus Holz.
Emil trat an eines der Fenster und zog die Gardine ein Stück zur Seite. Der Blick ging nach vorne zur Straße. Die drei Jugendlichen, die bei seinem Eintreffen auf dem Bürgersteig gesessen hatten, fuhren inzwischen mit ihren Skateboards vorm Haus hin und her und beäugten es neugierig. Ihm fielen die Bilderrahmen zwischen den Fenstern zum Nachbarhaus auf. Auf dem ersten Foto war der junge Lothar Menne mit einer Frau zu sehen, etwas steif beim Fotografen, wobei Emil sich fragte, ob so ein glückliches Paar aussah. Es gab wohl keine verlässliche Antwort darauf, also verschob er das Thema. Das zweite Bild zeigte dieselbe Frau mit Baby im Arm, das dritte ein kleines Mädchen auf einem Kinderfahrrad. „Er hat Frau und Tochter?“
Marion zuckte mit den Schultern. „Wie es scheint. Ich werde das checken.“
Auf einem Schreibtisch gab es weitere Fotos von dem Mädchen. Mit Schultüte, auf einem Pony, im Urlaub. Emil griff nach der wahrscheinlich jüngsten Aufnahme, auf der das Mädchen etwa fünfzehn oder sechzehn Jahre alt war und mit Frisur und Kleid bereits wie eine junge Frau wirkte. Er suchte nach Ähnlichkeiten zwischen ihr und Lothar Menne, fand aber keine, die ins Auge stach. „Dann schließ nicht aus, dass sie tot sind“, sagte er und stellte den Bilderrahmen zurück neben eine halb heruntergebrannte Stumpenkerze.
Seine Kollegin nickte bedächtig. „Sieh dir nur die vielen Bilder an. Hast du so viele von deiner Tochter in deiner neuen Wohnung?“
„Eine schlechte Frage“, grummelte Emil.
„Tut mir leid, habe ich auch gleich gedacht, als ich es ausgesprochen habe. Ich meine ja nur: Er muss sie sehr geliebt haben.“
Emil konnte und wollte darüber im Moment nicht nachdenken. Was fatal war, er durfte keine Einzelheiten weglassen, nur weil sie ihn persönlich störten. Das war das Letzte, was er sich vorwerfen lassen wollte: dass sich sein Privatleben negativ auf die Arbeit auswirken würde. Darauf hatten doch alle nur gewartet.
„Warum kriege ich Beklemmungen in diesem Haus?“, hörte er Marion fragen.
„Was meinst du?“
Seine Kollegin hatte sich in die Mitte des Raumes gestellt. „Keine Ahnung. Alles wirkt so trostlos hier.“
„Es ist nicht jeder so modern eingerichtet wie du.“
„Woher willst du das wissen, du warst doch noch nie bei ...“ Sie verstummte.
„Warum findest du es trostlos? Nur weil die Tapete alt und abgenutzt ist? Muss deshalb auch das Leben des Mannes trostlos gewesen sein? Wir kennen ihn doch noch gar nicht. Vielleicht hat er einfach andere Priorität gesetzt. Hast du zum Beispiel die Tasche gesehen?“
„Welche Tasche?“
„Die Sporttasche im Flur mit einem Schläger, sieht nach Badmintonschläger aus. Der Mann ist gerade beim Sport gewesen oder wollte hin. Badminton spielt man nicht alleine. Er ist gesellig.“
Marion verschränkte die Arme. „Der Schläger ist aber so gut wie neu, wenn du richtig hingesehen hast, und kann nicht wirklich oft benutzt worden sein. Außerdem ist unser Mann übergewichtig. Sport?“
„Er will etwas ändern in seinem Leben.“
„Ja, genau. Weil es so eintönig ist.“
Emil ließ sich den Gedanken auf der Zunge zergehen. Er arbeitete gerne mit Marion zusammen, weil sie jede Menge brauchbarer Ideen lieferte. Und sich zum Glück nicht so schnell einschüchtern ließ. Seine nächste Frage war die nach möglichen Hinweisen, dass sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafft worden war.
„Gewaltsam nicht. Die Haustür ist laut den Kollegen vom KK3 von innen verschlossen gewesen. Dafür hat die Tür, die vom Garten direkt in den Keller führt, sperrangelweit offen gestanden.“
„Kann man das von der Straße aus einsehen?“
„Nein. Im Dunkeln schon gar nicht.“
Dass man eine Kellertür aufließ, solange man selber zuhause war, fand Emil nicht ungewöhnlich, zumindest tagsüber. Nachts sollte man sie auch im Kreis Höxter lieber verriegeln.
„Soll ich es dir zeigen?“ Bevor er etwas dazu sagen konnte, verbesserte sich Marion: „Natürlich willst du dir dein eigenes Urteil bilden. Dann hier entlang.“
Im Flur kam ihnen ein junger Beamter in Uniform entgegen, der sich räusperte, bevor er zu reden begann: „Ich soll Bescheid geben, dass wir im Schlafzimmer was entdeckt haben.“
Emil und seine Kollegin warfen sich erwartungsvolle Blicke zu und folgten ihm durch eine Glastür über die Treppe hinauf ins Obergeschoss. Dachschrägen reduzierten die nutzbare Wohnfläche ungemein. Links befand sich ein Badezimmer, den winzigen, schwarzweißen Kacheln nach zu urteilen, die im Türspalt zum Vorschein kamen, dahinter ein weiterer Raum. Das Schlafzimmer lag rechts.
Emil registrierte die Kälte, die ihn dort empfing: sicher keine fünfzehn Grad und damit unterhalb der empfohlenen Schlaftemperatur, was erholsamen Schlaf unmöglich machte. Prompt überkam ihn der Drang zu gähnen, was er unterdrückte. Als Zweites fiel ihm auf, dass nur die linke Hälfte des Ehebetts bezogen war. Ein untrügliches Zeichen, dass Lothar Menne das Haus allein bewohnte, ohne Partnerin oder Partner. Tapete und Möblierung passten zur Etage darunter.
Seine Kollegin schüttelte den Kopf, als würde sie nicht verstehen, dass jemand auf diese Weise leben konnte.
„Und, was habt ihr Schönes für uns?“, fragte Emil in die Runde.
Einer der uniformierten Beamten zeigte auf die Wand über einer Kommode im Stile Gelsenkirchener Barock: „Da!“
Der rechteckige Abdruck auf der Tapete, etwa dreißig mal vierzig Zentimeter groß und dunkel, ließ keinen Zweifel, was er meinte. Der Nagel steckte noch. „Das könnte was zu bedeuten haben. Gute Arbeit“, sagte Emil.
Marion betrachtete die Ränder genauer, allerdings mit gerunzelter Stirn. „Entschuldige mal. Nur, weil dort mal ein Bilderrahmen gehangen hat, muss das nicht gleich heißen, dass ...“
„Es muss nicht, aber es kann. Und unten stehen mehrere Schranktüren und Schubladen offen. Mich würde es nicht wundern, wenn noch mehr fehlt.“
„Heißt das, ich soll Verstärkung anfordern? Ok, ich fordere Verstärkung an.“
„Was ist mit dem Kleiderschrank da, schon mal reingeschaut?“
Die Männer vom KK3 verneinten. „Das wollten wir, aber ... Er klemmt.“
„Jungs, lasst mich mal.“ Demonstrativ schob Marion ihre Ärmel hoch und stemmte ihren Körper gegen die Schranktür, während sie den Schlüssel umdrehte. Ohne Widerstand ließ die Tür sich öffnen. „So, kann ich sonst was für euch tun?“, fragte sie und trat zur Seite.
Emil betrachtete den Inhalt des Möbelstücks. Die Anziehsachen waren penibel einsortiert, oben Pullover, an der Stange Anzüge, Hemden und Freizeithosen und unten die Strümpfe und Unterwäsche. Die Krawatten hingen der Farbe nach über einem Bändchen auf der Innenseite der Tür. Sagte das etwas über Lothar Mennes Charakter aus? Durfte man die Ordnung eines Kleiderschranks überhaupt interpretieren? Wenn er an seine eigenen Klamotten dachte, dann unbedingt.
Zufällig beobachtete er durchs Fenster, wie sich im Nachbarhaus ein Vorhang bewegte. „Wohnt dort die Frau, die uns gerufen hat?“
„Frau Krull“, antwortete Marion. „Sie hat eine etwas merkwürdige Aussage gemacht.“
„Weiß sie schon, was passiert ist?“
„Von mir nicht.“
„Dann komm, bringen wir es hinter uns.“
3
Vor knapp sechs Wochen:
Dichte Wolken verdeckten die Sterne und ließen das Mondlicht nur durch, wenn sie hie und da ein Stück weit aufbrachen. Der schlankere der beiden Männer presste sich fester gegen die Holzwand. Gleich würde es losgehen. Und dann gäbe es kein Zurück mehr, er wäre für immer gebrandmarkt. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Am Ende der Dorfstraße trat eine junge Frau in den Schein der Straßenlaternen. Die Hände in ihren Jackentaschen vergraben, lief sie den Bürgersteig entlang. Der Schnee war erst vor wenigen Tagen weggetaut, vereinzelt lagen noch Reste herum, dort, wo man ihn aufgeschüttet hatte.
Als die junge Frau abrupt stehenblieb, schnellte sein Puls in die Höhe. Doch sie kramte bloß ein Handy hervor und tippte etwas, was vermuten ließ, dass ihr das Rascheln auf der anderen Straßenseite nicht aufgefallen war. Oder sie hatte es bemerkt und dabei an nichts Schlimmes gedacht, dass es bloß eine Katze gewesen wäre oder ein aufgescheuchter Vogel. Warum auch, schließlich war in dieser Gegend noch nie etwas passiert. Tiefste Provinz! Woher sollte sie wissen, dass an der Seite der Gartenhütte zwei Männer lauerten, komplett in Schwarz gekleidet und mit Sturmmaske überm Kopf. Sie hätte ihren Weg bestimmt nicht seelenruhig fortgesetzt, ohne von ihrem Handy aufzusehen.
Der Schlankere von beiden, der ihr dabei zusah, entspannte sich leicht. Er hatte lediglich den Reißverschluss seiner Jacke aufgezogen, weil ihm trotz der Kälte warm geworden war – allerdings eine Spur zu schnell. Und zu laut, weswegen er sich insgeheim verfluchte. Sie waren bis hierher gekommen, an die gewünschte Straße in der gewünschten Ortschaft, ohne dass irgendjemand etwas davon mitbekommen hatte. Nicht ein einziges Fahrzeug war ihnen die ganzen Kilometer entgegengekommen. Ihm war klar, sollten sie jetzt auffliegen, wäre schlagartig alles vorbei.
Nach ein paar Schritten hielt die Frau erneut an, drückte an ihrem Handy herum und fasste sich an die Ohren. Der schlanke Mann kniff die Augen zusammen.
„Was is’?“, flüsterte der andere, der Stämmige, mit rauer Stimme.
„Ich glaube, sie hört Musik.“
„Glaubste oder biste sicher?“
„Ich würde sagen, sie wippt mit dem Kopf.“
„Dann los jetzt. Komm!“
Nahezu geräuschlos setzten die beiden sich in Bewegung und überquerten die Straße an der Stelle, wo eine Laterne vor langer Zeit den Geist aufgegeben hatte.
Es war das erste Mal, dass sie gemeinsam auf die Jagd zogen. Ihr Opfer hatten sie sich nicht zufällig ausgesucht, sondern wohlüberlegt. Alles, was sie wissen mussten, wussten sie. Dass es unbedingt heute Nacht geschehen musste, zum Beispiel. Und dass es sich lohnen würde.
Die junge Frau bog in einen Feldweg ein, nichtsahnend, was in ihrer unmittelbaren Nähe geschah.
Die beiden Männer legten einen Zahn zu und hatten wenige Sekunden später das Grundstück erreicht, auf das sie wollten. Der Bewegungsmelder schaltete das Außenlicht an. Das Haus erstrahlte in vollem Glanz, aber dafür hatten sie keinen Sinn. Viel wichtiger war das Carport. Und dass der Mercedes GLS, der für gewöhnlich dort parkte, fehlte. So schnell wie möglich quetschten sie sich durch den Spalt zwischen Mauer und Eibenhecke, was nicht so einfach ging wie erhofft, denn die Zweige waren sperrig, und gelangten in den dahinterliegenden Garten. Hier wurde es schlagartig dunkler. Die Umrisse einer Tür tauchten auf. Sie führte in die Doppelgarage, wusste der Schlanke mit der offenen Jacke und drückte die Klinke herunter. Wie vorausgesagt war nicht abgeschlossen. Aber das Schloss klemmte und fast wäre ihm das Herz stehengeblieben, dann klappte es doch und er schlüpfte hinein. Der andere folgte ihm.
Drinnen empfing sie eine totale, fast unheimliche Schwärze. Bis eine Taschenlampe aufblitzte und ihren Strahl einmal durch den Innenraum der Garage warf. Ein silberner Porsche 911 Carrera stand dort, daneben ein neuer MINI Cooper in Racing Green. An den Wänden hingen Gartengeräte, gegenüber des Garagentors befand sich, eingerahmt von zwei Schränken voller Werkzeug und Blumentöpfe, eine weitere Tür. Zum Abschluss leuchtete der Stämmige seinem Begleiter aufs das riesige S auf dem Sweatshirt, der Anfangsbuchstabe von dessen Vornamen. „Alles klar, Superman?“, flüsterte er.
Es war vermutlich nichts weiter als eine Aufforderung, den nächsten Schritt zu gehen.
S. drehte sich weg.
„Ähm ... Was is’ los?“
„Nichts, warum?“
„Du bist schon die ganze Zeit so komisch. Willste kneifen oder was?“ Als keine Antwort kam, schien der Groschen zu fallen. „Ist jetzt nicht dein Ernst, oder?“
S. ging zwei Schritte in die entgegengesetzte Richtung und kehrte sofort zurück. „Ich weiß es nicht.“
„Sollteste aber.“
„Genau das ist es. Ich bin mir nicht sicher, ob ich will oder nicht.“
„Das fällt dir ja früh ein, echt.“ Der Stämmige warf seinen Rucksack auf den Boden, wobei das Licht der Taschenlampe unruhig flackerte. Mit viel zu lauter Stimme wetterte er: „Du weißt, was das bedeutet. Wenn du jetzt ’nen Rückzieher machst? Dann kannste meine Hilfe vergessen. Ich hab’ gedacht, du brauchst Kohle.“
S. hatte das auch gedacht. Und es stimmte nach wie vor. Aber nicht so. „Es muss doch noch einen anderen Weg geben“, versuchte er zu erklären und gleichzeitig, die Spannung aus der Luft zu nehmen. Die Garage war solide gebaut, aber auch solide genug, dass die Nachbarn nichts von ihrer Debatte mitbekamen?
„Verdammte Scheiße. Ich hätte mich nicht darauf einlassen sollen.“
„Sorry, aber ... Ich gehe zurück.“
„Mach das. Dann zieh’ ich’s allein durch. Ohne dich. Gar kein Problem.“ Es klang aber nicht danach. Wutschnaubend klemmte der Stämmige die Taschenlampe zwischen Arm und Oberkörper und kramte etwas aus seinem Rucksack hervor. Es war, wie sich herausstellte, ein Klappmesser. Als wäre es das Normalste von der Welt, hielt er es vor sich, nahm mit der anderen Hand seinen Rucksack wieder auf und stampfte zur Tür, durch die man ins Haus gelangen würde.
„Was hast du denn damit vor?“ S. konnte nicht anders, als das Messer anzustarren.
„Gar nichts. Was interessiert dich das?“
„Pitt ...“
„Und nenn mich, verflucht noch mal, nicht so, solange wir hier sind. VERDAMMT!“
Der Ausruf hallte lange nach. Hätte sich in diesem Moment jemand in der Nähe der Garage aufgehalten, vermutlich wäre er Zeuge davon geworden.
„Ja, sorry. Also dann ... gehe ich, ok?“ S. fühlte sich wie ein dummes Kleinkind. Auf die Idee, zum Fenster zu gehen und zu überprüfen, ob sie tatsächlich jemanden auf sich aufmerksam gemacht hatten, kam er nicht, sondern stand einfach nur da, unschlüssig, was als Nächstes kam. Bestimmt keine Verabschiedung, also hob er die Schultern und schlenderte Richtung Garagentür, durch die sie erst wenige Minuten zuvor eingedrungen waren. Hinter ihm hörte er, wie Pitt an der Tür zum Haus rüttelte und gleich darauf tobte:
„Was soll’n das jetzt? Hier ist abgeschlossen. Du hast doch gesagt, es ist kein Problem reinzukommen.“
S. holte tief Luft, als wäre sein eigener Rucksack nicht leer, sondern prall gefüllt und fünfzig Kilo schwer. „Ist es auch nicht. Warte. Und bleib um Gottes Willen ruhig!“
Er ging zurück zum Werkzeugschrank. „Leuchte mal lieber hier rein“, sagte er und begann, die Fächer abzusuchen.
„Was machsten da?“
„Ich suche was.“
„Wärich nicht drauf gekommen. Nen Brecheisen? Seit wann kennste dich mit so was aus?“
S. ersparte sich eine Antwort. Es brachte nichts, mit Pitt zu diskutieren, solange er sich in dieser Stimmung befand. Es dauerte nicht allzu lange, bis er ihn gefunden hatte. Für einen klitzekleinem Augenblick erinnerte S. das an den Plan, den sie gefasst hatten und an den finanziellen Schlamassel, in dem er steckte. Nie im Leben war es seine Absicht, sich persönlich zu bereichern. Es ging einzig und allein um die Lösung seines Problems. Gab es da nicht dieses alberne Sprichwort mit Zweck und Mitteln? „Ich habe den hier gesucht. Zufrieden?“ Er präsentierte den Schlüssel, der unter einer der Kisten gelegen hatte. Die Frau des Hauses selber hatte ihm die Stelle gezeigt.
Pitt riss ihn an sich und probierte ihn sofort aus. Er passte, die Tür ließ sich mühelos öffnen. Wie bisher alles an diesem Abend ohne nennenswerte Schwierigkeiten gelaufen war, dachte S. unter Herzklopfen. Von ihrer kleinen Meinungsverschiedenheit natürlich abgesehen. Vielleicht ein gutes Omen. Vielleicht sollte er doch ...?
„Da haste ja Glück gehabt“, raunzte der andere. „Also, ich gehe jetzt rein. Was ist mit dir, kommste mit?“
4
„Bitte kommen Sie“, flüsterte die Frau und winkte Emil und seine Kollegin mit einem Kochlöffel herein. „Hallo, sind Sie noch da?“ Das sagte sie in das Telefon in ihrer anderen Hand.
Um ihr Gespräch nicht zu unterbrechen, verzichtete Emil darauf, sich förmlich vorzustellen, und steckte seinen Dienstausweis in die Innentasche seines Sakkos zurück.
Die Frau, die sich – wenn überhaupt – nur flüchtig dafür interessiert hatte, schien zu jener Sorte zu gehören, die mehrere Dinge gleichzeitig erledigen konnte: Essen kochen, telefonieren und nebenbei die Polizei ins Haus lassen. Sie war zwischen fünfunddreißig und vierzig Jahre alt, dezent geschminkt, was ihre Wangenknochen betonte, die blonden Haare zu einem Zopf geflochten. In ihrer Jeans steckte kein Gramm zu viel.
Emil hatte ein Hausmütterchen erwartet, das den Tag über am Fenster saß und strickend die Nachbarschaft beobachtete, wie die alte Frau Nowak, die zwei Etagen unter ihm wohnte. Jedes Mal, wenn er die Werbung aus seinem Briefkasten nahm und einfach in die Ecke warf, stürmte sie aus ihrer Wohnung und hielt ihm einen Vortrag.
Schuld an seiner Erwartungshaltung waren Marions Worte gewesen, als sie ihm auf dem Weg hierher Lothar Mennes Kellertür gezeigt hatte. Eine gewöhnliche Metalltür, ohne Anzeichen, das sich jemand gewaltsam Zutritt verschafft hätte. Der Schlüssel steckte von innen. Nichts Auffälliges, bis auf der Scherbenhaufen zwei Meter davor, den sich die Spusi genauer ansehen würde. Emil hatte wissen wollen, auf was er sich bei der Frau im Nebenhaus gefasst machen müsste, und seine Kollegin geantwortet: „Na, die perfekte Hausfrau und Mutter.“ Eine befriedigende Erklärung war das für ihn nicht gewesen. Jetzt löste es sich auf.
„Nein, nein, der Spiegel sollte rund sein. Das hatte ich doch extra so bestellt.“ Die Frau verzog genervt den Mund, und machte beim Anblick ihres Besuchs schnell ein Lächeln daraus. „Kreisrund, genau. Aha. Da bin ich aber gespannt. Ja, tschüss. – Handwerker“, erklärte sie, als das Gespräch beendet war.
„Ärger?“, fragte seine Kollegin.
„Kann man so sagen. Die tun, als hätten sie noch nie was von Feng-Shui gehört.“
„Ah, verstehe.“
„Nett haben Sie es“, warf Emil ein, dem der verglaste Eingangsbereich mit lachsfarbener Akzentwand, davor ein halbhoher Schrank aus Acryl, gut gefiel. Auf der gegenüberliegenden Seite verrieten kleine Jacken und ebensolche Schuhe, dass hier eine junge Familie wohnte.
Stefanie Krull, wie die Nachbarin hieß, winkte das Kompliment ab, während ihre Absätze jeden einzelnen Schritt ins Innere des Hauses vertonten. „Ich bin gerade am Kochen und ein bisschen spät dran. Wir waren eben noch beim Heilpraktiker in Arolsen.“ Sie hielt inne und fuhr fort, als wäre es erklärungsbedürftig: „Mein Sohn, er leidet manchmal an Kopfschmerzen, wissen Sie? Er soll heute lieber zuhause bleiben.“
Emil nickte verständnisvoll.
Sie betraten eine Küche, die fast genauso aussah, wie er es erwartet hatte: weiße Schränke, viel Licht, Holz, dazu ein paar Zimmerpflanzen. Das Fenster über dem Spülbecken zeigte nach vorne zur Straße, die zwei im angrenzenden Essbereich auf eine Terrasse seitlich des Hauses. Der mannshohe Flechtzaun dahinter verdeckte die Sicht zum Garten von Lothar Menne.
Frau Krull verschwand hinter einer großen Kochinsel. Auf dem Herd dampfte ein hoher Topf mit Deckel ruhig vor sich hin. „Es ist furchtbar unhöflich, ich weiß, aber wenn meine Kinder binnen dreißig Minuten nichts zu essen kriegen, werden sie ungenießbar. Ich hoffe, das ist in Ordnung?“
„Natürlich“, antwortete Emil. Eine Befragung in der gewohnten Umgebung hatte den Vorteil, dass man eine Menge über diejenige Person erfuhr. Ob ihnen das wirklich weiterhalf, blieb abzuwarten, dachte er und beobachtete, wie geschickt Stefanie Krull eine Paprika in kleine Würfel verwandelte. Mit einem Küchenmesser, wie auch seiner Kollegin aufgefallen war. „Darf ich Ihnen denn dabei ein paar Fragen stellen?“
„Es ist also tatsächlich was passiert?“
„Was meinen Sie?“
„Nun, die Polizei würde doch nicht mit so viel Leuten anrücken, wenn es bloß eine Lappalie wäre.“
Emil gab ihr recht. „Herr Menne ist tot.“
Frau Krull sah von ihrem Schneidbrett auf. „Was? Oh mein Gott. Das ist ... Ich hab’s ja gewusst.“
„Was haben Sie gewusst?“
„Dass was passiert ist. Das habe ich vorhin schon Ihrer Kollegin erzählt. Ich habe es im Gefühl gehabt.“
„Und haben Sie deswegen die Polizei gerufen? Wegen eines Gefühls?“
„Ja, genau. Ich bin eine Mutter. Da verlasse ich mich darauf.
„Könnten Sie trotzdem etwas konkreter werden?“
Frau Krull legte das Messer weg und fuhr sich mit dem Handrücken über die Nase wie bei einem Niesreiz. „Möchten Sie vielleicht was trinken?“
Emil überlegte, welchen Grund es geben könnte, dass ihr ausgerechnet jetzt das Thema Getränke einfiel. „Ein Glas Wasser wäre nett.“
Sie reichte Gläser und eine Karaffe, auf deren Boden einen violetter Stein lag. „Wir verleihen unserem Wasser mit einem Amethysten zusätzliche Energie“, lautete die Erklärung, nach der niemand gefragt hatte.
„Sie wollten konkreter werden, Frau Krull.“
„Ja, richtig.“ Sie schnitt als Nächstes eine Zwiebel. „Nun, wir sind Nachbarn, ganz einfach. Da achtet man aufeinander. Herr Menne führt ein ... nun, wie soll ich sagen ... ein recht geordnetes Leben. Immer, wenn man mal nichts hört oder wenn etwas abweicht, macht man sich Gedanken.“
„Und was genau ist heute abgewichen?“
„Sein Auto hat noch in der Einfahrt gestanden. Das ist ungewöhnlich, normalerweise fährt er es abends immer in die Garage.“
„Das ist alles?“
„Natürlich nicht. Das Licht in der Küche hat die ganze Nacht durchgebrannt.“ Sie füllte Öl in eine Pfanne und ließ die gehackten Zwiebeln hineingleiten. Es brutzelte und fing an zu duften.
„Und deswegen haben Sie die Polizei gerufen?“
„Ja?“ Dadurch, dass sie das Wort als Frage aussprach, klang das zuvor Gesagte wie eine Selbstverständlichkeit. „Und, hatte ich nicht recht?“
Emil musste zugegeben, dass diese Denkweise eine gewisse Logik barg.





























