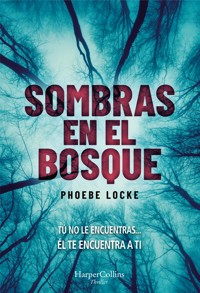12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie hat einen Menschen getötet. Die Frage ist nur: wen? 1990 Vier Mädchen folgen einem Schatten in den Wald. 2000 Die junge Mutter Sadie Banner verschwindet kurz nach der Geburt ihrer Tochter Amber spurlos. 2018 Ein Filmteam will die Wahrheit über Amber Banner aufdecken. Die rätselhafte junge Frau wurde gerade des Mordes angeklagt und freigesprochen. Aber wen hat sie getötet – und ist sie tatsächlich unschuldig?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Phoebe Locke
Rachemädchen Eine ist verschwunden. Eine ist angeklagt. Wer ist das Opfer?
Psychothriller
Über dieses Buch
Nur Tage nach der Geburt ihrer Tochter Amber verschwindet die junge Mutter Sadie Banner ohne jede Spur. Ihr Ehemann Miles zieht Amber allein groß – bis Sadie sechzehn Jahre später überraschend wieder vor der Tür steht. Nach und nach versuchen sie, wieder in ein normales gemeinsames Leben zurückzufinden. Bis zu jenem Tag, als ihre Familie erneut durch ein schreckliches Ereignis auseinandergerissen wird.
Zwei Jahre später folgt ein Filmteam Amber Banner durch Los Angeles. Amber wurde gerade von einer Mordanklage freigesprochen. Die Filmemacherin Greta gerät zunehmend in den Bann der rätselhaften jungen Frau und der Schatten, die sie verfolgen. Ist Amber wirklich unschuldig? Und was ist damals geschehen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Phoebe Locke liebt True-Crime-Geschichten. Während einer langen Zugfahrt stieß sie in der Zeitung auf einen Fall, der ihr trotz sommerlicher Temperaturen das Blut in den Adern gefrieren ließ und der sie seither nicht mehr losgelassen hat. Inspiriert von dieser Geschichte schrieb sie ihren ersten Thriller, »Das Mädchen mit den toten Augen«. Phoebe Locke lebt und arbeitet in London.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Aus »Making the Movie: Die schwierige Reise zur Wahrheit« von Federica Sosa, erschienen in Variety, Juli 2019
Als ich mit dem Projekt begann, war ich vorsichtig. Obwohl mein vorheriger Dokumentarfilm viel Kritikerlob erhalten hatte, suchte ich schon lange nach einer neuen Geschichte, die mich ebenso packen, ja förmlich verschlingen würde wie diese.
Während eines längeren Londonaufenthalts stieß ich auf die Geschichte der Familie Banner. Der Fall erregte damals viel Aufsehen; als der Prozesstermin näher rückte, konnte man ihm überhaupt nicht entgehen. Bei den Schlagzeilen bekam ich eine Gänsehaut: ein sinnloser Mord, eine Familie, die von den Dämonen eines Mitglieds verfolgt wurde. Eine Großstadtlegende, die ihre Krallen in ein unschuldiges Kind gebohrt und das Leben vieler Menschen unwiderruflich verändert hatte. Ich wusste sofort, dass ich diese Geschichte erzählen wollte.
Im Planungsstadium ahnte ich noch nicht, auf welche Schwierigkeiten mein Team und ich stoßen würden. Was anfangs noch wie eine simple – wenngleich tragische – Story aussah, schien sich uns zunehmend zu entziehen. Für jeden Knoten, den wir lösten, entdeckten wir einen neuen, stießen auf ein weiteres Geheimnis im Gewebe dieser Familie. Wir trugen Interviews zusammen, betrachteten die Ereignisse aus jeder erdenklichen Perspektive, versuchten, einen Zugang zu gewinnen. Und über allem hing immer dieser Schulhofmythos, die dunkle Gestalt des Großen Mannes.
Ein Problem war der fehlende Zugang. Nicht alle Personen, um die es in dieser Geschichte geht, sind noch am Leben. Oft mussten wir auf Material aus dem Nachlass zurückgreifen, auf Berichte aus zweiter Hand. Diese können oft erhellender sein als ein Interview, doch für eine Filmemacherin ist es unglaublich frustrierend, wenn man an bestimmten Punkten nicht nachhaken und »Warum?« oder »Kam Ihnen das real vor?« fragen kann.
Vieles von dem, was im Film vorkommt, ist dank des Prozesses, des gewaltigen Medieninteresses an der Familiengeschichte der Banners und des öffentlichen Hungers nach weiteren grausigen Details inzwischen allgemein bekannt. Ursprünglich wollte ich mit meinem Film lediglich die Gerichtsverhandlung begleiten, hinter die sensationslüsternen Schlagzeilen blicken und die Wahrheit über einen Mord aufdecken. Doch mit den Betroffenen selbst zu sprechen ließ mich die Ereignisse in einem anderen Licht betrachten. Dies ist keine blutige, schockierende Boulevardgeschichte; es ist eine Geschichte von Trauer und Schuld und schrecklichen Geheimnissen. Sie erzählt vom Vermächtnis einer grausamen Legende. Sie beginnt und endet in den dunkelsten Wäldern.
Sie verfolgt mich bis heute.
1990
Es begann gegen Ende des Sommers, als die Tage lang und heiß waren und die Schule so fern erschien, dass man sich nicht vor ihr fürchten musste. Sadie und Helen schoben ihre Fahrräder am Fluss entlang und suchten eine Stelle, an der sie sich hinsetzen und in Ruhe Bonbons essen konnten – Toffos für Sadie, Opal Fruits für Helen, alles genau wie immer. Sadie war im Wald an einer Wurzel hängen geblieben und hatte sich die Handfläche aufgeschürft, als sie sich an einem Baum abgestützt hatte. Sie untersuchte erneut den Kratzer, die winzigen Rindenstückchen, die in der Haut eingegraben waren.
»Hey, da drüben ist Marie«, sagte Helen, den Mund voller Kaubonbon.
Helens ältere Schwester saß auf einer verwitterten Bank am Flussufer, neben sich zwei Freundinnen. Sadie schaute von ihrer Hand auf.
Marie war kürzlich zwölf geworden und trug jetzt einen Lern-BH. Sadie hatte ihn selbst gesehen, als er bei Helen zu Hause auf der Wäscheleine hing. Er hatte kleine, weiche Körbchen und dünne Satinträger. Sie schaute Marie an, die auf der Bank saß und mit den Turnschuhen Staub aufwirbelte, und fragte sich, ob sie ihn wohl gerade anhatte, wobei ihr ganz heiß wurde.
Marie blickte auf und bemerkte die beiden. Ihre Mundwinkel verzogen sich zu einem Lächeln, das sich langsam auf ihrem Gesicht ausbreitete. Sie stieß ihre Freundinnen an und winkte die Mädchen zu sich. Die Räder klickten beim Schieben, und der Toffeegeschmack in Sadies Mund wurde sauer.
»Hi, Mädels«, sagte eine der Freundinnen, ein dunkelhaariges Mädchen mit Sommersprossen auf der schmalen Nase. »Wollt ihr ein Spiel spielen?«
»Das ist kein Spiel, Justine.« Jetzt erkannte Sadie auch das andere Mädchen. Es war Ellie Travis, die ältere Schwester eines Klassenkameraden von Sadie. Sie hatte hellblonde Haare, eine Strähne hatte sich zwischen ihrem Gesicht und dem Brillenbügel verfangen. »Ihr wisst doch, was mein Bruder gesagt hat.«
»Du solltest nicht auf das hören, was James sagt«, verkündete Helen fröhlich. Ihre Schüchternheit war verflogen. »Er redet nur dummes Zeug.«
»Sie meint doch nicht James.« Marie verdrehte die Augen. »Es geht um Thomas. Er ist der Älteste, und es war seine Aufgabe, Ellie vom Großen Mann zu erzählen. Und weil ich die Älteste bin, ist es jetzt meine Aufgabe, euch davon zu erzählen.«
Sadie sah zu, wie Justine die Augen zukniff, ihr Mund zuckte in einem Lächeln. Sie holte einen Lolli aus der Tasche, wickelte ihn aus und schaute beiläufig von Sadies Shorts hoch zu ihrem T-Shirt und dann zu ihrem Gesicht, hielt ihrem Blick stand.
»Wer ist der Große Mann?«, wollte Sadie wissen.
»Er lebt im Wald«, sagte Marie, beugte sich vor und nahm Helen die Bonbonpackung aus der Hand.
»Er sieht alles«, fügte Ellie hinzu, während sie die Brille auf der Nase hochschob.
»Er ist ein Mörder.« Justine lehnte sich grinsend zurück. »Er kommt in der Nacht und nimmt dich mit.«
»Vor fünf Jahren hat er ein Mädchen aus meiner Straße geholt«, sagte Ellie und zupfte ängstlich am Saum ihres T-Shirts. »Das habe ich jedenfalls gehört.«
»Das stimmt nicht.« Helen hakte Sadie unter. »Hört auf, uns Angst zu machen.«
»Und ob es stimmt.« Marie schnippte ein zerknülltes Bonbonpapier auf ihre Schwester. »Aber keine Sorge, jetzt wisst ihr Bescheid und seid vor ihm in Sicherheit.«
»Nicht nur in Sicherheit«, sagte Justine und zerbiss den Lolli mit ihren kleinen weißen Zähnen. »Der Große Mann kann euch auch zu etwas Besonderem machen, wenn ihr ihn darum bittet.« Sie stand auf und sah demonstrativ auf die Uhr – eine violett und gelb gemusterte Swatch, die Sadie wochenlang im Schaufenster des Juweliers betrachtet hatte. »Ich muss los. Macht euch auf weitere Geschichten vom Großen Mann gefasst. Er wird euch mögen.«
Marie unterdrückte ein prustendes Lachen, doch Sadie bemerkte, dass Ellie die Augen gesenkt hielt und mit den Fingern immer noch am losen Saum ihres Oberteils zupfte.
»Bringt er wirklich Mädchen um?«, fragte Helen mit großen Augen, worauf auch Ellie von der Bank aufstand.
»Ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel.«
Justine zuckte mit den Schultern. »Dann geh doch nach Hause, Ellie. Wir brauchen dich jetzt eh nicht mehr.« Sie lächelte Sadie und Helen zu und achtete nicht auf den Blick, den Marie ihr zuwarf. Nur Sadie schaute Ellie nach, als sie davonschlurfte.
»Um deine Frage zu beantworten, Helen«, sagte Justine, stellte ihr Fahrrad hin und schwang ein langes Bein über den Sattel. Sie trug Jeansshorts mit zerfranstem Saum und zerrissener Tasche. »Ja. Das tut er. Er hat seine eigene Tochter umgebracht.« Sie trat gemächlich in eine Pedale und rollte am Flussufer davon. »Sie wollte nicht tun, was er gesagt hat«, rief sie über die Schulter. Dann war sie verschwunden.
1999
Er hatte sofort ein ungutes Gefühl. Sie gingen auf die Musik zu, das Gras strich über ihre Unterschenkel, doch er hätte am liebsten kehrtgemacht.
»Geht es dir gut?« Sie schob ihre Hand in seine.
Miles warf ihr einen Blick zu. Sie hatte sich an diesem Morgen anders gekleidet; ein Sommerkleid mit aufgedruckten Gänseblümchen, dazu eine weiße Strickjacke, nicht die Latzhosen oder weiten Jeans und Tops mit dünnen Trägern, die sie bevorzugte. Er freute sich, weil sie sich besondere Mühe gegeben hatte.
»Ja«, sagt er. »Mir geht’s gut.«
Ihm war immer noch schlecht. Vielleicht aus Solidarität – so etwas sollte es geben. Sadie hatte ihm abends im Bett alles Mögliche vorgelesen, lauter Wusstest du schon und Wow, das ist ja mal seltsam und Hör dir das an, und alles klang widersprüchlich und bizarr und hexenmäßig, das Baby wurde mit einer Frucht verglichen, und man sollte ihm im Mutterleib Musik vorspielen, um es klüger zu machen.
Er dachte an das höhnische Gesicht seiner Mutter, als er dies vor einer Stunde erwähnt hatte, um die Stimmung aufzulockern. Wie sie die Hand ausgestreckt hatte, um ihm und Sadie Tee nachzuschenken. Klar, klassische Musik wird dem armen Ding sicher helfen, damit es überhaupt eine Chance im Leben hat. Wie sich die Hand seines Vaters fest um ihre geschlossen hatte. Frances, Liebes. Und wie seine Mutter geseufzt, zweimal entschlossen geblinzelt und ihnen den Teller mit den Keksen angeboten hatte. Es tut mir leid, Miles, aber ihr seid beide noch so jung.
»Sie werden sich schon damit abfinden.« Sadie drückte seine Hand, schirmte die Augen ab und sah zum Festivalgelände hinüber. Die Bühne war mitten auf dem Feld aufgebaut, an beiden Seiten gab es Verkaufsstände. Rauchwolken stiegen auf, der Geruch von gebratenem Fleisch wehte zu ihnen herüber, als sie den improvisierten Parkplatz hinter sich ließen und den Hügel hinaufgingen.
Dafür liebte er sie. Und seine Eltern würden sich damit abfinden, ganz sicher. Wie konnte es auch anders sein? Ihr einziger Sohn bekam ein Kind, ihr erstes Enkelkind – und ja, vielleicht waren er und Sadie zu jung, erst im dritten Semester, doch nichts geschah grundlos, oder? Manche Dinge waren einfach vorherbestimmt.
Sadie zog die Strickjacke aus und band sie um die Taille. »Immerhin haben wir es hinter uns.« Sie legte den Arm um ihn. »Jetzt können wir den Nachmittag genießen.«
Mit Sadie war es jedenfalls vorherbestimmt. Das wusste er genau.
Er konnte sich ziemlich gut vorstellen, was seine Eltern machten. Sein Vater holte gerade bestimmt den guten Gin aus dem Schrank, dazu die dicken Kristallgläser, die seine Mutter so liebte. Sie würden schweigend ein Glas auf der Terrasse trinken, und später würde seine Mutter in der Küche auf und ab laufen, das Abendessen vorbereiten und ihre Meinung kundtun. Danach würde sie Miles vielleicht anrufen.
»Als Nächstes müssen wir es wohl deinen Eltern sagen.« Er spürte, wie Sadie neben ihm erstarrte.
»Das mache ich besser allein.« Sie wandte sich ab. »Ich glaube, sie werden nicht sonderlich erfreut sein.«
»Nicht so wie meine?« Er wollte ihre nackte Schulter küssen, doch der Scherz verpuffte, sowie er seinen Mund verlassen hatte und die Erinnerung an die entsetzten Gesichter seiner Eltern wiederauftauchte.
Miles hatte gewusst, dass es nicht leicht werden würde. Er erinnerte sich an den Moment, in dem Sadie ihm gesagt hatte, dass sie schwanger war. Er hatte auf der Kante ihres schmalen Bettes im Wohnheim gesessen. Am Abend vorher war er feiern gewesen, eine Kneipentour mit den anderen Soziologen, und rieb an dem schwachen Stempelabdruck eines Clubs, der auf seiner Hand prangte. Sadie war zwei Abende hintereinander zu Hause geblieben, wegen einer Magenverstimmung. Doch die hatte sich als etwas völlig anderes entpuppt. Als etwas, das ihren flachen Bauch nun kaum merklich wölbte, etwas, das sie nächste Woche in Schwarzweiß auf einem Monitor im Krankenhaus sehen würden.
»Hey«, sagte sie, als sie am Rande des Festivalgeländes ankamen, und schaute ihn eindringlich an. »Alles wird gut.« Sie fuhr mit den Händen über seine Hüften bis zu den Rippen hinauf. Die Berührung verursachte ihm eine Gänsehaut, sein Mund wurde ganz trocken.
»Ich weiß«, sagte er und neigte den Kopf, um sie zu küssen. Lächelnd grub sie ihre Zähne in seine Lippen.
Er folgte ihr zur Menge hinüber, der Saum ihres Kleides bewegte sich im Wind. Er hatte Angst, natürlich hatte er das. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass sie in einem Jahr zu dritt sein würden, immer und überall. Fürs Erste war es leichter, sich aufs Studium zu konzentrieren – das hatte er immerhin unter Kontrolle. Etwas, das praktisch und wichtig war für ihre Zukunft, für Sadie, für das Baby. Er bekam ein eigenartiges heißes Gefühl in der Brust.
Sie erreichten die ersten Verkaufsstände: Marmelade, Kuchen und Käse aus örtlicher Herstellung, Holzschmuck und Gläser mit Kerzen. Jemand aus Sadies Studiengang hatte ihr von dem Festival erzählt; Miles hatte den heißen Tipp pflichtschuldig an seinen Mitbewohner James und einige Kommilitonen weitergegeben. Er zuckte innerlich zusammen, als er die spießigen Mittelklasseangebote sah, und hoffte, dass sie nicht gekommen waren.
»Die Band nach dieser soll toll sein«, sagte Sadie und führte ihn an den Ständen vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen, und auf einmal war alles wieder gut.
Er wusste, es war ein Klischee, aber er hatte noch nie für jemanden so empfunden wie für Sadie. Einmal hatte er im Pub versucht, seinen Freunden davon zu erzählen, aber die hatten ihn ausgelacht. Sicher, sie war schön, das war nicht zu übersehen. Und auch witzig, obwohl nicht jeder diese Seite an ihr kannte. Ihre Empfindlichkeit schreckte manche Leute ab. Er hatte gehört, wie Lila, James’ neueste Freundin, sie als »kalten Fisch« bezeichnet hatte (vermutlich war er viel zu gnädig mit ihr; sie konnte ebenso gut »Bitch« gesagt haben). Doch Miles war fasziniert gewesen von dem Schutzwall, den Sadie um sich aufbaute, wenn sie neue Leute kennenlernte, und er war umso fester entschlossen, ihn zu durchbrechen.
Er schob ihr eine Haarsträhne hinters Ohr. »Du warst toll vorhin. Bei meinen Eltern, meine ich. Danke.«
Sie drehte sich um, den Mund zu dem kleinen, verstohlenen Lächeln verzogen, das er am liebsten mochte. »Es geht nur noch um uns beide, oder nicht?«
Und damit hatte sie recht.
Sie kamen zum Bühnenbereich, und Miles blieb stehen und reckte den Hals nach James und den anderen. »Na komm«, sagte Sadie und zog ihn durch eine Gruppe von Teenagern zum Rand des Feldes. »Lass uns näher an die Lautsprecher gehen. Ich wette, sie stehen da drüben.«
Seine Freunde hatten begonnen, Sadie zu behandeln, als wäre sie aus Glas oder hochexplosiv. Sie überschlugen sich seit kurzem beinahe, um ihr einen Stuhl oder einen besseren Blick auf den Fernseher anzubieten. Als er es ihnen letzte Woche erzählt hatte, hatten sie ihm mitleidig auf die Schulter geklopft. Ich bin so aufgeregt, hatte er hinzugefügt, worauf sie es sich anders überlegt und ihm einen ausgegeben hatten. Jetzt wollten sie nur noch wissen, wann der Ultraschall anstand, wie es Sadie ging, ob sie das Geschlecht des Babys erfahren wollten. Über den Rest dachte er nach, wenn er nachts allein im Bett lag. Sadie war in ihrem eigenen Zimmer, das sie verlassen musste, sobald sie sich exmatrikulierte. Wie würden sie leben, wie könnte er gleichzeitig studieren und für seine Familie sorgen? Er dachte oft daran, dass er noch nie ein Kind im Arm gehalten hatte – er hatte keine Geschwister, seine Cousins und Cousinen waren alle älter. Wie ging das doch gleich? Er hatte gehört, man müsse den Kopf abstützen, das sei wichtig. Genau wie das Bäuerchenmachen, ein Vorgang, der ihn immer noch verblüffte. Er würde sich ein Babybuch kaufen und es heimlich lesen. Oder gleich mehrere.
Keine Spur von James oder anderen Bekannten, doch Miles war nicht sonderlich enttäuscht. Nach dem unangenehmen Morgen bei seinen Eltern fühlte er sich mit Sadie warm und sicher – zu zweit gegen die ganze Welt –, und er wäre gern den Rest des Tages in dieser Blase geblieben.
»Ich besorge uns was zu trinken. Kommst du mit?«
»Ich warte hier.« Sadie schaute sich um. Es war eine gute Stelle am Rand der Menge, von der man freie Sicht auf die Bühne genoss. Daneben war ein Grasstreifen, über den Kabel zu einem Generator liefen, dahinter grenzte ein Wäldchen an das Feld. »Ich halte Ausschau nach den anderen.«
Miles arbeitete sich zum nächsten Getränkestand vor und kaufte ein Bier für sich und eine Cola für Sadie. Er schlenderte zu ihr zurück, spielte kurz mit dem Gedanken, einen Hotdog zu essen, bevor sein Blick auf ein vertrautes T-Shirt fiel. Neongrün, die Ärmel ein bisschen zu kurz – er sah die Person von hinten, machte dunkle, lockige Haare aus und wusste, es war James in seinem uralten Lieblings-T-Shirt mit den Teenage Mutant Ninja Turtles darauf. Miles glitt durch die Menge und versuchte, seine Getränke nicht zu verschütten. Die nächste Band kam auf die Bühne, die Leute rückten vor, und er verlor James aus den Augen, bis er schließlich in einer Lücke vor ihm auftauchte.
Dann drehte sich der Mann im grünen T-Shirt um, und es war gar nicht James – der hier war zwanzig Jahre älter, mit grauen Bartstoppeln, und das T-Shirt hatte ein kleines Adidas-Logo auf der Brust. Miles wandte sich verlegen ab.
Er schaute über die Menge und war überrascht, wie weit er sich von Sadie entfernt hatte. Er brauchte einen Moment, um sie wiederzufinden. Sie stand immer noch am Rand des Feldes, war jetzt aber in den Schatten der Bäume getreten. Es war eine seltsame Stelle, ziemlich abseits, und sie neigte den Kopf, als hörte sie jemandem zu – vermutlich einer Freundin, vielleicht der, die ihr das Festival empfohlen hatte. Er machte ein paar Schritte, konnte aber nicht sehen, wer bei ihr stand.
Sadie sagte etwas, und er bemerkte die Angst in ihren Bewegungen. Sie wich zurück aus dem Schattenfleck, drückte eine Hand schützend auf den Bauch. Ihr Gesicht war ganz blass, ihre Augen weit aufgerissen wie die eines Kindes.
Miles drängte sich durch die Menge, das Bier schwappte hektisch im Plastikbecher. Die Sonne blendete ihn, als sie hinter einer Wolke hervorglitt, und er bekam einen Ellbogen in die Rippen, während er sich den Weg bahnte. Die ersten Akkorde der Band kreischten aus den Lautsprechern. Er erhaschte wieder einen Blick auf Sadie, die Angst in ihrem Gesicht, den schlaffen Kiefer, als sie rückwärtstaumelte. Dann trat der Sänger ans Mikrophon, das Publikum drängte nach vorn, und er konnte sie nicht mehr sehen.
Miles schob sich an einer Gruppe Mädchen vorbei, stolperte über eine Tasche, und dann hatte er das Gedränge endlich hinter sich gelassen. Er stand am Rand des Feldes. Links von ihm war Sadie. Sie hatte ihm den Rücken zugekehrt und schaute zu den Bäumen. Sie war jetzt allein. Er lief zu ihr hin, streckte die Hand aus, umfasste ihre Schulter, und sie schoss herum. Als sie ihn erkannte, wurde ihr Gesicht weicher, obwohl die Angst (es war Entsetzen, meldete sich eine Stimme in seinem Kopf; hässliches, unkontrolliertes Entsetzen) in ihren Augen blieb und sie die Hand noch immer auf die Stelle drückte, an der ihr Kind wuchs.
»Geht’s dir gut? Was ist passiert?«
Sie wandte sich ab, nachdem sie noch einen Blick auf die Bäume geworfen hatte. »Ach, gar nichts. Ein Betrunkener, du weißt ja, wie die sind. Na los, gehen wir näher ran.« Er wollte noch etwas sagen, aber sie war bereits in Bewegung, den halbleeren Colabecher in der Hand.
Es passierte nicht zum ersten Mal, dachte er, während sie zur Bühne zurückkehrten. Sadie war schön, und Männer blieben oft auf der Straße oder in Kneipen stehen, sprachen sie an, wollten sie berühren. Warum also hämmerte sein Herz noch immer so in seiner Brust? Er drehte sich zu den Bäumen um, die jetzt von goldenem Sonnenlicht gefleckt waren. Er konnte durch sie hindurch auf die dahinterliegenden Felder schauen. Niemand war zu sehen.
Er warf einen Blick zu Sadie hinüber. Sie hatte die Augen auf die Band geheftet und nickte leicht im Rhythmus der Musik. Sie trank von ihrer Cola, den anderen Arm noch immer vor dem Bauch.
Es war ihr Blick gewesen. Sie hatte Angst gehabt, er hatte das Entsetzen deutlich in ihrem Gesicht gesehen. Es war so nackt und bloß gewesen, das hatte ihn wohl erschreckt. Aber er hatte noch etwas darin gelesen. Als die Band den zweiten Song begann und Sadie wieder zu den Bäumen schaute, begriff er: Es war Wiedererkennen. Vertrautheit. Sadie war außer sich vor Angst gewesen, aber das Gefühl war ihr nicht neu.
2018
Die Crew trifft Amber Banner zum ersten Mal in ihrem Hotelzimmer in West Los Angeles. Sie trägt einen plüschigen Hotelbademantel, die Haare hat sie auf dem Kopf zu einem unordentlichen Knoten gesteckt. Das Bettzeug ist zerwühlt, das Laken sichtbar, ein Kissen rutscht langsam auf den dunklen Teppich. In der Mitte des Raums steht ein Tablett vom Zimmerservice, auf dem ein Stapel Pfannkuchen den Puderzucker aufsaugt, während ein Teller mit Melonenstücken rosafarbene Tränen weint. Auf zwei verwaisten Tellern ist der Sirup geronnen und verströmt einen feuchtwarmen Geruch. Das Besteck liegt da, als stemmte es die Hände in die Hüften.
Sie lässt sich seufzend auf die Matratze sinken, schaut zu, wie sie hereinkommen, den wie Pfützen daliegenden Kleidern ausweichen, den obszönen, auf links gedrehten Strumpfhosen und Slips. Das Tischchen ist überhäuft mit Geschenktüten, Blumen und Obst, auf dem Teppich darunter liegen Karten verstreut, das Obst wird braun. Sie lächelt.
Als sie das Lächeln sieht, kommt Greta sich vor wie ein Kind vor dem Tigergehege.
»Amber, ich bin Greta. Wir haben schon miteinander telefoniert.«
Amber betrachtet sie, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Sie spielt mit dem Gürtel des Bademantels.
»Du bist jung«, sagt sie schließlich. Ihre Augen zucken in koffeinbedingter Nervosität über die beiden Männer, das flauschige Mikro und die entfalteten Reflektoren. Sie winkt, worauf Greta den zuckerwattepinken Hocker heranzieht, sich unbeholfen hinsetzt, einen Stapel Papier unter dem Arm hervorholt und auf ihren Oberschenkeln glattstreicht.
»Wir hatten gehofft, dass wir dich filmen können, während du dich fertigmachst«, sagt sie. »Ich weiß, du hast heute Morgen viel zu tun.«
Vermutlich schaut der Chauffeur bereits ungeduldig aufs Handy, während er draußen wartet, und das Studio, das Amber gleich besuchen wird, erwacht allmählich zum Leben; Scheinwerfer werden auf Bühnen gerichtet, Sessel an den richtigen Platz gerückt, das eifrige Publikum in eine Warteschlange gescheucht, während das Sonnenlicht den Gehweg überflutet. Frühstücksfernsehen: Gretas schlimmster Albtraum.
In London war sie Praktikantin bei einer solchen Sendung gewesen und hatte sich nach einem Monat eine feste Stelle verdient. Sie weiß noch, wie sie ihre Eltern in Michigan angerufen und es ihnen erzählt hat – zweiundzwanzig, die Uni vor sechs Monaten abgeschlossen und einen Schritt näher an der Karriere, die sie ihnen angekündigt hatte. Sie nahmen es ihr nicht übel, dass sie Dearborn bei erster Gelegenheit verlassen hatte und nach England gegangen war, aber es hatte trotzdem gutgetan, es ihnen zu sagen: Ja, es hat sich gelohnt. Alles läuft nach Plan. Und falls sie ein paar belanglose Details über den Job verschwiegen hatte (ein endloser Zyklus, bei dem sie Möbel rückte, Gäste umherschob, angebrüllt wurde, alles falsch machte), dann war das auch in Ordnung. Denn letztlich ist alles nach Plan gelaufen, und hier ist sie nun, neun Jahre und zahlreiche Jobs später, und Amber Banner fordert sie heraus, sich zu beweisen.
Das Handy in ihrer Tasche summt, und sie wühlt zwischen USB-Sticks, Parkzetteln, zerknüllten Servietten und klebrigen Tuben mit Sonnencreme. Amber betrachtet sie gleichgültig wie eine Katze.
Greta liest die Nachricht von Federica: Wie ist sie so? Entschuldige mich bei ihr. Verdammt, ich kriege keinen Flug.
In London ist es zwei Uhr morgens. Greta kann sich genau vorstellen, wie Federica sich noch einen Kaffee nachschenkt und den Becher neben den Laptop stellt. Federica, die auf den Balkon schlendert, sich wegen der Dreharbeiten sorgt – wenn auch nicht genug, um tatsächlich den Versuch zu unternehmen, einen der vielen Flüge zu buchen, die in den nächsten Tagen London verlassen. Stattdessen wird es wieder die üblichen Entschuldigungen geben, und Greta wird diejenige sein, die sich um einen reibungslosen Ablauf kümmert und ein Verhältnis zu Amber aufbaut. Greta wird an der Fassade der »Eisprinzessin« meißeln, als die Amber Banner in den britischen Medien präsentiert wird. Sie wird die eisige Ruhe, die viele so entsetzlich finden, durchbrechen und eine verborgene Tiefe finden müssen, eine unbekannte Wahrheit, auf der sie ihren Film aufbauen können.
Amber sitzt gelassen da, als Tom sich vorbeugt, um die Lichtstärke zu prüfen, seine sommersprossige Hand dicht neben ihrer Wange. Ihre Augen sind mit Wimperntusche verschmiert, doch die Haut ist rein und glatt bis auf einige kaum sichtbare Narben auf der linken Wange. Im frühen Morgenlicht des Hotelzimmers sieht sie perfekt aus, wie gemacht für eine Titelstory. Greta erinnert sich an das Foto von Amber, das in London über Federicas Schreibtisch hängt. Ein DIN-A3-Ausdruck aus der Zeitung, das Bild, das alle Fernsehsender und Titelseiten in den vergangenen Monaten gezeigt haben – Amber auf den Stufen des Gerichtsgebäudes, die Haare brav zum Pferdeschwanz gebunden, eine makellose, kragenlose weiße Bluse, die bis zum eleganten Hals zugeknöpft ist. Am Rand sieht man verschwommene Blitzlichter, Hände, die ihr Mikrophone hinhalten. Und das schmallippige Lächeln, das ihren Mund kräuselt, während sie trotzig und unbeirrt in die Kamera schaut. Das Ende einer Geschichte, die von den Boulevardblättern ausgebreitet wurde – und der Beginn einer neuen.
»Ich muss in einer halben Stunde im NBC-Studio sein«, sagt sie und gähnt so breit, dass Greta den pelzigen Sirupbelag auf der Zunge und die roten Rachenwände sehen kann. »Aber es ist okay, wenn ihr filmt. Mich kümmert so was nicht – ihr könnt mich filmen, wann immer ihr wollt.«
Greta hört, wie Luca und Tom hinter ihr alles aufbauen. Julia, die neue Produktionsassistentin, glänzt durch Abwesenheit. Sie war auch ein Versprechen, das Federica gegeben und gebrochen hat – ein weiterer Anruf, den sie versäumt hatte, und als Greta schließlich selber anrief, hatte Julia bereits einen anderen Job angenommen. Die Flüge nach L. A. gingen schon am nächsten Tag. Also würden sie, Tom und Luca sich als Dreierteam durchschlagen müssen – fünf Tage, in denen sie ständig schweißnass wären, ihre Ausrüstung von einem Drehort zum nächsten schleppen und versuchen würden, mit Federicas ständig wechselnden Visionen für den Film Schritt zu halten.
Sie will nicht im Weg stehen, als Luca nach einer Position für den Mikrophongalgen sucht, der natürlich keinen Schatten ins Bild werfen darf. »So, Amber«, sagt sie und versucht, die Ecke ihres Flipflops von einem BH-Träger zu lösen, während sie sich vorsichtig über den Teppich bewegt. »Bist du noch einverstanden mit dem, was wir vereinbart haben? Wie wir uns den Film vorstellen? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, über all das zu reden.«
Sie muss das fragen, obwohl Federica sicher sauer wäre. Rechtlich gesehen ist Amber erwachsen – so gerade eben – und hat einen Vertrag unterzeichnet. Das haben Greta, Federica und der Sender gründlich abgecheckt. Aber sie kann nicht anders. Sie muss Amber einen Ausweg bieten, selbst wenn diese offensichtlich nicht daran interessiert ist.
»Plant ihr immer noch zehn Folgen?« Amber beugt sich vor und berührt ein Stück Melone, als wollte sie es nehmen, tut es aber nicht. Ihre Finger verweilen darauf, während sie Greta beobachtet.
»Kommt drauf an, wie viel Material wir bekommen. Ich hoffe schon.«
Amber zieht die Finger zurück, wischt rosafarbenen Saft am Bademantel ab. »Will mein Dad noch immer nicht mit euch reden?«
Gretas Handy klingelt, eine willkommene Ausrede, um die Frage nach Miles nicht zu beantworten. Sie schlüpft in den Flur und nimmt Federicas Anruf an, bevor die Mailbox sich meldet.
»Wie läuft es? Ist sie okay?«
»Wir sind gerade erst angekommen. Sie sieht gut aus. Glücklich.«
»Filmt ihr sie beim Fertigmachen, wie ich es wollte?«
»Ja.«
»Super. Perfekt. Das gefällt mir – die Vorstellung, dabei zuzusehen, wie sie ihr öffentliches Gesicht aufsetzt. Ich wette, ohne Make-up sieht sie viel jünger aus, was?«
»Ja, irgendwie schon.« Greta ist sich nicht sicher. Sie hat sich so daran gewöhnt, Bilder von Amber Banner zu betrachten, Mitschriften und Berichte und Kolumnen über das zu lesen, was sie getan hat, dass sie leicht vergisst, wie jung sie ist. Eine Achtzehnjährige, die dabei gefilmt wurde, wie sie mit ihrer Anwältin lachte, während sie vor dem Gerichtssaal wartete. Eine Achtzehnjährige, die angeblich keine achtundvierzig Stunden nach ihrer Freilassung aus der Haft einen Vertrag mit einem Agenten unterzeichnete. Ein Mädchen, das die Welt zuerst auf einem verschwommenen Handyfoto gesehen hatte, ihr helles Top blutgetränkt, ein roter Streifen neben ihrem Mund.
»Hör zu«, sagt Federica. »Ich weiß, wir haben den Plan mit ihr durchgesprochen – und das ist auch wunderbar so –, aber es wäre gut, wenn du versuchen könntest, noch tiefer zu gehen. Wirf ihr ein paar unerwartete Bälle zu, versuche, sie aus dem Konzept zu bringen. Ach ja – und wenn du Tom allein erwischst, dann sag ihm, er soll die Kamera hin und wieder einfach laufen lassen. Während ihr mit ihr rumhängt und so.«
Greta kaut auf ihrer Lippe. »Du meinst, sie filmen, ohne dass sie es weiß?«
»Wenn du es so ausdrückst, hört es sich schlimm an. Ihr sollt keine Kamera in ihrem Zimmer verstecken. Aber du weißt, wie es läuft. Die besten Sachen bekommt man meistens dann, wenn die Klappe zu ist. Also tut einfach, als hättet ihr schon Schluss gemacht.«
Greta schweigt, das Handy liegt heiß an ihrem Ohr. Der Flur mit der geprägten Tapete und dem gestreiften Teppich erstreckt sich ins Unendliche.
»Die Sache ist die, Greta … Die Boulevardblätter hier reden viel über ihren Buchdeal. Angeblich eine siebenstellige Summe, obwohl ich mir da nicht sicher bin. Aber an der Sache ist was dran. Und das ist super – ein Buch ist kein Film. Das Buch wird Ambers Version sein, Ambers Sicht – ihre überarbeitete Wahrheit. Aber wir brauchen mehr. Es gibt mehr als ihre Version, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Die müssen wir aus ihr rauskitzeln, wenn das hier funktionieren soll.«
»Na schön … ich werde es versuchen.«
»Es tut mir wirklich leid, dass ich noch nicht da bin. Ich weiß, es ist eine beschissene Zeit, um mit persönlichen Problemen anzukommen, aber das konnte einfach nicht warten. Ich erkläre es dir, wenn wir uns sehen. Und ich vertraue dir. Ich weiß, du hast es im Griff. Glaub mir, das wird dein großer Durchbruch.«
»Schon okay. Ich hoffe, alles geht gut.« Sie wird rot, ist verlegen. Ambers Lachen klingt unter der Tür hindurch. »Ich sollte wieder reingehen.«
Als sie ins Zimmer kommt, sitzt Amber vor dem Spiegel und schminkt sich, während Tom sie filmt. Luca steht neben dem Nachttisch und blättert in den Zeitungen, die Amber dort gesammelt hat – amerikanische Zeitungen der letzten Tage und britische Boulevardblätter, die sie von zu Hause mitgebracht hat. Als sie in den Staaten eintraf, gab es eine frische Welle von Artikeln, die ganze Geschichte wurde noch einmal erzählt. Während die britischen Medien nicht immer freundlich zu ihr waren – Greta kann sich lebhaft an eine Kolumne in der Mail erinnern, nach der Amber Banner für alles stand, was mit den »jungen Leuten von heute« nicht stimmte –, scheinen die Amerikaner ihre schreckliche Geschichte, den tragischen Start ins Leben, zu mögen. Sie sind vom Amber-Fieber befallen. Oben auf dem Stapel liegt eine Zeitschrift, die sie bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen von Los Angeles zeigt, den Kopf gesenkt, mit einer Filmstarbrille. Amber Banner kommt nach Hollywood! Luca schaut zu Greta und verdreht die Augen.
Der Hauch eines Lächelns umspielt ihren Mund, und sie tritt beiseite. »So, Amber, freust du dich auf heute?«
Sie zuckt mit den Schultern und bohrt einen Pinsel in eine Lidschattenpalette. Sie setzt ihn ans Auge, ohne die überschüssige Farbe wegzupusten, worauf sich ein grauer Puderschleier auf ihre Wange legt. »Nicht direkt. Aber es ist nett, über Dinge zu reden. Jetzt, wo der Prozess erledigt ist.«
»Um die Sache richtigzustellen?« Greta hasst es, dass sie ihre Stimme verändert, nur weil sie vielleicht im Film zu hören ist. Es klingt, als läse sie einen Text vor, obwohl sie sich eher hindurchtastet und erahnen muss, was Federica haben will, während sie sich auf einem anderen Kontinent befindet.
Amber lächelt ihr im Spiegel zu. Greta weiß genau, wie gut Tom, der hinter ihr steht, die Einstellung gefällt. Er beugt sich vor, und Amber erträgt es geduldig, auch sie hält flüchtig inne. Und dann sagt sie: »Genau.«
2000
Miles erwachte mit einem Gefühl der Furcht, wie immer in letzter Zeit. Komisch, dachte er im Halbschlaf, dass man eine Woche als »immer« empfinden konnte. Länger war es tatsächlich nicht; er konnte die Tage im Kopf abzählen. Zehn Tage seit Ambers Geburt. Sechs seit Sadie ihm gesagt hatte, ihre Tochter sei verflucht.
Oft kam es ihm vor, als verliefe sein Leben im Zeitraffer, als wäre nur ein Augenblick vergangen, seit Sadie ihm gesagt hatte, sie sei schwanger, und nun hatten sie ein Baby. Sie waren aus dem Wohnheim in eine winzige Familienwohnung gezogen, die nicht weit vom Campus entfernt war. Alles war wunderbar gewesen, aufregend – die Monate, in denen Sadies Bauch wuchs, in denen erst ein und dann zwei Ultraschallbilder mit Magneten am Kühlschrank hingen; ein Foto von ihnen beiden im Standesamt nahm einen Ehrenplatz auf dem Fernseher ein. Sie hatten das schlichte braune Sofa mit bunten Kissen aus dem Secondhandshop aufgehübscht, und im schäbigen Schlafzimmer stapelten sich winzige weiße Kleidungsstücke. Auch im Studium lief es gut. Er wachte jeden Morgen früh auf und las, seinen Lieblingsbecher mit Kaffee neben sich auf der Fensterbank, während Sadie noch schlief, um die Kuhle gerollt, die sein Körper im Bett hinterlassen hatte.
Dann wurde Amber geboren, und alles hatte sich verändert.
In den ersten Tagen nach der Geburt war er empfindlich und nervös gewesen. Sie hatten ihm Amber gereicht, während er Sadies wachsbleiches Gesicht und die Blutlache auf dem Boden anstarrte, überzeugt, er würde sie verlieren. Eine Nottransfusion nach dem Notkaiserschnitt, man hatte Miles beiseitegeschoben, während er das Baby im Arm hielt. Die Gewalt des Ganzen hatte ihn schockiert, er hatte ihren Widerhall noch tagelang gespürt. Er war jeden Morgen überrascht, wenn er sein erschöpftes, gequältes Gesicht im Badezimmerspiegel des Krankenhauses betrachtete. Doch Amber trank gut, schlief gut, ein blonder Flaum bedeckte ihr weiches Köpfchen. Allmählich legte sich das angsteinflößende Gefühl, er näherte sich einem steilen Abgrund.
Dann, am ersten Morgen in ihrer Wohnung, hatte sie es gesagt. Sadie stillte im Bett, ein Kissen im Rücken, während ein verschlafener Miles zur Toilette stolperte. Sie hatte auf ihre Tochter hinuntergeschaut und Es tut mir leid gesagt.
Er hatte nicht weiter darauf geachtet, doch als er zurückkam, lag Amber auf seiner Bettseite, und ihr Wimmern schwoll allmählich zu Gebrüll an, während Sadie dasaß und in die Zimmerecke starrte. Er schaute hin, konnte aber nichts entdecken – nichts außer einem alten Stuhl, den sie beiseitegeschoben hatten, um Platz für den Wickeltisch zu machen, darauf ein Stapel gefalteter Kleidung. Er schaute wieder zu Sadie, deren Blick auf den Stuhl geheftet war, sie hatte den BH noch auf einer Seite heruntergeklappt. Amber schrie jetzt noch lauter.
Er sagte ihren Namen, sein Herz hämmerte. Er war erleichtert, als sie ihren Blick von der Ecke abwandte und ihn anschaute. Aber nicht lange.
»Sie werden kommen und sie holen. Sie ist verflucht, genau wie ich.«
Dann hatte sie von ihrer eine Woche alten Tochter zu Miles geschaut. »Es tut mir leid«, hatte sie gesagt, war aus dem Bett aufgestanden und hatte das Zimmer verlassen.
Amber brüllte jetzt aus vollem Hals. Miles hatte das Baby beruhigt und gehört, wie unten Töpfe im Spülbecken schepperten. Sadie hatte ihm zugerufen, sie wolle Milch kaufen, und die Tür war hinter ihr zugeschlagen, bevor er etwas sagen konnte. Er war zum Telefon gegangen und hatte seine Mutter angerufen.
»Es ist eine schwierige Zeit«, hatte Frances wegwerfend gesagt. »Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Es geht ihr bald besser.«
Aber es ging ihr nicht besser. Obwohl Sadie den Fluch nicht mehr erwähnt hatte, ertappte Miles sie immer wieder dabei, wie sie das Baby betrachtete. Sie überprüfte ständig die Fenster und verriegelte auch tagsüber die Tür.
Am schlimmsten aber war das Flüstern. Es war nur ein Mal vorgekommen (soviel du weißt, fügte eine unwirsche Stimme in seinem Kopf hinzu), doch er musste ständig daran denken.
Er war spät von der Vorlesung heimgekommen, halb im Delirium vor lauter Schlafmangel. Amber weinte wieder einmal. Er hatte sie in der milchfleckigen Babywippe gefunden, die sie wie fast alles andere gebraucht gekauft hatten. Er hatte sie hochgenommen und war zum Schlafzimmer gestürmt, weil er erwartete, Sadie schlafend vorzufinden. Sein Ärger verflog, als Amber plötzlich verstummte und ihr feuchtes Mündchen an seine Schulter drückte.
Doch Sadie war nicht im Bett gewesen. Sie hatte mit dem Rücken zu ihm gestanden, über den Stuhl in der Ecke gebeugt, die Hand an die Wand gestützt – und hatte geflüstert.
Nicht sie, meinte er zu verstehen, obwohl er sich das vielleicht nur eingebildet hatte. So wie er sich wohl auch eine Sekunde lang nicht einen, sondern zwei Schatten an der fleckigen Wand eingebildet hatte.
Nicht eingebildet hatte er sich allerdings den wilden Zorn in Sadies Augen, als sie sich umdrehte und ihn dort stehen sah, und er hatte sich ganz gewiss nicht eingebildet, dass sie ihm die Schlafzimmertür vor der Nase zugeschlagen hatte. Doch als sie fünf Minuten später in die Küche kam, wo er Amber ein unbeholfen zubereitetes Fläschchen gab, war es, als wäre nichts geschehen. Sadie begann in aller Seelenruhe, eine Zwiebel und eine Möhre kleinzuschneiden, weil sie sich am Morgen auf Shepherd’s Pie geeinigt hatten.
Seither wachte er mitten in der Nacht mit einem Gefühl der Furcht auf. Es war vertraut, beinahe tröstlich, ein alter Freund. Darum hätte er an diesem besonderen Morgen um ein Haar die Augen geschlossen und sich davon überfluten lassen.
Stattdessen drehte er sich um und berührte das kühle Bettlaken auf Sadies Seite. Sie lag nicht neben ihm im Bett, die Ecke der Decke war fein säuberlich zurückgeschlagen.
Miles konnte hören, wie Amber sich in ihrem Babykörbchen regte. Er stand auf, leise Furcht meldete sich, wurde drängender. Amber wimmerte im Schlaf. Er kniff die Augen zu, um die letzten Schlafspuren zu vertreiben, und trat auf den Treppenabsatz.
Später würde er allen erzählen, er habe es sofort gewusst. Er wusste es, er spürte es. Dennoch spulte er die Routine ab, ging durch alle Zimmer, horchte auf die Schreie des Babys, die sich von verdrossen zu verzweifelt steigerten. Es dauerte nicht lange, bis er sich vergewissert hatte, dass alles still und ruhig war, jede Spur von ihr bereits verflogen. Die Haustür war nicht abgeschlossen, ihr Schlüssel lag auf dem Tisch.
Da begriff er, dass sie wirklich weg war.
2018
Beim Mittagessen drückt Amber die Finger in den schwankenden Burger; das Brot ist fügsam, das Blut sintflutartig. Sie gräbt die Zähne hinein und begegnet Gretas Blick, Gurken knirschen. Sie kaut, und beide schauen zu, wie das kraterübersäte Brötchen sich langsam wieder hebt und ein Käsefaden, der am Tellerrand gestrandet ist, langsam auf den schimmernden Holztisch trieft. Die Kamera scheint Amber nicht zu stören, als hätte sie vergessen, dass sie da ist – bis sie sich umdreht und Tom eine Handvoll Pommes anbietet.
»Was glaubst du, wie es gelaufen ist?«, fragt Greta und schiebt ihren Salat beiseite.
Amber zuckt mit den Schultern und trinkt schlürfend von ihrer Limo. »Alle waren echt nett«, sagt sie dann.
»Fällt es dir schwer, über das zu sprechen, was passiert ist? Es wieder aufzuwühlen?«
Amber greift nach dem Burger und betrachtet ihn nachdenklich. Ein weiterer Käsefaden löst sich langsam und tritt seine unvermeidliche Reise in Richtung Tischplatte an. Das Blut tropft leise auf den Teller. »Nein«, sagt sie schließlich und schaut Greta an. »Nein, es tut gut, dass ich jetzt darüber reden kann.« Sie zuckt wieder mit den Schultern und knabbert an ihrem Burger. »Der ist super.«
Greta schaut sich im Restaurant um. Es ist halb leer; der große Andrang beginnt erst in einer Stunde. Keine Paparazzi, immerhin. Sie weiß, dass Tom diese Aufnahmen haben will. Sie kann sich genau vorstellen, wie sie später aussehen; vermutlich schwarzweiß und mit Federicas Kommentar versehen. Vielleicht sogar in Zeitlupe; Kamerablitze explodieren vor dem getönten Wagenfenster, die Münder der Fotografen öffnen und schließen sich, als sie nach Amber rufen und sie sich abwendet. Sie könnten es sogar für den Vorspann verwenden.
Amber betrachtet sie, ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel. Sie hat es gemerkt, denkt Greta. Sie weiß, dass Greta keine Ahnung hat, was sie tut. Man hat sie beide hier ausgesetzt, aber nur eine von ihnen ist verunsichert. Amber lehnt sich in der Nische zurück und gähnt.
Greta räuspert sich. »Stört es dich nie, bekannt zu sein? Dass Leute dich auf der Straße ansprechen? Fühlt es sich nicht komisch an, wenn Fremde mehr über deine frühe Kindheit wissen als du selbst? Es gibt ganze Doktorarbeiten darüber.« Sie übertreibt – nur ein Mensch hat darüber geschrieben. Ein Mensch, der gewissenhaft jeden Onlineartikel über die Banners kommentiert, der eine eigene Website über die Familie und ihre Geschichte unterhält. Eine von mehreren, das schon – aber die einzige, von der man eine umfangreiche Dissertation herunterladen kann. Neulich hat Greta einen Recherchetag eingelegt und sich in die beunruhigende Welt der Fanfiktion über Amber und Sadie Banner begeben.
Amber lacht, und Gretas Herz schlägt schneller. Dieses Lachen wird Federica gefallen, es ist kurz und bitter. Vermutlich wird sie den Clip unmittelbar hinter eins der Talkshow-Interviews von heute Morgen montieren; einen Ausschnitt, in dem Amber niedlich und besonders britisch wirkt, in dem die Tränen weich und rotzfrei fallen. Vermutlich den, in dem die Moderatorin selbst nach einem Taschentuch griff und die Maskenbildnerin in der Werbepause auf die Bühne stürzte, die Amber soeben verlassen hatte. Ja, das dürfte Federica gefallen, zumal es nun ganz still ist und Amber noch immer aus dem Fenster schaut. Das Öffentliche und das Private. Die Gedanken zucken knapp unter der Oberfläche von Großbritanniens aktuell berühmt-berüchtigstem Gesicht.
Von Großbritanniens gefragtester Mörderin.
Sie fahren Amber zum Hotel, wo sie mehrere Termine im Spa gebucht hat. Auf dem Rücksitz umklammert sie Gretas Hand.
»Soll ich blond werden? Ich meine, richtig blond? Ich habe an diesen Ton gedacht, der fast silbern ist. So ein Lilaweiß.«
Greta, deren Strähnchen bis zu den Ohren herausgewachsen sind, brummt unverbindlich. »Das ist ein cooler Look. Aber wartungsintensiv.«
Amber verzieht das Gesicht und wendet sich ab, Gretas Hand fällt auf den Sitz. Als sie vor dem Hotel anhalten, klettert Amber hinaus und lässt eine Kaugummiblase platzen. »Bis morgen dann.«
»Bis morgen«, sagt Greta und widersteht dem Drang, Amber zu sagen, dass eine neue Frisur den Film uneinheitlich machen und Federica auf die Palme bringen wird.
Warum eigentlich nicht?, denkt sie bei sich. Warum nicht Federica auf die Palme bringen? Amber ist das Einzige bei diesem Filmprojekt, das nicht geplant und kontrolliert werden kann, und Greta weiß genau, dass es die berühmte Federica Sosa ganz schön nervt. Das hat sie in den letzten Tagen in London gemerkt, als Amber diverse Anrufe von Federica ignorierte, als ein geplantes Treffen zweimal verschoben und dann ganz abgesagt wurde. Ein feierliches Abendessen fiel ins Wasser, nachdem Amber vier Cocktails getrunken und danach verkündet hatte, sie wolle lieber in eine Disco gehen statt in den schicken Club, an den Federica gedacht hatte. Daher überrascht es Greta nicht, dass Federicas »persönliche Probleme«, von denen sie eine ganze Menge hat, auf einmal so wichtig geworden sind, dass Greta die Verantwortung für diese Phase des Projekts übertragen wurde. Greta, die den Erfolg braucht und Federica-geschult ist, sich mit anderen Worten ausgezeichnet darauf versteht, schwierige Personen wie Amber zu handhaben (zu manipulieren, beharrt die Stimme, und Greta muss sie gewaltsam verdrängen).
Sie sitzt in ihrem billigen Motel, ignoriert das rhythmische Hämmern, mit dem das Bett nebenan gegen die Wand stößt, und die heulenden Sirenen auf der Straße, und ruft ihre E-Mails ab. Nichts Neues – was an sich schon ungewöhnlich ist –, doch in London ist es spät, vermutlich genehmigt sich Federica gerade den ersten oder zweiten Wodka Tonic. Greta liest eine Mail ihrer Mitbewohnerin Hetty, die wie immer gleich zur Sache kommt – es geht um ein Geburtstagsessen nächste Woche für Lisette, die dritte Mitbewohnerin. Greta schreibt eine rasche Antwort; bis dahin müsste sie wieder in London sein. Vorher allerdings wird sie Neunzehnstundentage haben, an denen sie recherchiert, sich die täglichen Aufnahmen ansieht und Federica dabei hilft, das geheimnisvolle Etwas zu entdecken, das diesen Film zum Nonplusultra über den Fall Banner machen wird. Hinzu kommen die Dreharbeiten mit Amber. Irgendwie wird sie Zeit für das Essen finden, sagt sie sich. Sie wohnt erst seit sechs Monaten in der WG, während Hetty und Lisette schon seit drei Jahren zusammen sind – es ist schön, wenn man einbezogen wird. Und auch wichtig. Es ist wichtig, noch etwas anderes zu haben, etwas anderes als das hier. Den Fehler hat sie nämlich schon einmal gemacht.
Nachdem sie die Mail abgeschickt hat, öffnet sie einen neuen Tab und ruft die Arbeitsplattform des Teams auf. Toms Icon ist in der Ecke zu sehen; vermutlich geht er das Material des Tages durch. Federica hat ihre überarbeiteten Notizen in einer einmalig uneinheitlichen Kurzschriftversion hinzugefügt, die Greta mittlerweile beunruhigend gut versteht.
Sie kann sich nicht dazu überwinden, die Notizen zu lesen, und klickt stattdessen durch das Material, das sie in London zusammengestellt hat: Dateien mit Fallstudien, die sie und Federica gesammelt haben, frühe Interviews, Aufzeichnungen und Polizeifotos. Sie legt sich auf den Bauch und ruft ein Interview auf, das Federica geführt und ausnahmsweise korrekt benannt hat: Gavett 23.02.16 FS.