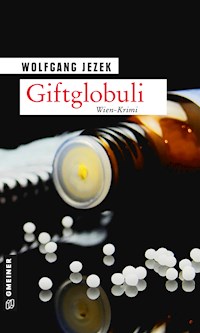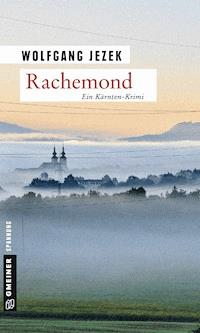
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Journalistin Elvira Hausmann
- Sprache: Deutsch
In einem Verein, der die verstorbene Dichterin Christine Lavant verehrt, ereignet sich ein seltsamer Todesfall. Die Kärntner Polizei zeigt allerdings kein wirkliches Interesse daran, den Fall aufzuklären. Deshalb wird Elvira Hausmann, eine Wiener Journalistin, nach Kärnten gesandt, um Licht in die Sache zu bringen. Trotz heftiger Widerstände und umgeben von einer Mauer des Schweigens, versucht Elvira Hausmann den Fall zu klären. Durch die Geschichte spukt die Gestalt der verstorbenen Dichterin, von der ein Fluch auszugehen scheint …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Jezek
Rachemond
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Wolfgang Jezek
ISBN 978-3-8392-5310-6
Widmung
Meiner Frau Riki
In großer Dankbarkeit gewidmet
Zitat
Der Abgrund menschlicher Illusionen,
das war die wirkliche, die strömungslose Tiefe.
(Henry James, Die mittleren Jahre)
Prolog (Ende 1954)
Die beiden Kerzen, die sie zum Lesen angezündet hatte, waren niedergebrannt. Das Wachs war zu beiden Seiten heruntergetropft und hatte sich auf der Tischplatte ausgebreitet. Eine Flamme flackerte leicht. Obwohl das Fenster geschlossen war, wehte ein leichter Luftzug herein. Im Raum war es fast finster. Kalt war es, so kalt, dass sie manchmal ihren Atem als weißen Hauch sehen konnte. Auch das Feuer im Ofen war heruntergebrannt. Eiskalt waren ihre Finger, sie zitterten. Es war nicht nur die Kälte, die sie zittern ließ.
Rauchschwaden hingen in der Luft. Der Rauch der Zigaretten, die sie heute Abend geraucht hatte. Filterlos, versteht sich. Sie paffte sie nur, aber hin und wieder fuhr doch der Tabakrauch in ihre Lunge. Dann kam es ihr vor, als ob plötzlich eine eiserne Klammer ihre Eingeweide zusammendrückte. Viele Zigaretten waren es heute geworden, noch mehr als sonst. Sie hörte auf die geräuschvollen Atemzüge ihres Mannes, der schon vor zwei Stunden zu Bett gegangen war und fest schlief. Manchmal gingen diese Atemzüge in leichtes Schnarchen über. Wie sie dieses Geräusch hasste! Wie sie ihn überhaupt hasste, in seiner ganzen Existenz! Oft hatte sie das Gefühl, als wäre er zu einer Statue geworden, zu einer kalten, glatten Skulptur, die neben ihr stand. Das Ordentliche in seiner Persönlichkeit war mit dem Alter zur Zwanghaftigkeit geworden. Seine Höflichkeit zur Fassade, seine Zurückhaltung zur Kälte, seine Gelassenheit zur Gleichgültigkeit. Sie waren einander gleichgültig geworden, und doch lebten sie miteinander, weil sie keine andere Wahl hatten. Sie hielten das nur aus, weil sie einander aus dem Weg gingen. Er lebte unter Tags, sie vor allem in der Nacht. Er machte kilometerlange Spaziergänge, sie blieb zu Hause. Die eheliche Kommunikation hatten sie auf ein Minimum reduziert. Körperliche Nähe gab es schon lange keine mehr. Sie waren einander so fremd geworden, wie sie sich im Grunde immer gewesen waren. Nur ihre Einsamkeit und ihre Sehnsucht nach einem Menschen hatten sie anfangs etwas anderes glauben lassen. Zwei, drei Jahre nach der überstürzten Heirat hatte sie ihren Irrtum bemerkt. Da war es zu spät gewesen. Sie war ein treuer Mensch und fühlte sich an ihr Eheversprechen gebunden. Sie fühlte sich verbunden, auch wenn sie ihn hasste …
Sie hatte die Hände auf den Schoß sinken lassen. Zwischen ihren zitternden Fingern lag ein Brief. Sie starrte ins Leere, in die Dunkelheit. Seit Minuten hatte sie sich nicht mehr bewegt. Bleischwer lagen die Hände in ihrem Schoß, auch der Brief schien schwer zu wiegen. Ja, es wog schwer, was er gefühlsmäßig in ihr ausgelöst hatte. Sein Inhalt hatte sie mitten ins Herz getroffen. Schon länger hatte sie damit gerechnet, dass dieser Moment kommen würde. Doch jetzt hatte es sie unerwartet getroffen. Gerade hatten sie eine bessere Zeit gehabt, vor Kurzem noch hatte er ihr versprochen, sie nie zu verlassen. Und nun das!
Sie beobachtete sich selber beim Atmen, fühlte ihren Herzschlag bis in den Hals klopfen. Wozu atmete sie noch, wozu schlug das Herz noch? Wozu das alles? Alles, alles war sinnlos geworden mit diesem Brief. Dieser hatte ihr die Gurgel durchgeschnitten und sie von ihrem Leben getrennt. Sie wusste, dass das ihr Ende war. Das Ende ihrer eigentlichen Existenz. Sie würde weiterleben, aber es würde nur mehr ein Vegetieren sein. Eine sinnlose, sinnentleerte Existenz. Alles, was ihr in den letzten Jahren wichtig gewesen war, alles, woran sie geglaubt hatte, alles, was ihrem unglücklichen Leben Sinn verliehen hatte, war mit diesem Brief zunichtegemacht worden.
Ungläubig führte sie ihre zittrigen Hände mit dem Brief wieder vor ihre Augen. Wegen ihrer schlechten Sehkraft und der Dunkelheit konnte sie die Buchstaben nicht mehr entziffern. Dennoch wusste sie genau, was da stand. Ihr ausgezeichnetes verbales Gedächtnis hatte dafür gesorgt, dass sie das Schreiben nach zweimaligem Lesen auswendig kannte. Die Worte hatten sich in ihr Gehirn eingebrannt:
Teure Geliebte, es tut mir von Herzen weh, dir diesen Brief schreiben zu müssen. Aber ich kann nicht anders. Die Umstände und vor allem meine Frau zwingen mich dazu, diesen Schritt zu tun. Glaub mir, lieber würde ich dir anderes, Erbaulicheres schreiben!
Ich sehe keine andere Möglichkeit mehr, als unsere Liebesbeziehung zu beenden. Ich kann nicht mehr, habe keine Kraft mehr. Dieses Doppelleben, dieses Versteckspiel raubt mir alle Energie, auch die schöpferische. Seit Wochen habe ich nicht mehr gemalt. Meine Gedanken sind ständig bei dir und dabei, wie ich die Situation lösen kann. So viel ich auch nachdenke, ich finde keine andere Lösung als diese.
Wir haben schon oft unsere Beziehung beendet und doch wieder neu angefangen. Diesmal ist es endgültig. Meine Gesundheit leidet dabei, meine Schaffenskraft, meine Familie. Seit Monaten sehe ich, wie auch du leidest. Du hast mich oft gebeten, meine Frau und die Familie zu verlassen. Ich schaffe es nicht. Ich kann das meinen Kindern nicht antun. Sie haben schon genug gelitten unter der unklaren Situation. Ich will und muss bei ihnen bleiben, auch wenn mein Herz mich ganz etwas anderes zu tun heißt.
In solch verfahrenen Situationen muss einmal das Herz schweigen und der Verstand Oberhand gewinnen. Deshalb habe ich mich jetzt zu diesem Schritt entschlossen. Ich bitte dich inständig, mich in den nächsten Monaten nicht zu kontaktieren. Sonst funktioniert diese Trennung nicht und wir kommen nie voneinander los. Vielleicht können wir nach einiger Zeit wieder aufeinander zugehen und einander als die Seelenfreunde begegnen, die wir sind und immer sein werden. Vielleicht hätten wir es dabei belassen und nicht dem Drängen unserer Körper nachgeben sollen.
Ich weiß, ich tue mir damit Gewalt an, aber ich muss mein Herz und meinen Körper zum Schweigen bringen. Ich tue diesen Schritt auch, um damit mögliches Schlimmeres zu verhüten. Du weißt, dass meine Frau mehrmals mit Selbstmord gedroht hat. Ich könnte es nicht ertragen, wenn sie es wirklich täte! Bitte, versteh mich, mein Herz ist immer noch bei dir. Aber ich muss als Mann und Familienvater einmal eine Entscheidung treffen, und das tue ich hiermit. Leb wohl und vergiss mich nicht! Gott schütze dich! In immerwährender Liebe
Dein Werner
Fassungslos ließ sie das Schreiben wieder sinken. Eine der Kerzen war nun erloschen. In der Wand machten sich Mäuse zu schaffen, so wie jede Nacht. Ihre kratzenden Geräusche, die ihr sonst auf die Nerven gingen, hatten heute etwas Tröstliches. So fühlte sie sich nicht ganz allein. Dennoch – da war sie wieder, diese eiskalte Einsamkeit, die sie jahrelang verspürt hatte und die in den letzten Jahren weniger geworden war. Da war sie wieder, und sie wusste, dass sie der Begleiter ihres zukünftigen Lebens sein würde, bis zum Tod. Ihr Leben war zu Ende, sie hatte keine Zukunft mehr. Erfrieren würde sie langsam in dieser kalten Dachkammer und in der Gegenwart ihres versteinerten Mannes.
Langsam löste sich die Erstarrung. Sie spürte eine Wut in sich hochkriechen, tief in ihrem Inneren. Die Wut stieg auf, erreichte den Mund und die Lippen und ließ sie sagen: »Du Schwein, du feiges Schwein, du! Verräter! Lügner! Verräter unserer Liebe! Verräter an allem, was uns heilig war! Mieses Schwein!« Für sie war klar, dass er nicht um seiner Frau oder seiner Familie willen die Beziehung zu ihr beendet hatte. Nein, sein Werk war es, das ihn dazu veranlasst hatte. Seine Bilder, die ihm über alles gingen. »Du liebst nur deine Bilder, deine Malerei! Sonst kannst du gar nicht lieben! Du faselst was von Liebe und kennst nur deine Kunst! Eitles, egoistisches Schwein!«
Die Worte kamen ihr über die Lippen, ohne dass sie nachgedacht hatte. Und auf einmal wuchs in ihr die Erkenntnis: »Modell war ich für dich, einfach ein Modell. Als Modell hast du mich benützt, als Inspiration für deine Bilder. Als Muse hast du mich bezeichnet, und ich habe geglaubt, du liebst mich! Dir ist es gar nicht um mich gegangen, sondern nur darum, mein Gesicht zu malen! Benützt hast du mich, du großer Künstler, du egoistisches Schwein!«
Ihr Mann rührte sich im Halbschlaf und stammelte: »Was ist denn? Mit wem redest du da?« Sie gab keine Antwort. Hasserfüllt starrte sie ihn an. Auch er war so ein Mann, der sie mit ihrer ganzen Sehnsucht vor der Tür hatte stehen lassen. Ihre Sehnsucht war riesengroß und unstillbar. Alles hatte sie ihm gegeben, ihrem geliebten Künstlerfreund. Ihr Herz, ihre Seele, sogar ihren Körper, den sie hasste. Ihren verunstalteten, hageren, früh welk gewordenen Körper hatte sie ihm anvertraut. Sie hatte es gewagt, diesen nach Jahren wieder einmal unverhüllt einem Mann zu zeigen. Und das war jetzt der Lohn dafür!
Immer hatte sie sich gefragt, was er fand an ihr. Warum er sich das alles antat, mit seiner Familie, seiner Frau. Nun hatte sie die Antwort: Eine perverse Faszination hatte ihn angezogen. Ihr Körper, der beileibe nicht schön war, hatte ihn fasziniert. Nicht den Mann, sondern den Maler wohlgemerkt. Der Maler hatte sie geliebt, und nun gab es genug Bilder von ihr. Nun war das Interesse verflogen, er würde sich ein anderes Modell suchen. Und er ließ sie in ihrem Schmerz allein, in ihrer Einsamkeit.
Hatte er nicht gespürt, wie verwundet ihre Seele war? Wie einsam, wie sehnsüchtig? Noch nie hatte sie jemanden so geliebt wie diesen Maler. Alles vorher war keine wahre Liebe gewesen – die zu ihrem Mann schon gar nicht! Aber er, ER, ER! Er war die große Liebe ihres Lebens gewesen, ein Mann, für den sie alles getan, alles hingegeben hätte! Und nun warf er sie weg, wie ein Stück Kreide, mit dem er gezeichnet hatte und das nun auf einen Stummel zusammengeschrumpft war. Unbrauchbar geworden, weg damit!
Sie spürte, wie die Wut in ihr immer mehr anschwoll. »Gott schütze dich!«, hatte er geschrieben. Wie wenn er, der alte Atheist, auf einmal an Gott glauben würde! Über ihr Ringen mit Gott, über ihre Anklagen dieser höheren Macht gegenüber hatte er sich lustig gemacht. Und nun: »Gott schütze dich!« Als ob er die Verantwortung für sein Tun auf Gott abwälzen wollte. Was für eine Gemeinheit, was für eine Heuchelei! Nein, mit Gott wollte sie in ihrem Leben nichts mehr zu tun haben, und mit ihm, dem für sie gottgleichen Wesen, auch nichts mehr!
Sie spürte, wie die Wut in ihr etwas Zerstörerisches bekam. Gleichzeitig wusste sie nicht, wohin mit dieser Wut. Am liebsten hätte sie sich das Gesicht zerkratzt, damit es noch unansehnlicher würde, als es schon war. Nein, dachte sie, nein! Die Freude mache ich dir nicht! »Du wirst noch an mich denken!«, hörte sie sich sagen. »Du wirst noch von mir hören, sodass dir Hören und Sehen vergeht! Ich bleibe in Gedanken bei dir und mein Hass wird dich überallhin verfolgen! Du entgehst meiner Liebe nicht!« Sie hatte ihre Stimme zu einem Flüstern gesenkt, zu einem harten, bösen Flüstern. Sie stieß jede Silbe einzeln hervor.
Und plötzlich wurde ihr klar, wie sie sich an ihm rächen konnte. Sie würde sich rächen mit der einzigen Waffe, die Gott, dieser ewig Missgünstige, ihr in die Hand gegeben hatte. Mit dem Wort, mit ihrem Schreiben. Ein Buch würde sie verfassen, über den Geliebten, über sie beide. Eine Abrechnung würde es werden, wie sie die Welt noch nicht erlebt hatte. Ein möglicher Titel zuckte ihr durch den Kopf: »Du hast mir meine Augen gestohlen«. Ihre Augen, die von Kindheit an schlecht waren, hatte er ihr ganz weggenommen. Blind war sie gewesen vor Liebe. Und gänzlich blind würde sie sein in Zukunft. Die Sonne, die sie ohnehin hasste, würde sie endgültig nicht mehr sehen! Sie würde sich ganz der Nacht zuwenden, die ihr durch Stille, Dunkelheit und Kühle kurzfristig Trost schenkte. Auch seelisch würde sie endgültig die Nacht umfangen. Oh, wäre ich doch endlich tot! Das war der Wunsch, mit dem sie sich in diese ewige Nacht begab.
Ob sie das Buch je veröffentlichen würde, wusste sie jetzt nicht. Das war auch egal. Hauptsache, sie konnte sich ihre ganze Enttäuschung und Wut von der Seele schreiben. Von dem Sockel, auf den sie ihren Geliebten gestellt hatte, würde kein Stein auf dem anderen bleiben. Sie würde schriftlich herumtrampeln auf ihm, in Grund und Boden würde sie ihn stampfen. »Wenn das einmal einer zu lesen kriegt, bist du geliefert!«, zischte sie. »Dein Bild werde ich zerschneiden in mir, in kleine Stücke werde ich dich zerschneiden!« Ihr Gesicht bekam den fanatischen Ausdruck einer Hexe, die einen giftigen Zaubertrank braute.
Entschlossen stand sie auf. Sie nahm den Brief, zerriss ihn in kleine Schnipsel und warf ihn auf die letzten Glutreste im Ofen. Diese flackerten kurz und schwach nochmals auf. Dann war totales Dunkel im Raum, absolute Stille umgab sie. So musste Sterben sein. Sterben konnte nicht schlimmer sein als das, was sie gerade erlebte. Verbittert zog sie sich in der Kälte aus und streifte ihr Nachthemd über. Sie legte sich unter die eiskalte Decke und wusste, dass sie auch diese Nacht nicht würde schlafen können. Der Einzige, der sie in diesem Leben hatte wärmen können, hatte ihr die Liebe aufgekündigt. Er sollte seines Lebens nicht mehr froh werden. Das war die einzige Genugtuung, die sie noch hatte. »Du hast mir meine Augen gestohlen«: Schon in der nächsten Nacht würde sie mit dem Schreiben anfangen.
1. Kapitel (Herbst 2010)
»Gehn S’, Frau Hausmann, fahren Sie bitte zu den Kärntnern hinunter! Da gibt’s wieder ein Problem. Da hat sich einer umgebracht, der Präsident von einer Literaturvereinigung. Unsere Redaktion in Klagenfurt hat aber einen anonymen Anruf erhalten, dass das kein Selbstmord war. Die Redaktion unten kommt nicht weiter. Helfen S’ denen, Sie sind ja eine Spezialistin für solche Fälle!«
Gestern hatte sie der Chefredakteur, Herr Prassler, in die Wiener Redaktion des Tagesboten – der Zeitung, für die sie arbeitete – bestellt und ihr aufgetragen, für einige Tage nach Kärnten zu fahren. Sie war nicht begeistert gewesen. Erstens war sie gerade mit einer anderen Recherche beschäftigt, über rechtsradikale Umtriebe bei der Wiener Polizei, und zweitens mochte sie Kärnten nicht besonders. Bei ihren kurzen Besuchen in dem Bundesland waren ihr die Landschaft zwar schön, die Bewohner aber oberflächlich und unehrlich vorgekommen. Und jetzt auch noch der Skandal mit der Hypo-Alpe-Adria-Bank! Die österreichische Bevölkerung würde jahrelang für dieses Desaster zahlen müssen. Nur weil ein größenwahnsinniger Landeshauptmann diese Bank mit seiner Privatschatulle verwechselt hatte!
Jetzt saß sie im Auto und fuhr nach Klagenfurt. Sie hatte gestern schnell zusammengepackt, für ein paar Tage brauchte sie nicht viel. Überhaupt war sie relativ anspruchslos, was Aussehen und Kleidung anbelangte. Ein paar warme Sachen hatte sie mitgenommen, weil der Wetterbericht kalte Tage für den Süden Österreichs voraussagte. Sie war gespannt und etwas bang, was sie da im Süden erwartete. Ob sich die Angelegenheit in einigen Tagen aufklären lassen würde? Sie hatte vor zwei Jahren bei einem Mordfall in Wien kriminalistisches Geschick bewiesen und der Polizei die entscheidenden Hinweise geliefert. Damals hatte ein junger Schnösel aus gutem Haus seine Freundin umgebracht und die Sache so aussehen lassen, als sei die Täterin die bosnische Putzfrau gewesen. Der Typ war ihr von Anfang an nicht geheuer erschienen und sie hatte ihn durch geschicktes Fragen in die Enge getrieben. In der Redaktion war man nach der Aufklärung stolz auf sie gewesen, sie hatte sogar eine Prämie bekommen. Die Prämie hatte sie dazu verwendet, ihrem damaligen Freund aus einer finanziellen Patsche zu helfen – was sie nicht zum ersten Mal gemacht hatte.
Ja, Emil – auf der ganzen Fahrt musste sie an ihn denken. Wie oft war sie diese Strecke gefahren, um ihn am Wochenende in Graz zu besuchen! Sie kannte die Strecke sozusagen auswendig, nur erschien sie jetzt nach der Trennung in einem anderen Licht. Jeder Wegweiser hatte etwas Trauriges, das Asphaltband nach Süden schien ins Nichts zu führen. Schlussendlich hatte sie sich von ihm getrennt, nachdem er jahrelang beruflich nichts auf die Reihe gekriegt und sie schließlich mit einer Studentin betrogen hatte. Als sie dahintergekommen war und ihn zur Rede gestellt hatte, war seine Erwiderung: »Weil ich deine Falten und Krampfadern schon nicht mehr sehen konnte!« Sie fragte sich, warum Männer in Trennungssituationen oft so brutal und würdelos agierten – und fand keine Antwort darauf.
Das letzte halbe Jahr war für sie voller Trauer gewesen. Sie war nicht mehr jung, gerade 42 – würde sie in ihrem Alter noch einen Partner finden? Das Internet war voller Geschiedener oder gestörter Typen oder voller Männer, die nur auf schnellen Sex aus waren. Nichts gegen Sex, aber schnell und unverbindlich – nein!
Die Erinnerungen wurden intensiver, als sie sich Graz näherte. Bei der Ausfahrt Sinabelkirchen fiel ihr wieder das dumme Lied von STS ein, mit dem diese bekannt geworden waren, mit dem Titel »Fürstenfeld«. Der Song war in den 80er-Jahren zur Hymne einer provinziellen Anti-Wien-Bewegung geworden. Sinabelkirchen wurde darin namentlich erwähnt, um von Wien dorthin flüchten zu können. So hatte es dieses Kaff zu einer gewissen Bekanntheit gebracht. Der Gedanke an diese Groteske aus der österreichischen Popgeschichte milderte kurz ihren Schmerz. Am liebsten wäre sie, einem alten Reflex gehorchend, bei Graz-Ost von der Autobahn abgefahren. Doch sie fuhr geradeaus weiter. In diesem Moment wurde ihr wieder bewusst, dass die Beziehung endgültig vorbei war.
Nach der Fahrt über den Packsattel, eine langweilige 100-km/h-Zone, tauchte am Fahrbahnrand das Schild ›Kärnten – Willkommen bei Freunden‹ auf. Welche Freunde oder Freundinnen warteten da auf sie? ›Wolfsberg Nord 12km‹ kündigte der Wegweiser an. In der Nähe von Wolfsberg war der fragliche Selbstmord geschehen, so viel wusste sie. Sie sah sich die Gegend, in der sie sich in den nächsten Tagen aufhalten würde, im Vorbeifahren neugierig an. Ein liebliches, weites Tal, das Lavanttal – nach Süden, zur Sonne hin, geöffnet. Diese war heute nur spärlich zu sehen, eine dicke Nebeldecke lag über dem Tal.
Weiter fuhr sie Richtung Klagenfurt. St. Andrä und Griffen waren die nächsten Ausfahrten. Griffen, davon hatte sie schon gehört. Griffen – Peter Handkes »Wunschloses Unglück« fiel ihr ein. Der berühmte Dichter stammte aus diesem Ort. Ihr Chef hatte von einer Schriftstellerin gesprochen. Wie hieß sie doch schnell? Der Tote war der Präsident eines Vereins gewesen, der sich mit der Dichterin beschäftigte. Deren Name hatte ihr jedenfalls nichts gesagt, die alten Dichter und Dichterinnen waren nicht ihr Spezialgebiet. Sie las gern, aber mehr moderne Autoren, Romane, Politisches. Und Krimis, natürlich. Schon berufsbedingt las sie viele Krimis, schließlich war sie im Chronikteil der Zeitung auch für die Gerichtsberichte zuständig. Es irritierte sie, wie gut sie sich in die Psyche der Täter hineinversetzen konnte. Mehr als mit den Mordopfern beschäftigte sie sich mit Mördern und Mörderinnen. Sie fand sie interessanter, und immer wieder stellte sich die Frage: Warum beging jemand ein Verbrechen?
Der Nachmittag rückte voran, es begann zu dämmern. Jetzt gegen Ende Oktober bestätigte sich die banale Erkenntnis, die sich die Menschen aber dennoch gerne mitteilten, dass die Tage kürzer wurden. Klagenfurt war nicht mehr weit, die Autobahn führte durch weite, dunkle, unheimlich wirkende Wälder. Die Redaktion hatte ihr ein Hotelzimmer für ein paar Tage reserviert. Ob sie es in der fremden Stadt schnell finden würde? Hartnäckig verzichtete sie auf ein Navi in ihrem Auto. Sie hatte in ihrem Leben immer noch die Orte gefunden, die sie angesteuert hatte – mit Karten, Nachfragen oder einfach mit Intuition.
›Klagenfurt-Ost/Zentrum‹ war nun angekündigt. Eine lange, gerade Straße führte zum Zentrum, gesäumt von den üblichen hässlichen Einkaufszentren. Überall die gleichen Geschäfte, dachte sie – Billa, Merkur, Vögele, Deichmann, Mediamarkt … Wie einfallslos und gleichmachend der Kapitalismus doch war! In allen Städten und Städtchen Österreichs die gleiche Szenerie. Wie stumme Wächter standen diese Riesengeschäfte an den Einfallsstraßen, um sicherzustellen, dass die Menschen alle brav in die gleiche Richtung fuhren – hin zum ungehemmten Konsum und zum Verkauf ihrer Seele.
In jungen Jahren hatte sie mit dem Kommunismus geliebäugelt. Irgendwann war sie drauf gekommen, dass dieser noch langweiliger und brutaler war als der Kapitalismus. Behalten hatte sie eine Aversion gegen alles Rechte in der Politik. Gerade hier in Kärnten war die politische Rechte stark vertreten. Der verstorbene Landeshauptmann – sie vertrat die Theorie, dass dieser mit seinem Verkehrsunfall eigentlich Selbstmord begangen hatte – war ein strammer Vertreter dieser Richtung gewesen. Nach dem, was sie wusste, stand das Land – zwei Jahre nach seinem Tod – immer noch stark in seinem Bann.
Das Hotel Geyer in der Priesterhausgasse war gleich in der Nähe, wo die Völkermarkterstraße, die von der Autobahn ins Zentrum führte, auf die Altstadt traf. Dank ihres guten Orientierungssinns hatte sie es rasch gefunden. Klagenfurt stellte sich, was Größe und Anordnung betraf, als überschaubare Stadt heraus. Ähnlich wie in Wien oder Graz gab es auch hier eine »Ringstraße«, die sich um die Altstadt herumwand. Erfahrungsgemäß verliefen diese Ringstraßen entlang der ehemaligen Stadtmauern. Das Hotel war also am Rand der Altstadt, relativ ruhig gelegen. Sie wollte ohnehin keinen Trubel.
Der Check-in im Hotel verlief problemlos. Sie wurde von einer hübschen jungen, dunkelhaarigen Rezeptionistin empfangen. Deren näselnder Kärntner Dialekt – vielleicht bemühte sich die junge Dame sogar, Hochdeutsch zu sprechen – berührte sie unangenehm. Das Hotel war ein altes Gebäude, das vor einigen Jahren modernisiert worden war. »Wir sind eines der traditionsreichsten Hotels der Stadt«, näselte die junge Kärntnerin. »Und Sie ham eins der bestn Zimma kriagt«, ergänzte sie, indem sie in ihren gewohnten Dialekt fiel. Das Zimmer war in Ordnung, modern und bunt eingerichtet. Nett, aber klein, dachte Elvira Hausmann – wie die Redakteurin mit vollem Namen hieß.
Vom befürchteten Trubel konnte im abendlichen Klagenfurt keine Rede sein. Eher wirkte es wie ausgestorben, als Elvira an diesem kalten Oktoberabend durch die Stadt schlenderte. Einige Leute eilten, dick vermummt, mit ihren Einkäufen nach Hause. Ihr fiel auf, dass viele Geschäftslokale leer standen. ›Zu vermieten‹, ›Zu verkaufen‹ war an den Glasscheiben zu lesen. War das die Folge der florierenden Zentren am Stadtrand, an denen sie vorbeigefahren war? Oder die Folge der Wirtschaftskrise, die Kärnten erfasst hatte, zusammen mit dem Hypo-Alpe-Adria-Desaster? Jedenfalls hatte Elviras erster Eindruck von der Stadt etwas Beklemmendes.
Sie bekam Hunger. Vor der Abfahrt in Wien hatte sie zu Mittag nur ein mit Käse gefülltes Weckerl gegessen, sonst nichts. Wie es wohl um die kulinarische Szene der Stadt bestellt war? Sie sah etliche italienische Lokale, einige Kärntner Gaststuben, ein paar Kaffeehäuser. Der italienische Einfluss in der Stadt war spürbar – in den Bezeichnungen von Gebäuden und Lokalen, in der Bauweise der Häuser. Einige Gehminuten vom Hotel entfernt fand sie die Trattoria Siciliana, wo sie durchaus zufriedenstellend zu Abend aß. Der Kellner redete nur Italienisch mit ihr, was ihr unangenehm war. Sie beherrschte zwar einigermaßen diese Sprache, aber in Österreich wollte sie Deutsch reden. Italien ist auch so ein Pleiteland wie Kärnten, dachte sie. Wahrscheinlich sind die Mentalitäten ähnlich, oh je! Früher war sie gern nach Italien gefahren. Aber seit der frühere Ministerpräsident, der von der naiven Bevölkerung immer wiedergewählt worden war, das Land jahrelang zu Tode regiert hatte, spürte sie wenig Lust auf Reisen nach Italien. Diese Art von Volkstribunen – zuerst geliebt, am Ende gehasst – schien in den südlichen Ländern sehr verbreitet zu sein. So scheinbar auch hier, im südlichsten Bundesland von Österreich.
Mit sattem Gefühl im Magen ging sie noch eine Weile in der Altstadt spazieren. Es war Nacht geworden. Die meisten Städte sahen in der Nacht schöner aus als am Tag, dachte sie. Das Hässliche wurde von der Dunkelheit verschluckt. So war es auch hier der Fall. Die Stadt hatte plötzlich etwas Sympathisches, Heimeliges. Am Rückweg zum Hotel traf sie auf den »Neuen Platz«, den Hauptplatz der Stadt, mit seinem »Lindwurm« – dem Wahrzeichen der Stadt. Sie stellte fest, dass dieses auf vielen Postkarten und Briefmarken festgehaltene Ungetüm eine künstlerisch beachtliche Bildhauerarbeit der Renaissance war, die sie – auch wegen ihrer Größe – beeindruckte. Seit Jahrhunderten schwang der steinerne Herkules davor seine Keule, um das Böse zu besiegen – ohne Erfolg. Sie fragte sich, ob sie in den nächsten Tagen dem Bösen auf die Spur kommen würde. Hatte es bei dem Vorfall im Lavanttal überhaupt ein Verbrechen gegeben? Oder war es Schicksal gewesen, ein Unfall?
2. Kapitel
Am Morgen des nächsten Tages erwachte Elvira mit schmerzendem Rücken. Sie hatte nicht gut geschlafen, die Matratze war zu weich. Die Erinnerung an einen Traum verfolgte sie: Dem Herkules am Neuen Platz war es gelungen, mit seiner Keule auf den Drachen einzuschlagen und ihn zu erlegen. Der Drache war in Hunderte Stücke zersprungen. Doch als er endgültig besiegt schien, fügten sich die Stücke durch eine gewaltige Kraft wieder zusammen. Der Drache ging daraufhin auf den Herkules los und blies ihn mit einem Feuerstrahl von seinem Sockel. Als nun der steinerne Recke zerbrochen auf der Erde lag, fügten sich seine Teile ebenfalls wieder zusammen und der Kampf begann von Neuem.
Elvira überlegte, was der Traum bedeuten konnte. Emotional irritierte er sie, aber sie konnte den Sinn nicht verstehen. Sie betrat den Frühstücksraum und suchte sich einen Tisch aus. Alle Tische hier waren klein, für ein opulentes Mahl würde es eng werden. Eine hübsche blonde Kellnerin kam auf sie zu und fragte: »Wollen Sie einen Kaffee?«
»Nein, ich bin Teetrinkerin. Können Sie mir einen kräftigen Schwarztee bringen, mit etwas Milch?«
»Einen Earl Grey haben wir, der ist sehr gut.« Elviras Stimmung sackte ab. Wenn man in der österreichischen Gastronomie zum Frühstück schwarzen Tee bestellte (den »Russischen Tee«, wie er früher genannt wurde, hatte man sich endlich abgewöhnt), bekam man einen Darjeeling – viel zu leicht, oder einen Earl Grey – viel zu blumig. Mit einem Seufzer bestellte sie den Earl Grey, der überdies von seinen Nachbarn, neben denen er gelagert gewesen war, einen Geruch nach Hagebutten und Kamille angenommen hatte.
Nachdem sie sich am deftigen und reichhaltigen Frühstücksbuffet bedient hatte, begann sie, sich mit ihrem Tagesplan zu beschäftigen. Als Erstes würde sie die Klagenfurter Redaktion ihrer Zeitung aufsuchen und bei der dortigen Redakteurin in Erfahrung bringen, wie der Stand der Recherche war. Mit ihr würde sie dann – wenn diese Zeit hatte – ins Lavanttal fahren und Erkundigungen einholen. Auch Gespräche mit Betroffenen, vor allem von der Literaturgesellschaft, plante sie ein. Und sie würde mit dem ermittelnden Kommissar Kontakt aufnehmen, dies musste wiederum in Klagenfurt geschehen. Wie sie die Mentalität hier einschätzte, würde alles wohl länger dauern, als von ihr geplant.
Magister Karin Perkonig von der Lokalredaktion des Tagesboten erwartete sie schon in ihrem Büro in der Villacherstraße. Die Redakteurin war etwa 30 Jahre alt, Brillenträgerin, pummelig und sah aus wie eine Germanistikstudentin bei der Einführungsvorlesung, die in der ersten Reihe saß und alles fleißig mitschrieb. Sie begrüßte Elvira herzlich und offenbarte ihr Wissen: »Bisher ist sicher, dass es sich bei dem Toten um den Vorsitzenden der Christine-Lavant-Vereinigung in St. Stefan handelt. Sie müssen wissen, dass die Christine Lavant bei uns eine sehr bekannte Dichterin ist, die von 1915 bis 1973 gelebt hat. Sie war ein armes Weiberl, aber doch auch ein Genie. St. Stefan ist der Ort, wo sie fast ihr ganzes Leben verbracht hat. Jetzt ist es ein Teil von Wolfsberg, früher war es eine eigene Gemeinde. Ein Bergwerk war auch einmal dort, das ist schon lang geschlossen. Der Vater von der Christine Lavant hat dort in früheren Jahren als Bergmann gearbeitet. Und die Lavant-Vereinigung hat sich bemüht, die Erinnerung an die Dichterin hochzuhalten. Die haben Lesungen und Literaturwettbewerbe veranstaltet, aber in der letzten Zeit war nicht mehr viel los. Ja, der Tote war ein alter Mann, 75 Jahre alt, und hieß Siegfried Unterberger. Er war früher Hofrat bei der Landesregierung in Klagenfurt, jetzt war er schon länger in Pension. Alles deutet darauf hin, dass er Selbstmord begangen hat. Ach ja, er ist vor zwei Wochen gefunden worden, an einem kleinen Wehr in der Lavant bei St. Andrä. Zwei Kinder haben ihn gefunden, die sind jetzt noch ganz fertig mit den Nerven. Schön hat er ja nimmer ausgeschaut, der Hofrat Unterberger. Und dann ist vor ein paar Tagen ein anonymer Anruf in unsere Redaktion gekommen. Ich war nicht am Apparat, unsere Sekretärin, die Frau Libernig, hat ihn entgegengenommen.«
Elvira hatte sich alles geduldig angehört und fragte dann: »Wie hat denn die Stimme geklungen?«
»Schwer zu sagen«, antwortete die eifrige Redakteurin. »Es war offenbar eine verstellte Stimme, sehr tief, unnatürlich. Der Mann hat gemeint, dass der Unterberger nicht freiwillig in die Lavant gegangen sei. Da wurde nachgeholfen, hat er gesagt. Und dann noch: ›Wer suchet, der findet.‹«
Elvira kam das seltsam vor. Ein anonymer Anrufer, der offenbar mehr wusste? Warum hatte er sich nicht bei der Polizei gemeldet?
»Und was ist mit der Polizei?«, fragte sie. »Was hat die herausgefunden?« Die Eifrige machte ein ratloses Gesicht und meinte: »Die haben noch gar nichts gefunden. Die scheint das nicht zu interessieren. Der zuständige Inspektor, ein Herr Speckbacher, hat gemeint, ein anonymer Anruf kümmere ihn nicht. Für ihn ist es klar Selbstmord, und aus. Er will den Fall möglichst schnell abschließen, glaube ich.«
»Kann man mit dem Herrn Speckbacher einmal reden?«, fragte Elvira übellaunig. Sie kannte zu gut die oft geringe Motivation der Kriminalpolizei in den Bundesländern, die sich auf Überlastung, Personalnot und dergleichen ausredeten. Das Gespräch würde wahrscheinlich schwierig werden.
»Unsere Sekretärin wird für Sie einen Termin ausmachen. Aber so einer ist schwierig zu bekommen, der Inspektor hat angeblich nicht viel Zeit«, antwortete die Perkonig mit einem Sarkasmus in der Stimme, den Elvira dem braven Mädchen nicht zugetraut hätte.
»Wir können übrigens gern per Du sein. Ich heiße Elvira.«
»Gern, ich bin die Karin. Da redet sich’s leichter, wenn man Du sagen kann.« Elvira, die sonst eher vorsichtig auf Menschen zuging, verwendete bei einer engen Zusammenarbeit immer das Du. »Und fahren wir dann gemeinsam ins Lavanttal?«, fragte sie.
»Warum denn das?«, versetzte die Redakteurin erstaunt. Die Frage Elviras schien sie durcheinanderzubringen.
»Weil ich mir alles vor Ort anschauen möchte. Und weil ich mit den Betroffenen dort reden möchte, wenn das geht«, antwortete Elvira. »Wer ist denn dort auskunftsbereit oder dazu fähig?«
»Mit dem Vizepräsidenten der Vereinigung hab ich schon gesprochen, der weiß auch nicht viel oder sagt nicht viel. Vielleicht mit der Frau von dem Hofrat, aber der geht’s halt noch sehr schlecht!«
Zähe Recherchen standen bevor, das war Elvira jetzt schon klar. Und das in ein paar Tagen? Die Redaktion würde ihr mehr Zeit geben müssen, sonst würde sie ohne Ergebnis zurückfahren.
Widerwillig setzte sich Karin zu ihr in den Wagen (ein Renault Clio übrigens, 90.000 km, trotz einiger Reparaturen noch recht verlässlich) und raunzte: »Wann soll ich denn meine andere Arbeit machen?« Sie lotste Elvira aber anstandslos aus Klagenfurt hinaus und auf die Autobahn Richtung Graz, die zum Lavanttal führte. Die Fahrt dorthin dauerte eine knappe Stunde, einige Baustellen verlängerten die Fahrtdauer. Unterwegs erzählte ihr Karin noch mehr von der Dichterin: »Sie war sehr arm, aus einer ganz einfachen Familie. Und sie war immer sehr krank, als Kind schon. Sie hat Skofulose gehabt, was das auch immer sein mag. Eine Krankheit, die es heut nicht mehr gibt, etwas mit den Lymphknoten … Sie wäre als Kind fast daran gestorben. Deswegen ist sie von den anderen Kindern ausgespottet worden, weil sie von der Krankheit entstellt war. Und weil sie so dünn war.« Mobbing unter Kindern hat es schon immer gegeben, dachte Elvira. Man hatte es nur anders genannt. Karin setzte fort: »Sie war auch im späteren Leben eine Außenseiterin im Dorf. Und trotzdem hat sie St. Stefan nie verlassen wollen. Einmal hat sie sich überreden lassen, nach Klagenfurt in einen Neubau zu ziehen. Das hat sie dort nicht lang ausgehalten – die Leute rundherum, die ganzen Geräusche … Nach zwei Jahren ist sie wieder zurück in die Einsamkeit von St. Stefan, in die primitive Wohnung, in der sie vorher gelebt hat. Sie war eine seltsame Frau, und trotzdem hat sie hervorragende Gedichte geschrieben!«
Sie kamen zu einem Wegweiser, der die Abfahrt ›Völkermarkt-Ost‹ ankündigte. Auf einem weiteren Wegweiser war zu lesen: ›Werner Berg Museum‹. Karin geriet in Begeisterung: »Das war ein berühmter Maler, der Werner Berg! Mit dem war sie befreundet, jahrelang. Man hat auch gemunkelt, dass sie was miteinander gehabt haben. Aber was Genaues weiß man nicht darüber. Jedenfalls hat er tolle Porträts von ihr gemacht!«
Elvira nahm alles aufmerksam zur Kenntnis. Die Beschreibung der Dichterin hatte etwas Widersprüchliches, fand sie. Aber es musste sich um eine interessante Person gehandelt haben. Sie würde im Internet über sie recherchieren, so viel stand fest. Sie musste mehr über sie erfahren. Sie fragte Karin, woher sie denn so gut über diese Dichterin Bescheid wusste. »Bei uns in Kärnten ist sie sehr bekannt. Und ich habe Germanistik auf der Uni Klagenfurt studiert, daher weiß ich das noch.« Elvira war mit ihrer spontanen Einschätzung der Germanistikstudentin goldrichtig gelegen.
Sie nahmen die Ausfahrt St. Andrä und fuhren durch die gleichnamige mittelgroße Ansiedlung, die als »Stadt« bezeichnet wurde. Sie hatte zwei überdimensionierte Kirchen, was Elvira wunderte. Die Beifahrerin erzählte vom »ehemaligen Bischofssitz von Kärnten, deshalb die zwei großen Kirchen« und von der »Marienbasilika, einer Wallfahrtskirche, die demnächst renoviert werden soll«. Von der Anhöhe, auf der der Ort lag, fuhren sie hinunter zum Fluss Lavant. »Ist das ein Zufall, dass die Dichterin so heißt wie der Fluss?«, fragte Elvira, nachdem sie die Namensgleichheit bemerkt hatte. Karin wusste auch darüber Bescheid: »Sie hat den Namen Lavant als Pseudonym angenommen. Eigentlich hat sie Thonhauser geheißen, oder später Habernig, weil sie einen alten Maler mit diesem Namen geheiratet hat. Das Pseudonym Lavant hat ihr der erste Verleger vorgeschlagen. Sie hat nämlich in ihrer Jugend sehr kritische Texte über das Dorfleben geschrieben, und wollte nicht, dass man im Dorf erkennt, dass die Texte von ihr waren. Aber es hat ihr nichts genutzt, die Leute sind draufgekommen und haben sie dann noch mehr gehasst als vorher.«
Also das Mobbing hat sich später noch fortgesetzt, dachte Elvira. Was für ein Außenseiterschicksal, was für eine seltsame Person! Ob dieses Schicksal etwas mit dem Tod ihres späteren Verehrers Unterberger zu tun hatte?
Sie waren am Ufer der Lavant angekommen. Die Straße endete bei einem Sportplatz, der am späten Vormittag noch leer war. Eine kleine Brücke führte von hier aus ans andere Ufer. »Wir müssen noch ein Stück die Lavant hinaufgehen, dort ist das Wehr, wo er gefunden wurde«, meinte Karin. Als sie flussaufwärts gingen, nahm Elvira einen eigenartigen, undefinierbaren Geruch war. Er hatte etwas Dumpfes, Modriges, Abgestandenes. »Riecht die Lavant immer so?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete Karin. »Wahrscheinlich hat das was mit der Frantschacher Papierfabrik zu tun, die nördlich von Wolfsberg liegt. Früher soll ja das Wasser der Lavant schwarz gewesen sein, unterhalb der Fabrik. Das ist besser geworden, aber ganz sauber ist es halt noch nicht.«
Als sie beim Wehr anlangten, bekam Elvira eine leichte Gänsehaut bei dem Gedanken, dass hier ein Toter im Wasser getrieben war. Sie gingen über das Gemäuer, das sich wie eine Brücke über die Lavant spannte. »Da unten ist er gelegen«, sagte Karin und deutete direkt unterhalb ins Wasser. Vor der Wehranlage ging ein Bach – vielleicht ein ehemaliger Mühlbach – seitlich ab, der vom Hauptstrom der Lavant durch einen »Rechen« abgetrennt war. Dieser Hauptstrom sammelte sich in einem Auffangbecken, bevor er etwa drei Meter in die Tiefe stürzte. Dieses Becken wies am Ende eine ansteigende Betonkante auf, um Treibgut aufzufangen. Der Tote war, sozusagen als Treibgut, hier hängen geblieben. Elvira fragte sich, ob sein Körper hier oder schon weiter flussaufwärts ins Wasser geraten war.
»Und zwei Kinder haben die Leiche hier gefunden?«, wollte Elvira wissen. »Ja, zwei Buben, acht und zehn Jahre alt, hier aus der Stadt. Die wollten am Samstagvormittag Fußball spielen gehen. Vorher sind sie mit den Fahrrädern zur Lavant, dabei haben sie den Toten gefunden. Die haben einen totalen Schreck gekriegt, sind zu ihren Eltern nach Haus geradelt. Die sind dann selber nachschauen gegangen, weil sie den Kindern nicht geglaubt haben. Und sie haben am Ende die Polizei verständigt.«
»Kann man mit den Kindern reden?«, fragte Elvira.
»Nein, die Polizei hat es schon versucht. Die sind noch ganz verstört. Gewusst haben sie auch nichts.«
Elvira ging eine kleine steinerne Treppe hinab, die auf ein Mäuerchen direkt am Fluss führte. Zu ihren Füßen rauschte das Wasser. Für einen Fluss dieser Größe hat das Wasser eine ziemlich starke Strömung, dachte sie. Sie kam zur Vermutung, dass der Körper – durch Mord oder Selbstmord – weiter oberhalb in den Fluss geraten und rasch bis hierher abgetrieben worden war, um schließlich am Wehr hängen zu bleiben.
»Welche Polizei hat denn da ermittelt?«, war Elvira neugierig.
»Na, zuerst die Stadtpolizei, aber die ist vor allem mit Verkehrssachen beschäftigt. Bei Verdacht auf Mord oder Selbstmord wird die Kriminalpolizei von Klagenfurt angefordert. Die sind dann auch gekommen, mit der Spurensicherung.«
Eben dieser Inspektor Speckbacher, dachte Elvira, dem die Sache offenbar auf die Nerven ging. »Und die Spurensicherung, was hat die gefunden?« »Nichts!« – Diese Antwort Karins hatte Elvira schon im Voraus geahnt. »Nur dass die Leiche am ganzen Körper starke Abschürfungen hatte. Was nicht sein kann, wenn er hier ins Wasser gegangen wäre. Der Körper muss abgetrieben worden sein.« Elviras Vermutung wurde also bestätigt. »Wo ist die Leiche jetzt?«
»Im Kühlhaus der Bestattung in Wolfsberg, sie soll nächste Woche beerdigt werden.«
»Und hat’s eine Obduktion gegeben?« Elviras Fragen begannen der Kollegin sichtlich unangenehm zu werden. Sie seufzte tief auf und meinte: »Eine gerichtsmedizinische Abteilung hat es in Klagenfurt nie gegeben, wir haben ja auch keine medizinische Fakultät. Bei uns gibt es einen Gerichtsmediziner, der von der Polizei beauftragt wird. Und wenn die sich auf den Standpunkt stellt, dass ein Todesfall Selbstmord war, dann gibt es halt keine Obduktion. So ist das leider bei uns!«
Elvira schwieg konsterniert. Ermittlungen bei einem unklaren Todesfall ohne Obduktion? Wie sollte das gehen? War es den Kärntnern egal, wie ihre Toten gestorben waren? Hatte die Polizei kein Interesse an der Aufklärung der Todesursache?
Langsam verließen sie die Stelle, die offenbar nicht der Tatort gewesen war. Am Flussufer war es kühl geworden. Obwohl der Grund ihrer Anwesenheit nicht gerade appetitanregend war, merkte Elvira ein zunehmendes Hungergefühl. Sie fragte ihre Kollegin nach einem Gasthaus, wo sie Mittagessen konnten. »Fahren wir nach Wolfsberg. In St. Stefan hat es ein feines Restaurant gegeben, Zum alten Schacht. Leider hat es zugesperrt. Und ein guter Grieche war auch da, auch den gibt’s nicht mehr. Hier ist leider eine kulinarische Wüste!« Karin schien sich in der Gastronomie Kärntens gut auszukennen.
Nach Wolfsberg waren es knappe zehn Kilometer auf einer schnurgeraden Bundesstraße. Nach der Stadteinfahrt – wie nicht anders zu erwarten – waren auf beiden Seiten Firmen, große Geschäfte und Einkaufszentren aufgereiht. Vor dem Zentrum staute sich der Verkehr. Sie stellten das Auto auf einem großen Parkplatz am Rand der Altstadt ab und begaben sich zu einem »original Kärntner Gasthaus«, wie Karin ankündigte. Ungefähr die Hälfte der Geschäftslokale stand leer, wie Elvira beim Gang durch die Altstadt feststellte. Hier war die Situation noch trostloser als in Klagenfurt! Die Stadtplaner mit ihrer Favorisierung von Einkaufszentren hatten – wie überall in Österreich – ganze Arbeit geleistet, um die mittelständischen Unternehmen im Zentrum umzubringen.
Das Gasthaus Dobernig – Zum grauen Wolf, wie es auch hieß – war eine gemütliche Kärntner Gastwirtschaft mit einer urigen Wirtsstube. Obwohl Elvira solche Lokale wegen des meist in der Luft hängenden Zigarettenrauchs – der Nichtraucherbereich war vom Raucher meist nicht klar abgetrennt – nicht besonders mochte, sah es einladend aus. Der Wirt näherte sich etwas ungestüm und erkundigte sich nach ihren Wünschen. Als Elvira fragte: »Haben Sie auch etwas Vegetarisches?«, sah er sie kurz geringschätzig an. »Die Kasnudeln, unsere Spezialität.« Elvira schluckte, wenn sie an die kalorienreichen Nudeln in der zerlassenen Butter dachte, aber sie sagte: »Na gut, dann nehm ich die Kasnudeln.« Karin, die sich als Kärntner Nudel-Fan herausstellte, nahm das Gleiche. Es folgte ein Vortrag von ihr über die verschiedenen Arten von Nudeln, die die Kärntner Küche bereithielt – Spinatnudeln, Kürbisnudeln, Blunzennudeln, Wurstnudeln und vieles mehr. »Und bei den wirklich guten Nudeln ist der Rand handgekrendelt«, sagte sie mit leuchtenden Augen. Die Oma hatte die Nudeln noch so zubereitet, ihre Mutter hatte keine Zeit mehr dafür gehabt. »Und die Minze darf man nicht vergessen«, ergänzte sie. »Das ist eine spezielle Minze, Nudelminze sagt man auch dazu. Wächst nur bei uns in Kärnten.«
»Was ist ›gekrendelt‹?«, fragte Elvira. Karin überlegte einige Momente, wie sie das erklären sollte. »Das ist … das ist … wenn man die Nudeln am Rand verschließt und so ein Muster reinmacht. Schaut aus wie eine Schnur …«