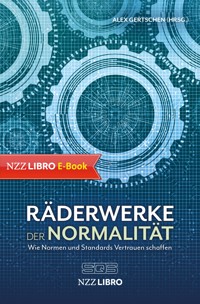
Räderwerke der Normalität E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Normen und Standards erleichtern es Unternehmen und anderen Organisationen, hohe Erwartungen zuverlässig zu erfüllen. Sie tragen so zu unserem Vertrauen in eine Normalität bei, die sich durch Qualität, Sicherheit und Komfort auszeichnet – und damit keineswegs «normal» ist. So nötig und wirksam Normen und Standards für eine arbeitsteilige und komplexe Gesellschaft sind, so gering ist das öffentliche Bewusstsein von ihnen. Deshalb gibt dieses Sachbuch erstmals einen Überblick über Normen- und Standardsysteme in der Schweiz. Aus einer historischen und aus einer zukunftsgerichteten Perspektive greift das Buch folgende Fragen auf: Warum und wie sind Normen und Standards in den letzten Jahrzehnten so bedeutsam geworden? Wie genau stiften sie ihren betriebswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen? Inwiefern können sie Innovation sowie Transformation behindern oder befördern – und welches Potenzial ergibt sich hieraus für eine nachhaltige Entwicklung? Journalistinnen, Wissenschaftler und weitere Experten geben Antworten anhand von Grundlagenartikeln sowie Fallbeispielen von Unternehmen und anderen Organisationen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RÄDERWERKE
DERNORMALITÄT
Wie Normen und Standards Vertrauen schaffen
Herausgegeben von Alex Gertschen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Text des E-Books folgt der gedruckten 1. Auflage 2023
(ISBN 978-3-907396-28-5)
© 2023 Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Managementsysteme (SQS), Zollikofen und NZZ Libro, Schwabe Verlagsgruppe AG, Basel
Lektorat: Dr. Gabriele Schweickhardt, Frankfurt
Korrektorat: Waldemar Wolf, Ludwigsburg
Umschlag: Grafik Weiss GmbH, Freiburg i. Br.
Gestaltung, Satz: Claudia Wild, Konstanz
Datenkonvertierung: Bookwire, Frankfurt a. M.
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werks oder von Teilen dieses Werks ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechts.
ISBN Print 978-3-907396-28-5
Das E-Book ist in folgenden Ausgaben erhältlich:
ISBN E-Book deutsch 978-3-907396-29-2
ISBN E-Book englisch 978-3-907396-60-5
ISBN E-Book französisch 978-3-907396-61-2
ISBN E-Book italienisch 978-3-907396-62-9
www.sqs.ch
www.nzz-libro.ch
NZZ Libro ist ein Imprint der Schwabe Verlagsgruppe AG.
Inhalt
Editorial
Norm und Normalität: eine Einführung
Kapitel 1Grundlagen:
Ordnung in einer komplexen und dynamischen Gesellschaft
1Das internationale Normensystem:Akteure, Prozesse und die Rolle der Schweiz
2Begriffe, Definitionen, Typen: ein Überblick
3Zertifizierung und Akkreditierung: ein System zur Prüfung von Anwendern und Prüfern
4Normen im historischen Wandel: vom Nebeneinander zum Miteinander auf den Strassen der Schweizer Städte und Agglomerationen
5Normen im Vergleich zu anderen Regelsystemen: das Beispiel des EFQM-Reifegradmodells
6Die ISO 9001: das Schweizer Taschenmesser des Qualitätsmanagements
7Das komplexe Zusammenspiel von Normierung und Innovation: Wie Stabilität und Wandel miteinander verbunden sind
Kapitel 2Fallbeispiele:
Wie Normen und Standards Organisationen besser machen und unseren Alltag prägen
8Nebenamtlich im Spitzenteam: Wie Normen die Kooperation zwischen Berufsfachschulen und Milizakteuren des Bildungssystems erleichtern
9Eines der besten Hotels will noch besser werden: der Balanceakt des Dolder Grand in Zürich zwischen normierter Qualität und individuellen Gästebedürfnissen
10«Verzichten Sie vorgängig auf die Rasur der Beine»: Der sichere Behandlungspfad ist in den Hirslanden-Kliniken standardisiert und zunehmend automatisiert
11Fertig gebaut ist nie: Implenias Betreuung künftiger Stockwerkeigentümer zeigt, wie Managementsystem-Normen zu einer besseren Dienstleistung führen können
12Ein gemütlicher Ausflug in ein raues Umfeld: Die Jungfraubahnen fahren seit 1912 Gäste ins Hochgebirge und überlassen dabei nichts dem Zufall
13Sicherheit und Gesundheit gehen vor: Wie das Bauunternehmen Lazzarini seine Mitarbeitenden bei der täglichen Arbeit schützt
14Mit hehren Motiven ist es nicht getan: Die ORS Gruppe hat für die Betreuung geflüchteter Menschen ein Qualitätsmanagementsystem aufgebaut
15Kultur in der Flasche: Das Rivella-Rezept besteht aus Normen, Vertrauen und vielen anderen Zutaten
16Von Interlaken nach Hamburg: Wie eine sichere und komfortable Zugfahrt zur Norm wird
17Standards als Schlüssel und Schrauben: Sie öffnen der SFS Group Türen und halten das Unternehmen zusammen
18Was ist schon normal? Die Paraplegiker-Stiftung pflegt einen kritischen und pragmatischen Umgang mit Normen
Kapitel 3Nachhaltige Entwicklung:
Bedeutung und Potenzial von Normen und Standards
19Transnationale Gouvernanz für nachhaltige Entwicklung: eine Ordnung für das Erdzeitalter des Menschen
20Standards für eine nachhaltige Unternehmensführung: Entstehung, Analyse und ein Lösungsansatz
21Normierung für transformative Innovation? Chancen und Risiken anhand des Fallbeispiels der ISO 30500 für netzunabhängige Sanitärsysteme
22Zur Rolle des Staats: «Wir können viel davon lernen, wie Qualitätsanforderungen in der Wirtschaft durchgesetzt wurden»
Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
Nachwort und Dank
Editorial
Geschätzte Leserin, geschätzter Leser
Normen und Standards prägen die Art und Weise, wie wir Güter und Dienstleistungen produzieren – und damit auch, wie wir konsumieren. Sie fördern Qualität, Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit, erleichtern die Kooperation und tragen so zum Vertrauen in unserer Gesellschaft bei.
Das Normensystem in der Schweiz besteht aus einer Vielzahl von Akteuren. Da sind zunächst die Normen- und Standardentwickler, unter denen die Internationale Organisation für Normung (ISO) die wichtigste ist. Die Schweizerische Normen-Vereinigung vertritt die Schweiz bei der ISO und dient allgemein als Scharnier zwischen dem nationalen und dem internationalen Normensystem. Die privaten Zertifizierungsgesellschaften überprüfen die Anwender der Normen und werden ihrerseits durch die staatliche Schweizerische Akkreditierungsstelle überwacht. Dieses System stellt für die hiesigen Unternehmen eine Infrastruktur dar, die es ihnen erlaubt, sich stetig weiterzuentwickeln, in der Weltwirtschaft zu behaupten und so zu unserem Wohlstand beizutragen.
Die praktische Bedeutung des Normensystems kontrastiert mit seiner Unscheinbarkeit. Einer breiten Öffentlichkeit ist es entweder nicht bekannt oder kaum verständlich – was angesichts seiner Komplexität nur allzu verständlich ist. Dieses Buch soll Abhilfe schaffen, indem es die historische Entwicklung und heutige Funktionsweise des Normensystems erklärt sowie aufzeigt, wie Normen und Standards die nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft unterstützen (können).
Die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) ist eine Schlüsselakteurin des Normensystems in der Schweiz. Sie wurde 1983 von Wirtschaftsverbänden und Vertretern des Bunds als weltweit zweite Zertifizierungsgesellschaft für Managementsysteme gegründet, um Qualität, Entwicklung und internationale Vernetzung der hiesigen Unternehmen zu fördern. Wir trugen massgeblich zur Entwicklung eines internationalen Systems bei, das mittels Normen und Zertifizierungen eine gemeinsame «Sprache» stiftet, technische Handelshindernisse sowie allgemein Transaktionskosten verringert, und wir verstehen uns noch heute als Unternehmen im Dienst der Schweizer Wirtschaft und Gesellschaft. Zu unseren über 9000 Kundinnen und Kunden gehören Unternehmen, Behörden, Verbände und andere Organisationen, global tätige Konzerne ebenso wie Mikrounternehmen mit einer Handvoll Angestellten.
Wir bewerten, auditieren und zertifizieren Organisationen nach Managementsystem- sowie zahlreichen anderen Normen und Standards. Der Nutzen dieser Dienstleistungen wirkt gegen innen und aussen. Zum einen entwickeln und verbessern sich unsere Kunden stetig weiter, indem sie sich im Dialog mit uns spiegeln. Zum anderen verschaffen wir Gewissheit, welchen Reifegrad eine Organisation bezüglich eines Standards erreicht, oder ob sie die Anforderungen einer bestimmten Norm erfüllt. So tragen wir zur Orientierung, Entwicklung und Glaubwürdigkeit unserer Kunden sowie zum Vertrauen in deren Umfeld bei – mit positiven Auswirkungen in die weitere Gesellschaft hinaus.
Unser Ansatz ist systemisch, umfassend und auf kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet. Wir nehmen in unseren Bewertungen und Audits stets das grosse Ganze in den Blick. So schauen wir auch auf unsere eigene Arbeit und Funktion. Deshalb publizieren wir zu unserem 40-jährigen Bestehen keine SQS-Chronik. Stattdessen zeigt dieses Buch mittels vielfältiger Grundlagenartikel und Fallbeispiele den Wert der SQS indirekt auf, im Kontext des gesamten Normensystems. Damit verbinden wir den Anspruch, dieses System auch weiterhin zu unterstützen, zu prägen und für eine nachhaltige Entwicklung nutzbar zu machen.
Das grosse Ganze im Blick zu behalten, darf nicht bedeuten, den einzelnen Menschen aus dem Auge zu verlieren. Normen und Systeme sind kein Selbstzweck, sondern Instrumente für ein besseres Zusammenleben. Deshalb widmen wir dieses Buch all jenen, die mit ihrem Einsatz für die SQS dazu beitragen, dass sich in der Schweiz die «Räderwerke der Normalität» drehen und Vertrauen schaffen.
Andrea Grisard, Präsidentin
Felix Müller, CEO
Norm und Normalität:eine Einführung
Normen und Standards erleichtern es Unternehmen sowie anderen Organisationen, hohe Erwartungen zuverlässig zu erfüllen. Sie tragen so in der Schweiz zu einer Normalität bei, die alles andere als normal ist. Zugleich dürfen sie nicht nur der Gewährleistung des Status quo dienen: Normen und Standards müssen als Instrumente für eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft genutzt werden.
Von Alex Gertschen
Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und treten auf die Bremse – und das Auto bremst. Mehr noch: Es bremst sachte und energieeffizient.
Stellen Sie sich vor, Sie nehmen die Eisenbahn – und kommen an. Mehr noch: Sie haben unterwegs den Anschlusszug erwischt und sind sicher und komfortabel weitergereist. Womöglich bis ins Hochgebirge.
Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich ausbilden – und lernen Nützliches. Mehr noch: Sie erwerben angewandtes und abstraktes Wissen, das Ihnen vielfältige berufliche Perspektiven eröffnet.
Stellen Sie sich vor, Sie lassen sich operieren – und werden wieder ganz gesund. Oder Sie werden nie wieder ganz gesund, erhalten aber die Unterstützung, um einen Weg zurück in ein lebenswertes Leben zu finden.
Stellen Sie sich vor, Sie nehmen einen Schluck aus der Flasche – und das Süssgetränk schmeckt genauso lecker, wie Sie es erwartet haben. Mehr noch: Wie Millionen von anderen Konsumentinnen und Konsumenten es vor Ihnen erwartet und bestätigt erhalten haben.
Stellen Sie sich vor, Sie stellen ein Produkt «Swiss made» her – und die ganze Welt fragt es nach. Mehr noch: Das Produkt wird nachgefragt, obwohl es um ein Vielfaches teurer ist als (vermeintlich) vergleichbare.
Keine dieser Situationen und Konstellationen löst bei Ihnen grössere Verwunderung aus? Natürlich nicht! Sie alle wirken auf Bewohnerinnen und Bewohner in der Schweiz ziemlich selbstverständlich. Dabei ist diese – unsere – Normalität alles andere als normal im Sinn von voraussetzungslos. Die erwähnten Beispiele beziehen sich auf Unternehmen und andere Organisationen, die in diesem Buch porträtiert werden und sich Tag für Tag dafür einsetzen, dass unsere hohen Erwartungen punkto Qualität, Sicherheit, Komfort, Wohlstand oder Lebensperspektiven erfüllt werden.
Während auf der Bühne des Alltags unsere Normalität verlässlich aufgeführt wird, wirkt hinter den Kulissen ein internationales System von Normen und Standards, das das Schauspiel anleitet und gewährleistet. Dieses System gibt Organisationen Orientierung, indem es aufzeigt, was als «Stand der Technik» eingefordert wird; es stellt Instrumente zur Verfügung, mit denen diese Anforderungen erfüllt werden können; und es enthält Prüfungs- und Zertifizierungsmechanismen, die für Glaubwürdigkeit und Vertrauen sorgen. Für welche Bereiche des Wirtschaftslebens gibt es Normen und Standards? Wie und durch wen werden sie entwickelt? Wie und warum werden sie so wirkungsvoll angewendet? Anhand dieser Leitfragen werden im Buch zentrale Regelwerke des Systems als Räderwerke unserer Normalität vorgestellt.
Eine Konstellation, die ebenfalls aufgegriffen wird, fehlt noch. Stellen Sie sich vor, wir alle leben ein ganz normales Leben – und zerstören dabei dessen natürliche Grundlagen. Mehr noch: Wir wissen, dass wir anders produzieren und konsumieren müssen, um die Erde in ihrem menschenfreundlichen Gleichgewicht zu halten, doch findet kein entsprechender Wandel statt. Das Buch thematisiert auch diese alltägliche Normalität und verbindet damit die Frage: Was für Normen und Standards können eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft unterstützen?
Normen und Standards als Voraussetzung und Ergebnis menschlichen Zusammenlebens
Normen und Standards beschreiben Normalität als Regel und Regelmässigkeit. Sie treffen Aussagen darüber, was für Situationen und Handlungen wahrscheinlich sind. Darüber hinaus stabilisieren und reproduzieren sie Normalität, indem sie vorgeben, wie man sich verhalten, was man tun sollte. Das ist ganz praktisch zu verstehen: Normen und Standards speichern Erfahrungswissen. Sie geben an, welche Handlungsweisen, Verfahren oder Techniken sich in bestimmten Situationen für bestimmte Zwecke bewährt haben. In der Form terminologischer Definitionen oder physikalischer Masseinheiten wiederum stellen Normen und Standards eine Sprache zur Verfügung, damit diese Regeln und Regelmässigkeiten überhaupt allgemein verständlich benannt werden können.
Auch wenn die beiden Begriffe auf Deutsch fast synonym verwendet werden: Es gibt Unterschiede. Normen werden unter Einbezug möglichst aller interessierten Parteien entwickelt. Hieraus erklärt sich ihr quasiöffentlicher Charakter und ihre breite Akzeptanz. Standards hingegen werden eher durch einen oder wenige marktmächtige Akteure gesetzt und durchgesetzt. Im Englischen wird deswegen zwischen «public standards» (Normen) und anderen Standards unterschieden. Aufgrund ihrer Entstehung haben Normen im deutschen Sprachgebrauch nicht selten eine moralische Qualität. Ihre Anforderungen zu erfüllen, ist «richtig». Wer sie missachtet, muss dies rechtfertigen. Standards geht diese Qualität ab.
Indem Normen und Standards Situationen oder Handlungen erwartbar machen und legitimieren, wird unser Zusammenleben einfacher und angenehmer. Wir können uns auf etwas Bestimmtes einstellen und müssen uns nicht mit tausend möglichen Szenarien auseinandersetzen. Vertrauen in die Normalität bedeutet, dass uns die offene Zukunft nicht als Gefahr begegnet. Es ist nicht unmöglich, aber unwahrscheinlich, dass mein Aufenthalt im Spital nicht zur Genesung führt; dass ich einen Unfall erleide, weil die Autobremse versagt; dass ich in der Berufslehre Kompetenzen erwerbe, die mir keine Erwerbstätigkeit ermöglichen; oder dass der Schluck aus einer Getränkeflasche mit einer Lebensmittelvergiftung endet. Ja, der Zug kann durchaus einige Minuten verspätet sein. Dass dies in der Schweiz bereits als erheblicher Verstoss gegen die Norm gilt, sagt auch einiges über unsere Normalität aus.
Normen prägen unsere Wahrnehmung. Deshalb fallen sie uns meist erst dann auf, wenn wir uns ausserhalb unserer Normalität bewegen: zum Beispiel im angelsächsischen Raum, wo mit Inches und Fuss gerechnet wird, statt mit dem metrischen System; oder in Ländern mit einem anderen Zeitverständnis, wo wir «pünktlich» zur Verabredung eintreffen und alle anderen mit ewig scheinender «Verspätung». Normen verändern sich entlang von Gesellschaften, Generationen, sozialen Milieus, Familien und Organisationen. Sie hängen von Gruppen ab und Gruppen von ihnen. Erst wenn sich Menschen auf gewisse Normen und Vorstellungen des Erwartbaren und Akzeptierten einigen, werden sie ein Kollektiv. Tatsächlich entstanden Normen und Standards in ihrer allgemeinsten Form – als Regeln des Zusammenlebens – mit den ersten menschlichen Gesellschaften, die die Arbeiten im Alltag aufzuteilen begannen und dafür soziale Rollen mit bestimmten Aufgaben und Kompetenzen schufen und miteinander koordinierten.
Thematischer Fokus und Struktur des Buchs
Der Fokus dieses Buchs liegt auf jenen formalisierten Normen und Standards, die die Art und Weise prägen, wie Unternehmen und andere Organisationen funktionieren, sich entwickeln, miteinander kooperieren und damit unsere hohen Anforderungen als Bürgerinnen und Konsumenten erfüllen. Viele von ihnen sind im Schweizer Normenwerk verknüpft, das rund 27 000 Normen zählt und seinerseits Teil eines europäischen und weltweiten Systems ist. Zu diesen Regeln gehören insbesondere die Normen der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und branchenspezifische wie jene des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (Bauwesen) oder von HotellerieSuisse (Hotelklassifikation).
Informelle gesellschaftliche Normen hingegen werden nur insofern berücksichtigt, als sie unsere Präferenzen und Ansprüche als Bürger und Konsumentinnen beeinflussen. Staatlich festgelegte und durchgesetzte Regeln werden ausschliesslich in ihrer Wechselwirkung mit Normen und Standards thematisiert. Letztere werden im Gegensatz zu Gesetzen oder Verordnungen von privaten Akteuren entwickelt, weshalb sie formell freiwillig sind. Im besten Fall ergänzen und unterstützen sich staatliche Regeln («Hard Law») und private Regeln («Soft Law») gegenseitig (vgl. Schaubild unten).
Dieser Fokus lässt sich wie folgt erklären. Das internationale Normensystem hat sich seit den 1980er-Jahren enorm entwickelt – aus ähnlichen Gründen, aus denen einst die ersten Normen und Standards entstanden waren: Im Zuge der Globalisierung bedurfte es neuer Regeln für die Arbeitsteilung und Koordination zwischen zahlreichen Marktteilnehmern, die sich nicht oder kaum kannten; es bedurfte eines gemeinsamen Verständnisses dessen, was gegenseitig erwartet werden durfte, und der Prüf- und Nachweismechanismen, um diese Anforderungen durchzusetzen. Nur so konnte das Vertrauen geschaffen werden, das für eine komplexe, sich immer weiter ausdifferenzierende Wirtschaft so wichtig ist wie die Luft zum Atmen. Dieses System wirkt mittlerweile in praktisch alle Länder und in alle Bereiche unseres Alltags hinein, doch kontrastiert die praktische Relevanz mit seiner Unscheinbarkeit, mit der Tatsache, dass die breite Öffentlichkeit von ihm kaum Notiz genommen hat.
Anerkannte Normen werden partizipativ sowie transparent entwickelt und sind frei anwendbar. Deshalb sind sie zugänglicher und verbindlicher als andere private Regeln. (Quelle: SNV)
Ein weiterer Grund dafür, das Augenmerk auf diese Normen und Standards zu legen, hat mit ihrem Potenzial für eine nachhaltige Transformation zu tun. Zu deren Herausforderungen gehört, dass sie in einer Weltwirtschaft ohne Weltstaat und unter erheblichem Zeitdruck stattfinden muss. Es gibt keinen staatlichen Akteur, der allgemein verbindliche Regeln festlegen und durchsetzen kann. Und wir haben relativ wenig Zeit, um lokal angepasste und global wirksame Lösungen zu finden, um die planetaren Ressourcen und Senken nicht zu überfordern und so das Erdsystem im Gleichgewicht zu halten. Privaten Regeln, die partizipativ, praxisnah und wirkungsorientiert entwickelt werden, kommt in diesem Kontext eine besondere Bedeutung zu.
Schliesslich prägt auch die Herausgeberin, die Schweizerische Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS), den thematischen Fokus. 1983 als weltweit zweite Zertifizierungsstelle für Qualitätssicherungssysteme gegründet, war sie sowohl ein «Kind» als auch eine treibende Kraft des internationalen Normensystems. Noch heute ist sie in der Schweiz die führende Anbieterin von anspruchsvollen Zertifizierungen. Zudem wirkt sie in der Entwicklung, Anwendung und Überprüfung von Standards mit, die Unternehmen und andere Organisationen bei ihrer nachhaltigen Transformation unterstützen.
Die Gründe für die inhaltlichen Schwerpunkte spiegeln sich in der Struktur des Buchs. Das erste Kapitel widmet sich den Grundlagen: der historischen Entwicklung und heutigen Funktionsweise des internationalen Normensystems; dem Unterschied zwischen Normen und Standards wie dem Reifegradmodell der European Foundation for Quality Management sowie den Akteuren und Pfadabhängigen, die die Entwicklung und den Wandel von Normen und Standards beeinflussen. Diese Artikel sind von Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft und der Praxis geschrieben worden. Das zweite Kapitel schildert anhand von elf Fallbeispielen aus dem Kundenkreis der SQS, wie sich Unternehmen und andere Organisationen in der Anwendung von und Auseinandersetzung mit Normen am Markt behaupten und ständig weiterentwickeln. Diese Texte sind grösstenteils von Journalistinnen und Journalisten verfasst worden. Die Beiträge des dritten Kapitels, das sich der Frage widmet, welcher Normen und Standards es für eine nachhaltige Transformation unserer Gesellschaft bedarf, stammen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Sechs Interpretationen zu Relevanz und Potenzial von Normen und Standards
Die zentrale Aussage des Buchs ist im Titel enthalten: Normen und Standards erleichtern es Unternehmen und anderen Organisationen, hohe Erwartungen zuverlässig zu erfüllen. Sie tragen so zu unserem Vertrauen in eine aussergewöhnliche Normalität bei. Anhand der einzelnen Beiträge lassen sich von dieser Grundaussage ausgehend sechs weitere Interpretationen entwickeln.
1.Normen und Standards sind entscheidend für den Wohlstand in der Schweiz. Einerseits ermöglichen oder erleichtern sie die Präsenz hiesiger Unternehmen auf bzw. in internationalen Märkten und Wertschöpfungsketten. Andererseits sind sie Instrumente, die zur Qualität, Funktionalität, Sicherheit und Verlässlichkeit von Gütern und Dienstleistungen «Swiss made» beitragen – und damit zu einer globalen, zahlungskräftigen Nachfrage. Der Grundlagenartikel «Das komplexe Zusammenspiel von Normierung und Innovation» (Kapitel 1) und das Fallbeispiel der SFS Group (Kapitel 2) zeigen, dass Normen und Standards selbst zu Innovationen beitragen können, die für die Schweiz so wichtig sind.
2.Normen und Standards sind grundsätzlich gerade für eine offene KMU-Wirtschaft wertvoll. Im Kontext einer globalisierten Arbeitsteilung und Spezialisierung stehen kleine und mittelgrosse Unternehmen (KMU) vor besonderen Herausforderungen. Sie sehen sich vonseiten der Kundschaft, zahlreicher Staaten und vielfältiger weiterer Anspruchsgruppen komplexen Anforderungen gegenüber. Managementsystem-Normen helfen, diese Komplexität auf ein bewältigbares Mass zu reduzieren. Zudem bewirken grössere Märkte einen Druck hin zu grösseren Unternehmen. Indem Normen und Standards die Zusammenarbeit zwischen den Marktteilnehmern erleichtern, lindern sie den Druck zur Konzentration und organisatorischen Integration. Sie können jedoch auch den gegenteiligen Effekt haben und KMU aus dem Markt verdrängen: dann nämlich, wenn sie zu wenig partizipativ entwickelt wurden und KMU überfordern, aber dennoch zum Beispiel in öffentlichen Ausschreibungen oder von privaten Grosskunden zu einer Anforderung für Zulieferer gemacht werden.
3.Normen und Standards unterstützen das schweizerische Milizsystem. Die unkomplizierte Zusammenarbeit in kleinteiligen und oft wenig finanzkräftigen Strukturen ist auch ein Merkmal des hiesigen Milizsystems. Dessen Grundgedanke ist es, dass dazu befähigte Bürgerinnen und Bürger neben- oder ehrenamtlich öffentliche Ämter und Aufgaben übernehmen können und sollen. Entsprechend gross ist der Koordinationsaufwand. Die Beispiele des Schweizerischen Verbands der Strassen- und Verkehrsfachleute (Kapitel 1), der Berufsschule Aarau und des Bildungszentrums Interlaken (Kapitel 2) zeigen, dass Normen und Standards Instrumente sind, um diesen Aufwand zu reduzieren und so das Milizsystem zu stützen.
4.Vertrauen ist gut, Audits sind besser. Der Zweck der Zertifizierung ist es, mittels Kontrollen und glaubwürdigen Nachweisen zwischen Marktteilnehmern Vertrauen zu schaffen. Oft sind Zertifikate eine Voraussetzung dafür, dass Unternehmen überhaupt als Zulieferer infrage kommen. Praktisch alle Fallbeispiele verweisen auf einen weiteren, oftmals wichtigeren Nutzen der Zertifizierung: Die Audits dienen sowohl der Kontrolle als auch dem Dialog, in den die Auditierenden die Erfahrung und die Erkenntnisse aus Hunderten, wenn nicht Tausenden von Organisationsbesuchen einbringen. Die Geprüften nutzen diese Aussensicht für eine Standortbestimmung und die ständige Weiterentwicklung der Organisation.
5.Der Staat ist für die Wirksamkeit privater Regeln zentral. Die Wirksamkeit des internationalen Normensystems beruht nicht zuletzt auf seiner Fähigkeit, Glaubwürdigkeit und Vertrauen zu schaffen. Der Artikel zur Zertifizierung und Akkreditierung (Kapitel 1) zeigt, dass der Staat hierfür eine wichtige Rolle spielt, indem er die privaten Prüfer der Normanwender – zum Beispiel Zertifizierungsstellen wie die SQS – seinerseits prüft. Im Fall der Schweiz geschieht dies durch die beim Staatssekretariat für Wirtschaft angegliederte Akkreditierungsstelle SAS. Auch das Interview zu den Wechselwirkungen zwischen Hard Law und Soft Law sowie der Artikel zu Standards für eine nachhaltige Unternehmensführung (Kapitel 3) machen deutlich, dass der Staat Normen und Standards mit gezielten Anreizen unterstützen muss, sollen diese die notwendige Wirkung für eine nachhaltige Transformation entfalten.
6.Normen und Standards können Wandel behindern und bewirken. Wandel entsteht durch die Entwicklung und breite Anwendung neuer Lösungen. Normierung ist gemeinhin dafür bekannt, die breite Anwendung einer bestimmten Lösung als «Stand der Technik» zu fördern. Mehrere Grundlagenartikel (Kapitel 1 und 3) zeigen auf, dass sie aber auch zu Innovation beitragen kann, indem sie den Wettbewerb in Bezug auf neue Lösungen steuert – weg von den normierten Fragen, hin zu jenen, für die noch viele Ansätze zugelassen werden. Die Gretchenfrage ist natürlich: Was soll (nicht) normiert werden, damit wir möglichst rasch möglichst effektive Lösungen für eine nachhaltige Transformation entwickeln und anwenden?
Einführende Literatur
Assmann, Heinz-Dieter; Baasner, Frank; Wertheimer, Jürgen (Hrsg.): Normen, Standards, Werte – was die Welt zusammenhält, Baden-Baden 2012.
Baberowski, Jörg (Hrsg.): Was ist Vertrauen? Ein interdisziplinäres Gespräch. Frankfurt am Main 2014.
Berghoff, Hartmut: Die Zähmung des entfesselten Prometheus? Die Generierung von Vertrauenskapital und die Konstruktion des Marktes im Industrialisierungs- und Globalisierungsprozess, in: ders./Jakob Vogel (Hrsg.): Wirtschaftsgeschichte als Kulturgeschichte. Dimensionen eines Perspektivenwechsels. Frankfurt am Main / New York 2004, S. 143–168.
Busch, Lawrence: Standards. Recipies for Reality, Cambridge/MA 2011.
Forst, Rainer; Günther, Klaus (Hrsg.): Die Herausbildung normativer Ordnungen. Interdisziplinäre Perspektiven. Frankfurt am Main 2011.
Frevert, Ute: Vertrauensfragen. Eine Obsession der Moderne. München 2013.
Loconto, Allison; Stone, John V.; Busch, Lawrence: Tripartite Standards Regime, in: The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Globalization, Chichester 2012.
Yates, JoAnne; Murphy, Craig N. (Hrsg.): Standards and the Global Economy, Business History Review, 96 (2022), 1.
Kapitel 1Grundlagen:
Ordnung in einer komplexen und dynamischen Gesellschaft
1Das internationale Normensystem:Akteure, Prozesse und die Rolle der Schweiz
Die Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV) ist im Auftrag des Bunds für das hiesige Normenwerk verantwortlich. Dieses zählt 27 000 Einträge, Tendenz steigend. SNV-Geschäftsführer Urs Fischer sagt im Interview, wie und durch wen diese Normen entwickelt werden. Und warum sie heute – im Gegensatz zu früher – nicht der Abschottung, sondern der Integration der Märkte und Volkswirtschaften dienen.
Interview und Text von Alex Gertschen
Urs Fischer, finden Sie Normen und Standards interessant?
Ich finde sie vor allem praktisch! Ich machte in den 1970er-Jahren eine Lehre als Maschinenmechaniker bei Contraves, anschliessend arbeitete ich als Flugzeug- und Triebwerkmechaniker des Hunters und Triebwerkmechaniker des Tigers [zwei damalige Flugzeugtypen der Schweizer Luftwaffe, Anm. d. Red.]. Es war unglaublich, was für einen Werkzeugsatz ich benötigte! Jede Firma, die einen Teil des Flugzeugs gebaut hatte – das Triebwerk, die Flügel und so weiter – verwendete eigene Schraubentypen, die spezielle Werkzeuge erforderten. Das ist heute nicht mehr so, weil es eine entsprechende Norm gibt: die ISO 1502:1996 «ISO general-purpose metric screw threads». Es gibt unzählige Beispiele dafür, wie die Normung die Interoperabilität ermöglicht und so die wirtschaftliche Zusammenarbeit erleichtert.
Wie ist es zu dieser internationalen Normung gekommen?
Sie ist Ausdruck veränderter politischer Absichten. Im 19. Jahrhundert und noch bis ins 20. Jahrhundert hinein machten die Staaten Normen, um ihre Hersteller vor ausländischer Konkurrenz zu schützen. Normen waren protektionistische Instrumente. Das hat sich um 180 Grad verändert. Wir wollen heute über Normen technische Handelshindernisse abbauen.
Wer sind «wir»?
Die Welthandelsorganisation WTO ist sicherlich zentral. Sie hat im Jahr 2000 sechs Prinzipien für die Entwicklung von internationalen Standards, Leitfäden und Empfehlungen erarbeitet, die der internationalen Zusammenarbeit und wirtschaftlichen Integration dienen. Die drei massgeblichen internationalen Normentwickler – die Internationale Organisation für Normung (ISO), die Internationale Elektrotechnische Kommission (IEC) und die Internationale Fernmeldeunion (ITU) – haben sich zu diesen Prinzipien bekannt. Als Mitglied dieser Organisationen haben auch wir von der SNV uns zu diesen Prinzipien verpflichtet.
Die Schweizerische Normen-Vereinigung hat vom Bund den Auftrag, die Schweiz mit dem internationalen Normensystem zu verknüpfen. (Quelle: SNV)
Energie- und Informationstechnik
Das bedeutet, dass es immer weniger schweizerische Normen gibt?
Die SNV ist über die Notifikationsverordnung des Bunds die benannte Stelle, die für das Normenwerk in der Schweiz zuständig ist. Früher bedeutete das tatsächlich auch die Entwicklung von rein nationalen Normen. Heute sehen wir unsere Rolle eher als Input-Geberin für die Entwicklung von Normen durch die ISO, die IEC und die ITU. Von den knapp 27 000 Normen des Schweizer Normenwerks sind nur rund 600 von nationalen Organisationen erlassen worden. Alle anderen haben wir übernommen. Dadurch haben sie den Status einer Schweizer Norm.
Ist die Schweiz mit dieser Praxis eine Ausnahme?
In den Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) [einem Klub relativ reicher Volkswirtschaften, Anm. d. Red.] verfolgen alle das Modell des Stakeholder Engagements. In anderen Ländern nehmen die Regierungen wesentlich mehr Einfluss, entsprechend höher ist der Anteil rein nationaler Normen.
Ist das nicht ein Verlust von Eigenständigkeit?
In der heutigen Zeit gibt es einfach viele Dinge, die man global regeln muss. Nationale Alleingänge bringen nichts.
Gilt das für Schrauben ebenso wie für soziale oder ökologische Themen?
Für ESG-Themen [Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung, Anm. d. R.] gilt das erst recht! Die Erwartung wird stärker und zunehmend auch vom Gesetzgeber aufgenommen, dass gewisse ESG-Anforderungen weltweit erfüllt werden.
Im Kapitel 3 dieses Buchs gehen wir auf die Bedeutung und das Potenzial von Normen und Standards für eine nachhaltige Unternehmensführung und Entwicklung ein. Ein Problem dabei: Es gibt eine fast unüberblickbare Anzahl von wenig oder nicht integrierten Regelwerken.
Das stimmt. Bei den technischen Normen haben wir es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, eine in sich geschlossene «Familie» zu schaffen, ein integriertes, kohärentes und weltweit akzeptiertes System. Bei anderen Normen, gerade solchen im ESG-Bereich, sind wir noch nicht so weit.
Quelle: SNV, Januar 2023
Das Schweizer Normenwerk umfasst fast 27 000 Normen. Sie sind eingeteilt in die Bereiche Metall und Maschinen (vertreten durch den Verband Swissmem), Architektur- und Ingenieurwesen (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein), Elektrotechnik (Electrosuisse), Strassen und Verkehr (Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute), Uhren (FH), Telekommunikation (asut) und Interdisziplinäres (direkt durch die SNV vertreten).
Das System für technische Normen ist wie eine Pyramide, an deren Spitze ISO, IEC und ITU stehen. Lässt sich die komplexe Gouvernanz für nachhaltige Unternehmensführung und Entwicklung ebenfalls so formen?
Das wird uns wohl nicht gelingen. Wichtig ist einfach, dass wir die Kohärenz stärken und so eine globale Marktdurchdringung erreichen. Denken Sie daran: Die ISO befasst sich seit Langem nicht mehr nur mit Schrauben! In den 1980er-Jahren kamen die Managementsysteme hinzu, später Themen wie die Umwelt, Corporate Social Responsibility, Cybersecurity, Künstliche Intelligenz, Blockchain etc.
Sie sehen die ISO also in der Führungsrolle, um auch für die nachhaltige Unternehmensführung und Entwicklung ein kohärentes internationales Normensystem zu formen?
Auf jeden Fall. Und sie nimmt diese Rolle auch schon wahr, indem sie eng mit UN-Organisationen wie der Internationalen Arbeitsorganisation und anderen relevanten Akteuren kooperiert. Sie ist dafür gut aufgestellt.
Wie meinen Sie das?
Das internationale Normensystem funktioniert aus drei Gründen. Erstens ist es partizipativ, es werden alle interessierten Stakeholder zugelassen. So stellen wir sicher, dass Ideen von vielen Akteuren einfliessen und dann auch breit angewendet werden. Als ich 2001 bei der SNV anfing, hiess es: Mit Umweltschützern setzen wir uns nicht an einen Tisch! Ich sagte: Doch, das müssen wir! Heute ist das selbstverständlich. Zudem ist es der ISO wichtig, dass auch Entwicklungsländer am Normungsprozess teilnehmen. So entsteht ein breit abgestützter Konsens.
Und zweitens?
Das Normensystem funktioniert transparent und demokratisch. «One country, one vote», lautet die Regel. Zuerst entwerfen eine ad hoc zusammengesetzte Arbeitsgruppe sowie das für den Normenbereich zuständige ISO-Komitee eine Norm. Dann gibt es eine offene Anhörung, in der sich alle Stakeholder zum Entwurf äussern können. Anschliessend wird die Norm gegebenenfalls überarbeitet, fertiggestellt und der Abstimmung durch die ISO-Mitgliedstaaten zugeführt.
Und drittens?
Jede Norm wird alle fünf Jahre überprüft und, wenn nötig, aktualisiert. Dadurch vermeiden wir Normen, die nicht mehr effektiv, effizient oder schlicht nicht mehr nötig sind.
Wie eine Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO) entsteht. Der Prozess zur Entwicklung europäischer Normen durch das Europäische Komitee für Normung (CEN) verläuft analog. (Quelle: SNV)
Das klingt fast zu gut, um wahr zu sein. Interessen und Macht spielen keine Rolle?
Doch, natürlich, es geht letztlich immer auch ums Business. Wenn jemand seine Normen oder Standards durchsetzt, beherrscht er den Markt. Deshalb braucht es die ISO, die IEC und die ITU. Proprietäre Normen, die das Eigentum eines Privaten sind, halten ohnehin oft nicht lange. Aber klar, es gibt wichtige Ausnahmen.
Wie wichtig ist der Zeitfaktor?
Sehr wichtig! Die ISO wird immer wieder aufgefordert, ihre Prozesse zu beschleunigen, gerade wenn es um Normen im Hightechbereich geht. Ich wehre mich dagegen. Natürlich kann man eine Norm schnell in drei Tagen schreiben! Aber nur der partizipative und demokratische Prozess führt zu breit akzeptierten und angewandten Normen. Und der braucht seine Zeit. ISO-Normen ermöglichen globale Interoperabilität, Effizienz und haben eine hohe demokratische Legitimation. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal.
Wie macht China in diesem demokratischen Prozess mit?
China hat das Potenzial und die Wirkung von Normen erkannt und versucht, dies konsequent für sich zu nutzen. Da der Prozess für alle offen ist, wird er durch jene geprägt, die sich am meisten einbringen. Die Chinesen stellen in den Arbeitsgruppen, die die Normen im embryonalen Stadium entwickeln, eine sehr grosse Anzahl von Sachverständigen. Das ist möglich, weil Sachverständige offiziell nicht ein Land vertreten, sondern kraft ihrer Kompetenz und ihres Interesses mitwirken. Zudem bringt China neue Vorschläge für Normen in einer Kadenz ein, die für die anderen fast nicht zu bewältigen ist. Es hält sich stets an die Regeln und nimmt über die schiere Masse Einfluss.
Obwohl demokratisch aufgebaut, kann die ISO von wenigen dominiert werden?
Die Ressourcen spielen tatsächlich eine wichtige Rolle. Die Schweizer, die Deutschen und die anderen, die uns ähnlich gesinnt sind, müssen wieder verstärkt in diese Arbeitsgruppen gehen. Die Bereitschaft dazu hat nachgelassen, obwohl Schweizer Sachverständige eine sehr gute Reputation haben. Sie gelten als kompetent, zuverlässig und anständig. Und sie verstehen demokratische Prozesse.
Was bedeutet es für die Schweiz, dass ISO, IEC und ITU allesamt ihren Sitz in Genf haben?
Das ist zunächst für das Normensystem ein Riesenvorteil, weil so die Koordination und Kooperation erleichtert wird. Die Schweiz hat dadurch aber nicht mehr Einfluss. Sie ist ein gewöhnliches Mitglied, und das soll auch so sein.
Wer die Normen entwickelt
Die Internationale Organisation für Normung wurde 1947 gegründet. Ihre Abkürzung ISO stammt vom griechischen Wort «isos», was «gleich» bedeutet. Sie wurde als neutrale Abkürzung gewählt, weil der Organisationsname in den verschiedenen Sprachen der Vereinten Nationen zu verschiedenen Abkürzungen führt – und keine von diesen benachteiligt werden sollte. Seit ihrer Gründung hat die ISO unzählige internationale Normen für unterschiedliche Bereiche des Wirtschaftslebens entwickelt, zum Beispiel für:
•Akustik
•Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
•Biotechnologie
•Blockchain
•Energiemanagement
•Farben und Lacke
•Geografische Informationen
•Hilfsprodukte für Menschen mit Behinderungen
•Klebstoffe
•Kosmetik- und Schönheitssalons
•Lebensmittel
•Licht und Beleuchtung
•Mengen, Einheiten, Symbole
•Möbel
•Nachhaltige Städte und Gemeinden
•Pestizide und andere Agrochemikalien
•Qualitätsmanagement
•Sicherheit von Spielzeug
•Sport- und Freizeitgeräte
•Textilien
•Tourismusdienstleistungen
•Transport und Logistik
•Umwelt und Nachhaltigkeit
•Ventile
•Verpackung; Zellstoff, Papier und Karton
•Wasserqualität, Trinkwassersysteme
Aus historischen Gründen gibt es zwei Bereiche, die nicht von der ISO normiert werden: zum einen die Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik, für die die 1906 gegründete Internationale Elektrotechnische Kommission (International Electrotechnical Commission, IEC) zuständig ist; zum anderen die Telekommunikation, um die sich die 1865 gegründete Internationale Fernmeldeunion (International Telecommunication Union, ITU) kümmert. Alle drei Organisationen haben ihren Sitz in Genf. Gemeinsam bilden sie die World Standards Cooperation (WSC).
Die 1919 gegründete, in Winterthur ansässige Schweizerische Normen-Vereinigung vertritt die Schweiz auf europäischer Ebene – beim Europäischen Komitee für Normung (CEN) – und bei der ISO. Sie hat hierfür einen Auftrag vom Bund. Ihr gehören vor allem Behörden, Verbände und Unternehmen an. Ihre Fachbereiche sind die Maschinen- und Metallindustrie (koordiniert durch den Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie Swissmem), das Bauwesen (Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA), das Strassen- und Verkehrswesen (Schweizerischer Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute VSS), die Uhrenindustrie (Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH), die Elektrotechnik (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik Electrosuisse) und die Telekommunikation (Schweizerischer Verband der Telekommunikation asut). Der interdisziplinäre Normenbereich wird direkt durch die SNV koordiniert. Diese Koordinationsstellen haben die Hoheit, in ihrem jeweiligen Fachbereich Normen zu entwickeln und zu erlassen.
2Begriffe, Definitionen, Typen:ein Überblick
Zusammengestellt von Hubert Rizzi und Alex Gertschen
Alle Normen tragen vor der Normennummer eine alphanumerische Bezeichnung. Anhand dieser Bezeichnung ist ersichtlich, woher eine Norm stammt und auf welcher Ebene sie anerkannt ist. Man unterscheidet zwischen nationalen, europäischen und internationalen Normen. Nationale Normen regulieren den Schweizer Inlandsmarkt, europäische Normen öffnen den Zugang zum EU-Binnenmarkt und internationale Normen den Zugang zum Weltmarkt. Welcher Markt durch eine Norm harmonisiert wird, ist an den Buchstaben vor der Normennummer erkennbar (SN, EN oder ISO).
Bezeichnung
Beschreibung
Beispiel
SN
Schweizer Norm, die überwiegend nationale Bedeutung hat.
SN 10130 «Geschäftsbrief»
EN bzw. SN EN
Europäische Norm bzw. Schweizer Ausgabe einer Europäischen Norm, die unverändert von allen Mitgliedern einer der europäischen Normungsorganisationen CEN, CENELEC oder ETSI übernommen wurde.
SN EN 71-14 «Sicherheit von Spielzeug – Teil 14: Trampoline für den häuslichen Gebrauch»
ISO bzw. SN EN ISO
Internationale Norm bzw. Schweizer Ausgabe einer Europäischen Norm, die mit einer internationalen Norm identisch ist und unverändert von allen Mitgliedern von einer der europäischen Normungsorganisationen CEN, CENELEC oder ETSI übernommen wurde.
SN EN ISO 9001 «Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen»
Die Schweizerische Normen-Vereinigung unterscheidet sieben verschiedene Typen von Normen:
Normentyp
Beschreibung
Beispiele
Grundnormen
Normen, die ein weitreichendes Anwendungsgebiet haben oder allgemeine Festlegungen für ein bestimmtes Gebiet enthalten.
•SN EN ISO 9001 zu Qualitätsmanagementsystemen
•SN EN ISO 14001 zu Umweltmanagementsystemen
•SN EN ISO/IEC 27001 zu Managementsystemen für Informationssicherheit
Terminologienormen
Normen, die sich mit Benennungen beschäftigen, die üblicherweise mit ihren Definitionen und manchmal mit erläuternden Bemerkungen, Bildern, Beispielen oder Ähnlichem versehen sind.
•SN EN ISO 4210-1 zu den Begriffen für die sicherheitstechnischen Anforderungen an Fahrräder
•SN EN 1540 zur Begrifflichkeit der «Exposition» (dem Ausgesetztsein) gegenüber chemischen und biologischen Arbeitsstoffen am Arbeitsplatz
Prüfnormen
Normen, die sich mit Prüfverfahren beschäftigen, wobei diese fallweise durch andere prüfungsbezogene Festlegungen ergänzt sind, wie etwa eine Probenentnahme, die Anwendung statistischer Methoden oder die Reihenfolge einzelner Prüfungen.
•SN EN 61000-4-2 zur «Elektromagnetischen Verträglichkeit – Teil 4-2: Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität»
•SN EN 12697-34 zu «Asphalt – Prüfverfahren – Teil 34: Marshall-Prüfung», mit der u. a. die Qualität des Asphaltmischguts festgestellt wird
•SN EN 12797 zu «Hartlöten – Zerstörende Prüfung von Hartlötverbindungen»
Produktnormen
Normen, die Anforderungen festlegen, die von einem Produkt oder einer Gruppe von Produkten erfüllt werden müssen, um deren Zweckdienlichkeit sicherzustellen.
•SN EN IEC 62680-1-4 zu «Schnittstellen des Universellen Seriellen Busses für Daten und Energie – Teil 1–4: Gemeinsame Bauteile – Festlegung für USB-Typ-CTM-Authentifizierung»
•SN EN 16732 zu «Reissverschlüsse – Spezifikation»
Verfahrensnormen
Normen, die Anforderungen festlegen, die durch Verfahren erfüllt werden müssen, um die Zweckdienlichkeit sicherzustellen.
•SN EN IEC 31010 zu «Risikomanagement – Verfahren zur Risikobeurteilung»
•SN EN 62308 zu «Zuverlässigkeit von Geräten – Verfahren zur Zuverlässigkeitsbewertung»
Dienstleistungsnormen
Normen, die Anforderungen festlegen, die durch eine Dienstleistung erfüllt werden müssen, um die Zweckdienlichkeit sicherzustellen.
•SN EN 14873-2 zu «Umzugsdienste – Lagerung von Möbeln und persönlichen Gegenständen für Privatpersonen – Teil 2: Bereitstellung der Dienstleistung»
Schnittstellennormen
Normen, die Anforderungen festlegen, die sich mit der Kompatibilität (Verträglichkeit) von Produkten oder Systemen an Verbindungsstellen beschäftigen.
•SN EN 50631-1 zu «Netzwerk- und Stromnetz-Konnektivität von Haushaltsgeräten – Teil 1: Allgemeine Anforderungen, allgemeine Datenmodellierung und neutrale Meldungen»
•SN EN 60118-14 zu «Hörgeräte. Teil 14: Spezifikation einer digitalen Schnittstelle»
Glossar
Akkreditierung: Akkreditierung bedeutet die formale Anerkennung durch eine spezialisierte Stelle. Pro Land gibt es eine solche Stelle. In der Schweiz ist dies die beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) angesiedelte Schweizerische Akkreditierungsstelle (SAS). Indem sie Zertifizierungsstellen wie die SQS akkreditiert, bestätigt sie, dass diese Stellen kompetent sind und über alle organisatorischen Voraussetzungen verfügen, um Zertifizierungen in einem bestimmten Normenbereich auszustellen. Die SAS beaufsichtigt Zertifizierungsstellen, aber auch Prüflaboratorien, Inspektionsstellen und andere Konformitätsbewertungsstellen des akkreditierten Normenbereichs gemäss der nationalen und internationalen Gesetzgebung (Akkreditierungs- und Bezeichnungsverordnung, AkkBV und EG-Verordnung Nr. 765/2008) sowie der ISO/IEC-Normenserie 17000.
Akkreditierung einer Zertifizierung: Die Zertifizierung einer Organisation zum Beispiel nach einer ISO-Norm kann akkreditiert oder nicht akkreditiert sein. Das bedeutet, dass die das Zertifikat ausstellende Stelle akkreditiert ist oder nicht. Weil die Akkreditierung eine zusätzliche Stufe in der Qualitätssicherung darstellt, sind in manchen Kontexten akkreditierte Zertifikate zwingend erforderlich. Zudem erhöht die Akkreditierung für die zertifizierten Organisationen die Gewähr für eine internationale Anerkennung und einen leichteren Zugang zum Weltmarkt. Das Vertrauensverhältnis zwischen Geschäftspartnern wird gestärkt.
Anwendungsbereich (Scopes): Der Anwendungsbereich (auch Scope genannt) ist ein wichtiges Konzept in der Normenwelt. Er bezieht sich auf die Reichweite eines bestimmten Regelwerks bzw. des Zertifikats, das gemäss dem Regelwerk erteilt wurde. Der Anwendungsbereich wird zum Beispiel anhand eines Standorts, einer Aktivität, eines Produkts oder einer Dienstleistung umgrenzt. Ein Zertifikat wird also zum Beispiel ausgestellt für die Muster AG am Standort Bern auf der normativen Grundlage der ISO 9001 (Qualitätsmanagementsystem) bezüglich der Entwicklung und Produktion sowie des Vertriebs und Unterhalts von Maschinen und digitalen Steuerungen.
Audit: In einem Audit wird die Erfüllung einer bestimmten Norm oder eines bestimmten Standards anhand spezifischer Kriterien geprüft. Dazu werden in einem systematischen, unabhängigen und dokumentierten Prozess Nachweise objektiv erstellt und ausgewertet. Es wird zwischen einem digital durchgeführten Fernaudit und einem Vor-Ort-Audit unterschieden. In Fernaudits begutachtet der/die externe Auditierende die Situation bzw. Normkonformität live per Kamera. Zudem gibt es das Voraudit, eine fakultative Begutachtungsleistung. Es wird analog einer Stichprobe durchgeführt, liefert erste Erkenntnisse über die Zertifizierungsreife und ermöglicht der Organisation, vorhandene Systemlücken vor dem offiziellen Verfahren zu schliessen.
Auditor/in: Ein Auditor, eine Auditorin führt ein Audit durch. Interne Auditierende sind Personen, die innerhalb der zu zertifizierenden Organisation die Einhaltung von normativen Anforderungen prüfen. Oftmals sind sie neben den Managementbeauftragten die Ansprechpersonen für die Zertifizierungsstelle. Die externen Auditierenden führen im Auftrag der Zertifizierungsstelle in regelmässigen Abständen eine Überprüfung zur Erteilung oder Aufrechterhaltung einer Zertifizierung durch.
Bewertung: Die Bewertung ist eine Beurteilung, ein Werturteil über einen Sachverhalt, ein Objekt oder eine Person. Im Gegensatz zur Auditierung und Zertifizierung nach Normen geht es in der Bewertung nicht um ein binäres Urteil (erfüllt vs. nicht erfüllt), sondern um eine differenzierte und oft vergleichende Beurteilung. In der Bewertung nach Reifegradmodellen wie Circular Globe (s. Seite 40) oder EFQM (s. in diesem Kapitel den Artikel «Normen im Vergleich zu anderen Regelsystemen») werden Organisationen daraufhin analysiert, wo sie im Vergleich zu früheren und angestrebten Zuständen («Reifegraden») sowie im Vergleich zu anderen Organisationen stehen.
Konformität: Konformität bezeichnet die Erfüllung einer Anforderung. Eine Nichtkonformität bedeutet das Gegenteil. Die SQS bezeichnet diesen Sachverhalt als «Abweichung» und unterscheidet zwischen «Neben- und Hauptabweichung». Bei einer Hauptabweichung





























