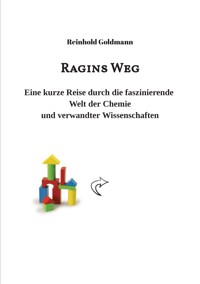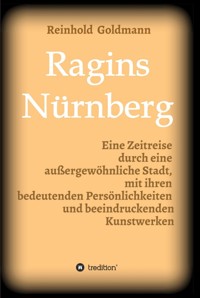
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Unzählige Werke sind zu Nürnberg bereits veröffentlicht worden. Doch in diesem Buch werden die Geschichte und Gegenwart dieser bemerkenswerten Stadt über Erlebnisse und Erinnerungen des Autors erzählt. Auch Lesern, die Nürnberg noch nicht so gut kennen wird vor Augen geführt, welche Bedeutung Nürnberg hatte und noch hat. Die Fülle der hier beschriebenen Entwicklungen, Entdeckungen, Biografien und Geschehnisse werden die Leser beeindrucken. Während des 15. und 16. Jahrhunderts gab es in Nürnberg eine technische, wissenschaftliche und künstlerische Entwicklung, die sich in zeitgemäßer Weise durchaus mit der klassischen Periode des antiken Griechenlands, während des fünften und vierten vorchristlichen Jahrhunderts vergleichen lässt. Für den Autor war es faszinierend, auf den Spuren der Nürnberger Vergangenheit zu wandeln und die berühmten Persönlichkeiten, Kunstwerke, den Erfindergeist und die allgemeine Geschichte dieser Stadt zu schildern. Trotz der verheerenden Zerstörungen im Verlauf des Zweiten Weltkriegs entstand diese Stadt in neuem Glanz. Nürnberg ist heute wieder eine lebens- und liebenswerte Stadt, die weiterhin Beachtung verdient.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zeitreise durch eine außergewöhnliche Stadt, mit ihren bedeutenden Persönlichkeiten und beeindruckenden Kunstwerken
Inhalt
Einleitung
Nürnberg im Mittelalter
Nürnberger Witz
Nürnberger Tand geht durch alle Land
Eine kurze Geschichte der Stadt
Die Zeit der Kelten
Die Franken
Freilassung der Sigena
Norenberc und die Noris
Sebaldus
Die Burggrafen
Die Patrizier und der Rat der Stadt
Nürnberg als Kaiserpfalz
Großer Reichslandfrieden
Kaiser Friedrich II.
Der Große Freiheitsbrief
Freie Stadt versus Reichsstadt
Nürnberger Stadtwappen
Die Goldene Bulle
Die Reichskleinodien
Wirtschaftliches Auf und Ab
Reichsparteitage
Nürnberger Gesetze
Nürnberger Prozesse
Der Wiederaufbau
Erfindungen und Entwicklungen in Nürnberg
Der Schockenzug
Verbesserung der Drahtziehtechnik
Leonischer Draht
Die erste Gewerbestatistik Deutschlands
Nadelwaldsaat oder Not macht erfinderisch
Die erste deutsche Papiermühle
Nürnberger Schere
Regiomontanus und die großen Entdeckungsfahrten
Martin Behaim und der erste Globus
Martin Löffelholz
Peter Henlein und die Erfindung der Taschenuhr
Willibald Pirckheimer und das erste deutsche Gymnasium
Thomas Venatorius
Entwicklung des gezogenen Büchsenlaufs
Inklination, Sonnenuhren und Kaliberstab
Die Brechschraube von Leonhard Danner
Leonhard Danner und die Holzersparungskunst
Rädleinmacher Hans Lobsinger
Nürnberger Gold- und Silberschmiedekunst
Der Nürnberger Brautbecher
Nürnberger Truhen
Universität der Reichsstadt Nürnberg in Altdorf
Wallenstein im Dreißigjährigen Krieg
Der Mathematiker und Astronom Johann Prätorius
Der Waldherr Paul Pfinzing
Das Geigenklavizimbel
Der Henker Franz Schmidt
Hans Hautsch und seine Fahrzeuge
Hinterlader-Gewehre
Entwicklung des Glasätzens
Erfindung der Klarinette
Der Kettensteg
Ultramarin und das erste deutsche Patent
Die erste deutsche Eisenbahn
Der Nürnberger Hauptbahnhof
Schreibstiftfabriken in Nürnberg
Erste Kopierstifte aus Nürnberg
Georg Simon Ohm
Sigmund Schuckert
Maschinenbau-Aktien-Gesellschaft Nürnberg (MAN)
Die Nürnberger Zweiradindustrie
Der erste deutsche Hustenbonbon
Tempo-Taschentücher
Die Brüder Schöller
Spielzeugstadt Nürnberg
Die kleine Nürnberger Bratwurst
Nürnberger Lebkuchen
Nürnberger Persönlichkeiten und ihre Werke
Heinrich Beheim und der Schöne Brunnen
Michael Wolgemut
Hartmann Schedel und die Weltchronik
Adam Kraft
Veit Stoß
Peter Vischer
Adam Kraft, Veit Stoß und Peter Vischer
Albrecht Dürer
Das Narrenschiff
Hans Sachs
Benedikt Wurzelbauer und der Tugendbrunnen
Wenzel Jamnitzer und seine Perspektiven
Der Künstler Christoph Jamnitzer
Das Große Tucherbuch
Der Neptunbrunnen
Der Barockkomponist Johann Pachelbel
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Staunenswertes Nürnberg
Eine kurze Geschichte der Nürnberger Burg
Die Burggrafenburg
Die vier großen Türme der Burg
Der Fünfeckige Turm
Luginsland
Sinwellturm
Heidenturm am Palas
Palas und Doppelkapelle
Die Kunigundenlinde
Eppelein von Gailingen
Die Burggärten
Der Maria-Sibylla-Merian-Garten
Weitere Attraktionen und deren Hintergründe
Die Stadtmauer
Unbezwingbarkeit der Stadtmauer
Die Frauenkirche mit dem „Männleinlaufen“
Der Christkindlesmarkt
Das frühere Judenviertel am heutigen Hauptmarkt
Der Johannisfriedhof
Der Rochusfriedhof, das verkannte Kleinod
Das Heilig-Geist-Spital und die Reichskleinodien
Der Deutsche Orden in Nürnberg
Einige Altstadtbrücken über die Pegnitz
Fleischbrücke
Museumsbrücke
Henkersteg mit Weinstadel
Maxbrücke
Karlsbrücke
Zwei erwähnenswerte Inseln
Trödelmarktinsel
Insel Schütt
Historische Gebäude und deren Nutzung
Fembo-Haus
Nassauer Haus
Pilatushaus
Albrecht-Dürer-Haus
Das Alte Rathaus
Reichsparteitagsgelände
Norisring-Rennen
Der Justizpalast
Das Germanische Nationalmuseum
Die Straße der Menschenrechte
Das Spielzeugmuseum
Die Spielwarenmesse
Das Verkehrsmuseum
Einige Sonderlichkeiten zu Nürnberg
Der Nürnberger Trichter
Der Pegnesische Blumenorden
Kaspar Hauser
Skurrile Nürnberger
Die Entwicklung des fränkischen Dialekts
Die Pegnitz
Der Main-Donau-Kanal
Lebenswertes Nürnberg
Der Autor
Einleitung
Bereits viele Jahre wohnt Ragin außerhalb seiner Geburtsstadt Nürnberg. Doch noch immer bewegt es ihn, wenn er den Namen dieser Stadt hört. Dies liegt an der Geschichte Nürnbergs, die außerordentlich interessant ist.
Schon im Kindesalter faszinierten Ragin die historischen Bau- und Kunstwerke Nürnbergs. Als kleiner Junge schlenderte er allein durch die Straßen und das mittelalterlich erhaltene Zentrum seiner Heimatstadt. Dabei entdeckte er auch die nicht sofort offensichtlichen architektonischen und künstlerischen Werke, die bei ihm große Wertschätzung hervorriefen.
Der links im Bild zu sehende, sehr kunstvoll gestaltete Erker war eines jener Objekte, die Ragin schon als Kind bewundert hatte.
Durch die Perspektive dieser Aufnahme wirkt der Sinwellturm in der Bildmitte recht klein.
Das rechts zu sehende Gebäude weist den Stil eines typischen Nürnberger Handelshauses, mit sehr hohem Giebeldach auf.
Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der größte Teil Nürnbergs in Trümmern. Viele Kunstwerke und Gebäude waren zerstört und teilweise für immer verloren. Unzählige Männer waren im Krieg gefallen oder befanden sich in Gefangenschaft. Daher mussten meist die Frauen die Trümmer beseitigen und mit dem Wiederaufbau beginnen. Auch Ragins Mutter war daran beteiligt, während sich sein Vater in Kriegsgefangenschaft befand.
Ragins Lehrer behaupteten, dass es viele Jahrzehnte in Anspruch nehmen würde, um die deutschen Städte wieder vernünftig aufzubauen. Aber der Wille und die Kraft der Bevölkerung überwand das Elend und Nürnberg erblühte in neuem Glanz. Auch die meisten historischen Bauwerke wurden wieder nach mittelalterlichen Plänen aufgebaut, sodass Ragins Stadt heute zu den 25 lebenswertesten Städten der Erde gezählt wird.
Wie viele Menschen dieser Stadt, wurden auch Ragins Verwandte während der brutalen Angriffe alliierter Flugzeuge mehrmals „ausgebombt“. Ihre Erzählungen dieser Katastrophen klangen, als wären sie tägliche Normalität gewesen. Mehr als einmal mussten sich Ragins Eltern, nach der Zerstörung ihrer Wohngebäude, eine neue Unterkunft suchen. Dies war möglich, weil die Menschen damals zusammenhielten und den Ausgebombten, in noch vorhandenen Räumen, eine Aufenthaltsmöglichkeit boten.
Aus den Trümmern des Zweiten Weltkriegs ist Nürnberg in veränderter Geltung wieder auferstanden. Den Stellenwert und das Ansehen des Mittelalters hat diese Stadt nicht mehr erreichen können. Dennoch hat sie sich gegenüber Ragins Jugendjahren deutlich erholt.
In den folgenden Kapiteln soll nun die Bedeutung Nürnbergs und seiner Bürger in Vergangenheit und Gegenwart beschrieben werden. Geschichte, Industrie, Kunst und Wissenschaft prägten die Entwicklung dieser Stadt, die außergewöhnlich und daher erzählenswert ist.
Nürnberg im Mittelalter
Um das Jahr 1500 war Nürnberg, nach Prag und Köln, die drittgrößte Stadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Kaiser und Könige wertschätzten diese Stadt wegen ihrer wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung.
Nürnberger Witz
Nürnbergs Wirtschaft beruhte, neben dem ausgedehnten Handel seiner Kaufleute, vor allem auf der mannigfaltigen Produktion und Qualität des Handwerks, welches hoch spezialisiert und dennoch vielseitig ausgerichtet war. Nürnberger Handwerker stellten hochwertige Gegenstände her und erschufen zahlreiche technische Neuerungen und Erfindungen.
Daraus entstand die Bezeichnung „Nürnberger Witz“. Witz als Wortteil von „gewitzt“ im Sinne von geschickt, klug oder fähig.
Dazu ist ein mittelalterlicher Spruch überliefert:
„Hätt ich Venedigs Macht
und Augsburger Pracht
Nürnberger Witz
Straßburger Geschütz
Und Ulmer Geld
So wär ich der reichst in der Welt.“
Alle Nürnberger Erfindungen wurden damals vom Rat der Stadt streng gehütet. Die Handwerksordnung jener Zeit bedrohte jeden „Verräter“ mit harten Strafen. Vereidigte Meister zerstörten minderwertige Ware vor Ort, sodass sie nicht in Umlauf gebracht werden konnten.
Nürnberger Tand geht durch alle Land
Den wirtschaftlichen Erfolg verdankt Nürnberg auch der zentralen Lage innerhalb des europäischen Verkehrsnetzes.
„Nürnberger Tand geht durch alle Land“ ist eine bekannte Redewendung, die vor allem den weitreichenden Handel der Nürnberger Kaufleute im Mittelalter, aber auch die hohe Qualität Nürnberger Erzeugnisse bezeichnete. Wegen der Handwerkskunst variierte man das Sprichwort bereits im 15. Jahrhundert in „Nürnberger Hand geht durch alle Land“. „Hand“ bezog sich dabei auf handwerkliche Erzeugnisse.
Nürnberger Kaufmannszug (Fassade des Kammergebäudes am Hauptmarkt)
Das obige Bild am Kammergebäude hatte Ragin schon als Kind bewundert, da es den Stolz der Nürnberger auf ihre kaufmännische Macht darstellt. Allerdings wurde die Fassade des Gebäudes erst im Jahre 1910 mit diesem Wandbild versehen.
Den dargestellten Handelszug führen ein Fahnenschwinger, ein Pfeifer und ein Trommler an. Die Fahne mit dem Wappen der mächtigen Reichsstadt Nürnberg und der Lärm der Trommeln sollten Wegelagerer abschrecken.
Spießgesellen, Reitknechte und Söldner gewährten Schutz. Außerdem konnten die Spießgesellen mit ihren langen Stangen im Schlamm festgefahrene Räder anheben, um dem Kaufmannszug das Weiterkommen zu ermöglichen.
Den Söldnern folgt der voll beladene, vierspännige Planwagen mit den Fuhrleuten.
Den Abschluss bildet der Reisewagen des Kaufmanns, der auf dem Wandgemälde mit Pelzrobe zu sehen ist.
Nürnberger Fernhändler waren meist reiche Patrizier, welche die politische und gesellschaftliche Führungsschicht der Stadt Nürnberg bildeten.
Nachdem Mitte des 16. Jahrhunderts die kaufmännische Selbstverwaltung Nürnbergs begann, wurde diese am Hauptmarkt konzentriert und im „Rathaus der Wirtschaft“ untergebracht. Auf diesem restaurierten Gebäude von damals ist heute der Kaufmannszug zu sehen. Dieses Wandgemälde soll verdeutlichen, dass Nürnberg im 15. und 16. Jahrhundert eines der bedeutendsten Wirtschaftszentren Europas war. Unter diesem Wandgemälde ist der bereits erwähnte Spruch „Nürnberger Tand geht durch alle Land“ eingefügt worden.
„Tand“ stand lange Zeit für die in Nürnberg hergestellten Qualitätsprodukte. Der Begriff tauchte erstmals im 16. Jahrhundert auf, als das „Zankeisen“, ein Geduldsspielzeug des Nürnbergers Hans Ehemann, mit dem Namen „Tand“ bezeichnet wurde. Ein Zankeisen (Hexenstrickzeug) besteht aus einen Holzgriff mit einer langen Metallschlaufe, an der mehrere Ringe befestigt sind. In sechzehn systematischen Schritten muss der Metallstab durch die einzelnen Metallringe herausgelöst werden.
Der Nürnberger Handel nutzte neben Fuhrmannswagen auch Schiffe als Transportmittel.
Ein entscheidender Kostenfaktor bei den Transporten war die Vielzahl von Zöllen, die unterwegs erhoben wurden. Allerdings hatten die Nürnberger Kaufleute ein weit verzweigtes Netz von Zollprivilegien, durch das sie Wettbewerbsvorteile gegenüber ihren Konkurrenten hatten.
Um sich auf dem Gütertransport vor Raubüberfällen zu schützen, schlossen sich meist mehrere Handelshäuser zu Kaufmannszügen zusammen, wodurch große Warenzüge mit ausreichender Sicherung entstanden.
Sicherungstruppen des Kaisers oder der Könige konnten gegen eine Gebühr als „Geleit“ angemietet werden. Erstmals wurde ein solcher „Geleitsbrief“ am 11. Juli 1240 durch den Stauferkaiser Friedrich II. beurkundet.
Der Schutzbrief garantierte allen Reisenden körperlichen Schutz durch kaiserliche Truppen: „Wer gegen dieses Gebot verstößt, sollte wissen, dass er mit dem Zorn unserer Majestät zu rechnen hat. “
Das Geleitrecht ging später auf die Landesfürsten über, durch deren Gebiete die Geleitzüge zogen.
Das Wirken der Nürnberger Handelshäuser war vielfältig. Es gab wohl keinen bedeutenden Handelsstandort in Europa, an dem sich nicht ein Nürnberger Kontor befand.
Diese Führungsrolle verdankt Nürnberg auch der zentralen geografischen Lage inmitten von Europa. Nach dem Ende der europäischen Teilung, während der 1990er Jahre, ist die Bedeutung dieses Standorts für die wirtschaftliche Entwicklung Nürnbergs und der gleichnamigen Metropolregion wieder ins Bewusstsein gerückt.
Zur „Europäischen Metropolregion Nürnberg“ gehören 23 Landkreise und elf kreisfreie Städte. Diese Gebiete arbeiten partnerschaftlich zusammen, damit die Herausforderungen, die das wachsende Europa und die Globalisierung fordern, leichter bewältigt werden können.
Eine kurze Geschichte der Stadt
Die Zeit der Kelten
Der Nürnberger Raum war bereits in der Bronzezeit besiedelt. Dies belegen unter anderem der Goldblechkegel von Ezelsdorf-Buch, der original im Germanischen Nationalmuseum zu sehen ist. Die Gemeinde Burgthann bei Nürnberg hat einige der bisher entdeckten keltischen Goldhelme in einer Abbildung dargestellt. Demnach weist der Ezelsdorfer Helm mit 88,3 cm Höhe eine beachtliche Größe auf. Der Ezelsdorfer Goldkegel war aus einem Stück Gold getrieben worden. Derartige Helme wurden von keltischen Priestern getragen.
Auch ein Schatzfund im heutigen Stadtteil Mögeldorf weist auf die Besiedelung des Nürnberger Raums durch die Kelten während der Bronzezeit hin.
Um 400 v. Chr. wurden die Kelten erstmals in schriftlichen Quellen genannt. Archäologische Funde, wie die oben abgebildeten Goldhelme, zeugen von dem meisterhaften Können der keltischen Handwerker.
Die Kelten lebten in einem riesigen Kulturraum, der sich trotz großer Heterogenität der verschiedenen Stämme herausbildete und in seiner Blütezeit an der Schwelle zur Hochkultur stand. Der Name „Keltoi“ bedeutet vermutlich „die Tapferen“ oder „die Erhabenen“.
Noch heute gültige Namen deuten auf Siedlungsgebiete der Kelten hin: Nürnberg ≙ „felsiger Berg“, Main ≙ Schlange. Auch die Namensbestandteile „ach“ (Wasser) oder „hall“ (Salz) sind keltischen Ursprungs.
Östlich von Nürnberg befindet sich die Houbirg, ein von den Kelten besiedelter Bergstock, dessen Ringwall eine Fläche von der Größe der Nürnberger Altstadt umschloss. Diese, für die damalige Zeit sehr ausgedehnten Siedlungen, überraschen noch heute. Ab 500 v. Chr. bauten die Kelten die vorhandene Befestigung aus, damit auch die im Umland lebende keltische Bevölkerung, auf der Houbirg Schutz finden konnte.
Die Römer beschrieben die Kelten als wilde Barbaren. Da die Kelten in weiten Teilen Europas siedelten, waren sie die direkten Nachbarn Roms. Die Beziehung dieser beiden Völker war geprägt von Krieg und Frieden, aber auch von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung beider Gesellschaften.
Das junge Rom erlitt durch die keltischen Krieger viele Niederlagen, welche noch lange die Politik des späteren Imperiums bestimmten. Im Jahre 387 v. Chr. besiegte der keltische Stamm der Senonen, unter ihrem Heerführer Brennus, ein römisches Heer von gut 40.000 Mann an der Allia, einem Nebenfluss des Tibers in der Nähe von Rom. Anschließend zogen die Senonen direkt nach Rom, plünderten und brandschatzten die Stadt und zogen erst nach Zahlung einer hohen Lösegeldsumme wieder ab.
Die Eroberung und Zerstörung der Stadt Rom wurde zu einer traumatischen Erfahrung für die Römer. Die Folge war eine tiefsitzende Furcht vor den keltischen Kriegern, weshalb die völlige Unterwerfung der Nachbarvölker für das Römische Reich immer wichtiger wurde, um künftig derartige Katastrophen zu verhindern.
Vercingetorix vereinigte 52 v. Chr. fast alle gallisch-keltischen Völker, um ihre Unabhängigkeit gegen Gaius Julius Caesar zu verteidigen. Vor Alesia (heute Alise-Sainte-Reine im Burgund) wurden die Gallier endgültig besiegt und Vercingetorix nach Rom gebracht, wo er hingerichtet wurde.
Nach und nach besetzten die Römer immer mehr der keltischen Gebiete und schließlich vermischten sich die beiden Kulturen.
Da die Kelten keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hatten, wurde ihr Beitrag für die europäische Zivilisation sehr lange unterschätzt. Erst in den letzten Jahren wurde deutlich, wie hoch entwickelt die keltische Kultur tatsächlich war. Heute erkennt man endlich an, dass die Kelten eine große und möglicherweise sogar eine der wichtigsten Kulturen in der europäischen Geschichte darstellen.
Keltische Schmiede konnten bereits Eisen härten und waren daher in der Lage, hervorragende Waffen zu fertigen. Auch kunstfertige Schmuckstücke stellten die keltischen Handwerker her.
Druiden waren Priester, Dichter, Historiker, Richter, Lehrer und Troubadoure. Mitglieder der druidischen Orden sammelten Erinnerungen, interpretierten Orakel oder deuteten Träume. Vor allem das Sammeln von mündlichen Informationen war notwendig, da die Kelten keine Schrift verwendeten.
In moderner Zeit fand man Belege dafür, dass keltische Frauen mit männlichen Kriegern tapfer kämpften und es auch Königinnen gab, die Armeen anführten. Legendär ist Königin Boudicca, die den letzten Befreiungskampf der britischen Kelten gegen die Römer leitete. Im Jahre 60 n. Chr. führte Boudicca die Icener und Trinovanten gegen die Römer und ließ römische Siedlungen plündern. Boudicca befehligte angeblich mehr als 50.000 Krieger.
In den vergangenen Jahren wurden keltische Moorleichen gefunden. Diese waren durch Erwürgen, Erstechen und Ertränken getötet worden. Dieser „dreifache Tod“ weist auf Menschenopfer hin, wenn Naturkatastrophen dies erforderlich machten.
Noch heute gibt es in der Bretagne, in Irland, Schottland und Wales Gebiete, in denen eine keltische Sprache gesprochen wird.
Anfang dieses Kapitels wurden bereits keltische Wortbestandteile genannt, die in der deutschen Sprache verwendet werden. Auch der fränkische Dialekt weist keltische Ursprünge auf. Darüber soll ab Seite 299 philosophiert werden.
Die Franken
In der Zeit um 100 v. Chr. verdrängten germanische Stämme die Kelten um Nürnberg.
Während der Völkerwanderung bildete sich um 250 n. Chr. das Volk der Franken („Freie“) aus verschiedenen germanischen Stämmen.
Die Besiedlung von Gallien durch die fränkischen Salier (sala ≙ Herrschaft) begann im 5. Jahrhundert.
Nachdem das Römische Reich durch einwandernde Völker immer mehr in die Defensive geraten war, nutzten die Franken das entstandene Machtvakuum und begründeten ihr Reich auf ehemaligen römischen Gebieten.
König Chlodwig (466 – 511 n. Chr.) wurde zum Gründer des Fränkischen Reiches, nachdem er die Stämme der Alemannen und Westgoten aus Gallien verdrängen konnte. Durch seine Taufe trat er zum Christentum über und sicherte sich somit die Loyalität der römischen Christen.
In der Merowingerzeit setzte eine Überschichtung der keltischgermanischen Bevölkerung durch eine fränkische Herrenschicht ein. Die Merowinger stammten von Childerich ab, der wohl ein Sohn Merowechs war.
Nachdem 639 mit Dagobert I. der letzte starke Merowinger-König gestorben war, wurde die Dynastie der Merowinger allmählich von den „Hausmeiern“ (Majordomus) verdrängt. Diese waren dem Namen nach „Verwalter des (Königs)Hauses“, übernahmen jedoch nach den Merowingern die Macht.
Im Jahre 732 besiegte der Hausmeier Karl Martell in der Schlacht von Tours und Poitiers, die in Gallien eingefallenen Araber. Durch diesen Erfolg wurde und wird er noch heute als Retter des Abendlandes verehrt.
Karl der Große war seit 771 Alleinherrscher der Franken. Er führte zahlreiche Kriege, vor allem gegen die Sachsen. Für die Stabilisierung der Grenzen errichtete Karl sogenannte Grenzmarken und setzte dort als Verwalter Markgrafen ein.
Wegen seiner militärischen Unterstützung für den Papst, wurde Karl von Papst Leo III. am 25. Dezember 800 in Rom zum Kaiser gekrönt. Mit dieser „Translatio imperii“ wurde die Kaiserkrone der Römer auf Karl und damit auf die Franken übertragen. Mit dieser Zeremonie war aus dem König der Franken ein römischer Kaiser geworden, dessen Machtbereich sich über weite Teile Europas ausbreitete. Das Kerngebiet des fränkischen Reiches umfasste ungefähr die Gebiete jener Staaten, welche etwa 1150 Jahre später die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gründeten: Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Luxemburg und die Niederlande.
Karl führte in seinem Reich eine gemeinsame Währung, gleiche Gewichtsmaße und eine einheitliche Schrift ein. Mit der als „karolingische Minuskel“ bezeichneten Schrift wurde die bis dahin gebräuchliche lateinische Schrift in Großbuchstaben (Majuskel) durch kleine Buchstaben (Minuskel) ergänzt. Dadurch wurden Texte übersichtlicher und leserlicher.
Er sammelte die bedeutendsten Gelehrten seiner Zeit um sich und beauftragte sie mit der Sammlung des damals bekannten Wissens. Damit schuf er die Grundlage für eine kulturelle Blüte des Frankenreiches.
Nach Karls Tod im Jahre 814 übernahm sein Sohn Ludwig der Fromme die Kaiserkrone. Ludwig wollte die Reichseinheit unbedingt bewahren und erließ die „Ordinatio imperii“, durch die stets der älteste Sohn die Kaiserkrone erben sollte.
Als Ludwig im Jahre 840 starb, einigten sich drei Jahre später seine Söhne Karl der Kahle, Ludwig der Deutsche und Lothar, im Vertrag von Verdun, auf eine Dreiteilung des Frankenreiches.
Karl der Kahle erhielt den westfränkischen Teil, den er als Frankreich bezeichnete.
Unter Ludwig dem Deutschen entwickelten die Ostfranken, durch ihre recht einheitliche germanische Sprache ein Gemeinschaftsgefühl, was durch die 33-jährige Regierungszeit König Ludwigs verstärkt wurde. Der Begriff „deutsch“ entstand aus dem germanischen Wort „teuta“ (Volk) und bezog sich zuerst auf diejenigen Völker, die weder lateinisch noch einen frühromanischen Dialekt sprachen. König Ludwig bekam erst in späteren Jahren den Beinamen „der Deutsche“, weil er das Deutsche Reich begründet hat.
Lothar, der älteste Sohn Ludwig des Frommen, erhielt das zwischen West- und Ostfranken liegende Gebiet, das sich von der Nordsee bis zum Mittelmeer erstreckte. Aus dem „Reich des Lothar“ oder auch Lotharingien, entwickelte sich später das Herzogtum Lothringen. Lothars Königreich wurde bereits 870 zwischen dem ost- und westfränkischen Reich aufgeteilt, nachdem Lothar im Jahre 869 verstorben war.
Lothringen, wie auch das Elsass, wechselte häufig zwischen den westlichen und östlichen Teilen des ehemaligen Frankenreiches hin und her.
In einer Urkunde von König Otto I. aus dem Jahre 948 wird im Deutschen Reich erstmals zwischen der „Francia occidentalis“ für die rheinischen Teile des Deutschen Reichs und der „Francia orientalis“ für die östliche Region um den Main unterschieden.
Nach dem Aussterben der Ottonen im Jahre 1024 entwickelte sich das Gebiet der Francia orientalis zur Machtbasis der deutschen Könige.
Im Jahre 1340 schloss Kaiser Ludwig der Bayer die Region Franken mit Bayern zu einem Gebiet zusammen und setzte einen Landfriedenshauptmann für Franken und Schwaben ein.
Im Zuge einer Reform des Deutschen Reiches wurden beim Augsburger Reichstag von 1500 zunächst sechs Kreise geschaffen. 1512 wurde das Reich in zehn, nun mit Namen bezeichnete Reichskreise eingeteilt, zu denen Franken gehörte. In den Reichskreis Franken wurden neue Gebiete, so auch Nürnberg aufgenommen, die vorher nicht zu Franken gerechnet worden waren.
In diesem 16. Jahrhundert formierte sich der niedere Adel in den alten Königslandschaften zur Reichsritterschaft und löste sich aus den landesfürstlichen Territorien. Die in sechs Kantonen organisierte „reichsfrey ohnmittelbare Ritterschaft Landes zu Francken“ verblieb außerhalb der Organisation des Reichskreises.
Nach der Übernahme der meisten Territorien des Fränkischen Reichskreises in das Königreich Bayern, während der Jahre von 1802 bis 1816, nahm König Ludwig I. von Bayern 1835 auch den Titel eines Herzogs von Franken an.
Als Symbol für Franken im bayerischen Wappen wählte er den fränkischen Rechen (s. Abb.).
König Ludwig I. führte auch die noch heute üblichen Kreisbezeichnungen Ober-, Mittel- und Unterfranken ein.
Freilassung der Sigena
Am 16. Juli 1050 gewährte Kaiser Heinrich III. der Leibeigenen Sigena die Freilassung. Dies wurde durch eine Urkunde beglaubigt, auf der Nürnberg als „Norenberc“ erstmals urkundlich erwähnt wurde. Offiziell wird dieses Datum heute als Beginn der Geschichte Nürnbergs angesehen.
Leibeigenschaft bedeutete, dass ohne Erlaubnis des Besitzers auch keine Heirat möglich war. Außerdem blieben die Kinder unfrei, selbst wenn eine freie Person geehelicht wurde.
Ein Mann namens Richolf war um das Jahr 1050 Burgkommandant oder Königshofverwalter in Nürnberg. Als Kaiser Heinrich III. sich in Nürnberg aufhielt, trat Richolf vor seinen Kaiser und stellte ihm die Magd Sigena vor. Richolf wollte die Unfreie Sigena heiraten und mit ihr daraufhin auch freie Kinder haben.
Die Urkunde war in lateinischer Sprache verfasst. In deutscher Sprache lautet der Text auf dieser, für Nürnberg so wichtigen Urkunde, wie folgt:
Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreifaltigkeit.
Heinrich von Gottes Gnaden, erhabener römischer Kaiser.
Kund sei allen unsern christgläubigen Untertanen heute und künftig:
Wir haben eine Leibeigene, Sigena mit Namen, die uns ein edler Mann namens Richolf an seiner Hand vorführte und die ihm gehörte, frei gemacht, indem wir aus seiner Hand einen Pfennig mit unserer Hand herausschlugen. Wir haben sie ganz vom Joch der Hörigkeit gelöst, so dass die genannte Sigena von nun an das gleiche Recht und die gleiche Freiheit genießen soll, wie sie die übrigen von Königen und Kaisern freigelassenen Leibeigenen bisher genossen haben.
Und damit die von uns geschenkte Freiheit nunmehr ihre dauerhafte und unverletzliche Rechtskraft behalte, haben wir diese Urkunde daraufhin ausgefertigt und durch Eindrücken unseres Siegels beglaubigen lassen.
Ich, Winitherius, Kanzler, habe anstatt des Erzkanzlers Bardo die Richtigkeit geprüft.
Gegeben am 16. Juli im Jahre der Fleischwerdung des Herrn 1050, im 3. römischen Steuerjahr, aber im 21. Jahr der Einsetzung des Herrn Heinrich, des dritten Königs und des zweiten Kaisers dieses Namens, im 12. Jahr seiner Königswürde, im 4. Jahr seines Kaisertums.
Geschehen zu Norenberc. Glückauf! Amen.
Obwohl in der Urkunde als Aussteller „Heinrich … des zweiten Kaisers dieses Namens“ steht, handelt es sich doch um Kaiser Heinrich III., da für die Bezeichnung die Namensreihenfolge der Könige gilt. Heinrich I. war lediglich König, nicht Kaiser.
Im Original hat die Urkunde einen quadratischen Querschnitt, mit einer Seitenlänge von 27 Zentimeter. Das Pergament wurde in lateinischer Sprache mit „spätkarolingischen Minuskeln“ beschrieben.
Die auf Seite 18 bereits erwähnte „karolingische Minuskel“ zeichnet sich durch Klarheit und Einfachheit des Schriftbildes aus. Aus ihr entwickelten sich die heutigen Kleinbuchstaben der lateinischen Schrift. Zuvor hatten die Schreiber auf Dokumenten nur Großbuchstaben genutzt.
Wie noch heutzutage üblich, wurden die Namen SIGENA (s. Abb.), Richolf und Norenberc in eine vorgefertigte Urkunde eingefügt. An Hoftagen lag stets eine Anzahl vorher beschriebener Urkunden bereit, auf die nur noch die Namen und das kaiserliche Siegel aufgetragen werden mussten.
Bildquelle: Stadtarchiv Nürnberg
Das Original der Sigena-Urkunde wird im Nürnberger Stadtarchiv aufbewahrt und ist als Faksimile im Stadtmuseum Fembohaus ausgestellt.
Im Vergleich zu den Städten, die bereits von den Römern gegründet wurden, trat Nürnberg erst mit dieser Urkunde beglaubigt in Erscheinung. Einige in der Umgebung Nürnbergs liegende Städte wie Forchheim oder Hersbruck wurden bereits Jahrhunderte früher genannt.
So befindet sich in der „Königsstadt“ Forchheim eine Kaiserpfalz, die als fränkischer Königshof bereits von Karl Martell (690 – 741) genutzt worden sein soll.
Nürnbergs Nachbarstadt Fürth war vermutlich von Karl dem Großen gegründet worden. Aber beglaubigt wurde die Existenz Fürths erst durch eine Urkunde von Kaiser Heinrich II., im Jahre 1007.
In den, auf die Freilassung Sigenas folgenden Jahren begünstigte Kaiser Heinrich III. die Siedlung Nürnberg und wollte damit offenbar, das unter seinem Vorgänger mächtig gewordene Bistum Bamberg zurückdrängen. Außerdem übertrug er Zoll-, Markt- und Münzrecht von der Nachbarstadt Fürth, die damals zum Stift Bamberg gehörte, auf Nürnberg. Damit leitete er den Aufschwung der Stadt ein.
Norenberc und die Noris
Der in der Sigena-Urkunde erwähnte Name „Norenberc“ leitet sich vom keltischen Wort „nor“ für „steiniger Fels“ ab. Nor bezeichnet also den Fels auf dem die Nürnberger Burg errichtet wurde.
Zuvor gab es an der Stelle der heutigen Nürnberger Altstadt Nadel- und Laubbäume. Zum Fluss Pegnitz hin wurde das Gelände sumpfig. Daher wurde häufig der Fels „Nor“ als Orientierungspunkt genutzt und später eine Burg auf dieser markanten Erhebung gebaut.
Um die Burg herum entwickelte sich eine Siedlung, die nach der Burg auf dem Nor benannt wurde.
Nürnberg wird häufig auch als „Noris“ bezeichnet. Noris war jedoch eine sprachliche Neuschöpfung von dem Arzt Dr. Fritz Helwig, der im Jahre 1650 einen Stadtführer durch Nürnberg veröffentlichte. Darin hat er die Stadt mit einer mythischen Nymphe Noris personifiziert. Die Nymphe sollte dem Leser in verklärender Weise die Schönheiten ihres Reiches erleben lassen.
Möglicherweise nahm Dr. Helwig auch an, dass der keltische Volksstamm der Noriker die Stadt gegründet hatte. Aber bereits zur Zeit des Römischen Reiches war der Raum nördlich der Donau ausschließlich von germanischen Stämmen bevölkert.
Nürnberg wird derzeit noch häufig als die „Alte Noris“ bezeichnet. Bestimmte Veranstaltungen erhalten manchmal die Benennung Noris, wie zum Beispiel das Norisring-Rennen auf dem Reichsparteitagsgelände.
Sebaldus
Sebaldus hat im 8. Jahrhundert als Einsiedler in der Gegend von Nürnberg gelebt. Der Legende nach war er ein dänischer Königssohn.
Nach fünfzehn Jahren in der Einsamkeit der Wälder um Nürnberg, unternahm Sebaldus barfuß eine Wallfahrt zu den sieben Pilgerkirchen in Rom. Es wird erzählt, dass er dabei die Donau auf seinem Mantel segelnd überquert hatte. Während der Reise soll er mehrere Wunder bewirkt haben. Nach Rückkehr von seiner Romreise betätigte er sich in und um Nürnberg als Glaubensbote.
Nachdem Sebaldus weiterhin Wunder bewirkt und Kranke geheilt hatte, wurde nach seinem Tod behauptet, dass sein Leichnam von einem führerlosen Ochsengespann zu der damaligen Nürnberger Peterskapelle gebracht worden sei, wo er beigesetzt wurde.
Mit dem Aufschwung der Reichsstadt und dem Aufblühen des Handels verbreitete sich durch die Nürnberger Kaufleute eine „Sebaldusfrömmigkeit“ im weiteren Umland der Stadt. Sebaldus wurde zum Stadtpatron.
Spätestens ab 1070 zogen zahlreiche Wallfahrer an das Grab von Sebaldus und trugen so zum wirtschaftlichen Aufblühen der Stadt bei.
Die führenden Patrizier bekundeten mit Sebaldus demonstrativ ihre Unabhängigkeit von den umliegenden Bischofsstädten Bamberg, Eichstätt, Regensburg und Würzburg.
In den Jahren von 1361 bis 1372 wurde die Sebalduskirche errichtet. Der Bau war vom Rat der Stadt Nürnberg gezielt gefördert worden.
Das Grabmonument von Sebaldus wurde ab 1508 vom Erzgießer Peter Vischer nach einem Entwurf von Adam Kraft gegossen. Es befindet sich heute in der Sebalduskirche und gilt als eines der bedeutendsten deutschen Bronzewerke. Im Kapitel zu Peter Vischer wird dieses Kunstwerk ausführlicher erläutert (Seite 166).
Erst im Jahre 1425 wurde Sebaldus von Papst Martin V. offiziell heiliggesprochen. Daher ist es recht ungewöhnlich, dass ein von der römisch-katholischen Kirche Heiliggesprochener, in der seit dem 16. Jahrhundert evangelischen Sebalduskirche weiterhin aufbewahrt wird. Aber dadurch ist noch heutzutage erkennbar, welche Wertschätzung Sebaldus für die Stadt Nürnberg hatte und noch hat.
Die Burggrafen
Im Jahre 1105 war Nürnberg in die Auseinandersetzung zwischen Kaiser Heinrich IV. und seinem Sohn Heinrich V. geraten. Heinrich V. hatte seinen Vater Kaiser Heinrich IV. für abgesetzt erklärt. Daraufhin belagerte Heinrich V. zwei Monate lang die Nürnberger Burg, in der sich Kaiser Heinrich mit seinen Gefolgsleuten verschanzt hatte. Nachdem Heinrich V. die Burg erobert hatte, ließ er die Stadt Nürnberg verwüsten.
Um Nürnberg künftig besser kontrollieren zu können, ernannte König Heinrich V. den österreichischen Grafen Gottfried II. von Raabs noch im Jahre 1105 zum Verantwortlichen für die Nürnberger Burg. Gottfried sollte dort kaiserlicher Stellvertreter sein und künftig als Burggraf wirken.
Gottfried I., der Vater von Gottfried II., erhielt die Burg Raabs im Jahre 1100 nach einem Streit und anschließender Eroberung der Burg überschrieben. Burg Raabs liegt an der Thaya im heutigen Österreich, an der Grenze zu Tschechien.
Mit dem Begriff „Burggraf“ wurde der königliche oder landesherrliche Amtsträger auf einer Burg mit zugehöriger städtischer Niederlassung und dem entsprechenden Umland bezeichnet. Er hatte militärische, richterliche und administrative Aufgaben wahrzunehmen.
Unter den Burggrafen im Deutschen Reich besaßen die Nürnberger Burggrafen eine Ausnahmestellung, da es ihnen relativ früh gelang, über dieses, in den Pflichten ursprünglich eng begrenzte Amt hinaus, zu den mächtigsten Landesherren in Franken aufzusteigen. Die Burggrafen von Nürnberg zählten sogar bald zum einflussreichsten Adel des Deutschen Reiches.
1138 eroberten die Staufer die Stadt Nürnberg. Von diesem Jahr an taucht Gottfried II. in zahlreichen Kaiserurkunden auf.
Mit dem Tod Gottfrieds II., übernahm nach dem Jahre 1147 sein Sohn Gottfried III. die Burggrafenschaft.
Um 1190 starb Konrad II., der letzte Graf von Raabs, ohne männliche Nachkommen. Daraufhin trat sein Schwiegersohn Friedrich I. von Zollern sein Erbe an. Im folgenden Jahr 1191 wurde er von König Heinrich VI. mit dem Burggrafenamt belehnt.
Mit Friedrich übernahmen erstmals die Grafen von Zollern die Herrschaft in der Burggrafschaft Nürnberg.
1273 wurde den Zollern, von dem ersten Habsburger König Rudolf I., das kaiserliche Landgericht in Nürnberg verliehen. Dieser Gerichtshof entwickelte sich zu einem der wichtigsten Instrumente, um den politischen Einfluss der Zollern zu festigen.
Ab der Mitte des 14. Jahrhunderts bezeichneten sich die Zollern als Hohenzollern, nach ihrer Stammburg im heutigen Baden-Württemberg. Durch eine geschickte Erwerbungspolitik bauten die Hohenzollern ihr Herrschaftsgebiet immer weiter aus.
Bis zur Reformation suchten alle Burggrafen die Nähe zum jeweiligen König bzw. Kaiser. Als Getreue, Räte, Diplomaten und Feldherrn erhöhten sie das bereits erlangte Ansehen stetig und verbesserten dabei ihren landesherrlichen Status.
Kaiser Ludwig der Bayer bestätigte erstmals 1328 die burggräflichen Privilegien mit kaiserlichem Siegel.
Kaiser Karl IV. erhob 1363 Burggraf Friedrich V. und seine Nachfolger, als Gegenleistung für vielerlei Unterstützungen, in den gefürsteten Grafenstand, der ihnen den Zugang zum Kreis der Reichsfürsten eröffnete.
Diesen Rang erhöhte der in Nürnberg geborene König Sigismund weiter, indem er Burggraf Friedrich VI. während des Konstanzer Konzils in den Jahren 1415 bis 1417, die Mark Brandenburg und die damit verbundene Kurwürde übertrug. Dadurch zählten die fränkischen Zollern zum kleinen Kreis der sieben Königswähler und damit zur höchsten Führungsspitze im Deutschen Reich.
Durch die maßlosen Machtansprüche der Hohenzollern kam es zu Konflikten mit den bayerischen Wittelsbachern, dem Bischof von Würzburg und der Reichsstadt Nürnberg. 1420 eskalierten diese Auseinandersetzungen in der Zerstörung der Nürnberger Burggrafenburg durch Truppen des Herzogs Ludwig VII. von Bayern-Ingolstadt.
Daraufhin erwarb die Reichsstadt Nürnberg 1427 das Burggrafenamt sowie den Teil der Nürnberger Burg, den die Burggrafen belegt hatten.
Die fränkischen Zollern kamen anfang des 16. Jahrhunderts über den in Ansbach geborenen Albrecht von Brandenburg-Ansbach nach Preußen. Albrecht wurde 1511 zum letzten Hochmeister des Deutschen Ordens gewählt. Während dieser Zeit säkularisierte er den Orden und verwandelte als erster Herzog von Preußen die weltliche Herrschaft des Deutschordensstaates in das erbliche lutherische Herzogtum Preußen.
Die Patrizier und der Rat der Stadt
Der Nürnberger Rat wurde erstmals 1256 urkundlich erwähnt. Im Rat der Stadt waren die reichen Kaufmannsfamilien vertreten, die sich nach römischem Vorbild „Patrizier“ nannten. Erst in späterer Zeit hatten auch einige Handwerkerzünfte ein gewisses Mitspracherecht im Rat, erreichten jedoch nicht die Machtfülle der Patrizier. Nürnberg konnte eigentlich als eine „patrizische Stadtrepublik" bezeichnet werden.
Der Rat wurde jährlich neu gewählt. Allerdings kann diese Wahl nach heutigen Vorstellungen nicht als demokratisch bezeichnet werden. Lediglich die mächtigsten Familien der Stadt bildeten das Patriziat. Im Jahre 1521 wurden durch das sogenannte „Tanzstatut“ 42 ratsfähige Familien festgelegt. Andere Familien konnten erst nach dem Aussterben dieser älteren Geschlechter in das Patriziat aufgenommen werden.
Die Anzahl der Ratsmitglieder wechselte ständig. Auch die für den Rat berechtigten Familien änderten sich laufend. Keine Familie durfte mehr als zwei Mitglieder im Rat stellen. Formal wurden die Ratsherren jedes Jahr neu gewählt, hatten jedoch ihr Amt meist lebenslang inne.
Die Patrizier stellten 26 Bürgermeister und acht „Alte Genannte“. Seit 1392 teilten sich diese Bürgermeister in 13 „Ältere Bürgermeister“ und 13 „Jüngere Bürgermeister“. Vorsitzende des Rates waren zwei Konsuln. Als Konsul traten ein „Älterer Bürgermeister“ und ein „Jüngerer Bürgermeister“ auf, die aber jeweils nur 26 Tage regieren durften. Der Ältere Bürgermeister leitete die Ratssitzungen und der Jüngere stand dem Gericht vor. Aus den „Älteren Bürgermeistern“ wurde ein Kreis von sogenannten „Älteren Herren“ gewählt, die wichtige Angelegenheiten entscheiden mussten.
Anfang des 14. Jahrhunderts kam noch der „Große Rat“ hinzu. Diesem gehörten einflussreiche Zunftvertreter oder andere Gewerbetreibende an. Der Große Rat trat nur auf Einberufung des „Engeren Rats“ zusammen. Die im Großen Rat vertretenen Zunftfamilien galten nicht als „ratsfähig“ und waren deshalb auch nicht Teil des Patriziats. Sie waren jedoch gerichtsfähig, weshalb sie einem Gerichtshof vorsitzen konnten.
Durch wechselnde Lehensverhältnisse der Ratsherren mit den Bauern der Umgebung, dehnte sich der Einfluss der Nürnberger Patrizier auf das gesamte Umfeld der Stadt aus. Für das Jahr 1497 gibt das Stadtlexikon insgesamt 28.000 Personen in 5.780 Haushalten und 780 Orten außerhalb Nürnbergs an, die an die Reichsstadt Abgaben leisten mussten.
Seit 1410 setzte sich der Rat aus den 26 Bürgermeistern, acht Handwerksherren, als Vertreter der Zünfte und acht „Alten Genannten“ zusammen.
Eigentliches Machtzentrum bildete das „Septumvirat“ der „Älteren Herren“. Dazu gehörten die Obersten Hauptleute, die für die militärische Sicherheit der Stadt zuständig waren und vier Ältere Bürgermeister.
Ab 1370 ist die Führung einer Ratsbibliothek belegt. Diese ist wahrscheinlich die älteste deutsche städtische Bibliothek. Sie entwickelte sich aus einer kleinen Verwaltungsbibliothek, durch zahlreiche Schenkungen im 15. Jahrhundert, zu einer Gelehrtenbibliothek. Ein Förderer der Bibliothek war Hartmann Schedel, dem in diesem Buch ab Seite 156 ein eigenes Kapitel gewidmet ist.
Nürnberg als Kaiserpfalz
Friedrich I. Barbarossa (1122 – 1190) setzte den Um- und Ausbau der Nürnberger Burg fort und erweiterte sie zur Kaiserpfalz.
Eine Pfalz war Stützpunkt für den im Mittelalter stets reisenden Kaiser oder König des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Herrscher dieses Reichs regierten nicht von einer Hauptstadt aus, sondern versuchten möglichst den persönlichen Kontakt zu ihren Untergebenen zu pflegen. Deshalb wurden im gesamten Reich Pfalzen gebaut und als wechselnde Regierungssitze genutzt.
Als Pfalzstadt wurde Nürnberg vom Geleitgeld und Marktzoll befreit.
Die Kaiserpfalz Nürnberg verkörperte die Macht und Bedeutung des Reiches sowie die seiner Herrscher. Könige oder Kaiser hielten sich alljährlich in Nürnberg auf.
1356 wurde in der „Goldenen Bulle“ festgelegt, dass in Nürnberg jeder erste Reichstag nach einer Königswahl abgehalten werden musste. Außerdem wurde die Stadt als Aufbewahrungsort der Reichskleinodien bestimmt. Dazu später mehr.